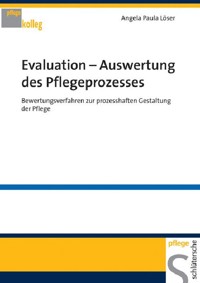Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Angela Paula Löser
Palliative Care in derstationären Altenpflege
Das passende Konzept erstellenund umsetzen
schlütersche
Angela Paula Löser ist Diplom-Pädagogin (Dr. phil.), Lehrerin für Pflegeberufe, Fachkrankenschwester für Pflege in der Onkologie und in Palliative Care, Interne Auditorin sowie freiberufliche Dozentin. Sie verfügt seit über 30 Jahren über praktische Erfahrungen in der Pflege und Betreuung, arbeitet seit 20 Jahren als Dozentin und seit 14 Jahren als Beraterin in der stationären Altenpflege, insbesondere in der Vorbereitung auf MDK-Prüfungen.
„Hilfe ohne Konzept kann Nöte lindern, Strategien können Abhilfe schaffen.“
RAYMOND WALDEN
Der Pflegebrief Newsletter – für die schnelle Information zwischendurch Anmelden unter www.pflegen-online.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-89993-372-7 (Print)
ISBN 978-3-8426-8810-0 (PDF)
ISBN 978-3-8426-8811-7 (EPUB)
© 2016 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden. Alle Angaben erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autorin und des Verlages. Für Änderungen und Fehler, die trotz der sorgfältigen Überprüfung aller Angaben nicht völlig auszuschließen sind, kann keinerlei Verantwortung oder Haftung übernommen werden. Die im Folgenden verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen stehen immer gleichwertig für beide Geschlechter, auch wenn sie nur in einer Form benannt sind. Ein Markenzeichen kann warenrechtlich geschützt sein, ohne dass dieses besonders gekennzeichnet wurde.
Reihengestaltung:
Groothuis, Lohfert, Consorten, Hamburg
Umschlaggestaltung:
Kerker + Baum, Büro für Gestaltung GbR, Hannover
Titelbild:
Photographee.eu –
fotolia.com
INHALT
Vorwort
1Die aktuelle Situation der Sterbebegleitung
1.1Stationäre Pflegeeinrichtungen als erweiterte Hospize
1.2Hochbetagte Menschen mit komplexen Krankheitsund Symptombildern
1.3Veränderungen in den Familien
1.4Veränderte Anforderungen an Pflegemitarbeiter
1.5Entstehung neuer Netzwerkpartner und Kooperationsleistungen
1.6Geforderte Integration von Hospizgedanken und Palliativkultur
2Die Ziele bei der Implementierung des Hospiz- und Palliativgedankens
2.1Ziele auf der Ebene des Betroffenen
2.2Ziele auf der Ebene der Angehörigen und anderer Bezugspersonen
2.3Ziele auf der Mitarbeiterebene
2.4Ziele auf der Ebene der Einrichtung
2.5Ziele im Bereich des Gesundheitswesens
2.6Ziele im Bereich gesellschaftlicher Wertebildung
3Die Voraussetzungen für die Implementierung des Hospiz- und Palliativgedankens
3.1Voraussetzung 1: Ressourcen auf den Ebenen von Politik und Kostenträgern schaffen
3.2Voraussetzung 2: Das Verständnis von Palliative Care etablieren
3.2.1Begriffsklärung Palliative Care
3.2.2Palliative Care als Kultur
3.3Voraussetzung 3: Sich für ein Palliative-Care-Konzept entscheiden
3.3.1Das Palliative-Care-Konzept als gemeinsame Orientierungshilfe und Handlungsgrundlage
3.3.2Die Entwicklung und Implementierung des Palliative-Care-Konzepts
3.4Voraussetzung 4: Grenzen erkennen
3.4.1Personelle und strukturelle Grenzen
3.4.2(An)Erkennen der Situation
3.4.3Finanzielle Grenzen
4Die Rahmenbedingungen für die Gestaltung und Umsetzung von Palliative Care
4.1Das Verhältnis des Palliative-Care-Konzepts zum Pflege- und Betreuungskonzept
4.2Ziele – Strukturen – Prozesse
4.3Klassifizierung der Betroffenen, der Zielgruppe und die Erfassung von Palliativsituationen
4.4Merkmale der professionellen Umsetzung von Palliative Care – von der Planung bis zur Evaluation
5Die Struktur des Palliative-Care-Konzepts
5.1Präambel
5.2Organisation von Palliative Care: Zuständig- und Verantwortlichkeiten, Pflegeorganisationssystem
5.2.1Palliative-Care-Expertin und Konsiliarteam oder alle Mitarbeiter qualifizieren?
5.3Die 7 Säulen des Konzepts – Gestaltung und konkrete Handlungen
5.3.1Radikale Orientierung am Sterbenden
5.3.2Symptommanagement
5.3.3Netzwerkarbeit und Interdisziplinarität
5.3.4Abbau der Hierarchie
5.3.5Qualitätsentwicklung und Evaluation
5.3.6Trauerbegleitung / lebensbegleitende Trauerarbeit / Sterbebegleitung
5.3.7Begleitung und Betreuung von Angehörigen
5.4Der Managementprozess: Management der Palliativsituation
5.4.1Klärung der Palliativsituation/Sicherung der Diagnose
5.4.2Klärung möglicher Ziele zur Gestaltung der Versorgung
5.4.3Einbindung von Hausarzt, Palliativmedizinern und anderen Berufsgruppen
5.4.4Beachtung der Wünsche und Ziele des Betroffenen
5.4.5Erstellung eines Versorgungs- und Handlungsplans
5.4.6Einbindung von Hausarzt, Palliativmedizinern, anderen Ärzten und weiteren Partnern des Netzwerks
5.4.7Neuausrichtung des geplanten Vorgehens bei Entstehung vitaler Indikationen
5.4.8Maßnahmen für das Team
5.4.9Spezifische Prozesse im Qualitätsmanagement
5.4.10Kontinuierliche Evaluation
5.4.11Kontinuierliche Integration der Angehörigen
5.4.12Begleitung in der lebensbegleitenden Trauerarbeit
5.4.13Versorgung des Verstorbenen
5.4.14Retrospektive Evaluation des Sterbeverlaufs
5.5Spezifika einer Pflege- und Betreuungsplanung in der Palliativsituation
5.5.1Anforderungen im Bereich der Planung
5.5.2Anforderungen an die Dokumentation
5.5.3Anforderungen an die Evaluation
6Die Konzepterstellung und die Implementierungsstrategien
6.1Varianten der Konzeptentwicklung
6.1.1Bottom-up-Verfahren
6.1.2Top-down-Verfahren
6.1.3Fazit
6.2Methoden in der Entwicklung des Konzepts
6.2.1Beispiel 1: Konzeptentwicklung ausgehend von der Ist-Analyse der vorhandenen Handlungsrealität, Ableitung von Optimierungsvorschlägen
6.2.2Beispiel 2: Formulierung des Soll-Zustands als anzustrebenden Zustand, Implementierung in die Praxis
6.3Häufig auftretende Probleme bei der Konzeptentwicklung und mögliche Lösungen
7Die Arbeitshilfen
Arbeitshilfe 1: Konkrete Handlungen zu den sieben Säulen der Palliativversorgung
Arbeitshilfe 2: Kurzanleitung zur Pflege- und Betreuungsplanung und zur Pflegedokumentation in der Palliativsituation
Arbeitshilfe 3: Umgang mit Expertenstandards und anderen Richtlinien/Handlungsanweisungen zu Pflege-, Betreuungs-, Versorgungsmaßnahmen in der Palliativsituation
Arbeitshilfe 4: Begründungsstränge bei Unterlassung ansonsten sinnvoller oder vorgeschriebener Maßnahmen
Arbeitshilfe 5: Pflegevisite in der Palliativ-Situation
Arbeitshilfe 6: Ergebnisprotokoll für Ethische Fallbesprechung
Arbeitshilfe 7: Retrospektive Evaluation nach dem Tod des Bewohners
Arbeitshilfe 8: Kooperation Einrichtung XY mit dem ambulanten Hospizverein (Beschreibung des Verfahrens)
Arbeitshilfe 9: PALMA-Formular (Patienten-Anweisungen für lebenserhaltende Maßnahmen)
Abkürzungsverzeichnis
Literatur
Register
VORWORT
Schon immer wurden in stationären Pflegeeinrichtungen Menschen in schwerer Krankheit und im Sterben betreut, gepflegt und versorgt. Doch gewinnt die Frage, wie die Erfüllung dieser besonderen Aufgabe möglichst gut gelingen kann, in den letzten Jahren an Bedeutung. Denn der Prozess einer gelingenden Behandlung, Pflege, Begleitung und Betreuung der genannten Zielpersonen soll nicht länger personenabhängig, sondern prozessgebunden erfolgen. Zugleich sind menschliche, ethische und wirtschaftliche Ziele und Rahmenbedingungen zu beachten. Daher sind
• ein Konzept und
• die angemessene Haltung der Mitarbeiter – die Entwicklung einer palliativen Kultur – erforderlich, um eine systematische, gemanagte Vorgehensweise zu ermöglichen.
Eine Orientierung zu den erforderlichen Strukturen, Prozessen und den angestrebten Ergebnissen bietet das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung (HPG), das im Dezember 2015 verabschiedet wurde. Damit wurden in Deutschland erstmalig gesetzliche Vorgaben für die Organisation einer spezifischen, an den Bedürfnissen eines schwerkranken oder sterbenden Menschen ausgerichteten Palliative Care geschaffen! Konkrete Handlungserfordernisse, Zuständigkeiten und finanzielle Vergütungssysteme sind dadurch geregelt.
Dieses Buch schlägt – nach einer einführenden Begründung der Notwendigkeit – mögliche Gliederungsbereiche und Inhalte eines palliativen Konzepts vor und erörtert diese. Daneben gibt es für die Mitarbeiter Arbeitshilfen, die direkt das Konzept betreffen. Es handelt es sich dabei um ergänzende Teile, die detaillierte Informationen über einzelne Handlungen sowie über die Art und Weise ihrer Gestaltung geben. Sie sind besonders hilfreich in den Phasen der Konzepterstellung und der anfänglichen Implementierung.
Soll das Konzept auch zur Veröffentlichung der angestrebten Ziele und der vorhandenen Handlungsangebote in der Einrichtung genutzt werden, erscheint es sinnvoll, zusätzliches Informationsmaterial in Form eines Flyers oder einer Broschüre zu erstellen. In diesen werden dann die Kernmerkmale dargestellt.
Für die sogenannte Kulturbildung und Implementierung neuer Konzepte ist es hingegen immer erforderlich, sich mit den Details zu beschäftigen. Dazu gehören etwa folgenden Fragen:
• Was soll mit diesem Prozess erreicht werden?
• Wer sind die Zielpersonen?
• Welche Inhalte sollen in dem Konzept beschrieben werden?
• Welche Handlungen werden angeboten?
• Wer ist für was zuständig?
Möglicherweise werden die Entwicklungsprozesse, die im Rahmen der Konzeptentwicklung stattfinden, und das letztlich fertiggestellte Konzept auch zu einer späteren Zertifizierung genutzt. So kann im Rahmen des Qualitätsmanagements nachgewiesen werden, dass sich die Einrichtung dem besonderen Handlungsfeld der Palliative Care auch in besonderer Weise zuwendet.
Nach einer erfolgten Zertifizierung durch einen Visitor der KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) kann z. B. das Deutsche Palliativsiegel »Palliativfreundliche Einrichtung« als Nachweis erworben werden. Dieses wird aktuell bevorzugt von Krankenhäusern angestrebt. Möglicherweise streben dieses Qualitätssiegel (oder auch andere spezifische Zertifizierungen) künftig auch vermehrt stationäre Pflegeeinrichtungen an.1 Schließlich ist der Nachweis einer konzeptionell erworbenen Qualität ein wichtiger Baustein der Öffentlichkeitsarbeit und der kaufmännischen Ausrichtung und kann im Vergleich zur Konkurrenz ein deutliches Plus für eine Einrichtung darstellen.
Bei der Auswahl der zu verwendenden Begriffe und Berufsbezeichnungen wird für die Pflegeperson mit einem Fachexamen in der Gesundheits- oder Krankenpflege (oder Kinderkrankenpflege) oder in der Altenpflege generell die Bezeichnung Pflegefachkraft verwendet. Hat die Pflegefachkraft zudem an einer Qualifizierungsmaßnahme gemäß § 39a SGB V (Fünftes Sozialgesetzbuch) teilgenommen, wird die Bezeichnung Palliative-Care-Expertin verwendet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege ohne Fachexamen in der Pflege werden als Pflegehilfe bezeichnet. Die Bezeichnungen gelten an dieser Stelle sowohl für weibliche als auch für männliche Personen.
Der Begriff Palliative-Care-Situation beschreibt die Phase, in der der betroffene Mensch voraussichtlich nur noch wenige Wochen, Tage oder Stunden zu leben hat. Liegt die Diagnose ICD Z 51.5 (palliativmedizinische Behandlung) vor, hat der Arzt bescheinigt, dass hier eine palliative Behandlung oder palliative Betreuung vorliegt.
Die hier erstellten Informationen beziehen sich auf das Handlungsfeld stationärer Pflegeeinrichtungen, d. h. auf Einrichtungen der stationären Altenhilfe und der Behindertenhilfe. Viele der aufgezeigten Informationen sind auf Einrichtungen der Behindertenhilfe oder auf andere Versorgungsbereiche wie der der ambulanten Pflege, auf Hospize und auf Wohngemeinschaften übertragbar.
Das vorliegende Buch soll als Grundlage verstanden werden – es enthält Hilfestellungen, Vorschläge und Hintergrundinformationen. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder darauf, allein den »richtigen Weg« zu beschreiben. Denn Konzepte lassen sich nur hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen von einer Einrichtung auf eine andere übertragen. Die Beschreibung konkreter Handlungen zur Umsetzung hingegen kann nur im Hinblick auf die vorhandenen Strukturen, Mitarbeiter, Zielgruppen und Bedingungen der konkreten Einrichtung und der in ihr gelebten Handlungspraxis erfolgen. Aus diesem Grund finden sich in Kapitel 4 Fragen, die dem Leser ermöglichen sollen, selbst Aussagen zur Umsetzung von Hospizkultur und Palliativversorgung in der eigenen Einrichtung konzeptionell zu erarbeiten.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern konstruktive Gedanken und ein gutes Gelingen bei der Entwicklung eines eigenen, einrichtungsspezifischen Konzepts wie auch der dort gelebten Kultur, die am Hospiz- und Palliativgedanken orientiert sind.
Duisburg, August 2016
Angela Paula Löser
_______________
1 Vgl. die umfangreiche Literatur von Prof. Wolfgang George.
1DIE AKTUELLE SITUATION DERSTERBEBEGLEITUNG
Im Jahr 2013 starben etwa 340.000–350.000 Menschen in vollstationären Einrichtungen, und dies mit steigender Tendenz. 60 Prozent dieser Menschen starben in Krankenhäusern, 30 Prozent in stationären Pflegeeinrichtungen, 10 Prozent zu Hause (Jevon 2013: 21).
Die Gießener Sterbestudie vom 21. April 2015 belegt demgegenüber eine Zunahme der Sterbefälle in stationären Pflegeeinrichtungen. »Von den in Deutschland 2013 insgesamt 893.825 Verstorbenen wurden 419.241 (ca. 48 Prozent) in Krankenhäusern, etwa 350.000 (ca. 39 Prozent) in stationären Pflegeeinrichtungen und ca. 25.000 (weniger als 3 Prozent) in stationären Hospizen betreut.« (Transmit 2015: 2)
Die Zunahme von Single-Haushalten und Kinderlosigkeit, eine wohnortbezogene räumliche Trennung von Familienmitgliedern, die berufliche Aktivität der Frauen und der Eintritt von Pflegebedürftigkeit im hohen Alter sind hier als Gründe für die hohe Zahl an Sterbefällen in Krankenhäusern und anderen stationären Einrichten genannt. Nicht selten weisen Kinder von Pflegebedürftigen selbst schon ein Lebensalter jenseits von 65 Jahren auf, wenn die Notwendigkeit eintritt, sich um die Eltern zu sorgen. Damit sind viele Betroffene dann überfordert und nicht in der Lage, die Eltern zu Hause zu betreuen. Eine stationäre Unterbringung ist der Ausweg.
Behandlungen im Krankenhaus werden beendet, wenn die über Fallpauschalen finanzierte Behandlungszeit ausläuft. So werden alte, hochbetagte, schwer kranke und sogar sterbende Menschen oft akut in eine andere Pflegeinstitution entlassen. Nicht selten wird der Sterbende in seinen letzten Tagen und Stunden in eine stationäre Pflegeeinrichtung aufgenommen. Altenheime werden somit immer stärker zu Sterbeorten.
Viele Menschen wünschen sich, ihre letzte Lebenszeit in einem Hospiz verbringen zu dürfen, wenn aufgrund von Krankheiten belastende Symptome bestehen oder die Versorgung in der Zeit zunehmender Hilflosigkeit zu Hause nicht mehr sichergestellt ist. Das Wissen über eine hervorragende Versorgung in der letzten Lebensphase ist aufgrund der guten Öffentlichkeitsarbeit der betreffenden Einrichtungen inzwischen bekannt. Doch nicht jeder schwerkranke oder sterbende Mensch wird in einem Hospiz sterben können. Zum einen ist die Anzahl vorhandener Hospize zu gering, sodass häufig Wartezeiten bestehen. Zum anderen bestehen oftmals Aufnahmekriterien, die mit der spezifischen Klientel stationärer Alteneinrichtungen nicht immer übereinstimmen.2 Ein dritter Grund dafür, dass nur in wenigen Ausnahmefällen Bewohner aus stationären Pflegeeinrichtungen im Hospiz aufgenommen werden, besteht in der Tatsache, dass bei ihnen bereits eine 24-stündige Versorgung sichergestellt ist. Ggf. erforderliche, zusätzliche oder besondere Leistungen im Symptommanagement oder in der Betreuung sind zudem über die Verordnung von SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) möglich.
So sterben Menschen auf der einen Seite im Hospiz, auf der anderen Seite im Pflegeheim. Dies jedoch mit unterschiedlichen Ressourcen – je nach Institution! Die Relevanz ist daher groß, eine adäquate Betreuung, Pflege, Behandlung und Versorgung, die auch den Palliativgedanken einschließt, institutionsunabhängig anzubieten. Es ist notwendig, die meist gute hospizliche Versorgung auch auf stationäre Pflegeeinrichtungen zu übertragen. Die Achtung vor der Würde des Menschen gebietet es, dass jeder – unabhängig von der Institution, in der er versorgt wird – beachtet und in seinem Sterben auf eine menschliche Weise begleitet wird. Es muss alles getan werden, dass er bis zum Schluss gut leben und in Würde sterben kann.
Die Begründerin der modernen Hospizbewegung Cicely Saunders hat seit der Entstehung des ersten Hospizes Mitte des 20. Jahrhunderts in London eine Vorstellung in die Welt getragen, wie die Ziele einer guten Sterbebegleitung erreicht werden können. Sie sind heute nach wie vor aktuell und Grundlage der folgenden Darstellungen!
1.1Stationäre Pflegeeinrichtungen als erweiterte Hospize
Neben den stationären Hospizen wurde in Deutschland in der Vergangenheit bereits eine ambulante Hospizversorgung ausgebaut. Im Jahr 2009 wurde beispielsweise die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) in das Fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V) aufgenommen, um Menschen in Palliativsituationen durch eine verbesserte Versorgung, Pflege und Betreuung im eigenen häuslichen Bereich ein menschenwürdiges und möglichst lebenswertes Leben zu ermöglichen. Entsprechende Leistungen werden als zusätzliche Angebote erbracht. Das sind etwa Versorgungen von Portsystemen, kurzfristige Umstellungen der Schmerztherapie, zusätzliche Betreuung. Als dritte Säule – neben Hospiz und ambulantem Bereich – geht es jetzt darum, auch in den stationären Pflegeeinrichtungen der Altenhilfe und Behindertenhilfe geeignete Strukturen und Strategien aufzubauen. Dabei sind die Ziele von Hospizversorgung und Palliativgedanken anzustreben und möglichst umzusetzen. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass die Angebote von Hospizen nicht vollständig erreicht werden können, da insbesondere unterschiedlich personelle und strukturelle Voraussetzungen bestehen.
Stationäre Einrichtungen der Altenpflege und Behindertenhilfe bieten bereits durch ihre Unternehmensformen eine 24-stündige Versorgung an. Die besondere, ergänzende Palliative Care soll weitgehend bei ihnen durch einerseits eigene Mitarbeiter und andererseits auch durch Vernetzung mit Kooperationspartnern außerhalb der Einrichtung sichergestellt werden. Es geht also um eine Orientierung an den hervorragenden Versorgungsleistungen des Hospizes und um die Entwicklung einer Kultur, die den Hospizgedanken als Philosophie beinhaltet. Sterbenden Menschen in stationären Einrichtungen soll eine möglichst gute Palliativversorgung angeboten werden können. Entsprechende Vorgaben und Informationen zu den Zuständigkeiten und Vergütungen finden sich im HPG (Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung von 2015).
1.2Hochbetagte Menschen mit komplexen Krankheits- und Symptombildern
In den stationären Einrichtungen der Altenhilfe finden sich Menschen mit den unterschiedlichsten Krankheits- und Symptombildern. Erschwerend zeigen sich hier multimorbide Krankheitsbilder, bei denen mehrere verschiedene Krankheiten parallel bestehen. Zum Teil verstärken oder bedingen sich diese Erkrankungen gegenseitig oder zeigen veränderte Symptombilder.
Gerontopsychiatrische Erkrankungen zeigen sich bei bis zu 80 Prozent aller aufgenommenen Betroffenen. Hierbei kommt es nicht nur zu Denk-, Orientierungs-, Wahrnehmungs- und Handlungseinschränkungen, sondern auch zu erheblichen Veränderungen der Kommunikationsfähigkeit. Daraus resultieren spezifische Probleme: Der Betroffene nimmt seine Situation ggf. verändert wahr und kann die Veränderungen häufig auch nicht einschätzen und angemessen handeln bzw. seine Bedürfnisse und Probleme sprachlich mitteilen (vgl. Buchmann 2007; Kostrzewa 2010).
Auch in den Einrichtungen der Behindertenhilfe findet sich eine spezifische Klientel. Oftmals über lange Zeiträume sind Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen in einem Umfeld versorgt, das für sie die Merkmale eines Zuhauses trägt. Hier kann es ebenfalls – je nach Art und Schweregrad der Behinderung – zu gleichen oder ähnlichen Veränderungen kommen wie bei Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen.
Für beide Klienten-Gruppen sind spezielle Angebote erforderlich und Menschen, die ihre besondere Lage erkennen und entsprechend handeln.
1.3Veränderungen in den Familien
Eine Sterbebegleitung findet heute nicht mehr in der Familie statt. Das war vor wenigen Jahrzehnten noch der Normalfall. Doch das Zusammenleben der Menschen verschiedener Generationen in einem Haus ist heute selten geworden. Selbst das Inder-Nähe-Leben der Familienmitglieder wird immer seltener: Eltern und Kinder leben oftmals in unterschiedlichen Städten, teils sogar in unterschiedlichen Ländern. Dies sind die Folgen einer globalisierten Welt und von modernen Arbeitsbedingungen, in denen insbesondere auch eine örtliche Flexibilität vorausgesetzt wird. Ferner sind viele erwachsene Kinder durch eigene Berufstätigkeit und die der Partner häufig nicht in der Lage, sich im familiären Umfeld um die alten, kranken Eltern zu kümmern. Diese Aspekte führen im Alter, bei Krankheit oder im Sterben oftmals zu einer Einweisung in eine Einrichtung. Dazu kommt die sogenannte Singularisierung, das Allein-Leben in Singlehaushalten und kleinen Wohnungen, in denen nicht ohne weiteres ein Pflegebett untergebracht werden kann.
Nicht selten berichten Angehörige, dass sie aufgrund mangelnder Erfahrungen auch Angst davor haben, den Vater, die Mutter oder einen anderen sterbenden Menschen zu begleiten. Den Erfahrungsraum, den die Menschen oftmals früher schon in der Sterbebegleitung als Kind unter dem Schutz der vorangehenden Generation von Eltern, Tanten oder anderen Verwandten erlebten, gibt es vielfach nicht mehr. So entwickeln sich im Erwachsenenalter nicht selten Angst vor einem falschen Handeln und Unsicherheit vor den sich zu stellenden Anforderungen in der Sterbesituation.
Die Pflege und die Versorgung Sterbender wurden daher in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Institutionen delegiert.
1.4Veränderte Anforderungen an Pflegemitarbeiter
Während vor 30 Jahren die Anforderungen an einen Mitarbeiter in einer Altpflegeeinrichtung eher darin bestanden, ältere Menschen zu betreuen, zu pflegen und zu beschäftigen, sind heute weitreichendere Kompetenzen vonnöten: etwa medizinisches Symptommanagement, intensive Betreuung und Begleitung der Pflegebedürftigen, Anleitung und Beratung von Angehörigen. Die aktuell erforderliche Pflege zielt gleichzeitig ab auf
• die medizinisch-pflegerischen Probleme und Erfordernisse sowie
• die psychosozialen und spirituell-religiösen Anliegen der Betroffenen und Angehörigen.
Es wird ein umfangreiches Wissen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen und über mögliche prophylaktische, behebende oder lindernde Maßnahmen im Kontext der sich entwickelnden Krankheiten und Symptombilder verlangt.
Die Pflege und Versorgung am Ende des Lebens benötigen verschiedene Akteure und umfassende Angebote verschiedener Organisationen, damit ein gutes Leistungsangebot für den Menschen am Ende seines Lebens besteht. Es geht u. a. darum, dass er während der letzten Lebenstage möglichst nicht noch in ein Krankenhaus verlegt wird. Daraus entwickelten sich in den letzten Jahren Kompetenzanforderungen an Pflegende, die Handlungsakteure in einem umfassenden Versorgungsnetzwerk zu koordinieren und die bestmögliche Versorgung eines Menschen zu erreichen.
Die Vorgaben zur Regelung sind entsprechend des HPG von 2015 bis zum 30. Juni 2016 umzusetzen (vgl. HPG § 87 Abs. 1b: 2115). Da heißt es:
»Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren im Bundesmantelvertrag erstmals bis spätestens zum 30. Juni 2016 die Voraussetzungen für eine besonders qualifizierte und koordinierte palliativmedizinische Versorgung. Im Bundesmantelvertrag sind insbesondere zu vereinbaren:
1. Inhalte und Ziele der qualifizierten und koordinierten palliativmedizinischen Versorgung und deren Abgrenzung zu anderen Leistungen,
2. Anforderungen an die Qualifikation der ärztlichen Leistungserbringer,
3. Anforderungen an die Koordination und interprofessionelle Strukturierung der Versorgungsabläufe sowie die aktive Kooperation mit den weiteren an der Palliativversorgung beteiligten Leistungserbringern, Einrichtungen und betreuenden Angehörigen,
4. Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität.«
Die Mitarbeiter sollen den einzelnen Schwerkranken oder Sterbenden einerseits in seiner Individualität beachten, andererseits bei der Auswahl und Anwendung von Maßnahmen seine Selbstbestimmung anerkennen. Gleichzeitig sollen sie zahlreiche Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen einhalten. Sie stehen nicht selten im Spannungsfeld der Vorstellungen verschiedener Handlungsakteure und werden hier als Moderatoren für Kommunikationsprozesse gefordert. Die Vorstellungen des sterbenden Menschen müssen künftig stärker beachtet werden. Dies soll durch eine »Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase« erreicht werden, die mit dem Betroffenen, dem Arzt, ggf. Angehörigen und Betreuer gemeinsam erstellt wird (vgl. HPG 2015 § 132: 2116).
Mitarbeiter in den Einrichtungen müssen ein umfangreiches fachliches Wissen haben, ein hohes Maß an Empathie, Managementkompetenz und die Fähigkeit mitbringen, sich in jeder Situation neu zu orientieren. Sie müssen in der Lage sein, aus den gegebenen Möglichkeiten geeignete auszuwählen und diese dann zur Anwendung zu bringen.
Einrichtungen der Behindertenhilfe erleben die Veränderungen der Zeit auch insofern, dass Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen heute dank der medizinischen Versorgung ohne Weiteres ein höheres Lebensalter erreichen können. Dadurch stehen die Akteure dieser Institutionen vor ähnlichen Anforderungen wie die stationäre Altenhilfe. Das passende Palliativkonzept kann beiden Einrichtungsformen zur Orientierung dienen.
1.5Entstehung neuer Netzwerkpartner undKooperationsleistungen
Wo vor wenigen Jahren in der Sterbebegleitung der Hausarzt, Fachärzte im Bedarfsfall, Mitarbeiter und Strukturen des Krankenhauses und die Mitarbeiter der verschiedenen Pflegeeinrichtungen die Behandlung, Betreuung und Versorgung der Betroffenen sicherstellten, entwickeln sich zunehmend weitere Organisationseinheiten und Partner für die Unterstützung im Palliative Care. Die wichtigsten sind hier kurz vorgestellt.
SAPV
Bereits 2009 wurde die Grundlage für die SAPV (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung) im Fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) verankert (BMJV 2009: SAPV). Versicherten kann damit eine zusätzliche Betreuung und Versorgung angeboten werden. Voraussetzung dafür ist die Bescheinigung der Notwendigkeit vom Arzt. Auch für Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen kann diese Leistung verordnet und zusätzlich durch die Krankenversicherung finanziert werden. Indikationen hierfür wären z. B. die Notwendigkeit, eines intensiven Symptommanagements, etwa bei Menschen, deren Symptome sich schnell ändern und/oder bei denen bislang keine zufriedenstellenden Ergebnisse in der Symptomlinderung erzielt werden konnten. Eine weitere mögliche Indikation wäre: Bei einem erheblichen Betreuungsaufwand im psychosozialen oder spirituellen Bereich können entsprechende Angebote nicht allein durch die stationären Pflegeeinrichtungen sichergestellt werden.
Palliativnetze
Palliativnetze stellen spezifische Versorgungseinheiten dar, die eine palliativmedizinische Versorgung sicherstellen sollen. In einem Palliativnetz schließen sich mehrere Palliativmediziner zu einem Verbund zusammen und ermöglichen so eine 24-stündige Ansprechbarkeit und ein kontinuierliches palliativmedizinisches Versorgungsangebot bei medizinischen Problemen oder Fragestellungen. Zum Teil werden auch SAPV-Leistungen direkt über das Netzwerk angeboten und organisiert oder über deren Ärzte verordnet.
Durch die permanente Möglichkeit, einen im Bereich von Schmerztherapie und Palliativversorgung spezialisierten Arzt erreichen zu können, lassen sich erforderliche Therapien frühzeitig organisieren. Eine Einweisung ins Krankenhaus wird so oft überflüssig. Zudem haben Pflegende in den Einrichtungen einen Ansprechpartner, den sie bei Unsicherheit, Fragen, neuen Erkenntnissen und Hilfebedarfen direkt kontaktieren und das weitere Vorgehen besprechen können. Mitarbeiter in den Einrichtungen werden hier zu Netzwerkkoordinatoren: Sie managen die Aktivitäten der einzelnen Handlungsakteure. Ein umfangreiches Wissen zur Netzwerkarbeit und die Kompetenz, diese zu koordinieren, werden erforderlich.
1.6Geforderte Integration von Hospizgedankenund Palliativkultur
Politisch gewollt und nun auch durch das sogenannte Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) gefordert, sollen die stationären Pflegeeinrichtungen eine entsprechende palliative Kultur entwickeln und die geforderten Voraussetzungen und Handlungen veranlassen. Dafür ist die Kompetenzentwicklung bei den Mitarbeitern erforderlich, damit die Gestaltung der systematischen Prozessabläufe initiiert und das angestrebte Handeln schließlich prozessgeleitet umgesetzt wird.
Es gilt, einen Wandel in den »Köpfen« der Mitarbeiter loszutreten, damit sie
• veränderte Handlungsziele für Menschen in den letzten Lebensphasen annehmen können,
• Vorstellungen loslassen können, alles zu tun, damit die verlängerte Lebenszeit als alleiniges Merkmal zählt (ohne hierbei immer eine geeignete Lebensqualität erzielen zu können),
• die verstärkte Integration des Betroffenen in alle Entscheidungen mittragen und
• die absolute Ausrichtung an seinem Wohlbefinden akzeptieren können.
Erst der Wandel in den Köpfen wird einen Wandel im Handeln möglich machen. Entsprechende Prozessabläufe sind daher zu beschreiben. Dieses wird auch durch das HPG gefordert (vgl. BMG HPG 2015).
_______________
2 Mögliche Aufnahmekriterien für Heimbewohner sind laut HPG bis spätestens 31. Dezember 2016 neu zu regeln (HPG v. 01.12.2016: 2114).
2DIE ZIELE BEI DER IMPLEMENTIERUNG DES HOSPIZ- UND PALLIATIVGEDANKENS
Bereits Cicely Saunders, die Begründerin des ersten Hospizes in London vor mehr als 60 Jahren, forderte: »Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.«3
Am Lebensende wird die nun verbleibende Zeit zur wichtigsten Ressource dieses Menschen. Diese Zeit soll so gut gelebt werden können, wie es eben geht. Wenn der nahende Tod unabwendbar geworden ist, zählt nicht die Verlängerung der verbleibenden Lebenszeit, sondern ihre Qualität. Jetzt wird es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Lebensqualität des Betroffenen weitgehend erhalten bleibt oder wiederhergestellt wird. Er soll in der Lage sein, die Dinge und Aufgaben zu tun und zu regeln, die ihm wichtig sind. Das Ziel allen Handelns besteht darin, ein »gutes Sterben« bzw. einen »guten Tod« zu ermöglichen.
Auch in Zukunft wird es nicht genügend Hospizplätze für alle Sterbenden geben können. Pflegeeinrichtungen sind daher aufgefordert, die Philosophie des Hospizgedankens aufzunehmen und daran angelehnt entsprechende Kultur und Konzepte zu entwickeln, mit denen die Umsetzung der palliativen und hospizlichen Handlungen gelingen kann. Leistungen, die innerhalb der Einrichtung nicht angeboten werden können, sollten aus einem Netzwerk heraus ermöglicht werden – sie gilt es dann »einzukaufen« bzw. über Kooperationen abzubilden. Etwaige Versorgungslücken können so geschlossen und Versorgungsunterschiede zum Hospiz bestmöglich ausgeglichen werden.
Die folgenden vier Ziele, die sich aus der WHO-Definition zum Palliative-Care-Begriff ergeben, sind bei allen Entwicklungsschritten anzustreben:
1. Der Betroffene kann so lange wie möglich selbstbestimmt und unter der Beachtung seiner individuellen Bedürfnisse und Entscheidungen leben.
2. Symptome, die sein Wohlbefinden einschränken, sind weitgehend verhindert oder weitgehend reduziert.
3. Soziale Beziehungen sind gestärkt, können weiter gelebt werden. Der Betroffene und sein Angehöriger fühlen sich nicht alleingelassen.
4. Der Betroffene und sein Angehöriger fühlen sich in ihrer Trauer begleitet und unterstützt.
2.1Ziele auf der Ebene des Betroffenen
Der Betroffene ist immer als zentrale Hauptperson zu sehen. Er ist hier Intentionalitäts- und Handlungszentrum. Alle Entscheidungen und Handlungen werden immer unter der Beachtung seiner Bedürfnisse, Ziele und Entscheidungen durchgeführt. Dieses wird später unter dem Begriff der »Radikalen Orientierung am Sterbenden« in Kap. 5.3.1 erläutert.
Sämtliche anzustrebenden Ziele sind aus seiner Perspektive zu klären:
• Ein gutes Sterben und ein guter Tod sind weitgehend ermöglicht. Der Betroffene kann selbst entscheiden, was er möchte oder nicht, er spürt am ehesten, was ihm gut tut oder nicht.
→ Untersuchungen hierzu belegen, dass die Ziele eines guten Sterbens und eines guten Tods unmittelbar mit der Selbstbestimmungsmöglichkeit verbunden sind. Das Selbstbestimmungsrecht ist so weit zu beachten, wie das innerhalb juristischer Rahmenbedingungen möglich ist. Auch bei einem kognitiv eingeschränkten Menschen ist anhand von Mimik, Gestik und Reaktion zu erkennen, ob er in eine Handlung einwilligt oder nicht. Durch »abwägende Gespräche« mit dem Betroffenen kann ihm auch in gefährlichen oder sogar lebensbedrohlichen Situationen die Möglichkeit gegeben werden, dieses Selbstbestimmungsrecht auszuüben (vgl. BMG 2015. Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen: 10). Ein gemeinsamer Aushandlungsprozess ist geeignet, wenn der Betroffene zu diesem Recht kommen soll.
• Die möglichst weitgehende Freiheit von belastenden Symptomen ist die Voraussetzung für den Betroffenen, sein Leben in Ruhe zu bedenken und einen guten Abschluss für sich zu finden.
• Ausschließlich Maßnahmen, die das Wohlbefinden des Betroffenen erhalten, wiederherstellen oder steigern, sind geboten und werden nach seiner Einwilligung durchgeführt. Alle Maßnahmen, die die Lebensqualität eher behindern oder reduzieren, werden geprüft und ggf. abgesetzt oder zeitweise unterlassen.
→ Dabei müssen die Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Wohlbefindens des Betroffenen geprüft werden, wenn die Maßnahme unterlassen wird.
• Die körperlichen, psychischen, sozialen, spirituell-religiösen Bedürfnisse und Beschwerden des Betroffenen werden beachtet. Der Betroffene erhält entsprechende Angebote.
• Der Betroffene fühlt sich bis zum Schluss (bis zu seinem Tod) sozial integriert und erfährt menschliche Unterstützung. Betreuungsleistungen und spirituelle Angebote orientieren sich an seinen Bedürfnissen und an seiner individuellen Biografie.
• Eine Krankenhauseinweisung in den letzten Tagen und Stunden sollte verhindert werden. Der Betroffene kann gemäß seiner eigenen Bedürfnisse in der Einrichtung (oftmals als sein Zuhause verstanden) verbleiben, wenn er dort gut versorgt ist.
• Die erforderlichen Bedingungen, die für den Sterbenden ein möglichst »gutes Sterben« und schließlich einen »guten Tod« ermöglichen sind erkannt und hergestellt.
Im Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung (HPG) vom 01.12.2015 finden sich neue Regelungen, mit denen die Gesamtversorgung für Menschen auch in stationären Pflegeeinrichtungen deutlich verbessert werden soll.
2.2Ziele auf der Ebene der Angehörigen und andererBezugspersonen
Oftmals sind Angehörige, Betreuer oder andere Bevollmächtigte in mehrfacher Weise an Entscheidungen und Handlungen beteiligt. Insbesondere wenn der Betroffene nicht oder nicht mehr selbst entscheiden kann, werden sie in Entscheidungsprozessen zu seinem Stellvertreter, nehmen seine Rolle ein. Dies beginnt bereits bei der Auswahl einer geeigneten Einrichtung, bei Entscheidungen zu anzustrebenden Versorgungszielen und zu den erforderlichen Handlungen.