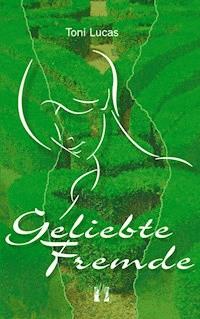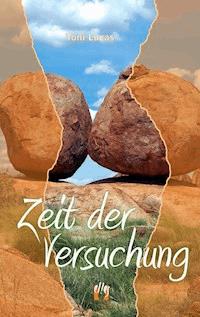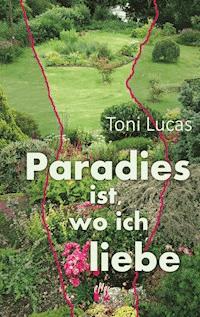
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: el!es-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An der wildromantischen Küste Cornwalls lernen Franziska und Josephine sich unter schicksalsträchtigen Umständen kennen. Franziska lässt sich auf eine Affäre mit Josephine ein, obwohl diese von Anfang an unter einem schlechten Stern steht. Als Franziska erkennt, dass sie keine Zukunft miteinander haben, kehrt sie mit gebrochenem Herzen nach Deutschland zurück und versucht dort an ihr altes Leben anzuknüpfen. Doch wenn das Schicksal beschlossen hat, dass zwei Menschen zusammengehören, versucht es alles, sie auch zusammenzubringen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toni Lucas
PARADIES IST, WO ICH LIEBE
Roman
© 2015édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-118-6
Coverillustration: © sergioboccardo – Fotolia.com
Tosend brandeten die Wellen gegen die Küste Cornwalls. Gischtkämme warfen sich an die Felsen der Bucht von Porthcurno, als forderten sie wütend ein Opfer ein. Graue Nebelschwaden schluckten die Schreie der Möwen, die in unruhigem Flug nach Beute Ausschau hielten.
Das imposante steinerne Halbrund des Minack Theatres lag nahezu verlassen in der fahlen Abenddämmerung. Nur im Besucherzentrum durchstöberten einige letzte Touristen die Regale nach Souvenirs.
Von der Terrasse aus ließ Josephine Turner noch einmal ihren Blick über das Gelände schweifen, um sicherzugehen, dass auch wirklich alle Teilnehmer ihrer Reisegruppe das malerische Gelände verlassen hatten.
Plötzlich stutzte sie.
Auf einer Felsnase, die ihrer Ansicht nach bereits hinter der Absperrung lag, stand eine einsame Gestalt. Sie hatte die Arme ausgebreitet, als wolle sie die berühmte Titanic-Szene nachspielen. Ihr rotes Haar flatterte im Aprilwind, während sich ihre dunkelgrüne Wetterjacke um sie bauschte.
Schon wollte sich Josephine kopfschüttelnd abwenden, als etwas an der Bewegung der Gestalt sie genauer hinschauen ließ.
Täuschte sie sich oder hatte diese Frau gerade auf den Zehen gewippt, als bereite sie sich auf den Absprung vor? Josephine kannte diese Bewegung nur zu gut, war sie doch früher Wettkämpfe geschwommen.
Sie blickte sich suchend um. Nichts. Kein Mensch weit und breit. Josephine schaute nervös auf die Uhr. Ihre Reisegruppe wartete bereits, der Busfahrer würde knurrig werden.
Unmutig gab sie sich einen Ruck und lief eilends die steilen Steinstufen hinunter. Sie überquerte den Theaterplatz, hastete einen schmalen Weg entlang und stoppte an der Absperrung.
Die Frau auf der Klippe hatte inzwischen die Arme sinken gelassen. Wie sie da stand, schmal, mit hängenden Schultern und flatterndem Haar, wirkte sie so zerbrechlich, dass es Josephine das Herz zusammenzog.
Sie kletterte behände über die Absperrung und versuchte, sich möglichst lautlos der Frau zu nähern.
Diese jedoch schien so in sich versunken, dass sie nichts um sich herum wahrnahm. Wie hypnotisiert starrte sie in die brodelnde, schwarze Tiefe, wippte immer mal wieder auf den Zehenspitzen und breitete ansatzweise die Arme aus, als bereite sie sich auf einen Flug vor.
Als Josephine schließlich neben ihr stand, fasste sie ihren Arm und flüsterte: »Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ich denke, wir sollten jetzt gehen. Die schließen gleich.«
Selbst durch die Wetterjacke konnte Josephine spüren, wie die junge Frau zusammenschrak und so stark zu zittern begann, wie es die junge Reiseleiterin noch nie erlebt hatte.
Die Fremde sank förmlich in ihre Arme und stammelte: »Ich kann das nicht. Ich schaff das einfach nicht.« Tränen strömten ihr über das Gesicht, und sie wiederholte immer wieder schluchzend: »Ich kann das nicht, ich kann das nicht . . .«
Josephine, deren Körper sich abwehrend versteift hatte, legte nun unbeholfen ihre Arme um die junge Frau.
»Ist ja schon gut. Sie müssen das nicht tun, wirklich nicht«, murmelte sie, während sie selbst das Gefühl hatte, völligen Unsinn zu reden. Vorsichtig machte sie zwei Schritte nach hinten, um die junge Frau von der Klippe wegzuziehen. Diese ließ es willig geschehen, klammerte sich jedoch nur noch fester an sie.
»Nicht weggehen, bitte nicht«, flehte sie.
Josephine fühlte sich mehr als unbehaglich. In was war sie hier bloß hineingeraten!? Ihre Reisegruppe würde schon mehr als ungeduldig sein. Sie war immerhin zum Arbeiten hier, nicht aus Vergnügen.
»Wie heißen Sie?«, erkundigte sie sich sanft, während sie der jungen Frau eine feuchte Strähne des kupferroten Haares aus dem Gesicht strich.
»Franziska«, schniefte diese, »Franziska Schrader.«
Na also. Das funktionierte offensichtlich immer. Josephine war erleichtert.
»Hören Sie, Franziska. Wir sollten ein Stück gehen. Denken Sie, Sie schaffen das?«
Wieder machte Josephine ein paar Schritte auf das Geländer zu, während Franziska nur wortlos nickte. Josephine hob Franziska mehr über die Absperrung als diese selbst kletterte. Auch den Weg zur kleinen Theaterbühne bewältigten sie eher schlitternd und rutschend als vorsichtig gehend, wie es die Nässe erfordert hätte.
Schließlich, mitten auf der Bühne, auf der sonst Romeo seine Julia anflehte, ihn zu erhören, brach Franziska endgültig zusammen. Ihr rutschten buchstäblich die Beine weg, ihr Schluchzen verstärkte sich, und sie zitterte wie Espenlaub.
Einen Moment saßen sie eng beieinander. Josephine hielt Franziska in den Armen und wiegte sie instinktiv hin und her, wie man es mit einem traurigen Kind tat. Plötzlich hörte sie ihren Namen.
»Jo! Wo bleibst du denn? Die warten schon alle!«, schallte es zu ihr herunter.
Jens, der Fahrer, hatte doch tatsächlich seinen Bus verlassen, war immerhin bis zur Terrasse gelaufen. Josephine musste lächeln. Dass sie das noch erleben durfte! Dann wurde sie gleich wieder ernst.
Was sollte sie bloß tun? Sie konnte dieses Mädchen in ihren Armen doch nicht einfach so sich selbst überlassen.
»Sag mal, wie bist du eigentlich hierhergekommen? Steht dein Auto noch drüben auf dem Parkplatz?«, fragte sie nun fürsorglich, aber bestimmt.
Pragmatismus konnte nie schaden.
Franziska schüttelte schniefend den Kopf.
»Nein«, flüsterte sie, »Ich bin mit dem Taxi gekommen. Ich musste ja nirgendwohin wieder zurück.«
Ein trauriges Lächeln glitt über ihr Gesicht.
Ratlos zog sich Josephine das schwarze Bandana vom Kopf, sodass ihre kurzen dunklen Locken zum Vorschein kamen. Sie zog die Stirn kraus. Was sollte sie bloß tun? Plötzlich ließ eine Eingebung ihre grauen Augen erstrahlen.
»Hast du seit heute Morgen schon was gegessen?«
Irritiert blickte Franziska sie an. Jetzt erst nahm Josephine das intensive Grün ihres Blickes wahr.
»Nein.« Franziska schüttelte den Kopf, »Hab ich nicht, irgendwie schien mir das nicht mehr notwendig.«
Ihr tränenersticktes Flüstern war seltsam heiser.
»Magst du mit mir mitkommen? Ich fahre jetzt in mein Hotel. Die haben ein erstklassiges Clubsandwich. Schon mal probiert?«
Franziska verneinte, ließ sich aber widerstandslos aufhelfen. Langsam, als gäbe es nichts auf der Welt, was sie auch nur im Geringsten drängen könnte, erklommen sie die Stufen des Amphitheaters, durchquerten das Besucherzentrum und wandten sich in Richtung Parkplatz.
Als Josephine auf den großen Fünfsternereisebus zusteuerte, spürte sie plötzlich, wie Franziska sich verweigerte.
»Du bist mit einem Reisebus hier?«, stieß sie entsetzt hervor.
Josephine nickte gelassen.
»Stimmt. Aber keine Sorge, die hören alle auf mein Kommando. Immerhin bin ich die Reiseleiterin.« Ein Lächeln verschönte ihr Gesicht und förderte auf der linken Wange ein Grübchen zutage.
Franziska schien noch immer zu zögern.
»Was werden die Leute sagen, wenn ich plötzlich mitfahre?«
»Oh, mach dir mal darüber keine Sorge. Ich kläre das schon.«
Energisch griff Josephine Franziska an der Hand und zog sie mit sich in den Bus. Dann nahm sie ein paar Sachen von der ersten Bank, stopfte sie hastig in die Ablage und bugsierte Franziska auf den Sessel.
»So, hier bist du ungestört. Hinter dir ist sogar ein Vorhang. Und jetzt will ich mal die erhitzten Gemüter beruhigen.«
Mit diesen Worten wandte sich Josephine abrupt um, griff nach dem Mikrofon und trat lächelnd in den Gang.
»So, liebe Gäste, nun sind wir wieder alle vollzählig. Tut mir leid wegen der kleinen Verzögerung, aber einer der Besucher im Theater war ausgerutscht. Eine Angestellte und ich haben uns noch schnell um ihn gekümmert. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Wahrscheinlich ist der Knöchel nur verstaucht. Der Krankenwagen wird gleich kommen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Unser Fahrer Jens wird uns jetzt auf dem schnellsten Weg ins Hotel zurückbringen, wo schon das Abendessen auf uns wartet.«
Josephine hatte gelogen, ohne rot zu werden. Sie schenkte den vorwiegend älteren Gesichtern im Bus ein strahlendes Lächeln. Ihr Publikum schien so von ihr eingenommen zu sein, dass die meisten freundlich zurücklächelten und verständnisvoll nickten.
Als Josephine sich umdrehte und das Mikro ablegte, begann hinter ihr ein allgemeines Gemurmel, das darauf hindeutete, dass die Leute sich wieder ihrem üblichen Geplauder widmeten.
Zufrieden grinste Josephine dem Fahrer zu: »Komm, tritt aufs Gas. Ich bin sicherlich nicht die einzige, die mächtigen Hunger hat.«
Jens nickte nur. Sie waren ein eingespieltes Team, das sich schon seit längerem kannte. Eigentlich hätte es keiner Worte bedurft. Er hatte den Bus bereits vom Parkplatz gefahren und war nun vorsichtig auf dem Weg die engen Serpentinen hinab.
Anstatt sich auf ihrem Sitz ganz vorn niederzulassen, setzte sich Josephine behutsam neben Franziska, die völlig apathisch in ihrer Ecke am Fenster zusammengesunken war. Ohne ein Wort zu sagen, betrachtete Josephine die junge Frau, der sie vermutlich gerade das Leben gerettet hatte.
Franziska sah bleich aus und starrte völlig teilnahmslos durch die regenbespritzte Scheibe. Ihr feuchtes Haar hing ihr strähnig ins Gesicht.
Sie wirkte zerbrechlich, beinahe wie aus Porzellan. Alles an ihr schien förmlich nach Zuneigung und Trost zu schreien.
Einen Moment lang verspürte Josephine das fast unwiderstehliche Bedürfnis, Franziska das nasse Haar aus der Stirn zu streichen. Gern hätte sie ihr den Reißverschluss ihrer Wetterjacke, die sie wie ein Schutzwall umgab, geöffnet, ihr die Jacke ausgezogen und Franziska schließlich tröstend in den Arm genommen. Doch sie bezwang sich und rührte sich nicht.
In gewisser Weise war Josephine froh, dass Jens die Schnellstraßen nahm. Eigentlich hatte sie es lieber, wenn er die kleinen verschlungenen Straßen durch die Ortschaften fuhr. Sie liebte diese Gegend und konnte stundenlang über all die Dörfchen und Sehenswürdigkeiten, die auf der Strecke lagen, erzählen.
An diesem Abend jedoch fühlte sie eine merkwürdige Erschöpfung. Josephine hatte schon viele Touren als Reiseführerin geleitet, und es hatte an Zwischenfällen aller Art durchaus nicht gemangelt. Sie war stets professionell damit umgegangen und hatte die auftretenden Probleme auf die ihr eigene pragmatische Art schnell und effizient gelöst.
Der Vorfall am späten Nachmittag jedoch hatte sie seltsam berührt. Wie konnte man nur einfach so sein Leben wegwerfen wollen? Noch dazu an einem so wunderbaren Platz wie dem Minack Theatre, der so voller Lebenslust und -willen steckte? Es erschien ihr unfassbar.
Gern hätte Josephine gefragt, was einem Menschen passieren musste, um an diesen für sie so unbegreiflichen Punkt zu gelangen. Doch Franziska schien wie von einer unsichtbaren Mauer der Trauer und Enttäuschung umhüllt. Ihre hellgrünen Augen glommen beinahe etwas unheimlich im schummrigen Halbdunkel des Busses. Hin und wieder rollte ihr eine einsame Träne die Wange hinunter, die sie mit matter Geste abwischte.
Sehen konnte Josephine dies nicht wirklich, aber das gelegentliche Rascheln der Wetterjacke wies sie stets darauf hin.
Als sie schließlich doch, einem inneren Bedürfnis nachgebend, ihre Hand tröstend auf Franziskas Linke legte, zog diese sie scheu zurück, als wäre ihr etwas Unrechtes geschehen.
Also gab sich Josephine dem sanften Schaukeln des Busses und der leise dudelnden Musik hin. Sie genoss die wohlige Wärme und Müdigkeit, die langsam in ihr aufstiegen. Nur hin und wieder wagte sie einen verstohlenen Blick hinüber zu Franziska, bis sie schließlich feststellte, dass die Anstrengungen des Tages ihren Tribut gefordert hatten und Franziska eingeschlafen war.
Nach einer knappen Stunde Fahrt erreichten sie das Hotel in Redruth. Die Stadt gehörte nicht unbedingt zu Josephines Lieblingsorten in Cornwall. Für ihren Geschmack strahlte sie mit ihren alten Backsteingebäuden und den Überresten alter Kupferminen zu stark die düstere Atmosphäre der Industriellen Revolution aus.
Das Clifton-Hotel jedoch, dessen breite Allee sie nun hinunterrollten, mochte sie sehr. In einem weitläufigen Park gelegen, verfügte es über den kuscheligen Charme eines Herrenhauses aus dem achtzehnten Jahrhundert. Selbst wenn man wie sie nur zum Arbeiten hier war, konnte man sich doch dem edlen Ambiente hingeben und für einen Moment den Alltag vergessen.
Vielleicht war es ja genau das, was die verstörte junge Frau neben ihr gerade brauchte.
Entschlossen stemmte sich Josephine aus ihrem Sitz und wandte sich erneut per Mikro an ihre Gäste. Freundlich-burschikos teilte sie ihnen den Verlauf des nächsten Tages mit, um sie schließlich zum Abendessen zu verabschieden. Danach half sie den älteren Herrschaften, aus dem Bus zu steigen, und hatte dabei für jeden ein Lächeln und ein freundliches Wort übrig. Auch achtete sie darauf, dass nichts Wichtiges im Bus liegenblieb.
Nachdem sich der Bus geleert hatte, stieg Jens ebenfalls aus und nahm Josephine beiseite. »Wen hast du denn da aufgesammelt? Bist du jetzt bei der Heilsarmee?«
Er lächelte spöttisch.
Josephine, die ihre Jacke im Bus gelassen hatte, schlang ihre Arme wärmend um sich. T-Shirt und Hemd, und waren sie auch noch so schick, waren eindeutig zu kalt für dieses nasse Aprilwetter. Mit bläulich verfärbten Lippen stieß sie hervor: »Was hätte ich denn machen sollen? Sie von der Klippe springen lassen? Kümmer du dich mal um deinen Bus. Auch ältere Herrschaften krümeln schließlich herum. Den Rest lass mal meine Sorge sein.«
Damit zwängte sich Josephine an ihm vorbei in den Bus, der zumindest eine wenig Wärme versprach. Franziska saß noch immer regungslos in ihrer Ecke und schaute sie mit großen ängstlichen Augen an.
Josephine hielt ihr die Hand entgegen, während sie ihr freundlich mitteilte: »Komm, wir sind da. Du kannst heute Nacht hier im Hotel bleiben. Ich arrangiere das schon.«
Franziska ignorierte geflissentlich die ihr dargebotene Hand und schob sich zaghaft aus der Sitzreihe.
Ein schüchternes Danke war alles, was sie hervorbrachte.
Das Hotel empfing sie mit anheimelnder Plüschigkeit. Dicke dunkelblaue Teppiche schluckten jeden Laut beim Gehen. Die meisten der Busreisenden hatten sich bereits zerstreut, nur zwei ältere Damen radebrechten ein etwas merkwürdiges Englisch am Empfang.
Zielsicher führte Josephine Franziska nun dorthin, um den beiden Damen bei ihren Verständigungsschwierigkeiten zu helfen. Ihr Englisch klang makellos.
Als die beiden dann gegangen waren, strahlte Josephine die junge Frau am Empfang an: »Hi Sharon. Glaubst du, dass es möglich ist, mir noch ein paar Handtücher aufs Zimmer bringen zu lassen?«
Als die Rezeptionistin, die in ihrer dunkelblauen Uniform mit der weißen Bluse äußerst adrett aussah, missbilligend eine Augenbraue hob, fügte Josephine mit müder Geste hinzu: »Und nein, es ist nicht, was du denkst. Das ist eine längere Geschichte.«
Sharon nickte scheinbar wissend: »Na, wenn das so ist, kannst du mir die Geschichte ja heute Abend bei einem Brandy erzählen. Ich habe um zehn Schluss.«
Sie lächelte schelmisch und zupfte ordnend an ihrer Uniform.
Josephine seufzte erleichtert auf. »Nichts lieber als das. Dann kann ich ihr wenigstens mein Zimmer überlassen.« Sie schmunzelte und fügte neckend hinzu: »Und nimm den guten Brandy. Letztens der war nicht mal dritte Wahl.«
Franziska indessen hatte von dem Gespräch nichts weiter mitbekommen. Nicht, dass sie kein Englisch gesprochen hätte. Aber sie fühlte eine unendliche Müdigkeit in sich, die nur von dem nagenden Hungergefühl übertroffen wurde.
Es hatte ihr gut getan, dass sich jemand um sie kümmerte und sorgte. Sie hätte nicht zu sagen gewusst, wann dies das letzte Mal geschehen war. Deshalb nahm Franziska es willig hin, als Josephine sie sanft am Arm berührte.
»Komm, mein Zimmer ist oben. Ich denke, du kannst eine Dusche gut gebrauchen. Die weckt die Lebensgeister.« Kaum war ihr der letzte Satz entschlüpft, biss sich Josephine verlegen auf die Lippen. Wie konnte sie nur so gedankenlos daherreden, nach dem, was heute passiert war. Rasch fuhr sie deshalb fort: »Und anschließend gibt’s auch das versprochene Clubsandwich . . . Oder was immer du willst.«
Sie schaute Franziska gespannt von der Seite an, doch diese reagierte nur mit einem leichten Nicken, ohne dass ihre Miene verraten hätte, was sie dachte.
Schweigend liefen sie nebeneinander die langen Flure entlang, die nur vom düsteren Schein kleiner Lampen erhellt wurden. Auch das war etwas, was Josephine an diesem Hotel so mochte. Sie liebte die gediegene Vornehmheit der alten Möbel, die hier und da auf den Fluren standen, den leicht muffigen Geruch, der aus den dunkelroten Seidentapeten aufstieg, den Türknauf mit dem Löwenknopf, der so elegant in der Hand lag, wenn man die Zimmertür öffnete.
Als Josephine genau dies tat und Franziska vor sich ins Zimmer schob, zeigte diese erstmals seit ihrem Zusammenbruch im Minack Theatre eine sichtbare Reaktion.
»Oh, wie schön«, entschlüpfte es ihr, und ihre Augen wurden groß und rund.
Der dunkelblaue Teppichboden unter ihren Füßen gab angenehm weich nach. Die Terrakottafarbe der Wände verlieh dem Raum eine anheimelnde Atmosphäre.
Schwer lagen die ebenfalls dunkelblauen Tagesdecken, verziert mit schmalen Silberstreifen, auf den beiden durch einen Nachttisch getrennten Betten. Auf den gleichfarbigen Schmuckkissen lockte jeweils ein Täfelchen Schokolade.
Josephine wies mit raumgreifender Geste um sich.
»Dies ist also mein Reich. Zumindest für drei Nächte. Übermorgen ist diese Tour zu Ende, dann fahre ich zurück.« Sie deutete auf das linke Bett. »Du kannst das da drüben haben. Handtücher müssten gleich kommen.«
Als wäre das der passende Zauberspruch gewesen, klopfte es an der Tür.
»Zimmerservice!«, war gedämpft zu vernehmen.
Josephine eilte zur Tür, wechselte ein paar englische Worte mit dem Zimmermädchen und kam mit einem Stapel blütenweißer Handtücher, einem ebensolchen, flauschigen Bademantel sowie Pantoffeln in Plastikverpackung zurück. Das Ganze wurde gekrönt von einer Zahnbürste, Zahnpasta und einem Kamm.
All das hielt sie Franziska entgegen. »Hier, das dürfte erst mal reichen. Wenn du magst, nimm ein Bad. Die Wanne hat epische Ausmaße.«
Josephine schmunzelte wissend, wurde jedoch sofort wieder ernst, als sie sah, welche tiefe Verlorenheit Franziskas Gesicht überschattete. Müdigkeit hatte ihr dunkle Ränder unter die Augen gemalt, während möglicherweise Hoffnungslosigkeit oder Trauer – da war sich Josephine nicht ganz sicher – ihr tiefe Furchen um die Mundwinkel grub.
Sicher war sich Josephine jedoch in einem – diese junge Frau mit dem sonst vermutlich wallenden roten Haar und der beinahe porzellanzarten Haut wirkte so hilfsbedürftig, dass sie sie am liebsten in den Arm genommen und zärtlich wie ein Kind gewiegt hätte.
». . . lebst du hier in der Nähe?«
Franziskas unverhoffte Frage riss Josephine aus ihren Gedanken.
»Tut mir leid, was hast du gefragt? Ich war in Gedanken gerade bei meiner Reisegruppe«, log sie geübt.
»Entschuldige. Ich fragte nur, ob du hier in der Nähe lebst.« Franziskas Stimme klang, als bereite ihr bereits das Sprechen große Mühe.
»Oh ja, das tue ich. Max und ich haben drüben in Dartmoor ein Hotel. Nicht besonders groß, neun Zimmer, aber für uns reicht’s.« Stolz schwang in Josephines Stimme, als sie das sagte.
»Max ist dein Mann?« Fast schien es, als schwang Enttäuschung in Franziskas Frage.
»Mein Mann?«, echote Josephine irritiert. Dann lachte sie verstehend. »Nein, nicht mein Mann. Max, also eigentlich Maxine, ist meine Freundin. Zumindest die meiste Zeit.«
Den letzten Satz nuschelte Josephine so stark, dass Franziska erstaunt aufblickte. Sie wagte jedoch nicht, nachzufragen.
Das Thema schien Josephine ein wenig unangenehm zu sein. Jedenfalls lenkte sie ab, indem sie Franziska sanft in Richtung Bad schob. »Genieß das Bad. Es ist wirklich sehenswert.«
Es dauerte dann auch wirklich eine ganze Weile, ehe Franziska nur mit dem weißen Badmantel angetan das Bad verließ. Ihre roten Locken schienen noch ein wenig feucht.
»Das Bad ist wirklich toll. Du musst deinen Job schon deshalb mögen, weil du so erstklassig wohnen kannst.« Sie lächelte verlegen, setzte sich in einen der beiden Sessel und zog die Knie an. »Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr herumgeplanscht.«
Josephine winkte ab. »Kein Problem. Das bin ich von zu Hause gewöhnt. Außerdem – besser hier als in Porthcorno vor der Küste.« Erschrocken schlug sie sich die Hand vor den Mund und murmelte: »Tut mir leid, das war gedankenlos. Ich würde jetzt gern meine Worte essen, wie der Engländer so schön sagt. Manchmal sollte ich wohl denken, bevor ich rede.«
Ehe Franziska etwas erwidern konnte, verschwand sie im Bad. Nur das Rauschen der Dusche war noch zu hören.
Als Josephine aus dem Badezimmer kam, fand sie Franziska blicklos starrend am Fenster vor. Sanft legte sie ihr die Hand auf die Schulter.
»Schön, nicht wahr?«
»Bitte?« Erschrocken fuhr Franziska, die immer noch im Bademantel war, herum.
»Ich sagte Schön, nicht wahr«, wiederholte Josephine mit freundlicher Stimme. »Ich meinte den Blick in den Park. Ich liebe diese englischen Gärten. Ihr Symmetrie erscheint mir stets so friedlich und beruhigend.«
»So habe ich das noch nie gesehen. Ich halte sie eigentlich eher für kitschig.« Mit dem Kinn deutete Franziska auf zwei bemooste steinerne Putten, die mit verträumtem Blick eine verwitterte Holzbank flankierten.
»Kitschig! Wohl kaum. Das ist reine Poesie. Sieh nur, wie sehnsüchtig sie schauen. Und der Park – lädt er nicht förmlich zum Flanieren ein? Stell dir vor, du spazierst im Frühling mit jemandem, den du wirklich magst, all diese wunderbaren Alleen entlang. Ihr verliert euch im Heckenlabyrinth, findet euch wieder, verirrt euch erneut, um am Ende an einem schattigen Fleckchen unter den alten Eichen ein stilvolles Picknick mit all den englischen Köstlichkeiten zu machen, während euch eine dieser Putten verschmitzt lächelnd zuschaut. Klingt das nicht romantisch?«
Josephine schien bei diesem Thema geradezu euphorisch geworden zu sein und strahlte Franziska erwartungsvoll an.
Diese zuckte nur müde mit den Schultern. »Kann schon sein. Ehrlich gesagt, ist mir derzeit nicht sehr nach Romantik. Außerdem glaube ich nicht, dass ich je gehört habe, dass jemand die englische Küche als köstlich bezeichnet hat.«
Franziska schlang die Arme enger um sich und starrte erneut ins Nichts.
Für den Moment fühlte sich Josephine, als hätte sie vom Zehnmeterbrett eine Bauchladung vollzogen. Doch sie verzog keine Miene.
»Mh. Tut mir leid. Ich fürchte, ich war ein bisschen überschwänglich bei meinem Lieblingsthema. Das mit der englischen Küche müssen wir aber noch genauer untersuchen. Magst du dich anziehen, und wir gehen hinunter etwas essen?«
Franziska zuckte erneut hilflos mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Ich glaube, meine Hose und meine Schuhe sind noch ganz nass.«
Josephine, mehr als hungrig und müde nach diesem anstrengenden Tag, fühlte, wie Unmut in ihr aufstieg. Sie selbst war jemand, der anpacken konnte und zumeist fröhlich und unbeschwert auftrat. Wann immer sie Probleme hatte, versuchte sie, diese auf den Tisch zu packen und wenn es sein musste, auch lautstark zu lösen.
Verhuschte Sprach- und Entschlusslosigkeit war ihr mehr als verhasst. Sie zögerte einen Moment, dann griff sie nach der Hotelmappe.
»Hier, die Speisekarte.« Josephine reichte sie Franziska hinüber. »Such dir was aus. Dann essen wir eben auf dem Zimmer.« Sie versuchte ein aufmunterndes Lächeln, doch es wirkte leicht genervt.
Franziska schien das nicht zu bemerken. Zu sehr war sie mit sich und ihrer Situation beschäftigt, als dass sie auf andere hätte zu achten vermocht. Ihr Körper fühlte sich ausgelaugt, beinahe taub an. In ihrem Kopf dröhnte es dumpf.
Mit schwacher Stimme antwortete sie: »Du hast gesagt, es gibt Clubsandwich. Ist das in Ordnung?«
Josephine nickte. »Sicher doch, da kannst du nichts falsch machen.«
Sie telefonierte, und eine Viertelstunde später saßen beide gemeinsam an dem kleinen Tischchen, jede ein solches Sandwich vor sich. Dazu hatte sich Josephine ein großes Guinness sowie ein rötlich schimmerndes Kilkenny für Franziska bestellt.
Mit fast schon wölfischem Hunger schlang sie das dreistöckige Hühnersandwich hinunter, wobei sie Mengen der mitgelieferten Saucentütchen darüber ausquetschte.
»Schmeckt’s?«, fragte sie mit vollem Mund, während sie Franziska beobachtete.
Diese knabberte nur zaghaft an dem kulinarischen Riesen. »Mh, geht schon. Ehrlich gesagt, habe ich irgendwie doch nicht so viel Hunger.«
Kraftlos ließ Franziska ein Stück Hühnerbrust zurück auf den Teller fallen und sich selbst zurück in den Sessel sinken. Sie schloss die Augen, während sie versuchte, einen Augenblick lang an nichts zu denken.
Der Anblick ihrer zarten Gestalt im weißen Bademantel, deren rotes Haar nun endgültig trocken war und wild um ihren Kopf wallte, rührte Josephine. Sie würgte hastig ihren Sandwichrest hinunter, spülte mit einem Schluck Bier nach und wischte sich Mund und Hände mit der Serviette ab.
»Darf ich dich etwas fragen?«, erkundigte sie sich vorsichtig.
»Sicher«, gab Franziska spürbar erschöpft zurück.
Josephine zögerte einen Moment, gab sich einen Ruck und fragte dann doch: »Weshalb standst du heute Abend dort auf der Klippe?«
Franziska öffnete die Augen und musterte mit mattgrünem Blick ihr Gegenüber. Sie war überrascht, wie weich Josephines Züge im gedimmten Licht der Stehlampe wirkten, wie sanft ihre sonst so scharfen grauen Augen sie anschauten. Nichts in ihr verlangte danach, irgendjemandem über sich und ihre Probleme zu erzählen, doch Josephines Blick ließ sie nicht los. Er saugte sich förmlich an ihr fest, sodass sie das Gefühl hatte, ihm unmöglich entkommen zu können.
Auch hatte sie die Empfindung, Josephine etwas schuldig zu sein. Also setzte sie sich ein wenig mühsam in ihrem Sessel auf und musterte Josephine eindringlich, bevor sie mit überraschend fester Stimme sagte: »Das ist wohl nicht so schwer zu erraten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Bad nehmen wollte, erscheint mir doch eher gering.«
Josephine schluckte überrascht und musste an ihre unüberlegte Bemerkung denken, ehe sie verlegen zurückgab: »Sicher. So meinte ich das auch nicht. Ich dachte nur, es gäbe sicher einen Grund weshalb . . . Aber du musst natürlich nicht . . .«
Sie sah Franziska taxierend an.
Diese schüttelte den Kopf: »Nein, muss ich wirklich nicht. Will ich auch nicht . . . Jedenfalls nicht jetzt«, ergänzte sie begütigend, als sie bemerkte, wie schroff sie geklungen hatte.
Bei ihren Worten war Josephine zusammengezuckt, doch sie hatte sich schnell wieder im Griff. Sachlich erkundigte sie sich: »Du hast sicherlich ein paar Sachen mitgebracht. Wo sind die jetzt?«
Franziska lächelte ein kaum sichtbares trauriges Lächeln, als ob sie einer besonderen Erinnerung nachhing. Schließlich erwiderte sie: »Ich habe eine kleine Reisetasche in einem kleinen Bed and Breakfast in Saint Buryan. Das Zimmer ist noch für zwei Tage bezahlt. Nur für den Fall . . .«
Franziska zögerte, und es schien, als wolle sie etwas erklären. Dann jedoch holte sie nur tief Luft und erkundigte sich: »Weshalb fragst du?«
»Ach nur so. Ich dachte, es wäre vielleicht ganz nützlich, wenn du deine Sachen wieder hast. Irgendwann braucht man schließlich auch frische Socken.« Josephine deutete auf Franziskas Strümpfe, die zum Trocknen auf dem Heizkörper lagen. Als sie sah, wie Franziska verlegen die Augen niederschlug, stand sie auf und kramte in ihrer eigenen Reisetasche, aus der sie schließlich einen kleinen Beutel herauszog.
»Hier.« Sie reichte ihn Franziska hinüber. »Meine Notreserve. Irgendein Gast braucht immer mal ein paar Socken oder einen Slip. Ich habe stets welche dabei. Nur für den Fall . . .«
Erneut schrak Josephine ein wenig zusammen, als sie bemerkte, dass sie Franziskas Worte wiederholt hatte. Sie hätte sich für ihre Gedankenlosigkeit ohrfeigen können, doch Franziska schien nichts bemerkt zu haben. Sie kramte in der Tüte und zog ein paar neue Ringelsocken sowie einen noch frisch verpackten Slip heraus.
»Und so etwas hast du immer dabei?« Franziska konnte ihre Überraschung nur schlecht verbergen.
»Ja, schon.« Josephine zuckte leichthin mit den Schultern »Als Reiseleiter erlebst du so viel, da musst du einfach gewappnet sein. Hier, fang!«
Sie warf Franziska ein Taschenmesser zu, damit diese die Verpackung aufschneiden konnte.
»Das gehört auch zu deiner Grundausrüstung?«, erkundigte sich Franziska nunmehr lächelnd.
»Sicher doch.« Josephine grinste breit, froh zu sehen, dass sie ihr Gegenüber ein wenig aus ihrer Lethargie hatte reißen können. »Gibst du mir die Adresse und die Nummer deines Bed and Breakfasts? Dann kann ich eventuell organisieren, dass du deine Tasche bekommst.« Josephine zögerte. »Falls du willst, könntest du morgen mit uns weiterfahren. Dann wärst du erst mal nicht so allein. Wir fahren nach Trebah Garden. Der ist wirklich toll. Den muss man einfach gesehen haben, wenn man in Cornwall ist. Hast du Lust, oder soll ich dir lieber eine Mitfahrgelegenheit nach Saint Buryan organisieren?«
Wie immer, wenn sie über Cornwall sprach, leuchteten Josephines Augen voller Begeisterung. Franziska spürte, wie sehr sie diese Gegend liebte. Das erste Mal seit langem spürte sie auch, dass sich in ihr selbst so etwas wie ein Gefühl regte. Unter all der Taubheit, die ihren Körper und Geist befallen zu haben schien, fühlte sie zarte Neugier sprießen.
Die Frau, die ihr so lässig in sandfarbenen Cargohosen und rotem Sweatshirt gegenüber saß, schien so viel Lebenslust und Unbekümmertheit auszustrahlen, dass selbst sie, die dachte, dass ihr Herz erfroren sei, sich dem nicht völlig entziehen konnte.
Unter dem taxierenden Blick Josephines wägte sie ab, wie es weitergehen sollte. Es erschien ihr nicht sonderlich verlockend, nach Saint Buryant zurückzukehren. Zurück in das leere Zimmer, wo sie wieder allein auf ihrem Bett hocken würde, grübelnd, was zu tun sei, unfähig, einen kurzfristigen Entschluss oder gar einen von größerer Tragweite zu fassen.
Die Aussicht, einen weiteren Tag in Josephines Gesellschaft zu verbringen, mutete da weitaus verlockender an. Was hatte sie schon zu verlieren, jetzt, da sie sowieso schon mit allem abgeschlossen hatte?
Beinahe träumerisch hob Franziska ihre langbewimperten Lider, registrierte lächelnd, dass Josephine sie noch immer interessiert musterte und sagte schließlich: »Ich würde gern nach Trebah Garden fahren. Mutter hat mir immer davon vorgeschwärmt. Es muss dort wirklich toll sein. Wenn ich dir nicht zur Last falle . . .?«
»Zur Last fallen?« Josephine lachte amüsiert auf. »Ich betreue einen Bus mit fünfundvierzig Leuten, die alle über sechzig, die ältesten sogar fünfundachtzig sind. Die sitzen beinahe alle in diesem Bus, weil sie zu Hause einsam sind und weil sie einfach mal rauswollen. Glaubst du ernsthaft, mir würde eine verlorene Seele mehr etwas ausmachen?«
Josephine nahm einen letzten Schluck Guinness und stand auf.
»So siehst du mich also, als verlorene Seele?« Nachdenklich neigte Franziska ihren Kopf zur Seite, sodass ihr Haar ihr wallend über die Schulter fiel. Dabei öffnete sich ihr Bademantel ein wenig und gab den Blick auf makellose weiße Haut und den Ansatz einer wohlgeformten Brust frei.
Josephine musste schlucken. Hastig wandte sie sich ihrem Rucksack zu und kramte darin herum.
Als sie sich wieder herumdrehte, hatte Franziska den Bademantel zusammengerafft und hielt ihn nun mit der Hand zusammen. Ihr Gesicht war von zarter Röte der Verlegenheit überzogen.
Dabei überhörte Josephine Franziskas Frage geflissentlich. Stattdessen erkundigte sie sich erneut nach der Adresse des B&B, rief einen Kollegen an und verkündete schließlich freudestrahlend, dass Franziska am nächsten Tag auf der Rückfahrt nach Redruth unterwegs auf einem Parkplatz ihre Tasche bekäme. Es sei zwar ein wenig kniffelig gewesen, aber zwei Kollegen würden sie weiterreichen, wann und wo sei egal, wichtig sei schließlich, dass es funktionierte.
Franziska nahm diese Mitteilung mit einem vagen Nicken zur Kenntnis. Noch immer schien es ihr unmöglich, die Geschehnisse, die den von ihr seit langem sorgfältig geplanten Verlauf des Nachmittags so grundlegend veränderte hatten, einzuordnen und zu werten. Alles, was sie zunächst hervorbrachte, war ein schwaches: »Danke.«
Allerdings konnte sie trotz ihrer Müdigkeit sehen, dass Josephine einen Moment lang enttäuscht darüber war, dass ihre Bemühungen nicht stärker gewürdigt wurden. Franziska rang sich ein zaghaftes Lächeln ab und ergänzte: »Tut mir leid. Ich sollte wohl dankbarer sein, aber . . .«
Josephine schüttelte unwillig ihre Locken.
»Ach wo. Du solltest gar nichts. Mach dir keine Gedanken.« Sie sah sich wie suchend im Zimmer um. »Brauchst du noch irgendetwas?«
Franziska verneinte, zog den Bademantel noch enger um sich und sah Josephine mit bittendem Blick an: »Ich bin wirklich sehr müde. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich schlafen gehe?«
Fast schien es, als würde Josephine erleichtert aufatmen.
»Nein, nein, keineswegs. Es ist immerhin schon nach zehn. Ich bin auch ziemlich kaputt.« Sie zögerte. »Denkst du, dass du allein zurechtkommst? Ich möchte dich nicht stören und habe mir ein anderes Zimmer gesucht.«
Der Anflug eines wissenden Lächelns glomm in Franziskas Augen auf, als sie beinahe gleichmütig nachfragte: »Die Blonde von der Rezeption?«
Röte ergoss sich über Josephines Gesicht. Sie fühlte sich ertappt. Von ihrer sonstigen Coolness war nichts mehr zu spüren, als sie verlegen haspelte: »Ja, Sharon. Wir kennen uns schon lange. Sie hat mir ein anderes Zimmer besorgt, so wie dir die Handtücher. Ist schließlich ihr Job.«
Josephine versuchte, glaubhaft zu klingen, doch sie spürte selbst, wie lau sich die Ausrede anhörte. Offensichtlich fiel es ihr schwer, Franziska anzulügen. Den Bruchteil einer Sekunde lang grübelte sie darüber nach, ob es an deren zerbrechlicher Schönheit oder aber an der Aura von Todessehnsucht und Trauer lag, die sie zu umgeben schien.
Um die merkwürdige Stimmung, die sich plötzlich zwischen ihnen beiden aufgebaut hatte, zu brechen, schüttelte Josephine lachend den Kopf.
»Sie ist wirklich nur eine Freundin. Und sie hat den besten Brandy im Umkreis von fünfzig Meilen. Genau das Richtige nach so einem langen Tag. Schlaf gut. Ich komm dich morgen gegen acht wecken. Ist das okay für dich?«
»Ja, sicher doch. Gute Nacht«, entgegnete Franziska mit einer unbestimmten Geste. Als Josephine sich abwandte, rief sie ihr plötzlich halblaut hinterher: »Und danke für alles.«
Josephine drehte sich noch einmal um, nickte und schenkte ihr ein warmes Lächeln. Dann verließ sie wortlos das Zimmer.
Kaum hatte Josephine die Tür hinter sich geschlossen, stand Franziska auf und trat ans Fenster. Für den Moment fühlte sie sich regelrecht erleichtert darüber, allein zu sein. Dies ersparte ihr die Mühen einer höflichen Konversation. Sie musste nicht länger Dankbarkeit zeigen, von der sie nicht einmal wusste, ob sie echt war.
Hätte sie nicht vielmehr wütend auf Josephine sein müssen? Wütend darüber, dass sie ihr das Leben gerettet hatte?
Franziska zögerte. Vielleicht musste sie ja nur auf sich wütend sein. Hätte sie nur mehr Mut gehabt! Hätte sie es nur gewagt zu springen! Hätte sie nur eine andere Stelle ausgesucht. Hätte, hätte, hätte!
Erschöpft vergrub sie das Gesicht in ihren Händen und ließ ihren Tränen freien Lauf. Schluchzend und mit zuckenden Schultern stand sie mehrere Minuten einfach da und weinte, bis sie schließlich keine Tränen mehr hatte. Sie fühlte sich ausgebrannt und leer, ein Gefühl, das ihr mehr als vertraut erschien. Mit matter Geste streifte sie den Bademantel ab und ließ ihn gedankenlos zu Boden gleiten. Nackt wie sie war schlüpfte sie zwischen die Laken, wo sie sich wie ein Embryo zusammenrollte.
Ihr letzter Gedanke galt Josephines Lächeln, dann schlief sie erschöpft ein.
Währenddessen hatte Josephine mit freudigen kleinen Hüpfern die langen Flure durcheilt. Ihr war, als hätte man eine Last von ihr genommen. Sharon und ein Brandy, das war genau das, was sie jetzt brauchte.
Schließlich bog sie in einen etwas dunkleren Gang in einen Seitentrakt des Gebäudes ab. Im Dienstbotengang, wie er von allen nur genannt wurde, befanden sich Zimmer für die Angestellten des Hauses. Diese übernachten dort, wenn ihre Dienstzeiten die etwas längere Heimfahrt nach Redruth oder in eines der umliegenden Dörfer beinahe unmöglich machten.
Josephine hämmerte ein kleines Trommelsolo an eine der Türen, die sich ihr sofort öffnete.
»Oh, Josie, du! Ich dachte schon, du kommst nicht mehr.«
Vor Josephine stand Sharon mit einem Glas in der Hand und einem amüsierten Lächeln im Gesicht. Das am Nachmittag so straff nach hinten gekämmte Haar fiel ihr locker auf die Schultern. Noch trug sie ihre Uniform. Sie hatte Jacke und Bluse bereits aufgeknöpft, sodass Josephine einen Blick auf ihren knappen BH erhaschen konnte, der zwei kleine Brüste heftig nach oben drückte.
»Hi Sharon! Seit wann zweifelst du an meiner Treue?« Josephine grinste spitzbübisch und versuchte Sharon um die schlanke Taille zu fassen. Sharon jedoch entzog sich mit einer flinken Bewegung ihrem Griff und eilte zurück ins Zimmer.
»Vielleicht, seitdem du Damenbesuch mit auf dein Zimmer nimmst und mich auch noch dazu verdonnerst, für ihr Wohlbehagen zu sorgen?«
Es klang mehr wie eine Feststellung als eine Frage. Sharon nippte an ihrem Drink und schaute Josephine mit hochgezogenen Brauen an, während diese die Tür hinter sich schloss.
Josephine blieb scheinbar ungerührt. Sie ließ sich mit ausgebreiteten Armen auf das Doppelbett fallen, das zwar nicht so nobel war, wie das in ihrem Zimmer, aber ebenfalls englische Gediegenheit ausstrahlte.
»Oh Sharon, Süße. Das war wirklich ein seltsamer Tag. Gib mir auch einen Brandy, und ich erzähl dir die ganze grässliche Wahrheit.« Sie stützte sich auf ihre Ellenbogen und schaute Sharon, die abwartend am Fenster stand, mit breitem Lächeln an.
Diese gab das Lächeln mit einem wissenden So, so. zurück. Dann nahm sie eine Flasche vom Tisch und goss einen ausgesprochen großen Schluck der goldgelb schimmernden Flüssigkeit in ein zweites Glas.
Mit wippenden Hüften trat sie vor Josephine und drückte ihr beide Gläser in die Hand.
»Hier, halt mal.«
Nun schob sie ihren engen Rock soweit in die Höhe, dass sie ihre Knie links und rechts von Josephine platzieren konnte und auf ihrem Schoß zu sitzen kam.
Josephine lächelte süffisant, als sie ihr Gesicht plötzlich auf Höhe von Sharons Brüsten wiederfand.
»Schöne Aussicht«, murmelte sie, »Blöd nur, dass ich gerade zwei Gläser in der Hand habe.«
Schon wollte sie ihre Nase schnuppernd in den ihr so wohlvertrauten Busen stecken, da hatte Sharon ihr schon ein Glas wieder abgenommen und drückte ihr den Kopf sanft aber bestimmt wieder nach hinten.
»Nichts da. Erst hätte ich gern eine Erklärung.«
Murrend nahm Josephine einen tiefen Schluck, der ihr weich und warm die Kehle hinunter rann. Sie seufzte selig auf.
»Ah! Besser als ein Orgasmus.«
Das brachte ihr prompt eine Kopfnuss ein.
»Das will ich doch nicht hoffen. Komm, erzähl schon, ehe mir die Beine einschlafen und ich mich nur nach einem Stuhl sehne.«
Doch Josephine schien es mit dem Erzählen nicht so eilig zu haben. Betont langsam nahm sie einen zweiten Schluck, wobei sie Sharon tief in die Augen sah. Währenddessen wanderte ihre freie Hand langsam über Sharons nackten Schenkel, streifte über den hochgerutschten Rock und tastete sich schließlich vorsichtig unter die geöffnete Bluse vor. Doch hier war dann auch endgültig Schluss.
Mit festem Griff stoppte Sharon Josephines Vordringen und schüttelte den Kopf. »Denk nicht mal dran. Erst deine Geschichte.«
Seufzend ergab sich Josephine. Zwar dachte sie nicht daran, ihre Hand zurückzuziehen, aber immerhin fing sie an und erzählte in knappen Sätzen vom Verlauf des Nachmittags und Abends.
Als sie geendet hatte, blickte Sharon sie vorwurfsvoll an. »Und du hast sie jetzt da oben ganz allein in deinem Zimmer gelassen?!«
»Ja, sicher doch.« Josephine zuckte mit den Schultern. »Ich hatte das Gefühl, dass sie mehr als froh war, mich los zu sein. Glaubst du etwa, sie tut sich was an?«
Es sollte spöttisch klingen, aber insgeheim beschlich Josephine ein ungutes Gefühl.
Sharon gab ihr einen Kuss auf die Nase und wuschelte ihr durchs Haar. »Ach Josie. Du bist unmöglich. Erst Mutter Theresa spielen und sich dann davonschleichen. Was hast du nur wieder angestellt.«
»Denkst du, ich sollte wieder nach oben und nach ihr sehen?«, gab Josephine kleinlaut zurück.
Sharon lachte. »Ich denke nicht. Was soll sie schon tun? Sich aus dem Fenster stürzen? Da bricht sie sich höchstens ein Bein. Nein, nein. Für heute hat sie sicher genug erlebt. Lass sie schlafen. Aber hast du dir mal überlegt, wie es morgen weitergehen soll?«
Josephine leerte ihr Glas endgültig und nickte.
»Sie kommt erst mal mit nach Trebah Garden. Dann sehen wir weiter.«
»Oh!«, bemerkte Sharon süffisant. »Wie nobel von dir. Die edle Ritterin wacht über die Schwachen. Fast könnte man meinen, du hältst sie dir warm.«
»Quatsch. Aber ich kann sie doch nicht so einfach aussetzen. Sie hat offenbar nicht mal einen Rückflug gebucht.«
»Versteh schon.« Sharon griente. »Aber sehen wir es doch mal positiv. Dann haben wir zwei Hübschen wenigsten noch eine zweite Nacht zusammen.«
Sie rekelte sich lasziv auf Josephines Schoß, sodass deren Nase wieder Kontakt zu ihren Brüsten bekam.
Josephine atmete genießerisch ihren Duft ein, wobei sie wohlig schnurrte. Dann begann sie, mit ihrer Zunge zärtlich Sharons Brüste zu liebkosen, während sie ihren Körper immer fester an sich drückte.
Einen Moment lang schien Sharon sich ihren Zärtlichkeiten ergeben zu wollen, doch dann griff sie Josephine mit festem Griff ins Haar und zog ihren Kopf zurück.
»Warte eine Sekunde. Ich muss die Gläser noch wegstellen«, flüsterte sie mit schnellgehendem Atem.
Rasch glitt sie von Josephines Schoß, griff sich auch deren Glas und stellte beide auf den Schreibtisch. Dann schob sie sich wieder über Josephine, die sich nicht gerührt hatte.
»So, jetzt können wir da weitermachen, wo wir gerade aufgehört haben.«
Sharon umschlang Josephine heftig und küsste sie gierig. Diese erwiderte ihren Kuss mit hungrigem Verlangen, hielt sich jedoch nicht lange damit auf. Sie begann, mit heißem Atem Sharons Hals zu liebkosen, ihre Nase in ihrem Kragen zu vergraben, während ihre Hände heftig an ihrer Uniformjacke zerrten.
»Oh, Sharon«, stöhnte sie lustvoll, »Ich liebe es, wenn du Uniform trägst, vor allem, weil ich es liebe, sie dir auszuziehen.«
Schon fiel die Jacke zu Boden, Bluse und BH folgten wenig später. Auch Sharon machte sich mit fliegenden Händen an Josephines Pullover zu schaffen. Es dauerte nicht lange, da waren beide nackt. Mit gieriger Entschlossenheit schob sich Josephine über Sharon, die das Gefühl von Josephines nacktem Körper auf ihrer Haut mit wohligem Stöhnen quittierte.
Josephine vergrub ihre Hände in Sharons blondem Haar, das sich wie ein Fächer auf dem Kissen ausbreitete. Sie biss ihr liebeshungrig in den Hals, während sie sich heftig an ihr rieb.
Plötzlich jedoch schien Josephine sich zu besinnen. Sie hielt kurz inne, schaute Sharon einen Augenblick lang tief in die von Begierde verschleierten Augen und begann schließlich, ihren Körper zärtlich mit Lippen und Händen zu liebkosen.
Sie spürte, wie Hitze in Sharon aufstieg, sah, wie unter ihren streichelnden Händen die Knospen ihrer kleinen Brüste hart wurden und dunkelrot erblühten.
Sharons Atem ging flach, ihr Bauch hob und senkte sich hastig. Ihre Hände versuchten Josephines Kopf in ihren Schoß zu drängen, während sie ihr diesen heftig entgegen hob. Dabei presste sie durch die Zähne: »Oh, komm schon Josie! Worauf wartest du noch!? Du musst mich nicht erst . . .«
Scharf zog Sharon die Luft durch die Zähne ein, hatte Josephine doch ihren Kopf in ihren Schoß versenkt und ihre Zunge zart über ihre Perle bewegt. Mit geschickten Zungenschlägen gelang es Josephine nun in kürzester Zeit, Sharon in einen ekstatischen Zustand zu versetzten. Sanft drängte sie ihre Finger in die feuchten Tiefen von Sharons Schoß und trieb sie mit zielstrebiger Unnachgiebigkeit zum Höhepunkt.
Sharon kam mit einem gedämpften Aufschrei.
Noch während sie nach Luft rang, drängte Josephine ihren Körper an Sharons zitternden Leib. Ihre Finger waren noch immer in der pulsierenden Weichheit ihres Schoßes gefangen und gönnten Sharon keine Pause. Wieder und wieder bog sich deren Körper unter immer neuen Wellen von Lust, bis sie schließlich völlig erschöpft um Einhalt bat.
»Josie, bitte! Ich kann wirklich nicht mehr.« Sharon holte tief Luft. Ihr Gesicht war hochrot. Ihr Körper glühte. »Außerdem . . . außerdem musst du mir schon noch ein bisschen Kraft für dich lassen.« Sie lächelte vielversprechend und rieb sich wohlig an Josephine.
Diese grinste fröhlich zurück.
»Bist du sicher, dass das alles war?« Ihre Finger führten Schmetterlingsflügelschläge aus, was Sharon sofort zusammenzucken ließ.
»Wirklich, Josie. Es reicht.« Wieder zog Sharon scharf die Luft ein. Sie griff nach Josephines Handgelenk.
»Süße, wenn du meinst, dass es reicht, dann müsstest du mich schon auch rauslassen.« Josephine schmunzelte wieder und bewegte die Finger aufreizend.
»Oh!« Irritiert löste Sharon die Spannung ihrer Schenkel, die Josephine ein Entkommen unmöglich gemacht hatten. »Besser so?«
»Viel besser«, erwiderte Josephine und löste ihre Hand mit aufreizender Langsamkeit aus Sharons Schoß, was diese erneut zu lustvollen Schauern trieb. Dann ließ Josephine ihre feuchten Finger in kleinen Trippelschritten über Sharons Bauch wandern. Sie umkreisten ihren Nabel, wobei sie einen kleinen Stepptanz aufzuführen schienen.
»Josie, du sollst nicht spielen!«, mahnte Sharon mit beinahe mütterlicher Zärtlichkeit und griff nach Josephines Handgelenken. Nach einem kurzen Gerangel hatte Sharon die Überhand gewonnen, und nun war es Josephine, die sehr bald die verräterische Nässe zwischen ihren Beinen spürte. Also überließ sie sich Sharons kundigen Händen, die ihr sehr schnell tiefe Seufzer des Entzückens entlockten, welche letztlich in einem kurzen spitzen Schrei gipfelten.
Schließlich lagen die beiden Frauen schwer atmend beieinander. Sharon malte zärtlich Kringel auf Josephines Bauch, während diese ihre Arme hinter dem Kopf verschränkt hielt.
»Jo!?«
»Mh?«
»Was meinst du? Ob wohl je etwas aus uns wird?«
Josephine nahm die Arme nach vorn und drehte sich Sharon zu, sodass sie Brust an Brust lagen.
»Was soll denn noch aus uns werden? Haben wir nicht die schönste Bettgeschichte der Welt? Mit Sex in guten Hotels?«
Das brachte ihr einen zarten Klaps ein.
»Du weißt schon, was ich meine. Warum ist aus uns eigentlich nie etwas Richtiges geworden?«
Josephine räusperte sich. Sie gab Sharon einen Kuss auf die Nase und fasste sie zärtlich an der Hüfte.
»Weil du ohne deinen Jim nicht sehr glücklich gewesen wärst und Maxine auch nicht kampflos das Feld geräumt hätte?«
»Ach Max«, wehrte Sharon murrend ab. »Als ob ihr eine Beziehung hättet.«
Josephine wurde plötzlich ernst.
»Das kannst du nicht beurteilen. Also tu es auch nicht«, entgegnete sie beinahe harsch und rückte ein wenig von Sharon ab.
Diese griff entschuldigend nach ihr und zog sie wieder an sich.
»Tut mir leid. Du hast ja recht.« Sharon gab Josephine einen Kuss. »Es ist alles gut so, wie es ist. Immerhin haben wir mehr Spaß als die meisten.«
»Sollte man meinen.« Josephine grinste und zog die Decke über beide. »Aber ich denke, wir sollten ein bisschen schlafen. Du musst morgen noch früher raus als ich.«