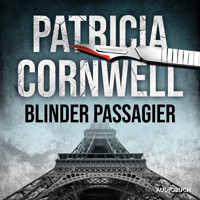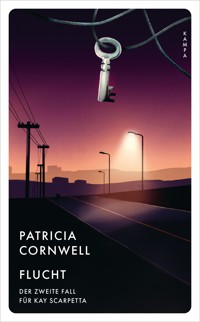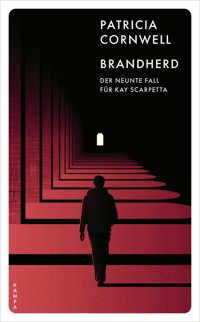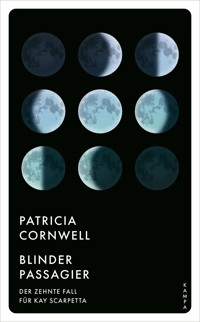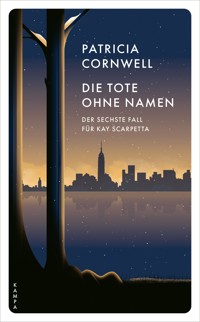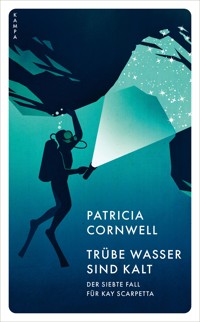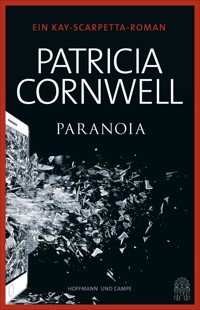
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Fall für Kay Scarpetta
- Sprache: Deutsch
Während sie einen Tatort untersucht, erhält Dr. Kay Scarpetta ein Video auf ihr Handy. Als sie es abspielt, kann sie kaum glauben, was sie sieht. Denn die Aufnahmen stellen alles infrage, was sie über ihre Nichte Lucy zu wissen meint … Der Clip bringt Scarpetta in einen grausamen Gewissenskonflikt: Die Bilder zeigen Lucy bei einer schweren Straftat, und Scarpetta weiß, dass sie sich weder ihrem Ehemann Benton Wesley noch ihrem Kollegen Pete Marino anvertrauen darf, um ihrer Nichte zu helfen. Aber was hat es mit dem Video auf sich? Und wer hat es ihr zugespielt? Auf sich allein gestellt, sieht sich Scarpetta schon bald mit einer Reihe von Morden konfrontiert, die eine Gefahr aus ihrer eigenen Vergangenheit heraufbeschwören …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Patricia Cornwell
Paranoia
Ein Kay-Scarpetta-Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Karin Dufner
Hoffmann und Campe
Für Staci
Juristische Definitionen von »entmenschlichtem Verhalten«
Das Fehlen von gesellschaftlichem Verantwortungsgefühl mit einem fatalen Hang zur Straffälligkeit.
Mayes gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, Oberster Gerichtshof Illinois (1883)
Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leben, frei von jeglicher Moral.
Vereinigte Staaten von Amerika gegen Feingold, Appellationsgericht New York (2006)
Rücksichtslosigkeit, in Verbindung mit Gleichgültigkeit, was die Begleitumstände anbelangt, ist ein objektives Indiz dafür, dass die Gefahr für Leib und Leben billigend in Kauf genommen wurde.
Vereinigte Staaten von Amerika gegen Sanchez, Appellationsgericht New York (2002)
Die Herrschaft eines bösartigen, verkommenen und gestörten Herzens; une disposition à faire une male chose; kann vom Gesetz ausdrücklich oder ansatzweise festgelegt werden.
William Blackstone, Commentaries on the Laws of England (1769)
Herr Gott, Herr Lucifer
Hab Acht
Hab Acht.
Aus der Asche
Erhebe ich mich mit meinem roten Haar
Und ich verschlinge Männer wie Luft.
Sylvia Plath, Lady Lazarus, 1965
1
Den alten Teddybären habe ich Lucy geschenkt, als sie zehn war. Sie hat ihn Mister Pickle genannt. Jetzt sitzt er auf dem Kopfkissen eines mit militärischer Präzision gemachten Bettes, dessen Krankenhauslaken an den Ecken ordentlich festgesteckt sind.
Der kleine Bär starrt mich stumpf an. Sein schwarzer Bindfadenmund zieht sich in einem umgekehrten V nach unten, und ich male mir aus, dass er froh, ja sogar dankbar wäre, wenn ich ihn retten würde. Ein unvernünftiger Gedanke, wenn man von einem Stofftier spricht. Insbesondere wenn man Anwältin, Wissenschaftlerin und Ärztin ist, von der eigentlich ein klinisch kühler und logischer Verstand erwartet wird.
Der unerwartete Anblick von Mister Pickle in dem Video, das gerade auf meinem Smartphone gelandet ist, löst verwirrte und überraschte Gefühle in mir aus. Offenbar hat man eine fest montierte Kamera von oben auf ihn gerichtet, vermutlich durch ein kleines Loch in der Decke. Ich kann seine weichen Fußsohlen aus Stoff ausmachen, das leicht gelockte olivgrüne Mohairfell, die schwarzen Pupillen seiner bernsteinfarbenen Glasaugen, den gelben Steiff-Knopf im Ohr. Ich weiß noch, dass er fünfunddreißig Zentimeter groß war, ein passender Begleiter für einen Kugelblitz wie Lucy, meine einzige Nichte und, genau genommen, mein einziges Kind.
Als ich den Stoffbären vor all den Jahrzehnten entdeckte, lag er umgekippt in einem zerkratzten hölzernen Bücherregal, das mit muffig riechenden, obskuren Bildbänden zum Thema Gartengestaltung und Südstaatenvillen gefüllt war, und zwar in einer schicken Gegend von Richmond, Virginia, die Carytown heißt. Er trug ein schmuddeliges weißes Strickkleidchen. Ich zog ihn aus, flickte einige Risse mit Nahtmaterial, das eines Schönheitschirurgen würdig gewesen wäre, setzte ihn in ein Spülbecken mit lauwarmem Wasser, schamponierte ihn mit antibakterieller, farbschonender Seife und trocknete ihn mit einem auf kalt gestellten Föhn. Ich beschloss, dass er ein männlicher Teddy war und ohne Kleidchen oder eine andere alberne Kostümierung besser aussah. Lucy neckte ich damit, sie sei nun stolze Besitzerin eines nackten Bären. Das passt, meinte sie.
Wenn du zu lange einfach nur rumsitzt, ohne dich zu bewegen, reißt dir meine Tante Kay die Kleider vom Leibe, spritzt dich mit dem Gartenschlauch ab und weidet dich mit einem Messer aus. Dann näht sie dich wieder zu und lässt dich nackt liegen, fügte sie vergnügt hinzu.
Unpassend. Scheußlich. Und überhaupt nicht komisch. Allerdings war Lucy damals erst zehn, und ihr kindlicher Redeschwall hallt plötzlich in meinem Kopf wider, als ich von dem verwesenden Blut zurückweiche, das auf dem weißen Marmorboden eine rotbraune Pfütze mit gelben wässrigen Rändern bildet. Die Gestankswolke scheint die Luft zu verdunkeln und zu verschmutzen, und die Fliegen erinnern an eine Armee winziger surrender Dämonen, geschickt vom Beelzebub persönlich. Der Tod ist gierig und hässlich. Er überwältigt unsere Sinne, löst sämtliche Alarmsignale in unseren Zellen aus und bedroht unser Leben an der Wurzel. Pass auf. Bleib weg da. Nimm die Beine in die Hand. Vielleicht bist du als Nächste dran.
Wir sind darauf geeicht, Leichen als widerlich und abstoßend zu empfinden. Allerdings ist in diesem einprogrammierten Überlebensinstinkt auch die seltene Ausnahme vorgesehen, dass wir unseren Stamm bei Gesundheit halten und beschützen müssen. Einige Auserwählte unter uns lassen sich vom Grauen nicht anfechten. Nein, es zieht uns sogar an, fasziniert uns und weckt unsere Neugier, und das ist gut so. Jemand muss die Hinterbliebenen warnen und auf sie achten. Jemand muss sich um das Schmerzliche und Unangenehme kümmern, um das Warum, Wer und Wie zu ermitteln und die verwesenden Überreste angemessen zu entsorgen, bevor sie weitere Menschen schockieren und Infektionskrankheiten verbreiten.
Meiner Ansicht nach unterscheiden sich jene, die sich dieser Dinge annehmen, erheblich. Ob es nun zum Vorteil oder zum Nachteil gereicht, wir sind nicht alle gleich. Nach ein paar großen Gläsern Scotch würde ich gestehen, dass ich eigentlich nicht ganz normal bin und es auch nie war. Ich fürchte den Tod nicht. Seine Begleiterscheinungen stoßen mich nicht ab. Gerüche, Flüssigkeiten, Maden, Fliegen, Geier, Ratten. Sie tragen etwas zur Wahrheitsfindung bei. Ich suche, und es ist wichtig, dass ich das Leben, das dem von mir untersuchten Tod vorausging, erkenne, sicherstelle und respektiere.
Kurz gesagt, nehme ich keinen Anstoß an dem, was die meisten Menschen als verstörend und ekelhaft empfinden. Allerdings hat das überhaupt nichts mit Lucy zu tun. Dazu liebe ich sie zu sehr. Schon immer. Ich fühle mich bereits verantwortlich und schuldig, als ich das schlichte, beige Wohnheimzimmer auf dem Video erkenne, das mich gerade überfallen hat. Ich bin die Autoritätsperson, die liebende Tante, die ihre Nichte in dieses Zimmer gesteckt hat. Ich habe Mister Pickle dorthin gesetzt.
Er sieht noch ziemlich genauso aus wie damals, als ich ihn zu Anfang meiner Laufbahn aus dem staubigen Laden in Richmond entführt und sauber gemacht habe. Mir wird klar, dass ich gar nicht mehr weiß, wann und wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, ob Lucy ihn verloren, verschenkt oder ihn in einen Wandschrank geräumt hat. Meine Aufmerksamkeit schweift ab, als ich einige Zimmer weiter ein lautes, krampfartiges Husten höre. In diesem wunderschönen Haus, wo eine wohlhabende junge Frau tot daliegt.
»Herrgott! Was ist denn das für ein Bazillenmutterschiff?« Das ist der Ermittlungsbeamte Pete Marino, der mit seinen Kollegen redet und scherzt, wie Polizisten es eben so tun.
Der State Trooper aus Massachusetts, dessen Namen ich nicht kenne, kämpft offenbar mit einer »Sommergrippe«. Allmählich frage ich mich, ob er in Wahrheit nicht Keuchhusten hat.
»Hör mal gut zu, du Hampelmann. Hast du vor, mir deinen Mist anzuhängen? Dass ich auch noch krank werde? Was hältst du davon, da drüben stehen zu bleiben?« Marinos Einfühlsamkeit, wie sie leibt und lebt.
»Ich bin nicht ansteckend.« Wieder ein Hustenanfall.
»Mein Gott, halt dir wenigstens die Hand vor den Mund!«
»Und wie soll ich das machen, wenn ich Handschuhe anhabe?«
»Dann zieh sie eben aus, verdammt.«
»Kommt nicht in die Tüte. Ich will doch meine DNA nicht hier hinterlassen.«
»Ach, wirklich? Und mit dieser Husterei versprühst du sie nicht durchs ganze Haus, sobald du wieder loslegst?«
Ich blende Marino und den Trooper aus und betrachte das Display meines Telefons. Das Video läuft weiter, doch das Wohnheimzimmer bleibt leer. Niemand ist da, nur Mister Pickle, der auf Lucys militärisch wirkendem, unbequemen, nicht sehr einladenden Bett sitzt. Es wirkt, als seien die weißen Laken und die hellbraune Decke mit einer Sprühdose auf die schmale, dünne Matratze und das einzige flache Kopfkissen aufgebracht worden. Ich hasse Betten, bei denen die Bettwäsche so straff gespannt ist wie das Fell einer Trommel. Ich meide sie, so gut ich kann.
Mein Bett zu Hause, mit seiner weichen orthopädischen Matratze, den fein gewebten Laken und den Daunendecken ist mein wichtigster Luxus. Hier komme ich endlich zur Ruhe. Hier habe ich Sex. Hier träume ich, oder besser auch nicht. Ich weigere mich zu schlafen wie in Frischhaltefolie eingewickelt, eingeschnürt und bewegungsunfähig wie eine Mumie, während mir allmählich die Füße absterben. Das heißt nicht, dass ich nicht an Kasernen, Sozialwohnungen, miese Motels oder andere Gemeinschaftsunterkünfte gewöhnt wäre. Unzählige Stunden habe ich an wenig gastfreundlichen Orten verbracht, allerdings nicht freiwillig. Bei Lucy ist es etwas anderes. Obwohl man ihr Leben inzwischen nicht mehr unbedingt als spartanisch bezeichnen kann, interessieren sie Annehmlichkeiten des Alltags einfach nicht so sehr wie mich.
Man könnte sie auch mitten im Wald oder in einer Wüste in einen Schlafsack stecken, was sie überhaupt nicht stören würde, solange sie Waffen und Hightech-Utensilien hat und sich gegen den Feind verbunkern kann, ganz gleich, wer das in diesem Moment auch sein mag. Sie kontrolliert ihre Umgebung gnadenlos. Und das ist ein wichtiger Einwand dagegen, dass sie geahnt hat, sie könnte in ihrem eigenen Wohnheimzimmer überwacht werden.
Sie wusste es nicht. Auf gar keinen Fall.
Ich schlussfolgere, dass das Video vor sechzehn, allerhöchstens neunzehn Jahren aufgenommen wurde, und zwar mit einer hochauflösenden Überwachungskamera, die ihrer Zeit voraus war. Megapixel-Input von mehreren Kameras. Eine flexible offene Plattform. Computergesteuert. Einfach zu bedienende Software. Gut zu tarnen. Mit Fernbedienung. Eindeutig das Ergebnis von Forschung und Entwicklung des neuen Jahrtausends, allerdings kein Anachronismus, keine Fälschung. Genau das, was ich erwartet habe.
Die technischen Geräte, mit denen meine Nichte sich umgibt, sind ihrer Zeit stets voraus. Mitte bis Ende der neunziger Jahre hat sie sicher vor allen anderen über die neuesten Entwicklungen in Sachen Überwachungstechnologie Bescheid gewusst. Doch das bedeutet nicht, dass Lucy während ihres Praktikums beim FBI selbst geheime Aufnahmetechnik in ihrem eigenen Zimmer installiert hat, während sie noch im College und schon genauso pedantisch auf ihre Privatsphäre bedacht war wie heute.
Die Wörter Überwachung und Spionage wollen mir deshalb nicht aus dem Kopf, weil ich sicher bin, dass die Bilder, die ich hier sehe, ohne ihr Wissen entstanden sind. Geschweige denn mit ihrer Zustimmung, und das ist wichtig. Zudem bin ich überzeugt, dass nicht Lucy mir das Video geschickt hat, obwohl es auf den ersten Blick den Anschein hat, als sei es von ihrem Notfalltelefon gesendet worden. Das ist nicht nur wichtig, sondern auch ein großes Problem. Fast niemand hat ihre Notfallnummer. Ich kann die Leute an einer Hand abzählen. Sorgfältig beobachtete ich die Aufnahme, die ich vor zehn Sekunden gestartet habe. Jetzt sind es elf. Vierzehn. Sechzehn. Ich betrachte aus unterschiedlichen Winkeln gefilmte Einstellungen.
Ohne Mister Pickle hätte ich Lucys früheres Wohnheimzimmer gar nicht erkannt. Mit seinen weißen Jalousien, die verkehrt herum geschlossen sind, sodass sie an Windelmaterial oder gegen den Strich gebürstetes Fell erinnern. Diese Angewohnheit von ihr hat mich schon immer genervt. Dennoch zieht sie die Lamellen andersherum zu. Irgendwann habe ich meinen Einwand aufgegeben, das sei, als trüge man seine Unterwäsche mit der Innenseite nach außen. Ihr Argument lautet, es sei unmöglich hineinzuschauen, wenn sich die Lamellen nach oben, nicht nach unten biegen. Und ein Mensch, der so denkt, achtet sorgfältig darauf, dass ihn niemand beobachtet, stalkt oder ausspioniert. Das würde Lucy keinem durchgehen lassen.
Außer sie wusste es nicht und hat dieser Person vertraut.
Die Sekunden ticken weiter. Im Zimmer verändert sich nichts. Leer. Still. Die Wände aus Betonbausteinen und der Fliesenboden sind weiß. Die Möbel billiges Ahornfurnier, alles schlicht und praktisch. Es berührt einen weit entfernten Teil meines Verstandes, den ich versiegle wie sterbliche Überreste unter einer gegossenen Betonschicht. Das, was ich auf meinem Display sehe, könnte auch ein Privatzimmer in der Psychiatrie sein. Oder die Gastunterkunft für Offiziere auf einem Militärstützpunkt. Oder ein nicht sehr phantasievoll ausgestatteter Zweitwohnsitz. Nur dass ich genau weiß, was ich da sehe. Diesen mürrischen Teddy würde ich überall wiedererkennen.
Mister Pickle begleitete Lucy überallhin. Und als ich sein wehmütiges Gesicht betrachte, erinnere ich mich daran, was in jenen längst vergangenen Tagen in den Neunzigern mit mir los war. Ich war Chief Medical Examiner in Virginia, die erste Frau, die diesen Posten bekleidete. Außerdem war ich Lucys Vormund geworden, nachdem meine egoistische Schwester Dorothy beschlossen hatte, ihre Tochter bei mir abzuladen. Der anfänglich als Spontanbesuch geplante Aufenthalt entpuppte sich als Dauerlösung. Das Timing, als alles anfing, hätte nicht schlechter gewählt sein können.
In meinem ersten Sommer dort stand Richmond unter Belagerung, weil ein Serienmörder Frauen zu Hause in ihren eigenen Betten erdrosselte. Die Morde wurden immer häufiger und zunehmend sadistisch. Wir erwischten ihn einfach nicht. Wir hatten nicht den geringsten Hinweis. Ich war neu. Presse und Politik überrollten mich wie eine Lawine. Ich passte nicht dorthin. Ich war kühl und abweisend. Ein Sonderling. Welche Frau seziert schon Leichen? Ich war unfreundlich, und mir fehlte der Südstaatencharme. Außerdem stammten meine Vorfahren weder aus Jamestown noch von der Mayflower. Eine abtrünnige Katholikin. Eine Linksliberale aus dem multikulturellen Miami. Und dennoch hatte ich es geschafft, meine Karriere in der ehemaligen Hauptstadt der Konföderierten zu starten, die damals die höchste Mordrate in den gesamten Vereinigten Staaten aufwies.
Warum Richmond in Sachen Mord die Goldmedaille gewonnen hatte, wurde mir nie ausreichend erklärt. Ebenso wenig, was sich die Polizisten davon versprachen, wenn sie damit prahlten. Hinzu kam, dass sich mir nie der Sinn erschloss, warum man Schlachten aus dem Bürgerkrieg nachstellte. Wieso seine größte Niederlage auch noch feiern? Rasch lernte ich, mir solche aufwieglerischen Bemerkungen zu verkneifen. Und wenn man mich fragte, ob ich ein Yankee sei, erwiderte ich, ich interessierte mich nicht für Baseball, was das Gegenüber meist zum Verstummen brachte.
Das Hochgefühl, einer der ersten weiblichen Chief Medical Examiner in den USA zu sein, legte sich rasch. Thomas Jeffersons Virginia machte eher den Eindruck eines Kriegsgebiets für Ewiggestrige als den einer Bastion der Zivilisation und Aufklärung. Es dauerte nicht lange, bis die Wahrheit schonungslos ans Licht kam. Der frühere Chief Medical Examiner, ein bigotter, frauenfeindlicher Alkoholiker, war plötzlich verstorben und hatte ein katastrophales Erbe hinterlassen. Kein erfahrener, approbierter Forensiker mit gutem Ruf hätte seinen Posten übernommen. Und so war den Verantwortlichen ein Geistesblitz gekommen: Warum nicht eine Frau?
Frauen sind doch Spezialistinnen fürs Saubermachen. Weshalb also kein weiblicher Chief Medical Examiner? Es spielt doch keine Rolle, dass sie noch jung ist und dass ihr die Erfahrung fehlt, die nötig ist, um die Behörde eines Bundesstaates zu leiten. Solange sie vor Gericht als qualifizierte Gutachterin anerkannt wird und sich ordentlich benimmt, wird sie in den Posten schon hineinwachsen. Wie wäre es also mit einer überqualifizierten, pedantischen, arbeitssüchtigen und perfektionistischen Italienerin, die in bitterster Armut aufgewachsen ist, allen etwas beweisen muss, motiviert und zudem kinderlos und geschieden ist?
Tja, kinderlos, bis das Unerwartete geschah. Der einzige Nachwuchs meiner einzigen Schwester, Lucy Farinelli, war das Baby, das auf meiner Türschwelle zurückgelassen wurde. Nur dass dieses Baby zehn Jahre alt war, sich besser mit Computern und sämtlicher Technik auskannte, als es mir jemals gelingen würde, und in Sachen anständiges Betragen ein völlig unbeschriebenes Blatt war. Lucy als schwierig zu bezeichnen war eine ähnliche Untertreibung, als hätte man gesagt, dass ein Blitzschlag gefährlich ist. Daran wird sich wohl nie etwas ändern.
Meine Nichte war schon immer eine Herausforderung. Unheilbar starrsinnig. Als Kind unerträglich und ungezogen. Sie war eine geniale Wilde, zornig, wunderschön, leidenschaftlich, furchtlos, ohne Gnade, ließ keine Nähe zu und war übermäßig empfindlich und unersättlich. Ich versuchte alles, aber nichts war genug. Doch ich ließ nicht locker. Wie eine Dampfwalze und entgegen jeglicher Wahrscheinlichkeit. Ich hatte immer befürchtet, ich würde eine lausige Mutter abgeben. Ich habe keinen Grund, eine gute zu sein.
Ich hatte gedacht, ein Teddybär würde dafür sorgen, dass sich ein vernachlässigtes kleines Mädchen besser, ja, vielleicht sogar geliebt fühlte. Und als ich nun Mister Pickle auf dem Bett in Lucys früherem Wohnheimzimmer sehe, und das noch in einem Überwachungsvideo, von dessen Existenz ich vor einer Minute noch gar nichts ahnte, weicht der leichte Schock einer Art abgestumpfter Ruhe. So als ob die Linie auf einem Herzmonitor plötzlich horizontal verläuft. Ich konzentriere mich. Ich denke klar, objektiv und wissenschaftlich. Das muss sein. Das Video auf meinem Telefon ist echt. Es ist wichtig, sich damit abzufinden. Die Aufnahmen wurden weder mit Photoshop manipuliert noch sonst irgendwie gefälscht. Ich weiß verdammt gut, was ich da sehe.
DieFBIAcademy. Wohnheim Washington. Zimmer 411.
Ich versuche, mir genau ins Gedächtnis zu rufen, wann Lucy, zuerst als Praktikantin, dann als frischgebackener Agent, dort war. Bevor sie rausgegrault wurde. Im Grunde genommen vom FBI gefeuert. Später auch vom ATF, dem Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Und dann zur Agentin für Spezialeinsätze wurde, die zu Missionen verschwand, von denen ich lieber nichts wissen möchte. Bevor sie in New York ihre eigene forensische Computerfirma gründete. Und auch dort scheiterte.
Inzwischen ist damals zu jetzt geworden, einem Freitagmorgen Mitte August. Lucy ist eine fünfunddreißigjährige, ausgesprochen wohlhabende Technologieunternehmerin, die ihre Talente großzügig mit mir teilt. Mit meinem Institut, dem Cambridge Forensic Center (CFC). Während ich mir das Video anschaue, bin ich zwiegespalten. Zwischen damals und heute, hier, in der Gegenwart. Es besteht ein Zusammenhang, ein Kontinuum.
Alles, was ich getan habe und was ich gewesen bin, hat sich langsam und unaufhaltsam vorangeschoben wie eine Erdlawine. Bis ich in diesem mit verwesendem Blut bespritzten Marmorfoyer gelandet bin. Die Vorgänge von früher haben mich schließlich hierhergebracht, hinkend wegen eines stark schmerzenden verletzten Beins und eine zerfallende Leiche neben mir auf dem Boden. Meine Vergangenheit. Doch, noch wichtiger, Lucys Vergangenheit. Dunkelheit, Skandale, Verrat, Vermögen, gewonnen und wieder verloren.
Unser gemeinsames Leben begann mit Hoffnungen, Träumen und Versprechungen und wurde schrittweise schlimmer und besser und schließlich sogar ziemlich gut, bis ich im letzten Juni beinahe gestorben wäre. Ich hatte gedacht, diese grausige Geschichte wäre für immer abgeschlossen und müsste niemanden mehr beschäftigen. Ein folgenschwerer Irrtum. Es ist, als wäre ich vor einem rasenden Zug geflohen, nur um von ihm überrollt zu werden, weil er mir hinter der nächsten Kurve wieder entgegenkam.
2
»Hat jemand Doc Scarpetta gefragt?« Die Stimme gehört Cambridge Police Officer Hyde. »Ich meine, Marihuana könnte so was auslösen. Man zieht sich eine Tonne Gras rein, ist stoned und hat dann eine Schwachsinnsidee wie warum wechsle ich nicht nackt eine Glühbirne? Das klingt doch nach einem Spitzeneinfall, oder? Wirklich ein Geniestreich. Und dann kippt man mitten in der Nacht, wenn sonst niemand da ist, von der Leiter und schlägt sich den Schädel ein.«
Officer Hyde heißt mit Vornamen Park. Wie kann man einem Kind so etwas Schreckliches antun? So zieht man beleidigende Spitznamen doch förmlich an und rächt sich später dafür. Um das Maß vollzumachen, ist Officer Park Hyde klein, pummelig und sommersprossig und hat strubbeliges, karottenrotes Haar wie eine schlechte Parodie einer Stoffpuppe. Im Moment habe ich ihn nicht im Blickfeld. Allerdings habe ich ein ausgezeichnetes Gehör, fast bionisch wie mein Geruchssinn (was eine Ironie des Schicksals ist).
Ich stelle mir Gerüche und Geräusche als Farben in einer Skala oder als Instrumente in einem Orchester vor und kann sie gut voneinander unterscheiden. Rasierwasser zum Beispiel. Manche Polizisten überschütten sich buchstäblich damit, und Hydes männlicher Moschusduft ist so aufdringlich wie seine Stimme. Ich höre, wie er im Nebenzimmer über mich redet, fragt, was ich gerade mache, und spekuliert, ob mir klar ist, dass die Tote Drogen genommen hat, wahrscheinlich ein Psychofall, eine Durchgeknallte, eine Spinnerin mit Bonusmeilen. Die Polizisten schlendern hin und her und lästern, als sei ich nicht anwesend. Hyde führt mit seinen plumpen Witzen und Seitenhieben das Kommando. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, insbesondere dann nicht, wenn es um mich geht.
Was hat Dr. Tod denn bereits entdeckt? Wie geht es dem Bein von unserem Oberzombie, nachdem, ihr wisst schon …? Mist. Das war vermutlich kein guter Spruch nach dem, was vor zwei Monaten in Florida passiert ist. Ich meine, wissen wir genau, was da auf dem Meeresgrund los war? Können wir sicher sein, dass es kein Hai war, der sie erwischt hat? Vielleicht hat sie sich ja aus Versehen selbst aufgespießt. Jetzt ist sie wieder okay, oder? Das muss doch ein Scheißschock für sie gewesen sein. Sie kann mich doch nicht etwa hören, oder?
Seine Äußerungen, vorgetragen in einem Bühnenflüstern, umschwirren mich wie glitzernde, scharfkantige Glasscherben. Hyde ist der Großmeister in Sachen dämlicher Spitznamen und erfindet die schauderhaftesten Wortspiele. Ich erinnere mich noch an seine Bemerkung, als wir uns erst vor einem Monat im Paddy’s, einer Kneipe in Cambridge, trafen, um auf Pete Marinos Geburtstag anzustoßen. Hyde bestand darauf, mich auf einen ordentlichen Drink einzuladen, der Tote aufwecken kann. Eine Bloody Mary vielleicht, einen Sudden Death oder einen Spontaneous Combustion?
Bis heute bin ich nicht sicher, woraus letztgenannter Drink besteht, doch Hyde behauptet, er enthielte Maiswhisky und werde flambiert serviert. Wahrscheinlich ist er nicht tödlich, obwohl man sich das wünschen würde, weil er es mindestens fünfmal wiederholt hat. Hin und wieder betätigt er sich als Feierabend-Comedian und tritt in Clubs in der Stadt auf. Er hält sich für ziemlich komisch. Ist er aber nicht.
»Ist Doktor Death noch hier?«
»Ich bin in der Vorhalle.« Ich werfe meine violetten Untersuchungshandschuhe aus Nitril in einen roten Müllsack für kontaminierte Abfälle. Die Tyvek-Überschuhe über meinen Stiefeln verursachen ein glitschiges Geräusch, als ich mich über den blutigen Marmorboden taste und dabei weiter auf das Display meines Telefons starre.
»Sorry, Doktor Scarpetta. Ich wusste nicht, dass Sie mich hören können.«
»Konnte ich.«
»Oh. Dann haben Sie bestimmt alles mitgekriegt, was ich gesagt habe.«
»Habe ich.«
»Tut mir leid. Wie geht es Ihrem Bein?«
»Es ist noch dran.«
»Kann ich Ihnen etwas mitbringen?«
»Nein danke.«
»Wir gehen uns bei Dunkin’ Donuts was holen«, ruft Hyde aus dem Nebenzimmer herüber. Ich nehme ihn und die anderen Polizisten, die herumwimmeln und Schränke und Schubladen öffnen, nur am Rande wahr.
Inzwischen ist Marino nicht mehr dabei. Ich höre ihn weder, noch weiß ich, wo im Haus er sich aufhält. Das ist typisch für ihn. Er zieht stets seinen eigenen Stiefel durch und ist ehrgeizig. Falls es in diesem Haus etwas zu finden gibt, wird er darauf stoßen, und ich sollte mich eigentlich auch umschauen. Aber nicht jetzt. Im Moment hat Vier-Elf, unser Name für Lucys Wohnheimzimmer in Quantico, Virginia, meine oberste Priorität.
Bis jetzt fehlen im Film Menschen, eine Geschichte oder Bildunterschriften. Er spult sich Sekunde um Sekunde ab und hat nichts zu bieten außer einer unbewegten Aufnahme von Lucys spartanischer früherer Unterkunft. Ich achte auf leise Hintergrundgeräusche, stelle den Ton lauter und lausche in meinen drahtlosen Ohrhörer.
Ein Helikopter. Ein Auto. Schüsse von einem entfernten Schießstand.
Schritte. Ich spitze die Ohren. Meine Aufmerksamkeit wendet sich wieder der Wirklichkeit zu, dem Hier und Jetzt in einer denkmalgeschützten Villa an der Grenze zum Campus von Harvard.
Ich erkenne das harte Auftreten von Gummisohlen: uniformierte Polizisten, die sich der Vorhalle nähern. Sie tragen keine Plastiküberschuhe über ihren Schuhen und Stiefeln. Also sind es weder Ermittler noch Spurensicherungsexperten. Auch nicht Officer Hyde, keiner von ihnen. Weitere überflüssige Mitarbeiter, von denen seit meiner Ankunft mehr als genug hier ein und aus gegangen sind. Ich bin seit etwa einer Stunde hier, kurz nachdem die siebenunddreißigjährige Chanel Gilbert tot in der mit Mahagoni getäfelten Eingangshalle hinter der massiven antiken Tür ihres denkmalgeschützten Hauses aufgefunden wurde.
Es muss eine schreckliche Situation gewesen sein. Ich male mir aus, wie die Haushälterin wie jeden Morgen zur Hintertür hereinkam. Das hat sie der Polizei erzählt. Sicher ist ihr sofort aufgefallen, dass es außergewöhnlich heiß war. Sie hat den Gestank bemerkt und ist ihm in die Vorhalle gefolgt, wo die Frau, bei der sie beschäftigt war, verwesend auf dem Boden lag, das Gesicht verfärbt und verzerrt, als machten wir sie wütend.
Hydes Bemerkung war beinahe zutreffend. Angeblich ist Chanel Gilbert von einer Leiter gefallen, während sie die Glühbirnen des Kronleuchters in der Vorhalle gewechselt hat. Das klingt wie ein schlechter Scherz, doch der Anblick ist alles andere als komisch. Ihr einst so schlanker Körper, im frühen Stadium der Verwesung, aufgedunsen und mit sich ablösenden Hautpartien. Sie hat ihre Kopfverletzungen lange genug überlebt, um Blutergüsse und Schwellungen zu entwickeln. Ihre Augen sind zusammengekniffen und quellen hervor wie bei einem Ochsenfrosch. Ihr braunes Haar hat sich in eine verklebte blutige Masse verwandelt, die mich an verrostete Stahlwolle erinnert. Meiner Schätzung nach hat sie, nachdem sie sich die Kopfverletzungen zugezogen hatte, bewusstlos und blutend auf dem Boden gelegen, während ihr Gehirn anschwoll und den oberen Teil des Rückenmarks zusammendrückte, bis schließlich Herz und Lunge den Dienst versagten.
Der Polizei kommt ihr Tod nicht verdächtig vor, nicht wirklich, ganz gleich, was sie auch erörtern und behaupten. In Wahrheit sind sie nur Voyeure. Auf die ihnen eigene unangemessene Art genießen sie dieses Drama, das zu ihrer Lieblingssorte gehört. Das Opfer ist schuld. Sie muss etwas falsch gemacht haben. Sie hat ihren vorzeitigen Tod selbst herbeigeführt, einen Tod, der einfach nur eine Dummheit war. Auch dieses Wort habe ich mehrere Male aufgeschnappt. Und ich kann es einfach nicht ausstehen, wenn Menschen sich weigern, über andere Möglichkeiten auch nur nachzudenken. Ich bin nicht überzeugt, dass es sich hier um einen Unfall handelt. Dazu gibt es zu viele Widersprüche und Ungereimtheiten. Wenn Chanel, wie die Polizisten vermuten, irgendwann spät letzte Nacht oder am heutigen Morgen gestorben ist, warum ist die Verwesung dann so weit fortgeschritten? Während ich versuche, den Todeszeitpunkt zu bestimmen, will mir ein Spruch von Marino nicht aus dem Kopf:
Geballte Scheiße. Und genau das ist es. Außerdem spüre ich noch etwas anderes, nämlich eine Gegenwart im Haus, und zwar nicht nur die der Polizisten. Oder der toten Frau. Oder der Haushälterin, die heute Morgen um Viertel vor acht erschienen ist und eine schreckliche Entdeckung machte. Eine, die ihr, milde ausgedrückt, den Tag verdorben hat. Ich erahne etwas, das mich beunruhigt, und da ich keine wissenschaftliche Erklärung dafür habe, beschließe ich, den Mund zu halten.
Normalerweise erzähle ich niemandem von meinen sogenannten Bauchgefühlen und intuitiven Anwandlungen. Nicht der Polizei, ja, nicht einmal Marino. Von mir erwartet man keine Eindrücke, die nicht beweisbar sind. Ich darf keine Gefühle zeigen, und gleichzeitig wirft man mir vor, dass ich keine habe. In anderen Worten: Die Katze beißt sich in den Schwanz, sprich: Ich kann nicht gewinnen. Aber das ist mir nicht neu. Ich bin daran gewöhnt.
»Ma’am?« Eine fremde Männerstimme. Doch ich blicke nicht auf, wie ich so in der Vorhalle stehe, von Kopf bis Fuß in weißes Tyvek gehüllt, das Telefon in der unbehandschuhten Hand, die tote Frau, nur wenige Meter entfernt von mir neben der umgekippten Leiter.
Beruf unbekannt. Lebte zurückgezogen. Attraktiv auf eine kantige, abweisende Art. Blaue Augen, laut dem Foto im Führerschein, den man mir gezeigt hat. Tochter einer supererfolgreichen Hollywood-Produzentin namens Amanda Gilbert, Besitzerin dieses teuren Anwesens und gerade unterwegs von Los Angeles nach Boston. So weit erstreckt sich mein Wissen, und es erklärt vieles. Zwei Polizisten aus Cambridge und ein Massachusetts State Police Trooper marschieren durchs Esszimmer und unterhalten sich laut über die Filme, die Amanda Gilbert gemacht oder nicht gemacht hat.
»Den habe ich nicht gesehen. Dafür aber den anderen mit Ethan Hawke.«
»Den, bei dem die Dreharbeiten zwölf Jahre gedauert haben und man einem Kind beim Erwachsenwerden zuschauen kann …?«
»Der war ziemlich cool.«
»Ich kann es kaum erwarten, dass American Sniper endlich rauskommt.«
»Was Chris Kyle passiert ist? Das ist doch unfassbar, richtig? Da kommt man als Kriegsheld mit hundertachtzig Abschüssen nach Hause und wird von so einem Loser auf einem Schießstand umgenietet. Das ist doch, als würde Spiderman an einem Spinnenbiss sterben.« Die letzte Bemerkung kommt von Hyde, der mit den anderen beiden Polizisten am Fuß der Treppe dicht vor der Eingangshalle verharrt, um sich mir nicht nähern zu müssen. Oder dem Gestank, der sie zurückhält wie eine Wand aus heißer, übel riechender Luft. »Doktor Scarpetta, wie ich schon sagte, gehen wir Kaffee holen. Möchten Sie etwas?« Hyde hat weit auseinander stehende gelbliche Augen, die mich an eine Katze erinnern.
»Bei mir ist alles bestens.« Was nicht stimmt.
Trotz meiner gefassten Art ist es alles andere als bestens, als ich weitere Schüsse höre und das Bild des Schießstands vor meinem geistigen Auge habe. Ich höre das dumpfe Einschlagen von Projektilen in ausklappbare Zielscheiben aus Metall. Das helle Pling, wenn ausgeworfene Geschosshülsen von Schusskammern und Bänken aus Beton abprallen. Ich spüre die südliche Sonne schwer auf meinem Kopf und wie der Schweiß unter meinem Kampfanzug trocknet, in einer Zeit, in der alles so schön und so schrecklich war wie noch nie in meinem Leben.
»Wie wäre es mit einer Flasche Wasser, Ma’am? Oder vielleicht einer Cola?« Das ist der Trooper, der die Worte zwischen Hustenanfällen hervorstößt. Ich kenne ihn nicht, aber wir werden uns nicht vertragen, falls er weiter darauf besteht, mich mit Ma’am anzusprechen.
Ich habe in Cornell, an der Georgetown Law School und an der medizinischen Fakultät der Johns Hopkins studiert. Ich bin Colonel der Reserve bei der Air Force. Ich habe vor Unterausschüssen des Senats ausgesagt und war ins Weiße Haus eingeladen. Ich bin unter anderem Chief Medical Examiner von Massachusetts und Leiterin der kriminaltechnischen Labors. Ich habe es nicht so weit im Leben gebracht, um mich weiter Ma’am nennen zu lassen.
»Für mich nichts, danke«, erwidere ich höflich.
»Wir sollten uns ein paar Vierliterbehälter Kaffee besorgen. Dann haben wir genug, und er bleibt heiß.«
»Ein toller Tag für heißen Kaffee. Was haltet ihr von eisgekühltem?«
»Gute Idee. Hier drinnen ist es noch immer wie in einer Sauna. Ich wage kaum, mir vorzustellen, wie es vorher war.«
»Wie in einem Ofen, das sage ich dir.« Noch ein scheußlicher Hustenkrampf.
»Tja, ich glaube, ich habe ein paar Liter ausgeschwitzt.«
»Wir müssten hier ziemlich bald fertig sein. Ein einfacher Unfall, richtig, Doc? Die toxikologischen Ergebnisse werden sicher spannend. Warten Sie’s nur ab. Sie war stoned, und wenn sie high sind, glauben die Leute zu wissen, was sie tun. Stimmt aber nicht.«
»High« und »stoned« sind zwei verschiedene psychoaktive Zustände. Und ich glaube auch nicht, dass Gras der Grund für diesen Vorfall ist. Allerdings äußere ich nicht, was mir durch den Kopf geht, während der Trooper und Hyde sich die coolen Sprüche zuspielen wie beim Pingpong. Hin und her. Hin und her. Die absolute Monotonie. Eigentlich will ich nur in Ruhe gelassen werden. Mein Telefon im Auge behalten und herauskriegen, was zum Teufel da passiert, wer dahintersteckt und warum. Hin und her. Die Bullen halten einfach nicht den Mund.
»Seit wann sind Sie so ein Experte, Hyde?«
»Ich spreche nur Tatsachen aus.«
»Passen Sie auf. Amanda Gilbert ist auf dem Weg hierher. Also wären wir gut beraten, auch die Fragen zu beantworten, die nicht gestellt werden. Sicher kennt sie alle möglichen einflussreichen Leute in hohen Positionen, die uns eine Menge Ärger machen können. Außerdem werden sich die Medien auf die Sache stürzen, wenn sie nicht sogar schon dran sind.«
»Ob sie wohl eine Lebensversicherung hatte? Hat Mama für ihr arbeitsloses Kiffertöchterchen einen Vertrag abgeschlossen?«
»Glaubst du echt, sie braucht die Kohle? Hast du eine Vorstellung davon, wie viel Amanda Gilbert wert ist? Laut Google etwa zweihundert Millionen.«
»Mir gefällt nicht, dass die Klimaanlage abgeschaltet war. Das ist nicht normal.«
»Ja, und genau das beweist meine Theorie. Genau das machen Leute, die auf Stoff sind, eben so. Die schütten Orangensaft über ihre Frühstücksflocken und gehen in Schneeschuhen auf den Tennisplatz.«
»Was haben Schneeschuhe damit zu tun?«
»Ich wollte nur sagen, dass es anders ist, als wenn man zu tief ins Glas geschaut hat.«
3
Sie reden miteinander, als wäre ich nicht vorhanden, während ich weiter das Video auf meinem Smartphone verfolge. Ich warte darauf, dass etwas passiert.
Ich betrachte es nun schon seit vier Minuten und kann es weder anhalten noch abspeichern. Jede Taste, die ich berühre, jedes Icon, jedes Menü ist nicht funktionsfähig. Unterdessen läuft der Film weiter ab, ohne dass etwas passiert. Bis jetzt konnte ich entlang der Lamellen der geschlossenenen Jalousie nur leichte Veränderungen der Lichtverhältnisse beobachten.
Es war ein sonniger Tag, doch es muss auch Wolken gegeben haben, sonst wäre das Licht konstant. Der Eindruck ist, als liefe ein Dimmer in diesem Raum, einmal hell, dann wieder ein wenig dunkler. Wolken, die über die Sonne hinwegziehen, schlussfolgere ich, während Hyde und der Trooper weiter an der Treppe aus Mahagoni herumlungern, laut ihre Meinungen zum Besten geben, Bemerkungen machen und tratschen, als hielten sie mich für geistig minderbemittelt oder für so tot wie die Frau auf dem Fußboden.
»Wenn sie fragt, sollten wir es ihr nicht erzählen.« Hyde ist immer noch bei Amanda Gilberts kurz bevorstehender Ankunft in Boston. »Dass die Klimaanlage aus war, ist eine Einzelheit, die wir ihr verschweigen sollten. Und natürlich auch den Medien.«
»Das ist das einzig Schräge daran. Weißt du, ich habe da ein mulmiges Gefühl.«
Das ist ganz sicher nicht das einzig Schräge daran, denke ich, spreche es aber nicht aus.
»Klar, und dann bricht sofort ein Shitstorm aus Gerüchten und Verschwörungstheorien los, und alles landet im Internet.«
»Nur dass Täter manchmal die Klimaanlage ausschalten oder die Heizung aufdrehen oder sonst was machen, damit es heiß in der Bude wird, um die Verwesung zu beschleunigen. So verschleiern sie den genauen Todeszeitpunkt, verschaffen sich ein Alibi und vernichten die Beweise, stimmt das nicht, Doc?« Der State Trooper mit dem Massachusetts-Akzent wendet sich direkt an mich. Seine »r« klingen wie »w«, wenn er nicht gerade hustet.
»Hitze beschleunigt die Verwesung«, antworte ich, ohne aufzublicken. »Kälte verzögert sie«, füge ich hinzu, als mir klar wird, was es bedeutet, dass die Wände des Wohnheimzimmers eierschalenfarben sind.
Als Lucy in den Washington Dorm einzog, waren die Wände ihres Zimmers beige. Später wurden sie neu gestrichen. Ich berechne die Zeit. Das Video wurde 1996 aufgenommen. Vielleicht 1997.
»Bei Dunkin’s gibt es ziemlich gute Frühstückssandwiches. Möchten Sie vielleicht etwas essen, Ma’am?« Der Trooper in seiner blaugrauen Uniform spricht mich wieder an. Er ist über sechzig, hat einen Bauch und wirkt nicht gesund. Sein Gesicht ist eingefallen, und er hat dunkle Augenringe.
Ich habe keine Ahnung, was er am Tatort zu suchen hat und welche sinnvolle Aufgabe er hier erfüllen könnte. Außerdem scheint er ziemlich krank zu sein. Allerdings war es nicht meine Entscheidung, wer hierher eingeladen wird. Ich betrachte Chanel Gilberts verwüstetes totes Gesicht und ihren blutigen nackten Körper, bedeckt mit grünlichen Verfärbungen. Der Unterleib ist von den Bakterien und Gasen aufgequollen, die wegen der Verwesung in ihren Gedärmen gedeihen.
Die Haushälterin hat der Polizei berichtet, sie habe die Leiche nicht berührt und sei nicht einmal in ihre Nähe gekommen. Ich bezweifle nicht, dass Chanel Gilbert noch genauso daliegt, wie sie gefunden wurde, der Morgenmantel aus schwarzer Seide offen stehend, Brüste und Genitalien entblößt. Schon lange habe ich mir abgewöhnt, die Nacktheit eines Toten spontan zu bedecken, solange es sich nicht um einen öffentlichen Ort handelt. Ich werde nichts an der Position der Leiche verändern, bis ich sicher bin, dass alle Fotos gemacht wurden und es Zeit ist, sie in einen Leichensack zu legen und ins CFC zu transportieren. Bald wird es so weit sein. Sogar sehr bald.
Es tut mir leid, würde ich so gerne zu ihr sagen, während ich die Blutlachen betrachte, zähflüssig, dunkelrot und an den Rändern schwarz antrocknend. Aber es ist etwas Wichtiges passiert. Ich muss weg, doch ich komme wieder. Das würde ich ihr erklären, wenn ich es könnte. Am Rande nehme ich wahr, wie laut die Fliegen in der Vorhalle geworden sind. Da beim Kommen und Gehen der Polizisten ständig Türen geöffnet wurden, haben sie das Haus gestürmt. Sie schimmern wie Benzintropfen, stürzen zu Boden und kriechen umher, auf der Suche nach Wunden und anderen Körperöffnungen, um ihre Eier abzulegen.
Ruckartig wandert mein Blick wieder zum Display meines Telefons. Das Bild hat sich nicht verändert. Lucys leeres Zimmer, während die Sekunden vergehen. Zweihundertneunundachtzig. Dreihundertzehn. Inzwischen sind es fast sechs Minuten. Da muss doch etwas passieren. Wer hat mir das geschickt? Nicht meine Nichte. Dafür gäbe es nicht den geringsten Grund. Außerdem, warum sollte sie es jetzt tun? Nach so vielen Jahren? Ich habe das Gefühl, die Antwort zu kennen, und will nicht, dass es stimmt.
Lieber Gott, mach, dass ich mich irre. Aber ich habe recht. Eins und eins nicht zusammenzuzählen, wäre der Gipfel der Realitätsverweigerung.
»Die haben auch vegetarische Sandwiches, falls Sie das lieber mögen«, sagt einer der Polizisten zu mir.
»Nein, danke.« Während ich weiter den Film verfolge, spüre ich etwas anderes.
Hyde richtet sein Telefon auf mich. Er macht ein Foto.
»Das werden Sie nicht weiterverwerten«, sage ich, ohne aufzublicken.
»Ich dachte, dass twittere ich, nachdem ich es bei Facebook und Instagram gepostet habe. Nur ein Scherz. Schauen Sie sich auf Ihrem Telefon einen Film an?«
Ich hebe lange genug den Kopf, um festzustellen, dass er mich anstarrt. Er hat das gewisse Funkeln in den Augen, dasselbe hinterhältige Glitzern, kurz bevor er wieder einen seiner blödsinnigen Sprüche ablässt.
»Ich kann es Ihnen nicht verübeln, dass Sie Unterhaltung brauchen«, sagt er. »Es ist ein bisschen tot hier drin.«
»Ich komme damit nicht klar, dazu bin ich zu altmodisch«, verkündet der Trooper. »Einen Film kann ich mir nur auf einem ordentlichen Bildschirm ansehen.«
»Meine Frau liest sogar Bücher auf ihrem Telefon.«
»Ich auch. Aber nur beim Autofahren.«
»Haha. Du bist ein echter Komiker, Hyde.«
»Glauben Sie, es bringt was, weiter hier rumzuhängen? Hey, Doc?«
Ich stelle fest, dass ein weiterer Polizist aus Cambridge hinzugekommen ist. Er fängt an, Vorträge darüber zu halten, wie man am besten die Blutreste sichert. Seinen Namen kenne ich nicht. Schütteres graues Haar, kurzer gestutzter Schnauzer, gebaut wie ein Hydrant. Er ist kein Ermittler, aber ich habe ihn schon auf den Straßen unweit von Cambridges Eliteunis beobachtet, wo er Leute kontrolliert und Strafzettel ausstellt. Noch ein überflüssiger Mensch, der eigentlich nicht hier sein sollte. Die Leiche und die mit ihr zusammenhängenden biologischen Proben fallen unter meine Zuständigkeit. Sonst nichts. Offiziell gesprochen.
Ja, offiziell. Denn zumeist entscheide ich selbst, wofür ich zuständig und verantwortlich bin. Man widerspricht mir nur selten. Im Großen und Ganzen verläuft meine Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden sehr kooperativ. Sie freuen sich eigentlich, dass ich mich um alles kümmere, was mich interessiert, und stellen mich fast nie infrage. Zumindest haben sie früher nur selten an meinen Entscheidungen gezweifelt. Inzwischen mag sich das geändert haben. Vielleicht ist das ja ein Vorgeschmack darauf, was in zwei kurzen Monaten alles anders geworden ist.
»In dem Lehrgang über die Verteilung von Blutstropfen, den ich besucht habe, hieß es, man solle alles mit Fäden miteinander verbinden, weil man vor Gericht danach gefragt werden wird«, verkündet der Polizist mit dem schütteren grauen Haar. »Wenn man aussagt, dass man sich diese Mühe gespart hat, steht man vor den Geschworenen schlecht da. Das sind die sogenannten Nein-Fragen. Der Verteidiger ackert alle möglichen Fragen durch, auf die Sie sicher mit nein antworten werden, und dann sieht es so aus, als hätten Sie Ihre Arbeit nicht gemacht. Als seien Sie inkompetent.«
»Insbesondere dann, wenn sich die Geschworenen CSI anschauen.«
»Ach, echt?«
»Was stört Sie denn so an CSI? Haben Sie keinen Zauberkasten in Ihrem Tatortkoffer?«
So geht es immer weiter, aber ich höre nur mit halbem Ohr zu. Ich erkläre ihnen, dass das Spannen von Fäden in diesem Fall Zeitverschwendung wäre.
»Hab ich mir fast gedacht. Marino findet es auch zwecklos«, meint einer der Polizisten.
Ich bin ja so froh, dass Marino das gesagt hat. Also muss es die Wahrheit sein.
»Wenn Sie wollen, könnten wir das ganze Revier mobilisieren. Nur damit Sie wissen, dass wir genug Leute haben«, wendet sich der Trooper an mich. Dann erläutert er mir alles über TSTs, elektronische Tachymeter mit Laserentfernungsmessern, obwohl er das in andere Worte kleidet.
Ich kenne deine Kompetenzen besser als du selbst und habe mehr Todesfälle untersucht, als du dir in deinen kühnsten Träumen ausmalen würdest.
»Danke, aber das ist nicht nötig«, erwidere ich, ohne die mit Blut gemalten Hieroglyphen unter der Leiche und ringsherum eines Blickes zu würdigen.
Ich habe das, was ich sehe, bereits gedeutet. Fadenstückchen oder Hightech-Untersuchungsgerätschaften zu verwenden, um die Blutspuren, Schmierer, Sprühnebel, Spritzer und Tröpfchen miteinander zu verbinden und zu kartographieren, würde uns nicht weiterbringen. Die Stelle des Aufpralls ist schlicht und ergreifend der Fußboden unter und rings um das Opfer. Chanel Gilbert stand nicht aufrecht, als sie sich die tödlichen Kopfverletzungen zuzog, so einfach ist das. Sie starb dort, wo sie jetzt liegt, und damit basta.
Das bedeutet nicht, dass kein Verbrechen dahintersteckt, weit gefehlt. Ich habe sie noch nicht auf einen sexuellen Übergriff hin untersucht, eine dreidimensionale CT-Aufnahme ihrer Leiche angefertigt oder sie obduziert. Während ich die optischen Eindrücke noch auf mich wirken lasse, erkundige ich mich, was in ihrem Bad und auf ihrem Nachttisch gefunden wurde.
»Ich interessiere mich für verschreibungspflichtige Medikamente wie zum Beispiel Lenalidomid, in anderen Worten eine langfristig angelegte, nicht auf Steroiden basierende Therapie, die immunmodulatorisch ist«, erkläre ich. »Eine kürzliche Einnahme von Antibiotika könnte auch zur Vermehrung von Bakterien beigetragen haben. Und falls sie beispielsweise positiv auf Clostridium botulinum getestet wird, könnte das die Frage beantworten, warum die Verwesung so rasch eingesetzt hat.«
Ich füge hinzu, ich hätte schon mit Fällen zu tun gehabt, in denen ich aufgrund eines Gase erzeugenden Bakteriums wie Clostridium einen Toten nach sage und schreibe zwölf Stunden in diesem Zustand angetroffen habe. Während ich versuche, den Polizisten das klarzumachen, ist mein Blick auf das Display meines Telefons gerichtet.
»Meinen Sie Clostridium difficile?« Der Trooper spricht lauter und erstickt fast an seinem nächsten Hustenanfall.
»Steht auf meiner Liste.«
»Hätte sie deshalb nicht ins Krankenhaus gemusst?«
»Nicht unbedingt, wenn es sich um einen leichten Verlauf handelte. Haben Sie irgendwo in ihrem Schlafzimmer oder im Bad Antibiotika entdeckt, die darauf hinweisen, dass sie an Durchfällen oder einer Infektion litt?«, frage ich.
»Ich bin nicht sicher, ob ich Tablettendöschen gesehen habe. Aber da war eindeutig Gras.«
»Mir macht Sorgen, dass sie vielleicht etwas Ansteckendes hatte«, wendet der grauhaarige Polizist aus Cambridge zögernd ein. »Auf Clostridium difficile kann ich dankend verzichten.«
»Kann man sich das von einer Leiche einfangen?«
»Ich würde empfehlen, den Kontakt mit Fäkalien zu vermeiden«, entgegne ich.
»Nett, dass Sie mir das sagen.«
»Behalten Sie die Schutzkleidung an. Ich schaue mich selbst nach Medikamenten um, weil ich sie sowieso lieber an Ort und Stelle sehen möchte. Und wenn Sie von Dunkin’ Donuts zurückkommen«, ergänze ich, »vergessen Sie nicht, dass hier drinnen weder gegessen noch getrunken wird.«
»Kein Problem.«
»Im Garten steht ein Tisch«, sagt Hyde. »Ich dachte, wir richten da draußen einen Pausenraum ein, bis es zu regnen anfängt. Laut Wetterbericht soll in ein paar Stunden ein Unwetter aufziehen.«
»Und wir wissen genau, dass im Garten nichts vorgefallen ist?«, erwidere ich spitz. »Wir wissen, dass er nicht zum Tatort gehört, weshalb es in Ordnung ist, dort zu essen und zu trinken?«
»Machen Sie mal ’nen Punkt, Doc. Es ist doch ziemlich offensichtlich, dass sie hier in der Vorhalle von der Leiter gefallen und daran gestorben ist.«
»Wenn ich an einem Tatort eintreffe, halte ich erst mal nichts für offensichtlich.« Ich würdige die drei keines Blickes.
»Nun, um ehrlich zu sein, finde ich das, was hier passiert ist, ziemlich offensichtlich. Natürlich fällt das, woran genau sie gestorben ist, unter Ihren Zuständigkeitsbereich, nicht unseren, Ma’am«, ruft der Trooper in bestem Verteidigerton aus. Ma’am hier, Ma’am dort. Damit die Geschworenen vergessen, dass ich Ärztin, Anwältin und Leiterin eines Instituts bin.
»Es wird weder gegessen, getrunken, geraucht noch die Toilette benutzt.« Diese Anweisung richte ich an Hyde, es ist ein Befehl. »Außerdem landen keine Zigarettenkippen, Kaugummipapiere, Fast-Food-Tüten, Kaffeebecher oder sonst etwas im Müll. Gehen Sie nicht davon aus, dass hier kein Verbrechen stattgefunden hat.«
»Aber Sie glauben es nicht wirklich.«
»Ich arbeite so, als ob es der Fall wäre, und Sie sollten das auch«, entgegne ich. »Denn ehe ich keine weiteren Informationen habe, weiß ich nicht, was wirklich hier passiert ist. Es gab heftige Gewebereaktionen und starke Blutungen, meiner Schätzung nach mehrere Liter. Ihre Kopfhaut ist schwammig. Vielleicht haben wir es ja mit mehr als nur einem Bruch zu tun. Sie weist postmortale Veränderungen auf, die ich nicht erwartet hätte. So viel verrate ich Ihnen jetzt, aber Genaueres erfahre ich erst, wenn ich sie in meinem Institut habe. Und dass mitten in einer Hitzewelle im August die Klimaanlage abgeschaltet war, gefällt mir überhaupt nicht. Also wollen wir ihren Tod nicht vorschnell auf Marihuana zurückführen. Sie kennen doch den Spruch.«
»Welchen?« Der Trooper wirkt verwirrt und besorgt. Er und die anderen sind noch einige Schritte zurückgewichen.
»Dass man sich besser mit Kiffern als mit Betrunkenen umgibt. Alkohol verleitet einen zu gefährlichen Aktionen, wie zum Beispiel auf Leitern zu klettern, ins Auto zu steigen oder eine Prügelei anzuzetteln. Gras wirkt nicht ganz so anregend. Für gewöhnlich löst es weder Aggressionen noch Risikobereitschaft aus. Normalerweise eher das Gegenteil.«
»Das hängt doch vom jeweiligen Menschen ab und davon, was er geraucht hat, oder? Und vielleicht auch davon, welche Medikamente er sonst noch nimmt?«
»Im Allgemeinen stimmt das.«
»Also möchte ich Sie Folgendes fragen: Würden Sie damit rechnen, dass jemand, der von einer Leiter fällt, so stark blutet?«
»Das hängt von den Verletzungen ab«, antworte ich.
»Wenn die schwerer sind, als Sie dachen, und sie negativ auf Drogen und Alkohol getestet wird, könnten wir ein großes Problem haben. Meinten Sie das?«
»Wenn Sie mich fragen, ist dieser Vorfall bereits ein großes Problem«, stößt der Trooper, wieder unterbrochen von Hustenkrämpfen, hervor.
»Für Sie ganz bestimmt. Wann haben Sie zuletzt eine DTP-Impfung gegen Tetanus gehabt?«, erkundige ich mich bei ihm.
»Warum?«
»Weil eine DTP-Impfung nicht nur vor Diphtherie und Tetanus schützt, sondern eben auch vor Pertussis, also Keuchhusten. Denn ich mache mir Sorgen, Sie könnten Keuchhusten haben.«
»Ich dachte, den kriegen nur Kinder.«
»Falsch. Wann haben die Symptome angefangen?«
»Nur eine Erkältung. Naselaufen und Niesen vor etwa zwei Wochen. Dann dieser Husten. Ich kriege Anfälle, dass ich kaum noch Luft bekomme. Offen gestanden, weiß ich nicht mehr, wie lange meine letzte Tetanusimpfung her ist.«
»Sie müssen zum Arzt. Ich möchte auf keinen Fall, dass Sie eine Lungenentzündung oder einen Lungenkollaps kriegen«, sage ich zu dem Trooper.
Dann lassen er und seine Kollegen mich endlich in Ruhe.
4
Nun läuft das Video schon seit acht Minuten, und ich bekomme nichts als Lucys leeres Wohnheimzimmer zu sehen. Wieder versuche ich, die Datei zu sichern oder den Film anzuhalten. Es geht nicht. Er spult sich einfach weiter ab wie ein Leben, das ereignislos verstreicht.
Nun, neun Minuten nach dem Start, ist es im Zimmer unverändert – leer und still. Nur im Hintergrund ist zu hören, dass es auf den Schießständen hoch hergeht. Schüsse knallen, und ich erkenne Lichtblitze, die durch die Ritzen zwischen den verkehrtherum geschlossenen Lamellen der weißen Jalousie hindurchdringen. Die Sonne scheint direkt aufs Fenster, und ich erinnere mich, dass Lucys Zimmer nach Westen zeigte. Also später Nachmittag.
Pop-pop. Pop-pop.
Ich kann dröhnenden Autolärm vier Stockwerke tiefer auf der J. Edgar Hoover Road ausmachen, der Hauptverkehrsader, die mitten durch die FBI Academy verläuft. Stoßzeit. Für heute sind die Lehrgänge zu Ende. Polizisten und Agents kommen von den Schießständen. Kurz glaube ich, den beißenden Bananengeruch von Essigsäureisopentylester des Waffenreinigungsmittels von Hoppe’s in der Nase zu haben. Ich rieche verbranntes Schießpulver, als umwabere mich eine Wolke. Ich spüre die schwüle Hitze Virginias und höre das Surren von Insekten, wo Geschosshülsen silbrig und golden schimmernd im von der Sonne erwärmten Gras liegen. Die Erinnerungen brechen mit Wucht über mich herein. Und dann geschieht endlich etwas.
Das Video hat einen Vorspann, der ganz langsam vor meinen Augen abläuft.
ENTMENSCHLICHTESVERHALTEN – I
Von CARRIEGRETHEN
QANTICO, VIRGINIA – 11. Juli 1997
Der Name löst Wut in mir aus. Es macht mich zornig, ihn in roten Fettbuchstaben so langsam und träge an mir vorbeigleiten zu sehen, Pixel für Pixel wie eine Blutung in Zeitlupe. Nun ertönt auch Musik. Karen Carpenter singt »We’ve Only Just Begun«. Es ist ein Ärgernis, dieses Video mit einer so engelsgleichen Stimme und den sanften Versen von Paul Williams in Einklang bringen zu müssen.
So ein wunderschönes und liebevolles Lied, verzerrt zu einer Drohung und Verhöhnung. Zur Ankündigung von mehr zukünftigem Leid, Elend, Quälereien und möglichem Tod. Carrie Grethen prahlt und verspottet mich. Sie zeigt mir den Finger. Ich habe mir schon seit Jahren nicht mehr die Carpenters angehört. Doch früher habe ich ihre Kassetten und CDs gespielt. Ich frage mich, ob Carrie das wusste. Wahrscheinlich schon. Das also ist die nächste Rate eines Plans, den sie vermutlich schon vor langer Zeit geschmiedet hat.
Ich spüre die Herausforderung, und meine Reaktion darauf brodelt hoch wie glühende Lava. Ich bin mir meines Hasses voll und ganz bewusst, meines Drangs, die widerwärtigste und abgefeimteste Verbrecherin, der ich je begegnet bin, zu vernichten. Dreizehn Jahre lang habe ich keinen Gedanken an sie verschwendet, nicht seit ich Zeugin des Hubschrauberabsturzes geworden bin. Das glaubte ich zumindest. Aber ich habe mich geirrt. Sie war niemals an Bord dieser Maschine, und als ich das erfuhr, war es die schlimmste Nachricht, mit der ich mich je hatte abfinden müssen. Es ist, als bekäme man gesagt, die tödliche Krankheit, an der man litte, sei wieder aufgeflammt. Oder dass eine grausige Tragödie nicht nur ein böser Traum war.
Und nun setzt Carrie das fort, was sie angefangen hat. Das war zu erwarten, und ich erinnere mich an die jüngsten Warnungen meines Mannes Benton. Ich dürfe kein Verständnis für sie entwickeln, indem ich in Gedanken mit ihr spräche, und mich in dem bequemen Glauben wiegen, sie werde ihr Werk nicht vollenden. Sie will mich nicht töten, weil sie etwas viel Schlimmeres im Schilde führt. Sie will mich nicht vom Erdboden tilgen, sonst hätte sie das schon im letzten Juni getan. Benton ist Criminal Intelligence Analyst beim FBI, also das, was man landläufig als Profiler bezeichnet. Er denkt, ich hätte mich mit der Angreiferin identifiziert, und mutmaßt, ich litte am Stockholm-Syndrom. In letzter Zeit mutmaßt er eine ganze Menge. Und dann geraten wir jedes Mal in Streit.
»Doc? Wie läuft es hier?« Die herannahende Männerstimme wird vom papierenen Rascheln von mit Plastik beschichteten Überschuhen begleitet. »Ich bin jetzt bereit für eine Tour durchs Haus, wenn du es auch bist.«
»Noch nicht«, erwidere ich, während Karen Carpenter weiter in meinen Ohrhörer singt.
»Workin’ together day to day, together, together …«
Er stapft durch die Vorhalle. Peter Rocco Marino. Oder Marino, wie ihn die meisten, auch ich, nennen. Oder Pete, obwohl ich ihn noch nie so angesprochen habe, und ich bin nicht sicher, warum wir überhaupt Freunde geworden sind. Dann gibt es natürlich auch noch die Spitznamen bastardo, wenn er sich wie das Hinterletzte aufführt, oder Arschloch, wenn das zutrifft. Er ist etwa eins neunzig, wiegt mindestens hundertzehn Kilo und hat Oberschenkel wie Baumstämme und Hände so groß wie Radkappen. Außerdem eine massive Präsenz, für die ich keine Metapher finde.
Sein Gesicht ist breit und wettergegerbt, und er hat kräftige weiße Zähne, ein Kinn wie ein Actionheld, einen dicken Hals und eine Brust von der Breite einer Tür. Heute trägt er ein graues Polohemd, Marke Harley-Davidson, Herman-Munster-Größe, Turnschuhe, Tennissocken und Khakishorts, deren gewaltige Cargotaschen ausgebeult sind. An seinem Gürtel hängen Dienstmarke und Pistole. Allerdings braucht er sich nicht auszuweisen, um zu tun, was er will, und den von ihm eingeforderten Respekt zu bekommen.
Marino ist ein Polizist, der keine Grenzen kennt. Auch wenn er nur in Cambridge zuständig ist, findet er stets einen Weg, seinen Einfluss über die privilegierten Linien des MIT und Harvard auszudehnen, ohne auf die Honoratioren, die hier wohnen, zu achten. Oder auf die Touristen, die nicht von hier sind. Er erscheint überall, wo man ihn einlädt, und noch häufiger dort, wo er unerwünscht ist. Mit Grenzen hat er ein Problem. Mit meinen hatte er das schon immer.
»Dachte, dich würde interessieren, dass das Marihuana aus medizinischen Gründen verschrieben wurde. Keine Ahnung, woher sie es hat.« Sein Blick aus blutunterlaufenen Augen wandert über die Leiche auf dem blutigen Marmorboden und landet schließlich auf meiner Brust. Sein Lieblingsplatz, um seine Aufmerksamkeit darauf zu richten.
Es spielt keine Rolle, ob ich einen OP-Anzug, einen Tyvek-Overall, einen Arztkittel oder einen Labormantel anhabe. Marino gönnt sich trotzdem das Vergnügen, unverhohlen hinzustarren.
»Knospen, Tinkturen, sieht aus wie in Folie eingewickelte Bonbons.« Er zieht eine breite Schulter hoch, um sich den vom Kinn tropfenden Schweiß abzuwischen.
»Habe ich schon gehört.« Während ich die Vorgänge auf dem Display meines Smartphones beobachte, frage ich mich allmählich, ob nicht mehr dahintersteckt. Nur Lucys leeres Wohnheimzimmer, das Licht fängt sich in den Lamellen der Jalousie, und Mister Pickle, der auf dem Bett sitzt und einsam und unverstanden wirkt.
»Es ist in einer uralten Holzschachtel, die ich versteckt unter einem Haufen Mist im Wandschrank in ihrem Schlafzimmer gefunden habe«, verkündet Marino.
»Ich kümmere mich darum, aber nicht jetzt. Warum sollte sie eigentlich ärztlich verordnetes Marihuana verstecken?«
»Weil sie es vielleicht gar nicht verordnet gekriegt hat. Oder damit die Haushälterin es nicht klaut. Keine Ahnung. Aber mich würde interessieren, was bei der toxikologischen Untersuchung rauskommt. Wie hoch ihr THC-Wert ist. Das könnte erklären, wie sie auf die Idee gekommen ist, mitten in der Nacht auf eine Leiter zu steigen und an den Glühbirnen rumzupopeln.«
»Du hast zu viel mit Hyde geredet.«
»Vielleicht ist sie einfach nur gestürzt, und mehr steckt nicht dahinter. Das ist eine logische Frage, über die man nachdenken müsste«, erwidert Marino.
»Meiner Meinung nach nicht. Außerdem wissen wir nicht, ob es mitten in der Nacht war. Offen gestanden bezweifle ich das. Wenn sie um Mitternacht oder später gestorben ist, wäre sie bei ihrem Auffinden erst acht Stunden oder weniger tot gewesen. Und ich bin sicher, dass der Todeszeitpunkt schon weiter zurückliegt.«
»Bei der Hitze hier kann man unmöglich feststellen, wie lange sie schon tot ist.«
»Könnte stimmen, aber nicht ganz«, entgegne ich. »Wenn wir weiter nachforschen, werde ich schon dahinterkommen.«
»Doch im Moment können wir noch nicht genau sagen, wie lang. Und das ist ein Riesenproblem, weil ihre Mutter Antworten fordern wird. Die lässt sich nicht mit Vermutungen abspeisen.«
»Ich vermute hier gar nichts. Ich schätze. Und in diesem Fall tippe ich auf mehr als zwölf und weniger als achtundvierzig Stunden«, erwidere ich. »Mehr kann ich dir im Moment nicht sagen.«
»Eine einflussreiche Frau wie sie? Eine erfolgreiche Produzentin wie Amanda Gilbert? Die wird sich mit so einer Antwort nicht zufriedengeben.«
»Die Mutter interessiert mich eigentlich herzlich wenig.« Allmählich nervt mich dieses Hollywood-Getue. »Mich beschäftigt viel mehr, was hier wirklich passiert ist. Denn das, was ich sehe, passt nicht zusammen. Der Todeszeitpunkt ist nur ein Ratespiel. Die Einzelheiten widersprechen einander. Ich glaube, dass ich noch nie etwas gesehen habe, das mich so verwirrt, und vielleicht geht es ja genau darum.«
»Worum?«
»Keinen Schimmer.«
»Gestern hatten wir eine Höchsttemperatur von über dreißig Grad. Die Tiefsttemperatur letzte Nacht war fünfundzwanzig.« Ich spüre Marinos Blick auf mir, als er hinzufügt: »Die Haushälterin schwört, sie habe Chanel Gilbert gestern gegen vier Uhr nachmittags zuletzt gesehen.«
»Das hat sie Hyde geschworen, bevor wir hier waren. Dann ist sie gegangen«, halte ich ihm vor Augen.
Es ist nicht unsere Art, anderen Menschen einfach Glauben zu schenken, wenn es sich vermeiden lässt. Marino hätte selbst mit der Haushälterin reden sollen. Das wird er sicher vor dem Abend auch noch tun.
»Sie sagte, Chanel sei ihr in der Auffahrt in Richtung Haus entgegengekommen, und zwar in dem roten Range Rover, der jetzt da draußen steht.« Marino wiederholt, was man ihm erzählt hat. »Wenn wir also davon ausgehen, dass sie irgendwann gestern Nachmittag nach vier gestorben ist und heute Morgen um acht schon in so schlechtem Zustand war? Passt das zu deiner Schätzung? Zwölf Stunden oder vielleicht ein wenig länger?«
»Es passt nicht«, antworte ich ihm, während ich weiter mein Telefon beobachte. »Und warum beharrst du darauf, sie sei mitten in der Nacht gestorben?«
»Nach dem, wie sie angezogen war«, erwidert Marino. »Nackt unter einem seidenen Morgenmantel. So, als wolle sie gleich ins Bett gehen.«
»Ohne Nachthemd oder Pyjama?«
»Viele Frauen schlafen nackt.«
»Ja?«
»Nun, vielleicht hat sie es ja getan. Warum starrst du eigentlich dauernd auf dein dämliches Telefon?« Er stellt mich auf seine übliche unverblümte Art zur Rede, die man meistens einfach nur als unhöflich bezeichnen kann. »Seit wann klebst du an einem Tatort am Telefon? Stimmt etwas nicht?«
»Es könnte ein Problem mit Lucy geben.«
»Öfter mal was Neues.«
»Ich hoffe, dass da nichts ist.«
»Meistens ist da was.«
»Ich muss nach ihr schauen.«
»Das ist auch nicht neu.«
»Bitte zieh es nicht ins Lächerliche.« Ich sehe nicht ihn, sondern mein Telefon an.
»Die Sache ist, dass ich nicht weiß, was das sein soll. Was zum Teufel wird hier gespielt?«
»Keine Ahnung. Aber etwas ist da faul.«
»Wenn du meinst.« Er sagt das so, als sei Lucy ihm gleichgültig, doch nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein.
Marino war für sie gewissermaßen Vaterersatz. Er hat ihr das Autofahren und das Schießen beigebracht. Ganz zu schweigen davon, wie man mit bigotten Hinterwäldlern umgeht, denn genau so einer war Marino, als wir uns vor langer Zeit in Virginia kennengelernt haben. Er war ein schwulenfeindlicher Chauvi, der versuchte, Lucy die Freundinnen auszuspannen, bis er seinen Irrtum endlich einsah. Inzwischen ist er, trotz seiner abfälligen Sprüche und seiner Bemühungen, sich anders darzustellen, derjenige, der Lucy am meisten die Stange hält. Er liebt sie auf seine ganz eigene Weise.
»Tu mir den Gefallen und richte Bryce aus, dass ich Rusty und Harold sofort hier brauche. Wir wollen die Leiche in mein Institut schaffen.« Ich neige das Telefon zur Seite, damit Marino das Video nicht sehen kann. Damit er das Schlafsaalzimmer in der FBI Academy mit dem kleinen grünen Stoffbären nicht mitkriegt, den er bestimmt wiedererkennen würde.
»Aber du hast doch den Transporter.« Sein Tonfall ist vorwurfsvoll, als würde ich ihm etwas verheimlichen, was auch zutrifft.
»Ich möchte, dass sich mein Transportteam darum kümmert«, entgegne ich, und das ist keine Bitte. »Ich werde das weder selbst erledigen noch gleich von hier aus ins Büro fahren. Und du auch nicht. Ich brauche deine Hilfe in Sachen Lucy.«
Marino kauert sich neben die Leiche, wobei er Abstand zu den dunklen, klebrigen Blutflecken hält. Er schlägt nach den Fliegen, deren ständiges Brummen an den Nerven zerrt. »Solange du sicher bist, dass Lucy wichtiger ist als dieser Fall? Solange du Luke damit beauftragst, sich der Sache anzunehmen?«
»Ist das ein Multiple-Choice-Test?«
»Ich kapiere nur einfach nicht, was du vorhast, Doc.«
Ich sage ihm, dass entweder mein Stellvertreter Luke Zenner die Autopsie durchführen wird oder ich, falls ich es endlich ins Institut schaffe. Allerdings könnte das bis zum Nachmittag, womöglich sogar bis zum späten Nachmittag oder bis zum Abend dauern.
»Was zum Teufel ist da los?« Marinos Stimme wird lauter. »Ich blicke nicht ganz durch. Warum bringst du die Leiche nicht selbst ins Institut, damit wir rauskriegen, was, verdammt noch mal, hier los war, bevor ihre Hollywood-Mama auftaucht.«
»Ich muss jetzt weg und komme später wieder.«
»Und warum kannst du nicht zuerst die Leiche wegschaffen?«
»Wie ich schon sagte, fahre ich nicht gleich ins CFC. Wir müssen nach Concord, und aus offensichtlichen Gründen kann ich nicht mit einer Toten hinten im Transporter herumkurven. Sie muss sofort in die Kühlkammer«, beharre ich. »Harold und Rusty sollen sofort herkommen.«
»Ich kapiere das nicht«, wiederholt er, diesmal mit finsterer Miene. »Du braust hier mit einem dämlichen Transporter davon und willst nicht auf direktem Wege ins CFC? Hast du einen Friseurtermin? Oder einen im Nagelstudio? Wollen Lucy und du ins Wellness-Center?«
»Das will ich nicht gehört haben.«
»War nur ein Witz. Jeder, der dich anschaut, weiß, dass das nur ein Witz war. Du hast dich seit Monaten nicht mehr mit solchem Mist befasst.« Marinos Stimme klingt verärgert und schneidend. Er beurteilt mich, und ich spüre, dass es wieder anfängt.
Dem Opfer die Schuld geben. Bestraf mich dafür, dass ich fast gestorben wäre. Sag, dass ich einen Fehler gemacht habe.
»Und was soll das heißen?«, entgegne ich.
»Das heißt, dass du dich irgendwie gehen lässt. Nicht, dass ich kein Verständnis dafür hätte. Bestimmt fällt dir das Gehen schwer, wahrscheinlich schwerer als vorher. Und sicher ist es anstrengend, dich anzuziehen und dich zurechtzumachen.«
»Ja, das mit dem Zurechtmachen war ein wenig schwierig«, antworte ich, leicht spöttisch. Und dass ein Friseurbesuch dringend angesagt wäre, ist auch wahr.
Meine Fingernägel sind kurz und unlackiert. Als ich heute Morgen das Haus verlassen habe, habe ich mir das Schminken gespart. Ich bin ein bisschen magerer als bevor auf mich geschossen wurde. Allerdings ist dies weder der richtige Ort noch der Zeitpunkt, um mir deswegen Vorhaltungen zu machen. Nicht, dass Marino sich in all den Jahren, die ich ihn nun kenne, davon hätte abhalten lassen. Doch dass er an einem Tatort und während ich mich wegen meiner Nichte zu Tode sorge, auf meinem Äußeren herumhackt, ist der absolute Tiefpunkt. Er sollte mich einfach beim Wort nehmen, wenn ich ihm sage, dass wir uns so schnell wie möglich um sie kümmern müssen. Er vertraut mir nicht mehr so wie früher. Und das ist das Problem.
»Mein Gott, hast du denn gar keinen Humor mehr?«, fragt er, nachdem ich wieder lange geschwiegen habe.