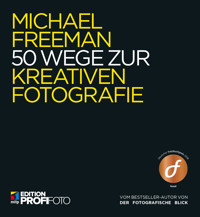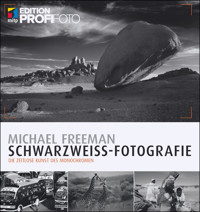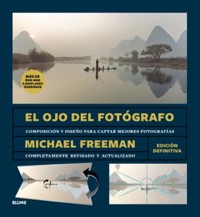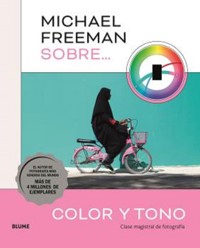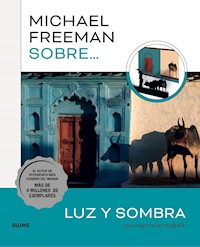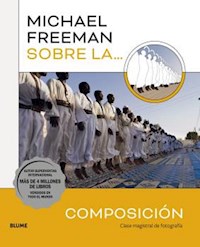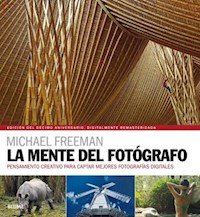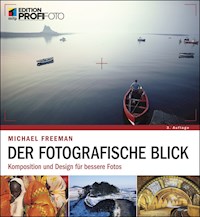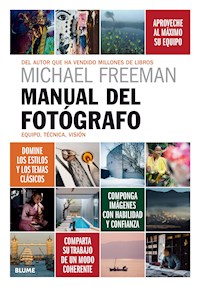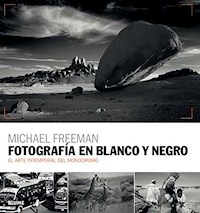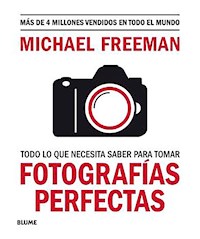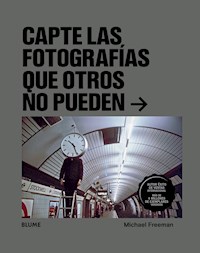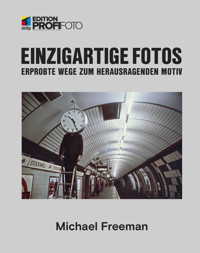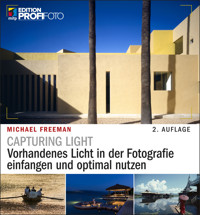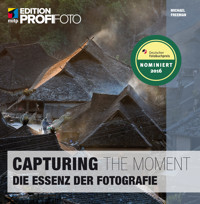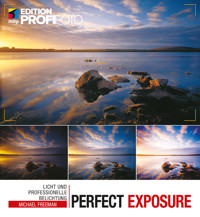
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MITP
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: mitp Edition ProfiFoto
- Sprache: Deutsch
Profitieren Sie von dem bemerkenswerten Dynamikumfang und den hohen ISO-Fähigkeiten moderner Kameras sowie von der jahrelangen Erfahrung des Autors Zwölf beispielhafte Belichtungssituationen samt der jeweils optimalen Vorgehensweise Anschauliche Workflow-Diagramme helfen, den Gedankenprozess zu filtern und die perfekte Belichtung in Sekunden zu wählen Gründliche Behandlung aller herkömmlichen Kameraeinstellungen sowie digitaler Belichtungstechniken wie High Dynamic Range (HDR) Imaging Belichtung ist das vermeintlich einfache Konzept im Kern der Fotografie – faszinierend für ambitionierte Amateure und professionelle Fotografen gleichermaßen. Die digitale Technik bietet unzählige Optionen, Belichtungen zu manipulieren. Fotografen müssen die Variablen Blende, ISO und Zeit verstehen, um ihre Bildideen verwirklichen zu können. Michael Freeman begleitet Sie auf dieses schwierige Lernfeld mit einer klaren und sich leicht zu erschließenden Methode, indem er einzigartige Workflow-Illustrationen, Histogramme und Beispielbilder verwendet. Erkunden Sie mit ihm die Feinheiten der Belichtung, sodass es Ihnen möglich wird, mit viel Selbstvertrauen und mehr Kontrolle zu fotografieren. Aus dem Inhalt: Die Grundmethode Belichtung denken Belichtung und Rauschen Belichtungsstrategie für hohen ISO Dynamikumfang des Sensors Belichtungsdreieck Szenenprioritäten Für Farbe belichten Zwölf Gruppen der Belichtungssituationen und ihre Lösungen Das Zonensystem High-Key und Low-Key Für Schwarz-Weiß belichten Silhouette Irrelevante Lichter und Schatten Die Belichtung später wählen Selektive Belichtung HDR-Bilder Glossar Über den Autor: Michael Freeman ist ein international bekannter Fotograf und Autor, der sich auf Reise, Architektur und asiatische Kunst spezialisiert hat. Er ist zudem bekannt für seine Expertise bezüglich Special Effects. Er arbeitet für renommierte Magazine wie National Geographic und hat bereits mehr als 20 Fotografie-Bücher verfasst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MICHAEL FREEMANPERFECT EXPOSURE
Im Laufe seiner langen und einzigartigen Karriere als Fotograf und Autor konzentrierte sich Michael Freeman vor allem auf Dokumentationen und Reiseberichte und wurde in verschiedensten Medien weltweit veröffentlicht, darunter Time-Life, GEO und Smithsonian magazine, für die er über 30 Jahre lang tätig war. Während dieser Zeit hat er Dutzende Fotostorys auf der ganzen Welt aufgenommen. Viele dieser Arbeiten spielten in Asien, zu Beginn in Thailand, später in Südost-Asien, darunter in Kambodscha, Japan und China. Seine aktuellste Dokumentation heißt Tea Horse Road, in der er die alte Handelsroute zwischen China und Tibet seit Beginn des 7. Jahrhunderts nachzeichnet.
Seine zahlreichen Bücher über die Fotografie als Handwerk wurden über vier Millionen Mal verkauft und in 27 Sprachen übersetzt. Sein absoluter Bestseller, Der fotografische Blick (erschienen bei mitp), wurde zum Standardwerk über fotografische Komposition und Design.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-95845-765-2 1. Auflage 2016
www.mitp.deE-Mail: [email protected]: +49 7953 / 7189 – 079Telefax: +49 7953 / 7189 – 082
© 2016 mitp Verlags GmbH & Co. KG
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Übersetzung der englischen Originalausgabe: Michael Freeman: Perfect Exposure First published in Great Britain 2009 By ILEX, a division of Octopus Publishing Group Ltd Carmelite House, 50 Victoria Embankment London EC4Y ODZ
Design, layout and text copyright © OctopusPublishing Group Ltd 2015Michael Freeman asserts the moral right to be identified as the author of this workAll rights reserved
Übersetzung: Claudia KochLektorat: Katja VölpelSprachkorrektorat: Petra Heubach-ErdmannCovergestaltung: Christian KalkertDatenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Inhalt
Einführung
KAPITEL 1: ÜBERHOLSPUR UND IDIOTENSICHER
Die Grundmethode
Schlüssel-Entscheidungen
Entscheidungsfluss
Helligkeit, Belichtung denken
Fallstudie 1
Fallstudie 2
Fallstudie 3
KAPITEL 2: DAS TECHNISCHE
Licht auf dem Sensor
Begriffe
Belichtung und Rauschen
Neue Belichtungsstrategie für hohen ISO
Dynamikumfang des Sensors
Lichterbeschneidung und -Abfall
Die Kameraleistung
Dynamikumfang: Szene vs. Kamera
Das Belichtungsdreieck aktualisiert
Kontrast, Hoch und Niedrig
Messmodi – einfach und gewichtet
Messmodi – intelligent und prädiktiv
Korrekturen nach der Messung
Objektiv richtig
Handmessgeräte und Graukarten
Schlüsselfarben, Schlüsselkonzept
Szenenprioritäten
Belichtung und Farbe
Für Farbe belichten
Belichtungsreihen
KAPITEL 3: DIE ZWÖLF
Erste Gruppe (Der Bereich passt)
1 Der Bereich passt – Durchschnitt
2 Der Bereich passt – insgesamt hell
3 Der Bereich passt – insgesamt dunkel
Zweite Gruppe (Der Bereich passt leicht)
4 Der Bereich passt leicht – Durchschnitt
5 Der Bereich passt leicht – insgesamt hell
6 Der Bereich passt leicht – insgesamt dunkel
Dritte Gruppe (Außerhalb des Bereichs)
7 Außerhalb des Bereichs – insgesamt hoher Kontrast
8 Außerhalb des Bereichs – groß hell vor dunkel
9 Außerhalb des Bereichs – klein hell vor dunkel
10 Außerhalb des Bereichs – die Kanten leuchten
11 Außerhalb des Bereichs – groß dunkel vor hell
12 Außerhalb des Bereichs – klein dunkel vor hell
KAPITEL 4: STIL
Stimmung, nicht Information
Personalisierte Belichtung
Erinnerungstonwerte
Vorstellung
Das Zonensystem
Was Zonen bedeuten
Zonendenken
Für Schwarz-Weiß belichten
High-Key
Hell und hell
Blendenflecke
Leuchtende Lichter
Low-Key
Ein Lob auf die Schatten
Tiefe Schatten
Noch mal Low-Key … irgendwie
Silhouette
Irrelevante Lichter und Schatten
Helligkeit und Blickfang
KAPITEL 5: NACHBEARBEITUNG
Die Belichtung später wählen
Belichtung, Helligkeit und Glanz
Selektive Belichtung
Kontrolle nach der Belichtung
HDR-Bilder
Belichtungsfusion
Von Hand zusammenführen
Glossar
Index
EINFÜHRUNG
Die Belichtung für ein Foto einzustellen ist sowohl erschreckend einfach als auch unheimlich komplex; tatsächlich handelt es sich um ein großes Paradox in der Fotografie.
Einfach ist es, denn die Dosierung des Lichts wird wie von jeher nur durch Belichtungszeit, Blende und Lichtempfindlichkeit des Films (bzw. des Sensors) bestimmt – das ist schon seit den ersten Plattenkameras so. Keine Einschränkungen oder Untereinstellungen, nur Bruchteile einer Sekunde, Blendenstufen und ein ISO-Wert. Wie sehr man sich auch quälen und darüber philosophieren mag – letztlich reduziert sich alles auf diese drei einfachen Einstellungen. Nichts weiter.
Komplex ist das Thema deswegen, weil es alles im Bild betrifft und letztlich bestimmt, wie das Bild auf den Betrachter wirkt. Es greift tief in die Intentionen des Fotografen ein und berührt sogar den eigentlichen Grund, warum das Foto überhaupt entstanden ist. Da gibt es unendlich viele Feinheiten bezüglich Helligkeit, Erkennbarkeit und Stimmung in jeder Szene, die letztlich dadurch beeinflusst werden, für welche Belichtung sich der Fotograf entscheidet. Halten Sie sich aus diesem Grund an einfache Regeln, wie z. B. »richtig belichten«.
Darum ist es viel wert, wenn Sie verstehen, wie und warum Belichtung funktioniert, denn sie hilft Ihnen, das Bild »richtig« hinzubekommen, wie Sie es sich vorgestellt haben – und das ist in der Fotografie entscheidend.
DOWNLOAD
Manche Bilder in diesem Buch erscheinen auf dem Computerbildschirm klarer und besser, denn Bildschirme haben einen größeren Dynamikbereich als die gedruckte Seite. Wo es hilft, haben wir deshalb Bilder auf einer Website hinterlegt, sodass Sie sie sich auf dem Bildschirm anschauen können – immer dort, wo Sie dieses Logo sehen. Die Bilder finden Sie unter
www.mitp.de/294
Nehmen Sie sich vor selbst ernannten »Systemen« in der Fotografie in Acht. Solche Systeme werden gern von Fotografen erfunden, die ihre Arbeitsweise propagieren wollen (was für sie zwar passt, aber keinesfalls richtig oder Standard ist), oder von Leuten, die mit der täglichen Fotopraxis wenig Erfahrung haben. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich Ihnen hier genau so etwas anbieten will. Mit dem einzigen Unterschied – zu meiner Rechtfertigung –, dass es sich um ein Destillat der Arbeitsweise vieler Profifotografen handelt. Die meisten Profis verwenden natürlich kein »System«, aber wenn die Fotografie Ihr täglicher Begleiter ist, Sie sie leben, atmen und damit Ihren Lebensunterhalt verdienen, entwickeln Sie gewisse Vorgehensweisen, die einem System ziemlich ähnlich sind. Muss ich ja sagen, oder?
Wie üblich halte ich mich in diesem Buch an die Arbeitsweise vieler Profifotografen. Mit »Profi« meine ich jemanden, der mit Fotoaufträgen seinen Lebensunterhalt verdient, das ist wichtig. Nicht dass Profis unbedingt ein Anrecht auf bessere Fotos hätten. Dieses Talent besitzen sicherlich viele. Jeder kann es auch verbessern, aber erfolgreiche Profis nutzen diese Fähigkeit eben beruflich aus. Dennoch lohnt es sich, dem professionellen Ansatz zu folgen, denn wir fotografieren immer, meist unter Druck, und müssen immer gute Produkte liefern.
Im ungewöhnlichen Gegensatz zu den meisten meiner anderen Bücher habe ich ein kurzes erstes Kapitel verfasst: einen Überblick über das, was darauf folgt, und eine Einführung, wie ich meine Entscheidungen treffe. Danach gehe ich tiefer ins Detail über die einzelnen Aspekte der Belichtung, bei denen das Lesen jeweils viel länger dauert als der Akt an sich.
Auf den nächsten Seiten sind wir jedoch rein praktisch unterwegs, denn wenn Sie fotografieren, haben Sie meist ohnehin keine Zeit. Entscheidungen über die Belichtung müssen sehr schnell getroffen werden, häufig ohne sie bewusst bis zu Ende zu denken. Dennoch ist die Entscheidungskette bindend – Sie haben nur weniger Zeit. So ist es nämlich in Wirklichkeit …
DIE GRUNDMETHODE
In diesem Buch habe ich mich für einen etwas anderen Ansatz entschieden, ich erkläre einfach alles kurz und bündig am Anfang. Das erscheint zwar fast unmöglich, aber bei dieser Thematik – die ja sowohl einfach als auch komplex ist – muss man in kürzester Zeit die wichtigsten Dinge erfassen und danach alle richtigen Schlüsse ziehen. In der Fotografie geht es immer um den Moment, und während Sie unendlich viel lernen können, drängt immer diese – völlig verständliche – Ungeduld, einfach nur abzudrücken.
Es gibt verschiedene Hilfsmittel, um die Belichtung einzustellen, und ebenso viele Möglichkeiten, für welche Kameraeinstellungen Fotografen sich entscheiden. Die Kamerahersteller sind sich dieses wichtigen Problems durchaus bewusst. Darum haben sie technische Lösungen entwickelt, die einander förmlich übertreffen. Herausgekommen sind wunderbar viele Optionen, aber auch ein riesiges Methodenchaos, und selbst die Namen der Optionen scheinen nur dazu da zu sein, ihre Überlegenheit gegenüber dem Mitbewerber auszudrücken.
Ich werde diesen Nonsens durchbrechen und wie immer darlegen, wie Profis wie ich denken und arbeiten. Profifotograf zu sein (also jemand, der sich von Kunden fürs Fotografieren bezahlen lässt und damit seinen Lebensunterhalt verdient, nicht nur indem er Vorträge hält, Bücher schreibt und Bildern mit Photoshop zu Leibe rückt), heißt nicht, dass die Arbeiten automatisch besser sind als die eines engagierten Amateurs. Es bedeutet jedoch, dass man sich immer und täglich konstant und realistisch mit der Fotografie beschäftigt.
Ein Profifotograf hat den Vorteil, dass er das immer tun kann und somit Erfahrungen aufbaut, die viel mehr zählen als jede gute Technik. Die meisten Profis haben mit Neuerungen wenig Geduld und die meisten stellen die Belichtung instinktiv ein. Ich habe viele Freunde, die für das, was ich vorhabe, wenig Verständnis zeigen, denn ich werde den Prozess analysieren und das auch aufschreiben. Aber das kommt daher, dass es für sie selbstverständlich ist. Ich möchte Sie allerdings vor der unvermeidlichen Flut an Wörtern in den hier beschriebenen Methoden warnen. Selbst um die nachfolgende kurze Zusammenfassung zu lesen und zu verstehen, brauchen Sie mindestens eine Minute oder so, dabei dauert die Umsetzung dann wieder nur Sekunden. Aber auch Reflexe beim Bewerten einer Szene und dem Einstellen der Belichtung lassen sich verbessern, und das sollten sie auch.
ENTSCHEIDUNGSDIAGRAMM (VEREINFACHT)
KAMERAPROZESSORDie in die Kamera eingebaute Elektronik kann Ihnen Entscheidungen abnehmen, wenn Sie das wünschen. Allerdings kann sie die Szene nur aus der Perspektive des »Durchschnitts« oder von »Otto Normalverbraucher« sehen.
BILDSENSOREin Canon-Vollformat-CMOS-Bildsensor. Dies ist das Bauteil in der Kamera, das schließlich dem Licht ausgesetzt wird.
Fangen wir also mit der absoluten Zusammenfassung an, so kurz wie möglich. Ja, in jeden Schritt fließen alle möglichen Entscheidungen ein, die erläutere ich aber später im Buch. Ich musste mich auch einschränken, was die vielen Möglichkeiten angeht, anhand derer sich heutzutage in modernen Kameras die Belichtung einstellen lässt. Wichtig ist hier eines: Es spielt weniger eine Rolle, welche Methode Sie verwenden. Entscheidend ist, dass Sie sie beherrschen. Ob Sie es glauben oder nicht, viele Profifotografen stellen ihre Belichtung manuell ein, mit einer einfachen mittenbetonten Durchschnittsmessung – und es funktioniert.
Das bringt mich zum Entscheidungsdiagramm auf der Seite gegenüber, eine gekürzte Version dessen, was auf den nächsten Seiten folgt. Halten Sie sich an die Abfolge, dann erhalten Sie die bestmögliche Belichtung.
Einzige Einschränkung: Die erste und die letzte Stufe in der Zusammenfassung (rechts) sind mechanisch, während alle anderen eine persönliche Einschätzung erfordern und sich mit zunehmender Erfahrung bessern – außer Nummer 3, die braucht ein Leben lang.
ZUSAMMENFASSUNG
1. EINSTELLUNGEN
Prüfen Sie, ob alle wichtigen Kameraeinstellungen so sind, wie Sie das haben wollen.
2. MESSMODUS
Wählen Sie den gewünschten Messmodus. Dazu müssen Sie genau wissen, wie er sich unter den aktuellen Bedingungen verhält.
3. WISSEN, WAS SIE WOLLEN
Stellen Sie sich vorher genau vor, wie die Helligkeitsverteilung im Bild aussehen soll.
4. PROBLEME SUCHEN
Schätzen Sie schnell ein, welche Probleme auftreten können, vor allem was den Dynamikbereich der Szene im Verhältnis zur Sensorcharakteristik angeht bzw. wenn das Licht schwach ist.
5. SCHLÜSSELFARBEN
Suchen Sie die Bereiche der Szene, die für die Helligkeit am wichtigsten sind, und legen Sie Prioritäten fest.
6. RISIKO DER BESCHNEIDUNG
Wenn der Dynamikbereich der Szene die Leistung des Sensors übersteigt, müssen Sie entscheiden, ob Sie Änderungen vornehmen, um einen Kompromiss bei der Belichtung zu finden, und/oder ob Sie sich eher auf die Nachbearbeitung verlassen.
7. MESSEN & BELICHTEN
Verwenden Sie den passenden Messmodus und korrigieren Sie nach oben oder unten, wenn nötig.
8. AUSWERTUNG
Bewerten Sie das Ergebnis auf dem Kamera-Display. Wenn Korrekturen nötig sind, fotografieren Sie erneut.
SCHLÜSSEL-ENTSCHEIDUNGEN
ZUERST WOLLEN WIR DIE ZUSAMMENFASSUNG VON SEITE 11 ETWAS ERLÄUTERN.
1. EINSTELLUNGEN
Bevor Sie fotografieren, müssen alle Kameraeinstellungen wie gewünscht vorgenommen sein:
• Messmodus: Wählen Sie zwischen Automatisch oder Manuell, wie Sie es wünschen.
• Dateiformat: Raw, Tiff oder JPEG oder eine Kombination aus Raw+JPEG
• Schnellansicht nach jeder Aufnahme (nur eine Empfehlung)
• Spitzlichtwarnung: Manche lenkt das ab, andere schätzen es als Soforthilfe, um diese für die Digitalfotografie typischen Belichtungsprobleme aufzudecken.
• Histogramm in Bereitschaft: Bei manchen Kameras überlagert das Histogramm das Bild und lenkt ab. Aber es ist praktisch, wenn es nur einen Klick entfernt ist.
2. MESSMETHODE
Sie müssen genau wissen, wie sich die eingestellte Messmethode verhält. Die meisten Kameras bieten die Auswahl zwischen mittenbetonter, Integral- und Spotmessung. Manche Kameras verwenden dabei sehr intelligente Methoden, bei denen zum Beispiel die Tonwertverteilung mit einer riesigen Datenbank aus vorher analysierten Bildern verglichen wird. Wenn Sie sich auf ein solches anspruchsvolles System verlassen wollen, sollten Sie in jedem Fall genau wissen, wie es sich bei Ihnen verhält. Falls es bei einigen Ihrer beliebtesten Einstellungen über- oder unterbelichtet, sollten Sie das vorher wissen, um bewusst damit umgehen zu können. Auch einfache Methoden sollten Sie in verschiedenen Situationen kennen. Es kann sein, dass Sie ständig korrigieren müssen, darum kommen wir in Schritt 7 noch einmal darauf zurück.
ENTSCHEIDUNGSFLUSS
3. WAS WOLLEN SIE?
Sie müssen eine klare Vorstellung haben, worum es in Ihrem Bild gehen soll – was hat Ihren Blick gefesselt, was gefällt Ihnen an der Aufnahme, was wollen Sie kommunizieren? Stellen Sie sich vor, wie hell das Bild sein soll und wie Sie die Helligkeit verteilen wollen. Das ist – natürlich – die Eine-Million-Euro-Frage.
4. MÖGLICHE PROBLEME
Untersuchen Sie die Szene auf mögliche Belichtungsprobleme. Denken Sie darüber nach, was Sie vor der Kamera haben, bevor Sie sich vom Messsystem ablenken lassen. Gibt es zum Beispiel eine sehr helle Stelle, die wahrscheinlich ausbrennen wird? Spielt das eine Rolle? Die meisten Probleme treten auf, weil der Dynamikbereich der Szene größer ist, als der Sensor mit einer Aufnahme festhalten kann.
5. SCHLÜSSELFARBEN
Legen Sie die wichtigen Motive fest und wie hell sie sein sollen. In einem Porträt ist das wahrscheinlich das Gesicht der Person, aber das hängt von Ihrer kreativen Ader ab. Bei einem Gesicht – ist es weiß, asiatisch (das heller als die Mitteltöne sein muss), oder schwarz (das dunkler sein muss als die Mitteltöne)? Die Schlüsselfarbe – oder Key-Farbe – kann nur einen Teil des Hauptmotivs ausmachen, in manchen Bildern ist sie außerdem in einem anderen Bereich des Bildes zu finden, zum Beispiel im Hintergrund.
6. BESCHNEIDUNGEN? KONFLIKTE?
Falls es zwischen Schritt 4 und 5 einen Konflikt gibt, müssen Sie dafür eine Lösung finden. Entweder Sie ändern das Licht oder die Komposition oder Sie verlassen sich auf eine besondere Bildkorrektur in der Nachbearbeitung. Oder beides. Wenn der Hintergrund bei einem Gegenlicht-Porträt zum Beispiel stark beschnitten werden muss, um das Gesicht richtig zu belichten, können Sie zum Beispiel die Tiefen im Vordergrund auffüllen, die Beschneidung im Hintergrund akzeptieren oder die Bildkomposition ändern. Oder noch ein Beispiel: Wenn ein kleiner heller Punkt, der für das Bild an sich nicht wichtig ist, Ihre Belichtung durcheinanderbringt, können Sie evtl. einen neuen Bildausschnitt wählen oder ihn aus dem Bild herauslassen bzw. später herauslöschen.
Eine Kompromissbelichtung heißt, dass Sie entweder zu dunkle Tiefen oder überbelichtete Lichter akzeptieren, was je nach gewünschtem Effekt durchaus akzeptabel sein kann (siehe Schritt 3).
Die dritte Möglichkeit, die zuweilen mit einem Belichtungskompromiss kombiniert werden kann, ist, sich auf die Nachbearbeitung zu verlassen, zum Beispiel das Montieren mehrerer Aufnahmen oder gar HDR (High Dynamic Range), wozu Sie wiederum mehrere Belichtungen brauchen, die Sie digital zu einer überblenden.
7. MESSEN
Das hängt von der Art und Weise ab, wie Sie am liebsten mit Ihrer Kamera arbeiten. Eine Methode wäre, die Schlüsselfarben zu messen und einzustellen, zum Beispiel mit einer Spot-Messung, um die Werte in einem Bereich genau zu ermitteln. Oder Sie entscheiden anhand Ihrer Erfahrungen, wie viel stärker oder weniger stark Ihre Belichtung vom Standard abweichen muss, und stellen das mithilfe der Belichtungskorrektur entsprechend ein.
8. AUSWERTEN UND ERNEUT FOTOGRAFIEREN
Schauen Sie sich Ihr Bild auf dem Kameradisplay genau an und korrigieren Sie dann die Einstellungen, wenn nötig – und wenn die Zeit ausreicht. Entscheidend ist schließlich die Art von Shooting und die entsprechende Situation, in der Sie sich befinden. Wenn die Action um Sie herum schnell abläuft und sich schlecht vorhersagen lässt, ist es sicher keine gute Idee, jede Aufnahme sofort nach der Belichtung zu prüfen. Wenn Sie jedoch eine Landschaft aufnehmen, während die Sonne langsam untergeht und Sie viel Zeit haben, können Sie sich diese Auswertung leisten und mehrere Varianten desselben Bildes aufnehmen.
ENTSCHEIDUNGSFLUSS
Die digitale Fotografie lässt sich in drei Bereiche unterteilen: Ihre Aufnahmetechnik, Ihren persönlichen Stil und die Nachbearbeitung – und genau darum geht es in den Hauptkapiteln in diesem Buch. Der dritte Abschnitt, Nachbearbeitung, mag auf den ersten Blick etwas merkwürdig erscheinen, schließlich dreht sich hier ja eigentlich alles um die Belichtung. Dennoch ist diese äußerst digitale Phase sehr eng mit der Aufnahme an sich verbunden, aus zwei Gründen. Zum einen gibt es das Raw-Format, das immer empfehlenswert ist und das unter anderem den Vorteil hat, dass Sie später zum Bild zurückkehren und die Belichtung einstellen können. Außerdem betreffen viele der neueren, anspruchsvolleren Bearbeitungstechniken direkt die Belichtungsentscheidung, sodass Sie bei einer Einstellung fotografieren können, die Sie sonst nie in Betracht gezogen hätten.
Dennoch ist die Abfolge Technik-Nachbearbeitung nicht unbedingt dieselbe, wie Entscheidungen getroffen werden. Auf den vorangegangenen Seiten haben wir alle wichtigen Belichtungsentscheidungen betrachtet, die Sie treffen müssen, manche davon ganz in Ruhe lange vor der Aufnahme, andere innerhalb von Sekundenbruchteilen vor dem Abdrücken. Ich habe den gesamten Entscheidungsfluss einmal in der logischen Reihenfolge zusammengestellt. Wenn er etwas gruselig aussieht, dann nur, weil ich den Prozess der Belichtung in Schritte unterteilt habe, die in Wirklichkeit sozusagen sofort geschehen.
Das beginnt damit, dass Sie alle Kameraeinstellungen und Messmodi eingestellt haben müssen, und variiert je nach allgemeiner Beleuchtung. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich wahrscheinlich bei schwachem Licht fotografieren werde, schalte ich den automatischen ISO-Wert der Kamera mit einer Obergrenze für die Belichtungszeit entsprechend dem Objektiv ein. Wenn ich mit Stativ arbeite, lasse ich die Obergrenze weg.
Dann folgt die überaus wichtige Entscheidung darüber, wie die Szene aussehen soll. Diese ist zutiefst persönlich und gleichermaßen ein grundlegender Zustand wie eine bewusste Entscheidung.
Danach kommen die beiden wichtigen Entscheidungen für die Szene, nach denen sich alles richtet. Zuerst müssen Sie festlegen, welcher Farbbereich der wichtigste in der Szene ist – der bei einer bestimmten Helligkeit eingefangen werden soll. Es kann sein, dass mehrere Farben um Bedeutung ringen, aber die erste wichtige Entscheidung steht: »Wie hell muss dieser kritische Bereich sein?«
Die zweite Entscheidung – die sofort danach zu fällen ist – dreht sich um Probleme, die Sie lösen müssen. Sie müssen also die Szene und die Situation sehr schnell bewerten.
Ist das erledigt, müssen Sie sich um Probleme mit Dynamikbereich und Beschneidung bemühen. Im nächsten Kapitel betrachten wir den Dynamikbereich und die drei Bedingungen, die eventuell für Probleme sorgen. Bei geringem Dynamikbereich werden sich kaum Probleme ergeben; wenn der Bereich der Szene zu dem des Sensors passt, ist alles in Ordnung, aber das hängt davon ab, für welche Schlüsselfarbe Sie sich entscheiden. Ist der Dynamikbereich groß, haben Sie bestimmt ein Problem mit der Beschneidung.
Wenn es also keinen Konflikt zwischen Schlüsselfarbe und Beschneidung gibt, belichten Sie auf die Farbe. Bei einem Konflikt bieten sich drei Lösungen an. Erstens können Sie einen Kompromiss bei der Belichtung akzeptieren und dabei die beste Lösung suchen. Zweitens können Sie Änderungen vornehmen, meist an Licht oder Bildkomposition. Drittens – eine digitale Lösung – können Sie bereits vor der Aufnahme die Bildbearbeitung einplanen, denn mit vielen Techniken lassen sich Farben korrigieren, die sonst womöglich gelitten hätten.
Bewerten Sie schließlich die Aufnahme, wenn dazu genügend Zeit ist, und wenn sie nicht perfekt aussieht, korrigieren Sie die Einstellungen und fotografieren Sie erneut … wie gesagt, wenn Sie Zeit haben.
REGLER FÜR DEN ENTSCHEIDERDie Belichtung reduziert sich im Wesentlichen auf drei Einstellungen – Belichtungszeit, Blende und ISO – alle leicht zugänglich im Menü der digitalen SLRs.
HELLIGKEIT, BELICHTUNG DENKEN
Diesen Abschnitt habe ich noch in letzter Minute eingefügt, nachdem ich mich intensiv mit Lesern unterhalten hatte. Dabei wurde mir klar, dass es manchen etwas schwerfällt, zwischen Helligkeit, Belichtung und Blendenstufen umzuschalten. Das hat mit der Arbeitsmethode zu tun und ja, es gibt Unterschiede. Fotografen, vor allem Profis, haben eine eigene Art und Weise entwickelt, über Licht und Belichtung nachzudenken, denn sie mussten sich idiotensichere Methoden ausdenken, die sie mit wachsender Erfahrung immer weiter verfeinerten. Wie Sie auch immer Ihre Entscheidungen treffen, alles läuft darauf hinaus, zu wissen, welche Kameraeinstellungen zu welchen Ergebnissen führen. Die einfachste und verständlichste Einheit ist die Stufe. Sie können es auch komplizierter haben und über EV sprechen (Belichtungswerte, Exposure Value) oder, für mich noch schlimmer, über Zonen. Stufen sind aber ganz einfach. Die gehen immer einen Wert nach unten oder oben, wenn es um Blende, Belichtungszeit oder ISO-Wert geht.
Diese Stufen zur Helligkeit ins Verhältnis zu setzen, ist auch nicht schwer (und meist muss man auch nicht übergenau sein). Das Diagramm unten ist eine einfache Übersetzung, aber ganz präzise ist sie nicht. Für die meisten Zwecke reicht sie jedoch aus. Schließlich machen wir an dieser Stelle Fotos und bearbeiten sie nicht in Photoshop. Ich stelle mir Helligkeit gern als Prozentwert vor: 0% ist Schwarz, 100% ist Weiß und 50% ist das Grau in der Mitte – Mitteltöne, Durchschnitt. Später betrachten wir auch Graukarten und warum sie 18% Weißgehalt haben, aber 50% sind viel intuitiver. Außerdem ist das ein Maß für die Mitteltöne am Computer in Photoshops HSL-System (oder einer anderen Bildbearbeitungssoftware).
Ganz krude könnte man auch sagen, ein wenig heller ist 1/3 Stufe, noch mehr heller ist 1/2 Stufe, viel heller ist 1 Stufe, deutlich heller sind 2 Stufen etc. Falls es Ihnen jetzt so vorkommt, als wäre ich hier etwas nachlässig, während ich in anderen Bereichen des Buches eher zwanghaft genau bin, liegt das vielleicht daran:
Ich muss immer wieder betonen, wie wichtig Relationen sind. Wenn Sie ausreichend Zeit haben und die Kamera auf einem Stativ steht, können Sie nach Herzenslust messen und alle Werte auf 1/3 Belichtungsstufe genau einstellen. Aber in der Fotografie ist es meist nicht so, Sie sind draußen und müssen innerhalb von Sekunden entscheiden, es muss also schnell und einigermaßen korrekt zugehen.
Ich kann gar nicht genug empfehlen, eine Szene genau anzuschauen, relativ helle Bereiche auszumachen, intuitiv zu wissen, was diese Helligkeit ist und wie sie sich in Belichtungsstufen umsetzen lässt. Mit etwas Übung finden Sie das leicht heraus, vielleicht können Sie es schon. Wenn nicht, wird es Zeit zum Üben!
SCHNELLE ENTSCHEIDUNGENIch habe mal aufgeschrieben, wie ich die Szene gesehen und kurz über die Belichtung nachgedacht habe. Auf das Wesentliche reduziert waren Meer und Himmel ein Farbblock für mich, die weißen Hemden der Männer im Schatten der zweite und die beiden weißen Hemden in der Sonne der dritte. Den schwarzen Sand erkannte ich als vierten Farbblock. Fürs Verständnis, ich habe nur ein paar Sekunden über diese Belichtung nachgedacht. Die schematische Darstellung zeigt die Blöcke und ihre Helligkeiten (in Prozent), dazu noch die Abweichungen in Belichtungsstufen vom Durchschnitt.
Der schnelle Entscheidungsprozess lief so ab:1. Achten Sie auf Beschneidungen in dem grellweißen Hemd, aber machen Sie es trotzdem so hell wie möglich.2. Meer und Himmel sind mehr oder weniger gleich, beide müssen recht hell sein.3. Die weißen Hemden im Schatten sind nicht so wichtig, sie können auf der Helligkeitsskala irgendwo landen.4. Der schwarze Sand ist nicht wichtig und wird ohnehin dunkel.
Ich wusste auch auf den ersten Blick, dass diese Mischung aus Tonwerten irgendwo im Durchschnitt landen sollte und dass ich mit dem Smart-Messmodus der Kamera verhindern würde, dass die zwei weißen Hemden ausbrennen. Ich wusste das, weil ich meine Kamera kenne.
FALLSTUDIE 1
Das ist die erste von drei Fallstudien zum Entscheidungsfluss. Im weiteren Verlauf des Buches finden Sie noch einige, von denen sich jede mit einem anderen Aspekt der Belichtung beschäftigt. Der Einfachheit halber habe ich mich für dieses Bild als erstes Beispiel entschieden, der Dynamikbereich der Szene passt zu Kamera und Sensor.
Dies war eine Auftragsarbeit für Sony über Fußball in verschiedenen Ländern. Hier fotografierte ich zwei junge Spieler – die Söhne unserer Nachbarn in Cartagena, Kolumbien. Ich nahm sie mit in die Altstadt und bat sie, einfach bei gutem Licht etwas zu kicken.
Ich wusste vorher schon ziemlich genau, wie die Sonne fallen würde, denn ich habe in diesem alten spanischen Kolonialhafen schon viel fotografiert. Ich kannte also das Zeitfenster von ca. einer Stunde, in dem die Schatten in diesen Straßen von West nach Ost länger wurden (viele sind von strukturierten und bemalten Mauern umgeben).
Ich war auf eine Situation aus, in der lange Schatten ein Muster auf die Mauer werfen würden, sodass ich wenigstens einen der Jungen mit Seitenlicht vor einem Schatten einfangen konnte – mit seinem übergroßen Schattenwurf an der Wand. Für die Belichtung hieß das, ich suchte nach einer Aufnahme mit starkem Kontrast, allerdings eher im Seiten- statt im Gegenlicht, um den Dynamikbereich des Sensors nicht zu überschreiten. In jedem Fall musste ich Beschneidungen in den Lichtern vermeiden und ein farbintensives Bild schaffen.
Im Prinzip bekam ich von den Werten von der Wand (nicht im Schattenbereich) genau, was ich brauchte, ich musste jedoch auf die weißen Teile in der Kleidung der Kinder achten, denn die würden leicht ausbrennen. Schärfentiefe war hier kein Problem, denn die Jungen standen nah an der Wand – wohl jedoch die Belichtungszeit. Ich verwendete darum eine Mehrbereichsmessung mit einer Belichtungskorrektur von -1/3.
ENTSCHEIDUNGSFLUSSDies ist der einfachste Entscheidungsfluss überhaupt, denn ich folge dem Hauptstrang und muss noch nicht einmal in die Beschneidungs-Schleife abbiegen.
ERGEBNISDieses Bild ist das Ergebnis der hier gezeigten Fallstudie. Das Diagramm unten zeigt, wie die Mitteltöne gefunden wurden, als der Fokuspunkt einmal feststand.
FOKUSPUNKTDer Fokuspunkt des Bildes ist weiß umrissen.
RASTERANALYSEDieses Schema zeigt die Helligkeit der Bildbereiche.
FOKUSPUNKTDer Fokuspunkt wird als Mittelton belichtet.
WEITERE MITTELTÖNEDieselben Mitteltöne sind auch in anderen Bildbereichen vorhanden.
FALLSTUDIE 2
Ich habe dieses zweite Beispiel ausgewählt, denn dabei hatte ich so gut wie keine Zeit für eine Belichtungsentscheidung. Es hing viel von den bereits vorhandenen Kameraeinstellungen ab und davon, dass ich meine Kamera sehr genau kannte – genau das ist hier der Punkt. Ich möchte Ihnen aber zeigen, dass auch so gut wie keine Zeit noch ausreicht, um ein gutes Bild zu machen.
Das Foto entstand in einem Konvent in Sagaing, einer buddhistischen Stadt in der Nähe von Mandalay, Myanmar. Das Wetter an diesem späten Nachmittag war ungewöhnlich und sehr klar, mit sehr starkem Kontrast. Die Szene in diesem Raum war schon allein wegen des Lichts sofort atemberaubend. Es gab da diesen Mix aus starkem Kantenlicht durch die Sonne, die durchs Fenster in den Konvent schien, und einen ähnlich attraktiven Reflexionseffekt von vorn auf die Novizin, wo der Sonnenstrahl den Boden traf (die Stelle ist nicht im Bild enthalten).
Meine Priorität war, die Lichter nur auf einer Seite der Person zu halten – auf ihrer Stirn, dem Oberteil der Kleidung und dem Schal. Ich wollte hier auf keinen Fall eine Beschneidung. In dieser kontrastreichen Szene musste ich entscheiden, ob das reflektierte Licht links von ihr gut im Bild ankommen würde. Es musste nicht durchschnittlich belichtet werden – mit einer Stufe weniger würde es gehen. Außerdem hoffte ich (und erwartete), dass die Details in den Schatten hinten im Raum gerade noch zu sehen sein würden.
ENTSCHEIDUNGSFLUSSDer hervorgehobene Strang zeigt, wie ich mich mit einem Kompromiss mit dem hohen Dynamikbereich auseinandergesetzt habe, wobei das Licht allgemein gut ist, für schwaches Licht musste ich also nicht belichten.
KONTRASTVERGLEICHHier sehen Sie zwei Alternativen, beide sind jedoch gelungen. Um sie hier zu zeigen, habe ich sie in ACR (Adobe Camera Raw) mit dem Belichtung-Regler bearbeitet und emuliert, wie wichtig Ihre Belichtungsentscheidungen sein können. Für das Foto oben war die Schlüsselfarbe der stark beleuchtete obere Teil der Bekleidung der Nonne Diese Belichtung erhält die Struktur des Stoffes, allerdings auf Kosten der Schattendetails und von Details im Gesicht. Hier unten ist die Belichtung heller, dadurch öffnen sich die Schatten und mehr Details im Gesicht werden erkennbar. Hier leiden allerdings die Lichter durch Beschneidungen in den Spitzlichtern, vor allem seitlich am Gesicht.
FALLSTUDIE 3
Diese Situation ist ganz anders als bei den vorangegangenen Bildern, denn hier war alles kontrollier- und planbar. Das Foto gehört zu einer Serie von Innenaufnahmen in einem alten Haus im spanisch-maurischen Stil in der südamerikanischen Stadt Cartagena, Kolumbien. Bei Innenaufnahmen ist es recht einfach, den Dynamikbereich für den Kamerasensor gering genug zu halten, indem man den Winkel sorgfältig wählt und helle Fenster vermeidet oder indem man Licht hinzufügt.
Allerdings werden die Aufnahmen dann auch schnell langweilig, und hier wollte ich etwas Dynamik im Bild haben. Eine Lösung war eine Nahaufnahme mit großem Weitwinkelobjektiv mit der Statue im Vordergrund. Eine andere war, die Eingangstür leicht zu öffnen, um etwas Sonnenlicht hereinzulassen. Dadurch würde der Dynamikbereich zwar sehr hoch, aber mit einer Belichtungsreihe aus drei Bildern und deren Umbau in HDR konnte es funktionieren. Ich trieb die Lichtsituation also bewusst ins Extreme, um einen stimmungsvollen Effekt zu erzielen, obwohl ich wusste, dass ich das Bild hinterher nachbearbeiten musste, um das Ergebnis zu erzielen, das ich mir vorgestellt hatte.
ENTSCHEIDUNGSFLUSSAuf jeden Fall HDR, also plante ich das ein.
SCHLÜSSELFARBEN GEFUNDENWenn ich die offene Tür und die Fenster ignoriere, die ganz klar zu hell sind, wird ein Bereich mit durchschnittlicher Helligkeit deutlich, den ich für die Belichtungsreihe verwenden wollte.
BELICHTUNGSREIHE AUS DREI AUFNAHMEN
FERTIGES BILD
So einfach. So wichtig. Die Belichtung richtig einzustellen, bleibt für eine Mehrheit der Fotografen die größte Sorge. In der Digitalfotografie ist es wichtiger als je zuvor: nicht nur, weil digitale Sensoren besonders nachtragend sind, wenn über- oder unterbelichtet wird, sondern auch, weil die Digitaltechnik mehr Gelegenheiten bietet, die Belichtung zu perfektionieren.
Die Grenzen werden von den Möglichkeiten mehr als wettgemacht; beide zusammen machen die Belichtung in der Digitalfotografie zu einem lohnenswerten Thema. Drei Bereiche sind gefragt: Technik, Geschmack und Nachbearbeitung. Wir beginnen hier mit der technischen Grundlage. Schauen wir uns an, wie ein Kamerasensor funktioniert, welche Rolle der Dynamikbereich (des Sensors und der Szene) spielt und wie Licht und Belichtung gemessen werden. All diesem liegt die Annahme zugrunde, dass es für jedes Bild eine Art von idealer Belichtungseinstellung gibt. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, allerdings kommen irgendwann Ihre kreativen Entscheidungen als Fotograf hinzu.
Ein Grund für dieses Buch ist die Tatsache, dass man bei digitaler Fotografie deutlich mehr beachten muss, wenn es an die Belichtung geht – wegen der Launen der Digitaltechnik und weil es so viel mehr Werte und Einstellungen gibt als bei Film. Angesichts dieser potenziellen Komplexität muss man beim ganzen Thema Belichtung einen klaren Kopf bewahren. Ein anderer Grund ist ehrlich gestanden, dass ich immer ganz perplex bin, welche seltsamen Ratschläge man zu Belichtung findet, speziell online. Viele kommen von Menschen, die eigentlich keine Fotografen sind, zumindest nicht im Sinne der Profifotografie. Es gibt immer mehr Experten für Bildbearbeitungssoftware und Kameratechnik, aber das ist für mich die völlig falsche Herangehensweise. Gewiss sollte doch die Fotografie zuerst kommen, oder? Zweck, Ideen, Vision, die Fähigkeit, lohnenswerte Motive wirkungsvoll aufzunehmen, so etwas. Von diesem – meinem – Standpunkt aus ist die Belichtung weniger das Herumfummeln an Knöpfen sondern eher das Arbeiten mit Licht und die Erkenntnis, was man von einem Bild erwartet.
Kehren wir für einen Augenblick zu dem erstaunlichen Paradox zurück, dass eine Entscheidung einerseits auf drei einfachen Werten basiert – Belichtung, Verschlusszeit und Empfindlichkeit – und dennoch gleichzeitig unendlich komplex ist.
LICHT AUF DEM SENSOR
Da fast alles bei der Belichtung irgendwie mit dem Sensor zu tun hat, lohnt sich ein Blick auf sein Inneres. Wie viel aber müssen Sie wissen? Wir sind Fotografen, keine Techniker (na ja, ein paar von uns vielleicht), und das Design und die Herstellung von Sensoren sind ziemlich kompliziert, ein vollständiges Verständnis ist daher sicher nicht möglich. Das ist oft ein Problem heute – digital zu arbeiten bedeutet, dass wir von schwer durchschaubarer Software, Firmware und Hardware abhängig sind. Abgesehen von der Komplexität der Technik halten sich Kamerahersteller natürlich bedeckt, was die inneren Vorgänge betrifft. Sie müssen ihre Produkte schützen und wollen natürlich keine Aufmerksamkeit auf Defizite lenken, die es immer gibt. Ich versuche hier zu behandeln, was nötig und relevant ist, rufe aber gleichzeitig zur Achtung auf.
Die Grundeinheit des Sensors ist das Bildelement, von denen jedes Licht für ein Pixel sammelt. Die meisten der heutigen High-End-DSLRs haben wenigstens 20 Millionen Pixel, einige Modelle überschreiten sogar die Marke von 50 Millionen Pixeln. Die Dichte der Bildelemente auf einem Sensor wird als Pixelpitch gemessen – als Abstand von der Mitte eines Pixels zu seinem Nachbarn. Je höher der Pitch, umso besser die Auflösung. Leider ist das Rauschen bei Sensoren mit kleinen Bildelementen stärker. Bildqualität ist daher ein Kompromiss aus Dichte und Größe der Bildelemente. Das Design kleiner Kameras ist deshalb besonders schwierig.
Wenn Licht auf den Sensor trifft, wird es als elektrische Ladung in den Bildelementen gespeichert. Ein Photon regt ein Elektron an und erzeugt eine Spannung. Die Spannung wird dann von einem Analog-Digital-Wandler (ADC) in digitale Daten umgewandelt. Das sind Monochrom-Daten, weshalb ein Mosaik-Filter oder Bayer-Sensor mit einem Muster aus Rot, Grün und Blau vor den Sensor kommt (doppelt so viel Grün wie Rot oder Blau, da das Auge für grüne Wellenlängen empfindlicher ist). Da hierbei zwei Drittel der Farbinformationen der Szene verloren gehen, muss der Prozessor der Kamera sie interpolieren.
Die für den gesamten Sensor erfassten, unterschiedlichen digitalen Werte der einzelnen Pixel können dann als Bild dargestellt werden. Ein normaler Computerbildschirm kann 256 Tonwerte von Schwarz bis Weiß anzeigen. Zwischen der Erfassung der rohen Bilddaten und der Speicherung eines Digitalbildes auf der Speicherkarte der Kamera gibt es noch mehr Verarbeitungsschritte. Jeder Hersteller hat seine eigenen Methoden, die alle darauf abzielen, Fehler zu korrigieren und dem Kunden, also Ihnen und mir, ein annehmbares Ergebnis zu liefern.
Was man sich jedoch merken muss, ist, dass Sensoren linear auf Licht reagieren. Das heißt ganz einfach, je mehr Licht es gibt, umso stärker laden sie sich elektrisch auf. In einem Diagramm ergibt das eine gerade Linie, was logisch ist. Wo ist also das Problem? Nun, unser eigenes visuelles System ist viel ausgefeilter und kulanter. Helle Lichter und tiefe Schatten verschwinden für uns nicht abrupt. Unsere Reaktion – und die von Film – ist nichtlinear, sodass wir Details in einem viel größeren Bereich von Tonwerten erkennen.
BESCHNEIDUNG VON SCHATTEN UND LICHTBeschneidung – dargestellt hier bei der Verarbeitung der Raw-Datei auf dem Computer – tritt plötzlich auf, wenn sich die Belichtung ändert, nicht schrittweise. Jede Belichtung ist hier eine Blendenstufe voneinander entfernt. Die blauen Bereiche zeigen komplett detaillose schwarze Teile des Fotos, während Rot auf reines Weiß hindeutet.
DAS MOSAIK-SYSTEMEin winziges Segment dieses Bildes der französischen Trikolore zeigt einzelne Pixel jeweils von einem Bildelement. Das aufgezeichnete Bild ist monochrom, nicht farbig, dem Sensor überlagert ist jedoch ein dreifarbiger Mosaik-Bayer-Filter. Aufgabe der Software ist es, aus dem Muster aus Rot, Grün und Blau anhand unterschiedlicher Helligkeiten die Originalfarben der Szene zu interpolieren.
BEGRIFFE
Ich denke, an dieser Stelle sollte ich ein Glossar der gebräuchlichsten Begriffe im Zusammenhang mit der Belichtung liefern. So gibt es einige Begriffe, mit denen die Menge an Licht beschrieben wird und die auf den ersten Blick ähnlich zu sein scheinen, aber dennoch wichtige Unterschiede aufweisen.
Seien Sie sich bewusst, dass diese Begriffe im Internet und sogar in einigen Programmen manchmal falsch benutzt werden. Programmierer brauchen Ausdrücke für das, was die verschiedenen Regler und Steuerungen machen, auch wenn das oft sehr komplex ist. Oft greifen sie auf ein naheliegendes Wort zurück, auch wenn dies etwas anderes bedeutet. Helligkeit ist so ein Beispiel. Sie gibt an, wie Auge und Hirn die reflektierenden Eigenschaften einer Oberfläche bewerten. Weißer Karton ist heller als grauer Karton. Bei der Software bezieht sie sich dagegen auf eine Einstellung, die entweder Weiß oder Schwarz hinzufügt – eine ganz andere Sache und ein anderes Ergebnis.
WAHRNEHMUNGSPSYCHOLOGIE
Man muss verstehen, was es bedeutet, wenn Licht auf das Auge oder den Kamerasensor fällt. Allerdings steht uns dabei die Wahrnehmungspsychologie im Weg. Unsere Augen und Hirne verarbeiten die Lichtinformationen ganz anders und viel intelligenter als ein Kamerasensor. Luminanz – die Menge an Licht, die ein Sensor treu und brav aufzeichnet – ist daher eine Kulmination des Physischen und des Wahrgenommenen.
Physische,messbare MengeWahrgenommene,subjektive Menge• Luminanz• Reflexionsgrad• Glanz• HelligkeitLUMINANZ, LEUCHTDICHTEDie Menge an Licht (genau genommen die Lichtstärke), die das Auge oder den Sensor von einer Oberfläche oder Lichtquelle erreicht. Im Prinzip die messbare Menge, die der Helligkeit am nächsten kommt; wird gemessen in Candela pro Quadratmeter (cd/m2).
BELEUCHTUNGSSTÄRKEDer Lichtstrom einer Lichtquelle, der auf eine Oberfläche fällt, pro Flächeneinheit, gemessen in Lux.
REFLEXIONSGRADDer Anteil des auf eine Oberfläche fallenden Lichts, der von ihr zurückgeworfen wird. Es ist eine messbare, physische Menge. Im Prinzip die Effektivität, mit der eine Oberfläche das auftreffende Licht weitergibt. Der Unterschied zwischen einer rein weißen und einer rein schwarzen Oberfläche im selben Licht ist nicht größer als 30:1 oder 4 Blendenstufen. Das mag wenig erscheinen, betont aber nur, dass die Menge an Licht, die auf unterschiedliche Teile einer Szene fällt, viel wichtiger ist. Ein Reflexionsgrad von 18% wirkt wegen der Nichtlinearität unserer Wahrnehmung für das Auge wie 50% – daher der Reflexionsgrad von 18% für eine Graukarte (siehe S. 58).
HELLIGKEITDies ist die wahrgenommene Luminanz, sie ist daher subjektiv und nicht exakt messbar. Mit diesem Wort beschreiben wir gewöhnlich die Menge an Licht, die wir sehen.
GLANZDies ist der wahrgenommene Reflexionsgrad. Er ist subjektiv wie die Helligkeit und der Versuch von Auge und Hirn, zu beurteilen, wie gut eine Oberfläche Licht reflektiert.
WERT (BELICHTUNG)Wenn man über das Messen von Licht redet, dann entspricht der Wert der Helligkeit.
WERTIn einer Kamera ist dies die Menge an Licht, die auf den Sensor fallen darf.
ÜBER- UND UNTERBELICHTUNGDiese Begriffe werden oft vage und subjektiv benutzt und bedeuten eher mehr (über) und weniger (unter) als ideal.
LICHTERDas obere Ende der Tonwertskala in der Szene oder im Bild. Es gibt keine exakte Definition des Punkts, an dem geschnitten wird. Manche meinen damit das obere Viertel des Bereichs, während es für andere nur die obersten Prozente sind. Beschnittene Lichter sind laut Definition diejenigen am ganz oberen Ende, die völlig überbelichtet sind.
SCHATTENWie bei den Lichtern, nur am entgegengesetzten Ende der Skala. Die Benutzung des Wortes variiert.
BESCHNEIDUNGVölliger Verlust an Informationen in einem Pixel aufgrund von extremer Über- oder Unterbelichtung.
SCHWARZPUNKTIn einem Digitalbild der Punkt am unteren Ende der Tonwertskala, der völlig schwarz ist – 0 auf der Skala von 0 bis 255. Sie entscheiden beim Vearbeiten eines Digitalfotos, wo dieser Punkt sein sollte.
WEISSPUNKTIn einem Digitalbild der Punkt am oberen Ende der Tonwertskala, der völlig weiß ist – 255 auf der Skala von 0–255. Sie entscheiden beim Verarbeiten eines Digitalfotos, wo dieser Punkt sein sollte.
DYNAMIKBEREICH, -UMFANGDas Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Luminanzwerten in einer Szene oder einem Bild.
KONTRAST UND KONTRASTREICHOft synonym zu »Dynamikbereich« verwendet, auch wenn es nicht unbedingt das Gleiche bedeutet. In den Tagen des Films war es das jedoch, daher die Verwirrung. Kontrast ist das Verhältnis zwischen hohen und niedrigen Luminanzwerten, umfasst aber nicht unbedingt den ganzen Tonwertbereich. Üblicherweise bezieht es sich auf das Verhältnis mit Ausnahme der obersten Lichter und der tiefsten Schatten.
KEY, SCHLÜSSELEs gibt hier zwei Bedeutungen. Eine bezieht sich darauf, welcher Teil des Helligkeitsbereichs in einem Bild benutzt wird, daher High-Key oder Low-Key. Die andere bezieht sich auf einen Tonwertbereich (oder eine Zone) mit besonderer Bedeutung.
BELICHTUNG UND RAUSCHEN
Das Fotografieren ist einer der großen Durchbrüche, die die digitale Technik gebracht hat – das Spektrum dessen, was in Fotos festgehalten werden kann, hat sich dramatisch ausgeweitet. Dazu erhöht man die Empfindlichkeit des Kamerasensors beziehungsweise, praktisch ausgedrückt, erhöht man den ISO-Wert. So weit, so wundersam gut. Allerdings hat diese Entwicklung Folgen: das Rauschen.
Rauschen kennen Sie aus dem Radio, und auch dort kann man ihm nichts Gutes abgewinnen. Manche Leute vergleichen es mit der Körnung im Film. Der Unterschied ist aber, dass die Körnung durch die Struktur der Emulsion bedingt ist und daher ganz annehmbar sein kann (warum sonst gibt es Softwareunternehmen, die anbieten, sie zu Digitalfotos hinzuzufügen!). Rauschen ist ein Abtastfehler, das heißt, wenn die Bildelemente nur wenige Photonen einfangen, gibt es nicht genügend exakte Bildinformationen.
Betrachten Sie ein stark verrauschtes Bild bei 100% Vergrößerung, ist es schwer, das Rauschen von den wirklichen Details in der Szene zu unterscheiden – die Stelle, an der sie nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind, wird »Grundrauschen« genannt.
In einem belebten, dunklen Teil des Bildes ist Rauschen nicht so schlimm. Das klingt vielleicht paradox, liegt aber daran, dass das Rauschen visuell betrachtet als Detail durchgehen könnte. Auffällig und störend wird es in Bildbereichen, die eigentlich glatt sein sollten: Himmel, Wände, sanfte Gesichtshaut. Es gibt allerdings einen kompositorischen Trick, um es dort zu reduzieren – vermeiden Sie in Ihren Bildern glatte Mittel- bis dunkle Töne.
Setzen Sie die ISO-Empfindlichkeit nur so hoch wie nötig. Allerdings ist es keine Lösung, bei einem sauberen, geringen ISO (z. B. 100 oder 200) zu fotografieren und dann nachträglich die Schatten aufzuhellen – das Rauschen wird trotzdem sichtbar.
Allerdings tut sich bei den Kamerasensoren Bemerkenswertes. Am offenkundigsten und bekanntesten ist der massive Anstieg der möglichen ISO-Empfindlichkeit – die D4 von Nikon und die Alpha 7S Sony können z. B. auf ISO 409.600 gestellt werden; andere Hersteller nicht weit dahinter. Wie viel davon ist nur Marketing? Professionell gesehen nicht viel. Vielleicht abgesehen vom höchsten Wert, der sicher verrauscht ist, sind die Ergebnisse durchaus akzeptabel und selbst ISO 409.600 liefert ein annehmbares Bild.
ABLAUF BEI SCHWACHEM LICHTProbleme mit dem Rauschen treten fast immer dann auf, wenn bei schwachem Licht fotografiert wird. Man muss daher bei der Belichtung besondere Überlegungen anstellen – mit anderen Worten, eine Schleife für schwaches Licht in den Entscheidungsfluss aufnehmen (siehe S. 14–15).
BEI NÄHEREM HINSEHENDiese Details stammen von einem Bild, das von einer Kamera mit ausgezeichneter Rauschunterdrückung bei verschiedenen ISO-Werten aufgenommen wurde – der Nikon D4s. Der maximale ISO-Wert der Kamera sind bemerkenswert hohe ISO 409.600, zu sehen hier ohne Rauschentfernung durch die Raw-Software.
NEUE BELICHTUNGSSTRATEGIE FÜR HOHEN ISO
Da Sensoren inzwischen radikal besser auf schwaches Licht reagieren, bieten die neuesten High-End-Kameras viel entspanntere Belichtungsmöglichkeiten als bisher. Die Grundlagen der Elektronik besagen, dass jede Zunahme der Verstärkung (was ein höherer ISOWert bewirkt) ein gewisses Rauschen auslöst. Die technische Entwicklung sorgt aber dafür, dass Sie es mit einer High-End-Kamera bis zu einem gewissen Punkt nicht merken. Das Abschätzen des Rauschens ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch dessen, was Sie und Ihr Publikum erwarten. Ich persönlich habe drei Kategorien: Nummer eins ist »Ich kann keinen Unterschied feststellen«, Nummer zwei ist »Ich kann es tolerieren« und Nummer drei ist »Ich akzeptiere es nur, wenn das Bild wichtig ist«.
Entsprechend meiner Einschätzung sehe ich mit meiner Kamera (einer Nikon D4s) keinen substanziellen Unterschied zwischen ISO 100 und etwa ISO 800, solange das Bild aus »normaler« Entfernung betrachtet wird. Natürlich gibt es bei 100% Vergrößerung einen sichtbaren Unterschied, aber trotzdem wurde die Rauschgrenze angehoben. Dadurch bekomme ich viel mehr Möglichkeiten hinsichtlich der Verschlusszeit und der Blende, wie Sie beim Belichtungsdreieck auf den Seiten 44–47 noch sehen werden.
Man muss jedoch realistisch bleiben und darf sich nicht einbilden, dass das Rauschen einfach erst bei einem höheren ISO-Wert beginnt. Für diese Erscheinung wurde der Begriff »ISO-Invarianz« geprägt, der aber so nicht zutrifft. Ein anderer beliebter Mythos lautet, dass man den ISO-Wert lieber nicht anheben und stattdessen unterbelichten und das Signal später bei der Verarbeitung auf dem Computer verstärken sollte. In Photoshop oder Lightroom würde man dazu den ungünstig benannten Belichtung-Regler erhöhen. Es wird argumentiert, dass hierbei die Lichter nicht beschnitten werden. Das stimmt schon, allerdings entstehen dabei auch Artefakte in den Schatten, die normalerweise inakzeptabel sind, wenn man eine anständige Bildqualität wünscht. Deshalb gibt es ja die ISO-Steuerung an der Kamera überhaupt.
Die Serie der 100%-Bilder bringt es zum Vorschein. Eine leichte Unterbelichtung – etwa um 1 oder 2 Blendenstufen – hat ihre Meriten, da die Lichter geschützt werden und an den dunkleren Bereichen bei der Verstärkung während der Raw-Nachbearbeitung nicht viel Schaden entsteht. Starke Unterbelichtung schadet dem Bild hingegen mehr, als es ihm nützt, und mehr als 2 Blendenstufen tiefer sind im Allgemeinen keine gute Idee.
Das hängt jedoch alles von der Leistung Ihres Kamerasensors ab. Bevor Sie also mit Unterbelichtungen arbeiten, müssen Sie vor wichtigen Aufnahmen unbedingt Tests durchführen. Seien Sie sich außerdem bewusst, dass die Lichterwarnung der Kamera ihre Informationen aus einem JPEG bezieht, das aus der Raw-Datei abgeleitet wurde, und nicht von der Raw-Datei selbst. Es gibt daher vermutlich weniger Beschneidung, als angedeutet wurde.
BEI SCHWACHEM LICHTDiese Details zeigen das Ergebnis eines unterbelichteten Bildes, das bei ISO 100 aufgenommen und anschließend in der Raw-Konvertierung »korrigiert« wurde. Wird mit dieser Kamera (Nikon D4s) um 1 oder 2 Blendenstufen unterbelichtet, werden die Lichter geschützt und die dunkleren Bereiche können ohne Schaden aufgehellt werden. Mit zunehmender Unterbelichtung jedoch führt das Aufhellen des Bildes zu mehr Artefakten in den Schattenbereichen, als wenn man gleich mit einem äquivalenten, höheren ISO-Wert fotografiert. In diesem Fall (bedenken Sie aber, dass unterschiedliche Kameras verschieden reagieren) ist es besser, gleich bei ISO 800 zu fotografieren, als ein Bild bei ISO 100 um 3 Stufen unterzubelichten und dann die Belichtung während der Nachbearbeitung zu »normalisieren«.
DYNAMIKUMFANG DES SENSORS
Nichts schlägt die Kombination aus Kamerasensor und Szene, die perfekt zueinanderpassen. Bei diesem Argument folgt der technische Aspekt dem philosophischen, weil bei jedem Abbildungssystem die Ausrüstung (in diesem Fall die Kamera) idealerweise 100 Prozent ihrer Möglichkeiten nutzt, um die Szene vor ihr aufzunehmen. Alles andere wäre ein Verlust an Qualität. Es gibt viele Softwarelösungen zum Wiederherstellen, Ändern, Verbessern und Erweitern des Bildes, und in Kapitel 5 werden wir diese auch einsetzen, doch merken Sie sich, dass diese immer einen Preis haben. Ja, die Algorithmen, die verlorene Lichter, Details in den Schatten und Defizite im Tonwertumfang ausgleichen, vollbringen kleine Wunder, aber ziehen gleichzeitig auch immer kleinere und manchmal größere Verluste nach sich. Die höchste Bildqualität in der Digitalfotografie erreicht man, wenn der volle Dynamikumfang des Sensors den vollen Bereich der Szene einfängt. Das ist nicht immer möglich, bleibt aber der Idealfall.
Eine gute DSLR hat heutzutage einen Dynamikumfang von etwa 10–14 Blendenstufen oder zwischen etwa 1.000:1 und 16.000:1. Das heißt, ein Bild kann ohne Beschneidung Helligkeitsstufen enthalten, die 10–14 Blendenstufen entfernt liegen. Der Dynamikumfang eines Sensors hängt im Prinzip von zwei Dingen ab – zwei Grenzen. Eine davon ist die Kapazität der einzelnen Bildelemente, Elektronen aufzunehmen. Je größer der Bereich des Bildelements, umso besser ist sie. Moderne High-End-DSLRs haben Kapazitäten von etwa 7.000–10.000 Elektronen. Auf der anderen Seite wird die Grenze durch das Rauschen gesetzt. Die Stelle, an der das Rauschen nicht mehr von den echten Details unterschieden werden kann, heißt Grundrauschen. Moderne DSLRs haben ein Grundrauschen von etwa 4–8 Elektronen. Die Gesamtkapazität geteilt durch das Grundrauschen ergibt den Dynamikumfang.
Liebe Film-Enthusiasten, ich fürchte, das ist viel besser als der Dynamikumfang von Diafilm, vor allem wegen des Verlusts an Details in den Schatten aufgrund der Körnung. Natürlich hat Film andere Vorzüge, und der schlechtere Dynamikumfang wird speziell durch zwei Dinge ausgeglichen. Eines ist das bessere Verhalten in den Lichtern und das andere ist, dass die Körnung potenziell angenehmer ist als digitales Rauschen. Das ist völlig subjektiv, aber Generationen von Fotografen haben akzeptiert, dass die Körnung unter bestimmten Umständen als Teil der Textur des Bildes betrachtet werden kann. Bei Rauschen ist diese Toleranz eher unwahrscheinlich.
DYNAMIKUMFANGDer Dynamikumfang eines Sensors ist die Differenz zwischen der Gesamtkapazität (der maximalen Anzahl an Elektronen, die jedes Bildelement aufnehmen kann) und dem Grundrauschen (der Stelle, an der das Rauschen alle Details des Motivs verschluckt). Das Grundrauschen wird ausschließlich durch das Ausleserauschen bestimmt, das Schrotrauschen dagegen, das mit dem zufälligen Auftreffen der Photonen zusammenhängt, ist mit dem Signal verbunden und reduziert so in der Praxis den Dynamikumfang weiter.
DEN BEREICH ÜBERSCHREITENDieses Foto, aufgenommen im Taj Mahal, enthält Extremwerte von Hell und Dunkel, sowohl im sonnendurchfluteten Inneren mit seinen strahlenden Lichtern und tiefen Schatten als auch in den beiden Personen, die in Schwarz und Weiß gekleidet sind. Der hohe Dynamikumfang ist etwas außerhalb des Dynamikbereichs der Kamera, sodass genau entschieden werden muss, wo man die Belichtung platziert. Ich hielt es in diesem Fall für besser, eine leichte Beschneidung in den Lichtern zu erlauben (hier rot dargestellt), da auf diese Weise die Details in der schwarzgekleideten Person erhalten bleiben und sie nicht zu einer nichtssagenden Form wird. Man könnte die Schatten zwar in der Nachbearbeitung öffnen, muss aber aufpassen, dass dabei das Rauschen nicht den Inhalt übertönt.
ENTSCHEIDUNGSFLUSS BEI BESCHNEIDUNGWenn der Dynamikumfang der Szene denjenigen Ihres Sensors überschreitet, muss jede Belichtungsentscheidung einen Umweg über die Schleife mit den Beschneidungslösungen nehmen (siehe S. 14–15).
LICHTERBESCHNEIDUNG UND -ABFALL
Der Verlust von Bilddetails ist ein großes Problem bei der Belichtung und kommt noch vor den ganzen Feinheiten in den Mitteltönen. In den Lichtern sind verloren gegangene Details immer deutlich auffälliger und sehen für die meisten Leute schlimmer aus als Verluste in den Schatten. Außerdem besteht immer ein größeres Risiko, dass sie auftreten. In der Digitalfotografie wird dies meist Lichterbeschneidung genannt. Das ist durchaus passend, weil dieser Effekt bei Überbelichtung mit einer Digitalkamera sehr plötzlich auftritt, die Lichter wirken wie weggeschnitten.
An diesem oberen Ende können sich digitale Lichter ganz unerwartet verhalten und visuell sehr unangenehm sein. (Ich weiß, dass das subjektiv ist und man das auch kreativ ausnutzen könnte, aber dazu kommen wir im nächsten Kapitel.) Bei einer Überbelichtung neigen die Lichter dazu, sehr hart und offensichtlich zu verschwinden, anders als es bei Film wäre. Es ist auch härter, als wir es wahrnehmen. Die S-Kurve, die man vom Fotografieren mit Film kennt, verkörpert nicht nur die Reaktion von Film, sondern auch die von Auge und Hirn. Dies ist die Kurve, die in der Kamera auf ein lineares Raw-Bild angewandt werden muss, damit es akzeptabel aussieht. Bei Film wird das obere Ende der Kurve als Schulter bezeichnet, während das untere der Boden ist.
Digital spricht man eher vom Abfall – im Prinzip bedeutet dies ebenfalls, dass die Lichter-Tonwerte schrittweise weggehen und nicht abrupt weiß werden. Die Verarbeitung in der Kamera bemüht sich, dies geschehen zu lassen, und wenn Sie später Raw-Bilder entwickeln (falls Sie Raw fotografieren), gibt es Prozeduren für einen zusätzlichen Abfall. Allerdings sind dem Erfolg hier Grenzen gesetzt, denn wenn Pixel auf dem Sensor auf so viel Licht reagiert haben, dass sie ihre Gesamtkapazität erreicht haben, dann war’s das – sie sind ausgebrannt und es gibt keine visuellen Informationen mehr. Und da die drei Farbkanäle Rot, Grün und Blau an unterschiedlichen Belichtungspunkten beschneiden, ergeben sich außerdem oft seltsame Farbränder.
NACHBEARBEITUNGEine Beschneidung ist unausweichlich, wenn man gegen die Sonne fotografiert. Die harten Kanten sind allerdings eine besonders unerfreuliche Eigenart von digitalen Aufnahmen. Eine lästige Nebenwirkung ist die Tatsache, dass die Beschneidungspunkte für die einzelnen Kanäle verschieden sind, wodurch sich Farbränder ergeben. Eine Vorverarbeitung in der Kamera kann Abhilfe schaffen, aber dies variiert von Modell zu Modell. Hier sehen Sie von links nach rechts das Original sowie die Raw-entwickelten Bilder mit 50% bzw. 100% Lichterwiederherstellung.
WIEDERHERSTELLUNGDieses Bild von Frauen, die am Cokva Beach in Goa Muscheln sammeln, wurde bei Sonnenuntergang aufgenommen, und zwar mit Blick auf die Sonne. Der Dynamikumfang der Szene war entsprechend hoch. Die Nachbearbeitung erlaubt zwar die Wiederherstellung von Details in den Lichterbereichen (unten), allerdings ist das in diesem Fall nicht die Antwort. Wenn man stattdessen dem Bereich um die Sonne erlaubt, »auszubrennen«, verstärkt man die Intensität der Szene und unterstreicht damit die Stimmung (links).
ABFALLDer Effekt des Abfalls ist subtil, aber wichtig und wird hier durch das Ein- und Ausschalten der Standardkurve demonstriert, die ein Raw-Konverter anwendet. Das ist vergleichbar einem Teil der Verarbeitung, die in der Kamera auf Nicht-Raw-Dateien angewandt wird, eine Kurve, die die Schulter dort anhebt, wo die hellen Stellen sind (die hohen Werte direkt unter den Lichtern). Der fragliche Bereich ist ein Detail des Gesamtbildes, eine leuchtend weiße Wolke. Sie sehen, dass die Standardkurve zwar eine gewisse Beschneidung einführt, indem sie die Lichter anhebt, der Übergang von den hellen Stellen in diese Lichter aber dennoch geglättet wird. Ohne die Kurve zeigt das Weiß eine deutliche Kante mit einem Farbstich, weil die drei Kanäle unterschiedlich reagieren.
DIE KAMERALEISTUNG
Kameras sind nicht mehr nur mechanische Geräte. Früher zählten vor allem Aufbau, Verarbeitung und Vorhandensein einer guten Optik. Heute enthalten Kameras Sensoren und Schaltkreise – und sind alle anders. Kameramarken und -modelle funktionieren in einer ganzen Reihe von Bereichen besser oder schlechter, darunter Auflösung, Empfindlichkeit, Rauschen, Dynamikumfang und Farbe. Sie sind nicht nur alle anders, sondern sie verbessern sich auch alle. Nichts steht still in dieser Welt. Es ist eine Tatsache, dass Ihre Kamera in manchen Aspekten besser ist als andere Kameras, in anderen dagegen schlechter.
Wie stellen Sie exakt fest, wohin Ihre Kamera passt? Indem Sie ihre Leistung messen, wozu Sie eine Reihe von Tests durchführen. Für die meisten Fotografen sind am wichtigsten: Rauschen, Dynamikumfang, geometrische Verzerrung, chromatischer Abbildungsfehler, Farbgenauigkeit und Schärfe. Dieser letzte Punkt ist subjektiv, aber wesentliche Maße sind Spatial Frequency Response (SFR) und Modulation Transfer Function (MTF). Für unsere Zwecke sind die wichtigsten das Rauschen und der Dynamikbereich, die eng zusammenhängen. Das Rauschen setzt die untere Grenze.
Sie sehen hier verschiedene Screenshots der führenden Objektiv- und Kamera-Testsoftware Imatest. Nicht jeder wird sich so viel Mühe machen, um die Leistung seiner Kamera zu ermitteln, es gibt aber auch einfachere Tests. In diesem Buch kümmert uns vor allem der mögliche Dynamikumfang der Kamera und damit auch Empfindlichkeit und Rauschen.
Eine einfache Möglichkeit ist das Fotografieren eines Graukeils. Es gibt sie in Fachgeschäften und online entweder ausgedruckt oder auf Film. Der hier gezeigte – ein 21-stufiger Graukeil von Stouffer – ist preiswert und weit verbreitet. Beleuchtet man ihn beim Fotografieren von hinten, deckt er einen deutlich breiteren Tonwertbereich ab als eine gedruckte Variante.
EINE SKALA FÜR DIE EMPFINDLICHKEITEine Kompaktkamera in Position für eine Nahaufnahme eines 21-stufigen Stouffer-Graukeils. Die Stufen repräsentieren Differenzen von je 1/2 Blendenstufe. Belichten Sie so, dass die hellste Stufe (1) gerade so unter der Beschneidung liegt (etwa 250 auf der 255er-Skala), prüfen Sie dann die dunkelste Stufe, die gerade noch unterscheidbar ist. Dieser Test ist bei ISO 80; bei höheren ISO-Werten stört das Rauschen. Dies ist nur ein grober Maßstab, allerdings hat der Dynamikumfang in jedem Fall ein subjektives Element – jemand muss irgendwann entscheiden, wann das Rauschen die Details schluckt, und darüber kann man sich streiten.
IMATEST-TESTBILDSCHIRMEImatest erledigt seine Berechnungen mit einer Reihe von Tests, die Sie mit ausgewählten Testdiagrammen durchführen. Zur hier gezeigten Auswahl gehören ein Dynamikumfang-Diagramm, ein SVG-Diagramm (Scalable Vector Graphics) zum Prüfen des chromatischen Abbildungsfehlers, ein Log-Frequency-Kontrastdiagramm und ein Diagramm für die Auflösung, ein Verzerrungsgitter mit einer mäßigen Kissenverzerrung, eine zweidimensionale a*b*-Darstellung eines IT8-Farbdiagramms und ein 7-teiliges Tortendiagramm zum Analysieren von Vignettierung und räumlichen Farbverschiebungen.
DYNAMIKUMFANG: SZENE VS. KAMERA
Der Dynamikumfang ist der Bereich zwischen den dunkelsten und den hellsten Tönen und gilt für Szenen in der wirklichen Welt, dem Bereich in einem Bild, der von einem Kamerasensor erfasst wurde, und dem Bereich, der auf einem Bildschirm oder in einem Ausdruck zu sehen ist. Er kann von reinem Schwarz zu reinem Weiß oder auch einfach vom dunkelsten zum hellsten Farbton reichen (im wirklichen Leben gibt es kein absolutes Schwarz und Weiß, obwohl manche Dinge schon recht nah sind). Wie Sie bald sehen werden, sind es die Szenen mit großen Dynamikbereichen, die Belichtungsprobleme verursachen, da man meist versucht, alle Tonwerte mit einem Sensor zu erfassen, der das einfach nicht kann (obwohl es besser geworden ist).
Eine der entscheidenden Fragen für die Belichtung ist daher: Reicht der Dynamikumfang des Sensors für den Bereich der Szene aus? Passt er? Falls er es tut, wird alles viel einfacher und es sollte keinen Grund für eine Über- oder Unterbelichtung des Bildes geben. Ist der Dynamikumfang des Sensors andererseits kleiner als der der Szene, haben Sie möglicherweise ein Problem.
Es gibt verschiedene Methoden, um den Dynamikumfang auszudrücken. Die für Fotografen sinnvollsten sind das Verhältnis – wie etwa 100:1 – oder die Blendenstufen (technisch: EV). Diese sind verständlich und wurden in der Tabelle auf der Gegenseite verwendet.
Der Dynamikbereich einer Szene hängt von dem Licht ab, das darauf fällt, sowie von dem Licht, das von den verschiedenen Oberflächen reflektiert wird. Wichtiger ist allerdings das einfallende Licht. Szenen mit sehr hohem Kontrast können bis zu 15 Blendenstufen umfassen, allerdings ist die Differenz im Umfang zwischen einer Weißkarte und einer Schwarzkarte nicht mehr als etwa 30:1, das reflektierte Licht trägt also relativ wenig bei.
Nackte Lichter (wie die Sonne oder ein Spot) erzeugen einen größeren Umfang als weiche, gestreute Lichter, da weniger von diesem Licht in die abgeschatteten Teile einer Szene streut. Mit anderen Worten, unter einer intensiven Sonne an einem klaren Tag ist der Umfang höher als an einem diesigen Tag mit Wolken. Und je mehr Strukturen es in einer Szene gibt, umso größer ist der Umfang, weil es potenziell mehr tiefe Schatten gibt (denken Sie an die Schatten in einem tiefen, schmalen Wüstencanyon).
WAS TRÄGT BEI ZU …
NIEDRIGEM DYNAMIKUMFANG1. Völlig diffuse Beleuchtung.2. Dicke Atmosphäre (wie Nebel, Rauch oder Staub).3. Weg von der Lichtquelle fotografieren.4. Ähnlich gefärbte Oberflächen.
MITTLEREM DYNAMIKUMFANG1. Intensive Lichtquelle, die scharfe Schatten wirft.2. Starkes Relief, das starke Schatten verursacht.3. Beleuchtung von hinten.4. Helle und dunkle Oberflächen zusammen.
WIRKLICH HOHEM DYNAMIKUMFANG1. Lichtquelle oder ihre starke Reflexion befindet sich im Bild.2. Sehr gut geschützte tiefe Schatten.3. Die Szene ist in hell erleuchtete/kaum beleuchtete Segmente aufgeteilt.
REFLEXIONSGRAD VS. LUMINANZUnterschiede im Reflexionsgrad tragen viel weniger zum Dynamikumfang bei als Unterschiede in der Beleuchtung. Bei dem Bild der Hinkelsteine liegen sowohl die linke Seite des Steins als auch das Gras im selben Licht. Der Unterschied in der Helligkeit ist völlig ihrem unterschiedlichen Reflexionsgrad geschuldet – der nur um etwa 1 Blendenstufe abweicht. Bei dem abendlichen Straßenbild liegt der Helligkeitsunterschied zwischen der Straßenlampe und dem Abendhimmel in der Luminanz und ist viel größer – etwa 5–6 Blendenstufen.
DUNKLER INNENRAUMJedes Bild aus einem unbeleuchteten Inneren auf eine helle Außenwelt hat unausweichlich einen großen Dynamikumfang, der die meisten Kameras an ihre Grenzen bringt. Das Histogramm des nichtverarbeiteten Bildes zeigt eine Häufung links und rechts – ein sicheres Zeichen für Schatten- und Lichterbeschneidung. In der Raw-Entwicklung lässt sich das jedoch meist beheben.
Einige Dinge aus der Tabelle auf der vorherigen Seite stechen hervor. Erstens, der riesige Umfang an Helligkeit, der in der wirklichen Welt möglich ist, zweitens, die außerordentliche Fähigkeit des menschlichen Auges, wenn man es durch die Szene streifen lässt und ihm Zeit gibt, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, drittens, dass nichts in der Welt der Bilderfassung dem menschlichen System nahe kommt, und schließlich, aber das ist eine neue Entwicklung – die schrittweise Verbesserung des Sensordynamikumfangs, wodurch die Anzahl der Situationen immer geringer wird, die man früher als »schwierig« angesehen hätte.
Es liegt an dieser Entwicklung, dass Szenen mit unmöglich hohen Dynamikumfängen immer weniger werden. Man könnte aber auch sagen, dass man schwierigen Szenen nun mit Zuversicht begegnen kann – Spitzenkameras haben einen Dynamikbereich von 13–14 Stufen und können solche Szenen bewältigen.
Das hat wiederum die Kamerahersteller ermutigt, Verarbeitungsmöglichkeiten für unterschiedliche Effekte in die Kameras einzubauen, wie Canon Highlight Tone Priority, Nikon D-Lighting, Sony Dynamic Range Optimizer und mehr. Diese Effekte klingen für jede Marke anders, aber im Prinzip machen sie alle das Gleiche – sie öffnen dunkle Schatten und ziehen helle Lichter herunter, um JPEG-Dateien mit einem scheinbar hohen Dynamikumfang herzustellen.
Die zunehmende Menge an Informationen in der Raw-Datei der Kamera macht diese Verarbeitung möglich, allerdings ist Ihr Computer immer noch besser beim Verarbeiten der Raw-Datei als der winzige Prozessor der Kamera. Außerdem liefern Ihnen diese Kamerafunktionen nur ein JPEG, wodurch Sie Ihre Möglichkeiten in anderen Bereichen der Nachbearbeitung beschränken.