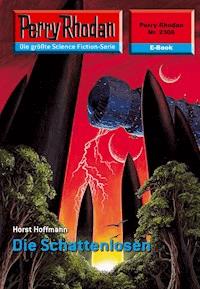Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Erstauflage
- Sprache: Deutsch
Sie geht ihren Weg - im Zeichen von Shaogen-Sternlicht Das unheilvolle Wirken einer bislang noch unbekannten Macht hat ein gigantisches Projekt sabotiert: Wie es aussieht, sind alle Heliotischen Bollwerke zerstört worden. Die wabenförmigen Raumstationen, die verschiedene Galaxien unter dem Dach der Koalition Thoregon miteinander verbinden sollten, existieren nicht mehr. Das hat für die Menschheit unter anderem zur Folge, dass zwei Teile der Erde durch hyperphysikalische Vorgänge in andere Galaxien "verschlagen" worden sind. An ihrer Stelle erheben sich an zwei Stellen Terras nun sogenannte Faktorelemente. Eines davon steht bei Kalkutta, in seinem Innern befinden sich Gebäude der Nonggo. Das andere steht in Terrania - und aus seinem Innern haben die barbarischen Dscherro die Hauptstadt der Erde mit ihrem Terror überzogen. Wo sich die "ausgetauschten" Menschen aus Terrania derzeit aufhalten, weiß niemand. Der verschwundene Teil Kalkuttas jedenfalls hat sich im Bereich des Teuller-Systems materialisiert, im Herzen der Nonggo-Zivilisation. Von dort aus bricht Perry Rhodan zu einer großen Expedition auf. Er will zur Galaxis Shaogen-Himmelreich, zu den mysteriösen Baolin-Nda. Bei diesen Konstrukteuren der Heliotischen Bollwerke will er weitere Informationen über Thoregon-Zusammenhänge erlangen. In dieser Galaxis wächst ein Wesen heran - es ist DAS MÄDCHEN SIEBENTON …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 1891
Das Mädchen Siebenton
Sie geht ihren Weg – im Zeichen von Shaogen-Sternlicht
von Horst Hoffmann
Das unheilvolle Wirken einer bislang noch unbekannten Macht hat ein gigantisches Projekt sabotiert: Wie es aussieht, sind alle Heliotischen Bollwerke zerstört worden. Die wabenförmigen Raumstationen, die verschiedene Galaxien unter dem Dach der Koalition Thoregon miteinander verbinden sollten, existieren nicht mehr.
Das hat für die Menschheit unter anderem zur Folge, dass zwei Teile der Erde durch hyperphysikalische Vorgänge in andere Galaxien »verschlagen« worden sind. An ihrer Stelle erheben sich an zwei Stellen Terras nun sogenannte Faktorelemente.
Eines davon steht bei Kalkutta, in seinem Innern befinden sich Gebäude der Nonggo. Das andere steht in Terrania – und aus seinem Innern haben die barbarischen Dscherro die Hauptstadt der Erde mit ihrem Terror überzogen.
Wo sich die »ausgetauschten« Menschen aus Terrania derzeit aufhalten, weiß niemand. Der verschwundene Teil Kalkuttas jedenfalls hat sich im Bereich des Teuller-Systems materialisiert, im Herzen der Nonggo-Zivilisation.
Von dort aus bricht Perry Rhodan zu einer großen Expedition auf. Er will zur Galaxis Shaogen-Himmelreich, zu den mysteriösen Baolin-Nda. Bei diesen Konstrukteuren der Heliotischen Bollwerke will er weitere Informationen über Thoregon-Zusammenhänge erlangen.
In dieser Galaxis wächst ein Wesen heran – es ist DAS MÄDCHEN SIEBENTON …
Die Hauptpersonen des Romans
Siebenton – Die junge Frau aus dem Volk der Mönche durchlebt ein ereignisreiches Dasein.
Walyon – Der Priester mischt sich nicht nur einmal in Siebentons Leben ein.
Koliwan – Der Archäologe forscht nach den Hinterlassenschaften der Tessma.
Hentele – Eine der besten Freundinnen Siebentons.
Tseekz
1.
Siebenton, 45 Jahre
Die Kolonne
Sie wusste genau, wann es kam. Dennoch überraschte es sie immer noch aufs neue. Auch wenn sie die Minute ahnte und darauf wartete, wenn sie sich schon zum Gebet niedergekniet hatte – es traf sie immer wieder bis ins Allerinnerste, in die Seele, in den Kern allen Denkens.
Es fuhr mitten in sie hinein. Ihr wurde heiß und kalt. Es berührte sie, und sie hatte das Gefühl, dass das Licht bis in ihre letzte Zelle drang und sie bis zum tiefsten Gedanken durchleuchtete.
Es dauerte nur einen Augenblick, aber für Siebenton war es wie eine kleine Ewigkeit. Als es bereits längst vorbei war, hörte sie sich ihre Gebete murmeln und um Vergebung für alle bösen Taten flehen, die sie seit dem letzten Licht getan hatte oder auch nicht. So genau konnte das kein Mönch wissen. Auch wer sich streng an alle Gebote hielt und versuchte, in Tun und Denken nicht zu sündigen, konnte fehlen.
»Was ich an Gutem getan habe, dafür danke ich dir, Sternlicht«, sprach sie die gängige Formel, die jeder für sich in Einzelheiten abwandeln konnte. »Und was ich Schlechtes getan haben mag, dafür bitte ich demütig um Vergebung.«
Sie hielt noch einige Momente lang den breiten Kopf gesenkt, der so flach war wie der gesamte Körper. Dann richtete sie sich auf und lächelte glücklich.
Das Shaogen-Sternlicht hatte sie erfasst und geprüft. Dies geschah alle siebzig Stunden, und solange dies so war, war ihre Welt in Ordnung. Keine Arbeit, keine Krankheit konnte so schlimm sein, um nicht vom Bewusstsein erhellt zu werden, Teil des Großen Ganzen zu sein, des Sternlichts, und eines Tages ins Tod-Erleben einzugehen.
»Genug gefaulenzt!«, rief sie ihren beiden Gefährtinnen zu, die noch im Staub des Ackerbodens knieten. »Die Arbeit muss getan werden. Wir sind noch immer hinter dem Plan zurück. Bevor es dunkel wird, muss diese Fläche bepflanzt und bewässert sein.«
»Warum, Siebenton?«, fragte Oriwad. »Wird es denn nicht regnen? Es regnet fast jede Nacht.«
»Es hat seit dreiundzwanzig Tagen nicht mehr geregnet«, erwiderte Siebenton geduldig, während sie mit ihren dreifingrigen Händen in den Kleincontainer griff und zwei Towambur-Pflanzen herausnahm.
»So lange ist das schon her?«, wunderte sich Greine, mit 98 Jahren die jüngere ihrer Freundinnen. Oriwad war bereits 127 Jahre und wartete eigentlich täglich darauf, dass sich ihr Geschlecht änderte.
Siebenton dachte, auch wenn sie sich über die Einfältigkeit der Frauen manchmal ärgerte, traurig daran, dass sie ihr als Gefährtin dann fehlen würde. Was hieß Gefährtin? Sie war, mit Greine zusammen, wie eine Mutter zu ihr gewesen, in ihren Kinderjahren. Die beiden Mönchinnen hatten sie in dem Abfallbehälter am Raumhafen im Norden der Hauptstadt Bleuht entdeckt, als sie noch ein Neugeborenes gewesen war. Niemals hatte man herausgefunden, wer Siebentons Eltern waren, doch Oriwad und Greine, damals als Lagerarbeiterinnen auf dem Hafen beschäftigt, hatten ihre Schreie gehört und sie davor gerettet, mit dem Müll in den insgesamt mehr als hundert Containern auf ein Mondschiff verladen zu werden, das den Abfall auf einen eigens dafür vorgesehenen Planeten brachte.
»So lange?«, fragte auch Oriwad. »Aber wer sagt uns, dass es diese Nacht dann nicht regnen wird?«
»Ich sage das«, antwortete Siebenton. »Und es wird auch die nächsten Tage und Nächte noch trocken bleiben.«
»Was du nicht alles weißt …«, seufzte Greine und griff nach neuen Pflanzen, um sie danach mit ihren bloßen Händen in die vorbereiteten Löcher in der Erde zu stecken und anzuhäufeln. »Wir Frauen sollten nicht soviel wissen.«
»Ja«, meinte Siebenton nur.
»Und du machst dir trotzdem andauernd Gedanken?«, fragte Oriwad. »Das ist nicht gut.«
»Ebenfalls ja«, antwortete Siebenton und pflanzte die nächsten Setzlinge ein.
»Irgendwann kommt ein Aufseher und nimmt dich uns weg«, sagte Greine. »Du wirst es erleben, wenn du so weitermachst.«
Siebenton atmete tief aus ihren vier Atemöffnungen aus, die quer unter den beiden gelben, runden Augen in einem Gesicht saßen, das breiter als hoch war. Unter dieser »Nase« befand sich die eigentliche Atemöffnung, ein durch eine innensitzende Membran verschließbarer Kreis. Der zahnlose Mund fand sich links an dem achtzig Zentimeter breiten und dreißig Zentimeter hohen Kopf und führte direkt zur Speiseröhre, links am dünnen Hals und ebenso äußerlich sichtbar wie die vorne verlaufende Luftröhre.
Sie trieb ihre beiden Gefährtinnen an, bis es zu dämmern begann. Greine warf ihr vor, dass sie die beiden scheuche wie ein Mann. Aber dieses Gemecker kannte sie wie die ewig gleichen Fragen, woher sie dies oder jenes wisse oder weshalb sie sich für dieses und jenes interessiere.
Es war einfach so.
Sie wusste, dass es ihr als – noch dazu junger – Frau nicht zustand. Nur die männlichen Mönche hatten Fragen zu stellen und überhaupt zu denken. Die kräftigeren Frauen waren für die einfachen Arbeiten bestimmt. Wenn Siebenton aber so lange warten wollte, dann hatte sie noch rund achtzig Lebensjahre vor sich. Erst mit 120 bis 130 Jahren wechselten die Mönche ihr Geschlecht.
Der Gedanke, so lange zu warten, war für sie unerträglich.
Endlich kam der Abend, und die Mönchinnen zogen sich von den Feldern zurück. Überall traten die Berieselungsanlagen in Aktion und versorgten die ausgedörrte Erde mit dem so sehr benötigten Wasser. Es war natürlich nicht das gleiche, als ob ein langer und kräftiger Regen fallen würde. Aber es konnte helfen, die diesjährige Saat wenigstens anwachsen zu lassen.
»Kommt!«, sagte Siebenton zu Greine und Oriwad. »Wir gehen in die Unterkunft. Es ist Zeit für das Abendessen. Wir haben es uns wieder einmal verdient.«
»Irgend etwas stimmt nicht mit dir«, sagte Greine. »Du sprichst wirklich wie ein Mann.«
Aber das hatte sie schon hundertmal gesagt.
*
Die Mönchinnen schlürften ihr Essen mit Hilfe von weichen Schläuchen aus großen Bechern, aus denen es warm dampfte. Mönche nahmen nur flüssige und breiige Nahrung zu sich. Von überall her waren schmatzende und schlürfende Laute zu hören. In dem Großhaus saßen und standen rund hundert Frauen. Insgesamt gab es sechs Großhäuser im Zentrum der Landwirtschaftlichen Kolonne, der Siebenton seit drei Jahren angehörte.
Als sie gesättigt war, brachte Siebenton den leeren Becher zurück zur Essensausgabe, bedankte sich mit einem Kompliment bei der Köchin, wünschte ihr eine angenehme Nacht und kehrte um zu ihrer Decke an der Innenseite der mit warmem Material isolierten Mauer des Hauses. Trennende Wände gab es im Inneren nicht, nur diesen einzigen großen Raum, wo jede Mönchin ihren Platz für die Nacht hatte oder für die schlechten Tage, an denen nicht auf den Feldern gearbeitet werden konnte.
Natürlich gab es in diesem Bereich auch keine Männer. Nur einmal am Tag erschien einer der Verwalter, um den Arbeitsplan für den nächsten Tag vorzulegen und kurz zu besprechen, was meist sehr einseitig war. Der Besuch erfolgte in der Regel eine Stunde nach der Nahrungsaufnahme. Selten geschah es, dass ein Shaogen-Hüter, ein Priester des Shaogen-Kults, ein Großhaus betrat und die Allmacht des Sternlichts lobte oder jenen, die gesündigt hatten, die Beichte abnahm.
Auch das geschah öffentlich. Der einzige Raum, in welchem die Mönchinnen der Kolonne nur für sich waren, war der Innere, war ihre Seele.
Siebenton ließ sich wieder auf ihrer Decke nieder, was für einen Menschen der Erde einigermaßen grotesk ausgesehen hätte. Sie ging zuerst in die Knie, dann lehnte sie sich vorsichtig nach hinten, stützte sich mit ihren durchgestreckten Armen ab, bis das Gesäß den Boden berührte. Dann erst bog sie ihren Körper nach vorn und ließ die Arme über die Knie baumeln, bis sie völlig im Gleichgewicht war. Die Körper der Mönche waren etwa 1,40 Meter hoch, und ihre Schulterbreite betrug rund achtzig Zentimeter. Dies war gleichzeitig die Breite des dreißig Zentimeter hohen Kopfes. Unterhalb des dünnen, sehnigen Halses boten die Mönche einen zwar etwas eckigen, aber durchaus humanoiden Anblick – nur wenn man sie von der Seite sah, wurde man überrascht.
Die Mönch-Körper waren nur zehn Zentimeter flach, und das an der dicksten Stelle. Sah man sie von vorne und dann sich drehen, konnte man an eine optische Täuschung glauben.
Siebenton lehnte sich mit dem Rücken gegen die behagliche Wand und zog langsam ihre Soukas aus, die enganliegenden Handschuhe, die während des Tages über die dreifingrigen Hände und dreizehigen Füße gestreift waren. Mönche waren Reinlichkeitsfanatiker und hatten dauernd Angst, sich mit irgendeinem Erreger zu infizieren. Bei der Feldarbeit war dieses Risiko natürlich größer als im Stadtleben. Aber auch dort trugen die Mönche Soukas.
Unter ihnen zeigte sich wie am ganzen Körper eine weißblaue Schuppenhaut. Kleidung im herkömmlichen Sinn kannten die Angehörigen des größten Intelligenzvolks der Galaxis Shaogen-Himmelreich nicht; sie besprühten sich in wöchentlichen Abständen mit einem saugenden, milchigweißen Kunststofffilm, der den Körper wie eine zweite Haut umschloss. Dazu trugen sie eben nur die Soukas und, um die Schultern geschlungen, Schärpen aus feinem Tuch, die sich wie Patronengurte kreuzten. In diesen Schärpen gab es Taschen für wichtige Utensilien.
In eine solche Tasche griff Siebenton und holte einen kleinen Beutel daraus hervor. Mit der anderen Hand nahm sie die weiße Dozz-Pfeife, die sie immer an einem geflochtenen Band um den Hals trug.
Oriwad und Greine, deren Decken sich links und rechts neben ihr befanden, sahen es und rückten schnell näher, so als hätten sie nur darauf gewartet. Dabei besaßen sie selbst jede ihre Pfeife. Jeder Mönch hatte eine.
»Du wirst doch nicht wieder allein rauchen wollen«, sagte Greine und hatte ihre Dozz-Pfeife bereits in der Hand. »Du hast das beste Kraut weit und breit. Heute gibst du uns etwas davon ab, ja?«
»Warum sollte ich das tun?«, fragte die junge Frau. »Ihr habt doch selbst genug davon, und wenn der Priester wie der …«
»Er wird so bald nicht kommen und neues Kraut verteilen«, fuhr Oriwad ihr schnell ins Wort. »Und außerdem stimmt es, dass er dir immer vom besten gibt. Woran liegt das, Siebenton? Wofür will er dich belohnen?«
»Für ihre Neugier«, stichelte Greine. »Dafür, dass sie denkt wie ein Mann.«
»Ihr seid verrückt, beide.«
»Sind wir das, ja?«, keifte Oriwad. »Wir werden es sehen, wenn Klast kommt und uns seinen Vortrag hält. Wen wird er dabei wohl wieder am längsten ansehen?«
Klast war einer der Verwalter.
Siebenton hatte keine Lust, sich zu streiten. Sie gab ihren beiden Gefährtinnen etwas von ihrem Kraut ab, das halluzinogen wirkte und im Shaogen-Kult als wichtiges Hilfsmittel dazu diente, das seelische Gleichgewicht und die Konzentrationsfähigkeit zu wahren. Die Mönche rauchten über den ganzen Tag verteilt etwas davon. Erst am Abend aber machten sie ein Zeremoniell daraus und ließen es zu, dass sie vom Dozz leicht berauscht wurden.
Siebenton sah jetzt überall die Frauen in Gruppen zusammensitzen und ihre Pfeifen benutzen. Ein süßlicher Duft erfüllte das Großhaus. Die Gespräche verstummten.
Siebenton war froh, als Greine und Oriwad endlich schwiegen. Sie war ihnen zu unendlichem Dank verpflichtet, aber immer häufiger fühlte sie sich besser, wenn sie nicht bei ihr oder, so wie jetzt, mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt waren.
Über dreißig Jahre hinweg hatten die beiden Frauen sie betreut und überall dorthin mitgenommen, wo sie Arbeit fanden – ob in Fabriken, in der Stadt oder wie jetzt hier auf dem Land. Immer hatten sie sie bemuttert, und immer größer war die Kluft geworden, die zwischen ihnen entstanden war.
Siebenton war anders als sie. Sie war nicht so vermessen, sich als intelligenter zu bezeichnen. Sie war einfach anders. Sie tat nicht nur das, was ihr von den Männern aufgetragen wurde, sondern stellte bei sich Fragen nach dem Sinn des Ganzen. Sie sah die Fehler in einem Arbeitssystem und wagte es als Frau, Vorschläge zur Verbesserung zu machen.
Deshalb hatte sie (und mit ihr ihre beiden Begleiterinnen) schon ein halbes Dutzend Arbeitsanstellungen verloren. Das hatte Greine mit ihrer Bemerkung gemeint: Irgendwann würde ein Aufseher oder Verwalter kommen, vielleicht gar ein Priester, und sie nicht nur versetzen, sondern von ihren Ziehmüttern trennen.
Die bisherigen Versetzungen waren paradoxerweise nicht deshalb erfolgt, weil Siebenton zu neugierig oder zu »aufmüpfig« gewesen wäre, sondern weil sie, so sagten es jedenfalls die männlichen Verwalter, für ihre jeweilige Arbeit eigentlich zu schade gewesen sei.
Frauen hatten zu arbeiten, Männer hatten zu denken. So konnte man es auch sagen.
Siebenton genoss den Rauch und ließ ihn tief in ihre Lungen dringen, bevor sie ihn wieder ausatmete. Diese weiße Dozz-Pfeife war das einzige Geschenk, das sie in ihrem Leben erhalten hatte. Ein Shaogen-Hüter hatte sie ihr gegeben, als sie mit einer einfachen Idee ein Problem gelöst hatte, vor dem die Männer in der Metropole Bleuht monatelang hilflos gestanden hatten.
Siebenton war für ihr Alter schon recht weit herumgekommen, aber überall hatte sie sich im Lauf der Zeit durch ihre unfrauische Neugier und Initiative ins Abseits gerückt. Trotz Greine und Oriwad hatte sie sich mehr und mehr isoliert gefühlt.
Und immer wie jetzt, als sie das Dozz-Kraut rauchte, kam die Sehnsucht über sie, wirklich Neues zu sehen und zu erleben; mit Männern zu diskutieren; Reisen zu machen, in den Weltraum. Sie hatte Wolkenort noch niemals verlassen – wie auch!
Aber sie wusste, dass Wolkenort mit seinen zehn großen Städten nur eine Welt von unzähligen war, auf denen Mönche lebten. Sie kannte die Namen der wichtigsten: Toun, Phasenberg, Kolmersgang oder Gismer.
Und dann gab es noch die vielen Planeten, auf denen sich anderes intelligentes Leben entwickelt hatte. Shaogen-Himmelreich war eine Welteninsel, eine Galaxis der Wunder – solange man nicht in ihren Rändern zu tun hatte, wo das Böse hauste.
Siebenton versank in ihren Träumen und sah sich unter dem freien Nachthimmel Wolkenorts stehen, unter dem sternübersäten Firmament. Wolkenort, auch das wusste sie bereits, stand relativ nahe zum Zentrum der Galaxis. Es war die Hauptwelt der Mönche, und nachts zogen zwischen den bekannten Sternen andere ihre Bahn, alle mit Kurs auf die einige tausend Kilometer entfernte Metropole.
Dies waren die Raumschiffe, die aus allen Teilen der Galaxis kamen, um Waren und Mönche zu bringen. Oder sie flogen in entgegengesetzter Richtung hinauf in die Atmosphäre und wieder fort von dem Planeten. Dann wünschte sich Siebenton jedes Mal, irgendwo dort oben an Bord sein und die große Reise zu anderen Sonnensystemen mitmachen zu können.
Eines Tages, das wusste sie, würde es soweit sein. Sie brauchte Geduld. Auch sie kannte die Stunden innerer Unausgeglichenheit. Dann verzweifelte sie fast bei dem Gedanken daran, in einem tiefen Loch zu stecken und von allem isoliert zu sein – blind und taub und stumm, lebendig begraben.
Sie hörte, wie Greine wohlig seufzte. Oriwad gab sich wie immer schweigend dem Genuss des Dozz-Krauts hin. Wenn die Frauen es rauchten, waren sie alle für sich, obwohl sie in Gruppen genossen. Jede Mönchin hatte dabei andere Empfindungen. Die eine träumte von der unendlichen Harmonie des Tod-Erlebens, die andere von Abenteuern und Glück.
Allen gemeinsam war, dass das Dozz-Kraut nie böse Gedanken weckte, sondern Harmonie schuf und Kraft schenkte, inneren Frieden. Es machte nicht süchtig. Die einzige Begleiterscheinung des langjährigen Konsums war die, dass sich die blauen Hautteilchen mit der Zeit rötlich färbten. Das Schuppenkleid der Mönche schimmerte dann nicht mehr weißblau, sondern weißlichrot.
Siebenton rauchte ihre Pfeife zu Ende, leerte sie und hängte sie sich wieder um den Hals. Sie hatte die Augen noch geschlossen und genoss das Gefühl der Inneren Ruhe. Es war wie ein Schlaf ohne Träume und daher um so wertvoller für Siebenton, denn ihre Träume fürchtete sie.
Wenn sie schlief, suchten sie ihre Dämonen heim. Dann sah sie schreckliche Bilder von einer Zeit ohne Licht. Und immer wieder sah sie sich einen steilen Berg hinaufklettern, dessen Gipfel sie niemals erreichte.