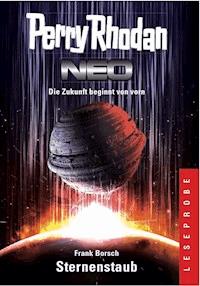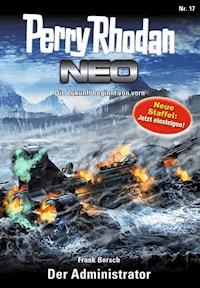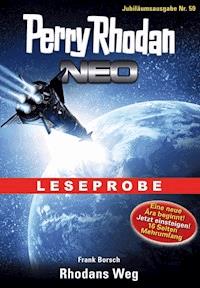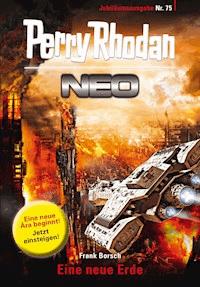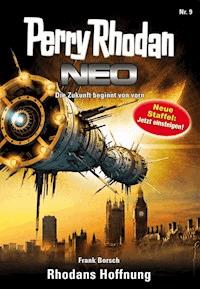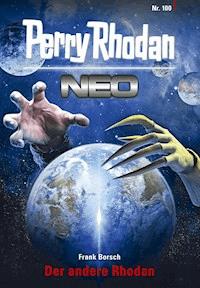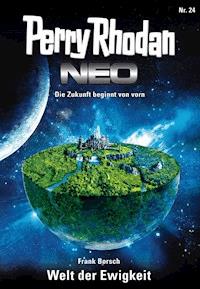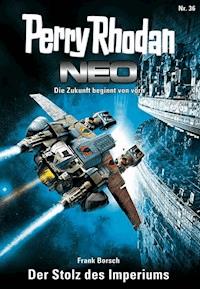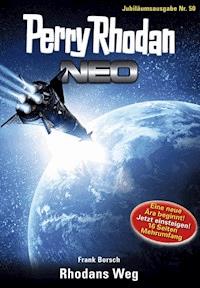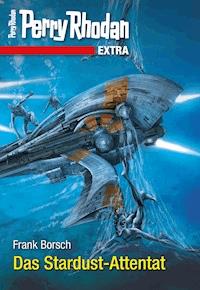Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Erstauflage
- Sprache: Deutsch
Perry Rhodan und Atlan in der Schattenstadt - im Zentrum einer uralten Macht Im Jahr 1332 NGZ sind Perry Rhodan und Atlan, Unsterbliche und ehemalige Ritter der Tiefe, schon seit vielen Wochen verschollen im - noch - vom Standarduniversum entrückten Raum des so genannten Sternenozeans von Jamondi. Hier stehen sie den menschenähnlichen Motana im Kampf gegen die Unterdrücker Jamondis zur Seite, gegen die Kybb. Vor langer Zeit stürzten die Kybb und ihre Herrscher das Regime Jamondis, das von den Schutzherren und deren Schildwachen geleitet wurde. Heute künden nur noch Mythen von der Zeit vor der " Blutnacht von Barinx ". An der Seite des Nomaden Rorkhete und der prophezeiten Befreierin Zephyda helfen Rhodan und Atlan dabei, eine Flotte der legendären Bionischen Kreuzer zu bemannen. Doch was sind sechzig Schiffe gegen eine Armada, was Hunderte Motana gegen Hunderttausende Kybb ? Ohne die Schutzherren von Jamondi und deren Schildwachen werden sie verlieren. Der seltsame Nomade Rorkhete glaubt, in Rhodan und Atlan die künftigen Schutzherren Jamondis erkannt zu haben. Den Beweis dafür kann angeblich nur einer liefern: Es ist DER GRAUE AUTONOM...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 2240
Der Graue Autonom
Perry Rhodan und Atlan in der Schattenstadt – im Zentrum einer uralten Macht
Frank Borsch
Im Jahr 1332 NGZ sind Perry Rhodan und Atlan, Unsterbliche und ehemalige Ritter der Tiefe, schon seit vielen Wochen verschollen im – noch – vom Standarduniversum entrückten Raum des so genannten Sternenozeans von Jamondi.
Hier stehen sie den menschenähnlichen Motana im Kampf gegen die Unterdrücker Jamondis zur Seite, gegen die Kybb. Vor langer Zeit stürzten die Kybb und ihre Herrscher das Regime Jamondis, das von den Schutzherren und deren Schildwachen geleitet wurde. Heute künden nur noch Mythen von der Zeit vor der »Blutnacht von Barinx«.
An der Seite des Nomaden Rorkhete und der prophezeiten Befreierin Zephyda helfen Rhodan und Atlan dabei, eine Flotte der legendären Bionischen Kreuzer zu bemannen. Doch was sind sechzig Schiffe gegen eine Armada, was Hunderte Motana gegen Hunderttausende Kybb? Ohne die Schutzherren von Jamondi und deren Schildwachen werden sie verlieren.
Der seltsame Nomade Rorkhete glaubt, in Rhodan und Atlan die künftigen Schutzherren Jamondis erkannt zu haben. Den Beweis dafür kann angeblich nur einer liefern: Es ist DER GRAUE AUTONOM...
Die Hauptpersonen des Romans
Perry Rhodan – Der Terraner folgt einem mysteriösen Ruf.
Rorkhete – Der einsame Nomade leidet still.
Venga – Die junge Motana erweist sich als hilfreich.
Keg Dellogun – Ein Vater bekennt sich zu seinen Taten.
Ka Than
1.
Venga rannte.
Hinter der Motana blieb der Teich der Trideage zurück, sein Wasser aufgewühlt von wuchtigen Körpern. Die Botin blickte nicht zurück. Seit Tagen hatte sie hier, an der Wurzel der Stadt Kimte, Wache gehalten – die wichtigste und zugleich langweiligste Aufgabe, die man ihr je übertragen hatte.
Lange Minuten rannte Venga durch von Dämmerlicht beherrschte, verlassene Gänge hinauf, der lebendigen Stadt Kimte entgegen. Der Puls pochte in den Schläfen, aber Venga kümmerte es nicht. Jeder Herzschlag brachte sie weg von dem feuchten Loch, das die Höhle mit dem Teich darstellte, drängte die Kälte aus ihren Gliedern, die sich in den vergangenen Tagen tief eingenistet hatte.
Licht glitzerte vor ihr. Venga stieß einen Freudenschrei aus; rau und unmelodisch, als wäre bei ihrer einsamen Wache selbst ihre Stimme eingerostet.
Dann trat sie durch das Tor aus Licht und gelangte in den Blütegürtel Kimtes. Es war später Nachmittag, die Zeit des Tages, in der die Motana von Tom Karthay, der letzten freien Motana-Welt, sich zu entspannen pflegten. Selbst die merkwürdig stolzen Männer von der Feste Roedergorm, die in großer Zahl nach Kimte geströmt waren, machten darin keine Ausnahme. Überall auf den Wiesen lagen und saßen Motana und lachten oder scherzten. Auffallend viele schliefen. Es waren anstrengende Tage für alle.
Die Motana kamen von überall her. Nicht nur von Roedergorm, nein, auch von hundert anderen Siedlungen auf Tom Karthay. Die Geschichten von Zephyda und den Fremden, die den Kampf gegen die Kybb-Cranar aufgenommen hatten, lockte sie zu Abertausenden in die Hauptstadt. Wenige der Neuankömmlinge besaßen vor ihrer Ankunft auch nur eine ungefähre Vorstellung davon, was sie zu dem Kampf beitragen konnten. Sie spürten nur, dass es für ihr Volk an der Zeit war, sich zur Wehr zu setzen.
Venga hatte eine genauere Vorstellung, eine sehr genaue sogar: Zuerst hatte sie sich gefürchtet, die Vorstellung von Blut, Tod, Einsamkeit und Verwüstung war alles beherrschend gewesen, sodass sie zu kaum etwas anderem imstande gewesen war, als zu zittern. Doch dann, allmählich, je länger sie Zephyda und ihre Begleiter beobachtete, je mehr sie erfuhr, desto schwächer war die Panik geworden. Sie hatte etwas anderem Platz gemacht. Und trotzdem war sie von Kischmeide bloß zur Wache an den Teich der Trideage geschickt worden. Von Kischmeide, der Planetaren Majestät Tom Karthays, in deren Dienst Venga als Botin stand.
Vielleicht, hoffte Venga, als sie das helle Licht und das Grün des Blütegürtels umfingen, würde sie doch noch einen Weg finden, ihre eigene Vorstellung wahr zu machen.
»Platz da!«, rief Venga, so laut sie konnte. Was beinahe schmerzhaft laut war, denn auch das Verscheuchen von lebendigen Hindernissen gehörte zur Ausbildung einer Botin der Planetaren Majestät. »Aus dem Weg! Ich habe eine wichtige Nachricht! Platz da!«
Niemals hatte Venga die Wege Kimtes so verstopft erlebt. Die Massen von Motana erschienen der Botin wie eine kompakte Wand, die ihr den Weg versperrte.
Die Motana folgten ihrer Aufforderung willig, aber unerträglich langsam. Viele standen beisammen oder hatten es sich sogar mitten auf dem Weg bequem gemacht, um Geschichten auszutauschen. Die Motana schilderten einander die überwundenen Gefahren und Abenteuer ihrer Reise in die Hauptstadt und die erhoffte Zukunft, wie sie es den Kybb-Cranar endlich zeigen würden. Andere gingen eng umschlungen oder in kleinen, beieinander untergehakten Gruppen. Venga schien es, dass sich die Motana wie in Zeitlupe bewegten, aber unweigerlich immer so, dass sie ihr im Bestreben, ihr auszuweichen, erst recht in die Quere kamen.
»Heiliger, schleimiger Flodder!«, fluchte Venga, als sie gegen eine wild gestikulierende Frau prallte, die gerade von einem wilden Sturm berichtete, der einer Botin nur ein herablassendes Grinsen abgerungen hätte. Venga verlor den Tritt und das Gleichgewicht. Die Botin schüttelte tadelnd den Kopf, verwandelte den Sturz in einen kontrollierten Fall, setzte die Bewegungsenergie in eine doppelte Rolle um und schnellte wieder hoch.
Als sie auf den Beinen landete, blickte sie einem jungen Motana aus Roedergorm direkt in die – bemerkenswert hübschen – Augen. Venga zögerte einen Augenblick, hauchte ihm einen Kuss zu, rief: »Schade, aber das hier ist wichtiger!« und rannte weiter.
Im Blütegürtel war so viel los wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Und sie war tagelang in einer feuchten Höhle mit ... mit ... – sie fand keine Worte dafür – eingesperrt gewesen!
Venga hatte in ihrem wilden Slalom den Blütegürtel noch nicht zur Hälfte durchquert, als ihre Oberschenkel mit dumpfen Schmerzen protestierten. Sie rannte zu schnell, viel zu schnell. Ihre Ausbilderinnen hätten sie dafür zusammengestaucht, sich frühzeitig zu verausgaben. Eine gute Botin behielt einen kühlen Kopf, teilte sich ihre Kräfte ein. Was zählte, war die Zeit, die sie für die Gesamtstrecke benötigte, nicht die für das erste Drittel.
Sie hatten leicht reden! Sollten sie sich doch probeweise eine Woche lebendig begraben lassen – mal sehen, wie sie dann rennen würden!
Außerdem war der Weg ja nicht weit, eigentlich.
Als das Halblicht des Graugürtels Venga umfing, keuchte sie stoßweise. Ihre Oberschenkel und Waden standen kurz davor zu verkrampfen. Was war los? Hatte sie ihre Kondition am Teich zurückgelassen?
Der Graugürtel schien endlos. Hinter jeder Biegung des Ganges erwartete Venga ein weiterer Gang, nicht wie ersehnt der Gürtel der Kantblätter, der die Außengrenze Kimtes markierte. Venga fluchte, mittlerweile eher ein atemloses Zischen als ein Rufen, und rannte weiter.
Dann, endlich, Venga hatte schon geglaubt, sie hätte sich verlaufen – ausgerechnet sie, die viel darauf hielt, sich noch nie verlaufen zu haben! –, durchstieß sie den Wall der Kantblätter.
Gleißendes Sonnenlicht empfing sie. Der Wind packte sie, wollte sie gegen die Außenhaut der Stadt werfen und den steilen Hang hinunterstoßen, doch die Botin fing sich geschickt ab und rannte weiter, den Serpentinenpfad hinunter.
Unter ihr auf der Ebene von Kimkay, die sich im Westen und Südwesten Kimtes erstreckte, lag ihr Ziel: die sechzig Bionischen Kreuzer, die Zephyda und Rhodan während der letzten Tage nach Tom Karthay gebracht hatten, die größte und mächtigste Flotte des Sternenozeans, wie sie sagten – wenn es ihnen gelänge, genug Motana zu finden, die sie fliegen konnten.
Vengas Herz machte einen Satz, als sie die Kreuzer erblickte. Es waren elegante Schiffe, ganz geschwungene Linien, wie große, exotische Raubtiere, die auf der Ebene kauerten und neue Kräfte schöpften, um sich bei der ersten Gelegenheit auf ihre Beute zu stürzen. Zumindest waren das die Assoziationen Vengas, die noch nie einem Raubtier begegnet war, nicht hier, in Tom Karthay.
Die meisten Motana, die die Kreuzer erblickten, waren von der Stärke gebannt, für die sie standen. Nicht so Venga. Die Waffen der Schiffe und was man damit anrichten konnte, machten ihr immer noch Angst. Was Venga zu den Kreuzern zog, war ihre Schnelligkeit. Die Bionischen Kreuzer würden sie viel weiter tragen, als es ihre Beine je vermochten.
Die Motana verlor jetzt zusehends an Höhe. Sie rannte zu schnell, viel zu schnell. Der Abhang war gefährlich, gefährlicher noch als der schlimmste Sturm. Einen Sturm respektierte selbst die dümmste Botin, seine Gewalt war offensichtlich. Der Hang dagegen schmeichelte, nahm der Botin einen Teil der Anstrengung ab, täuschte ihr ein größeres Reservoir an Kraft vor, als sie besaß. Und dabei lauerte er auf ihren Fehler. Ein falscher Schritt ...
Venga machte ihn auf dem letzten Wegstück. Die Motana – Männer und Frauen in gemischten Gruppen –, die zwischen den Kreuzern ihre Ausbildung erhielten, waren auf sie aufmerksam geworden, winkten ihr zu, feuerten sie mit lauten, melodischen Rufen an.
Einen Augenblick lang ließ sich Venga ablenken. Sie blickte auf, winkte zurück – und trat auf einen lockeren Stein.
Der Stein kippte weg, gefolgt von Venga selbst. Die Botin schlug hart auf, merkte es aber kaum, der stechende Schmerz, der durch ihren linken Knöchel jagte, blendete jede andere Wahrnehmung aus. Die Kreuzer und Motana verschwammen vor ihren Augen.
Venga schrie auf. Weniger vor Schmerz als vor Wut auf sich selbst. Verflucht, sie war eine Botin der Planetaren Majestät! Botinnen stolperten nicht!
Hunderte von Motana sahen ihr zu.
Venga richtete den Oberkörper auf, schloss die Augen, zählte bis drei und wuchtete sich hoch.
Der Schmerz raubte ihr den Atem. Dann, als sie den verletzten Fuß weiter belastete, schwand jede Empfindung aus ihm. Es war, als bestünde er aus Holz. Allerdings aus einem weichen, störrischen Holz, das ihr immer wieder wegrutschte.
Venga hinkte.
Vorbei an den Hunderten Motana, die hier unten lernten, die Bionischen Kreuzer zu bedienen, sie mit der Kraft ihrer Psi-Gabe zu steuern, ihre Biotroniken zu beherrschen und die Geschütze, mit denen sie die Kybb-Cranar vernichten würden.
Die Motana johlten übermütig, froh über eine Unterbrechung ihres anstrengenden Trainings. Als sie bemerkten, dass die Botin sich verletzt hatte, erstarb das Johlen nach und nach. Schweigen begleitete Venga, dann begann eine Motana zu klatschen, rhythmisch, auffordernd. Weitere Motana schlossen sich an, und als Venga die Heckschleuse der SCHWERT erreichte, gab es auf der Ebene keine Motana mehr, die sie nicht angefeuert hätte.
Die Botin kämpfte sich die Rampe hinauf in den Kreuzer.
Rhodan stand in dem Hangar. Er musste ihr Kommen von der Zentrale aus verfolgt haben. »Venga! Was, zum Teufel, ist los mit dir? Du siehst ...«
Die Botin winkte ab. »Egal. Wird schon wieder.« Das Gesicht Rhodans verschwamm, wurde zu einer Schliere, die sich wild tanzend um sie drehte. »Die Orakel ... die Orakel, sie haben gesprochen. Sie wollen euch ...«
2.
»Du hast sie wirklich gesehen? Bist du dir sicher?«
Zephyda warf Venga, die auf einer Antigravtrage neben dem Teich der Trideage lag, einen misstrauischen Blick zu. Ein Verband verbarg den verletzten linken Fuß der Botin, dessen Knöchel zu der Größe einer Kantblatt-Knolle angeschwollen war.
»Natürlich bin ich das!«
Die Empörung trieb Farbe auf Vengas unnatürlich bleiche Wangen. Auch wenn sie es vor niemandem – nicht einmal sich selbst – hatte zugeben wollen, setzte ihr der pochende Schmerz zu, der von ihrem Knöchel ausging. Die Motana-Ärztin, die den Verband angelegt hatte, hatte sie zwar beruhigt, dass es sich nur um eine Zerrung handelte, aber gleichzeitig hatte sie der Botin die Botschaft überbracht, die ihr am meisten gegen den Strich ging: »Du musst nur Geduld haben, eine Woche oder zwei, dann ist der Knöchel wie neu.«
Eine Woche oder zwei. Mit anderen Worten eine kleine Ewigkeit. Was stellte sich die Frau vor? Glaubte sie etwa, sie hätte eine Unsterbliche vor sich, die alle Zeit des Universums besaß? Venga hatte sich freundlich und aufrichtig bei der Frau bedankt, sie tat ja nur ihr Bestes, in Gedanken entschlossen, alles zu tun, außer ihrem Rat zu folgen.
»Ich weiß nicht ...«
Zephyda schien das Leid Vengas nicht zu kümmern. Falls sie es überhaupt wahrnahm. Die Epha-Motana widmete ihre ganze Aufmerksamkeit dem Teich, versuchte die Dunstschicht, die über seinem eiskalten Wasser lag, mit Blicken zu durchdringen.
Vergeblich. »Ich kann nichts erkennen.« Zephyda schüttelte den Kopf. »Was ist mit euch?« Sie sah zu Perry Rhodan, Atlan und Rorkhete, die sich ebenfalls am Teich eingefunden hatten.
Der Arkonide zuckte die Achseln. »Mir geht es wie dir.«
»Mir auch«, sagte Rhodan. »Aber das muss nichts bedeuten. Die Orakel können sich wieder zurückgezogen haben. Nach allem, was wir wissen, haben sie weiß Gott ihren eigenen Kopf. Ich bin sicher, dass sie sich Venga gezeigt haben.«
Venga sog Rhodans Worte begierig auf. Wenigstens einer, der ihr vertraute. Rhodan war es auch gewesen, der darauf bestanden hatte, dass Venga mit zum Teich kam, und der Echophage die Antigravbahre entlockt hatte. »Es ist nur fair«, hatte Rhodan auf die Proteste der Übrigen geantwortet, die keinen Sinn darin sahen, eine Verletzte mitzunehmen. »Venga hat tagelang für uns Wache gehalten. Sie soll mitbekommen, wofür sie es getan hat.«
»Rorkhete?«
Der wuchtige Shozide reagierte nicht auf Zephydas Frage. Er hatte seinen Helm abgenommen und damit den Kopf entblößt, der Venga unpassend klein erschien, wie ein Stummel. Der Helm leuchtete rot. Rorkhetes Finger, die ihn langsam und methodisch bearbeiteten, als hielte er eine Art Kontrollkonsole in den Händen, warfen Schattenspiele an die vor Nässe glänzenden Wände der Felsenhalle.
»Rorkhete, was denkst du?«, ließ Zephyda nicht locker. Die Epha-Motana war ungeduldig. Keine Motana beherrschte die Fähigkeit, die Epha-Matrix zu manipulieren, so gut wie sie. Zephyda wollte zurück auf die Ebene, um ihre Fertigkeiten an die Rekruten weiterzugeben.
Der Shozide schwieg weiter.
Venga fragte sich, was in ihm vorging. Rhodan hatte ihr erzählt, dass die Ozeanischen Orakel, die sich in dem Teich zu ihren Füßen verbargen, den Shoziden großgezogen hatten, nachdem seine Eltern gestorben waren. Sollte Rorkhete nicht aufgeregt sein? Sich darüber freuen, dass seine Stiefeltern unverhofft wieder zurückgekehrt waren, zwar erschöpft, aber, wie es schien, unverletzt?
Venga, die einiges auf ihre Fähigkeit hielt, die Gedanken anderer aus den Gesichtern oder aus ihrer Haltung zu lesen, stand bei Rorkhete vor einem Rätsel. Der Shozide sagte selten etwas, hatte sogar Vengas wiederholten Versuchen, ein längeres Gespräch anzuknüpfen, widerstanden. Sein Gesicht verschwand meist fast völlig unter seinem Helm, und das Wenige, was zu sehen war, blieb unbewegt. Sein Gang, seine Bewegungen waren immer gleichmäßig, immer kraftvoll, immer gemessen, als besäße er keine Gefühle.
Gut möglich. Aber ebenso gut das Gegenteil: dass in Rorkhete so viele widerstreitende Gefühle tobten, dass er nach außen hin wie betäubt erschien.
Venga hatte noch nicht entschieden, welche Möglichkeit sie für wahrscheinlicher hielt.
Zephyda stemmte die Hände in die Hüften. »Also gut, dann eben nicht. Ich verzichte auf die Orakel. Ich habe tausend wichtigere Dinge zu tun, als hier in der Kälte zu stehen und in den Dunst zu starren!«
Die Epha-Motana wandte sich zum Gehen – und verharrte in der Bewegung, als das Gurgeln von aufgewühltem Wasser die Felsenhalle erfüllte.
Ein runder Umriss schob sich durch die dünne Nebeldecke. Ein kahler Schädel, bedeckt von einer haarlosen, speckig glänzenden grauen Haut, wurde sichtbar. Dann kam der ganze Kopf zum Vorschein. Ein mächtiges Gebiss beherrschte das Gesicht, ließ die eigentlich ansehnliche Knollennase winzig erscheinen. Ein Paar runder blauer Augen – Venga erinnerten sie in ihrer Fremdartigkeit an die Rhodans und Atlans – fixierte sie prüfend. Venga war unwillkürlich froh, dass der Blick des Wesens sie nur streifte.
Das Orakel grunzte, aus seiner Nase sprühte ein Gemisch aus Wasser und Luft. Um das Orakel herum glaubte Venga weitere Umrisse zu sehen. Einen von ungefähr derselben Größe und vier kleinere, die ständig in Bewegung waren, als tollten sie herum.
Rhodan ergriff das Wort. »Ihr habt nach uns gerufen?«
Das Orakel grunzte erneut. »Ja.«
»Wozu?«
Statt zu antworten, schloss das Orakel die Augen. Sein Gesicht legte sich in speckige Falten, als konzentriere es sich.
»Keg Dellogun«, brach Rorkhete nach einiger Zeit die Stille. »Keg Dellogun, hör mir zu.«
Der Shozide hatte seinen Helm wieder aufgesetzt. Das rötliche Leuchten war erloschen. Hatte er damit die Orakel herbeigerufen?
»Was ist?«, antwortete das Orakel. Es sprach ein undeutliches Jamisch, als gurgle es jedes Wort.
»Spürst du sie? Perry Rhodan und Atlan besitzen eine Aura.«
Das Orakel, Keg Dellogun, öffnete die Augen, sah den Shoziden gereizt an. »Natürlich spüre ich sie.«
»Worauf wartest du dann noch? Wir müssen handeln!« Rorkhete schien nichts von Vorgeplänkeln zu halten. Oder, fragte sich Venga, wurde sie gerade Zeuge einer Auseinandersetzung, die sich schon seit langer Zeit hinzog?
»Das ist bereits geschehen. Wir haben sie der Prüfung unterzogen, in der Residenz von Pardahn. Beide sind durchgefallen.«
Venga hatte sich unwillkürlich auf ihrer Bahre aufgerichtet, trotz des Schmerzes, der damit verbunden war. Sie hatte noch nie ein Wesen wie Keg Dellogun gesehen. In den Tagen, die sie am Teich gewacht hatte, hatte sie sich oft vorzustellen versucht, wie die Ozeanischen Orakel aussehen mochten. Rhodan hatte sie ihr als massige Wesen, die im Wasser zu Hause waren, beschrieben. Hatte ihr gesagt, dass sie zwischen den Fingern Schwimmhäute besäßen und statt Beinen eine kräftige Schwanzflosse.
Kaum zu glauben. Venga war fassungslos. Wesen, die nicht gehen, nicht rennen konnten. Was für ein armseliges Dasein!
Aber Rhodan hatte gesagt, dass sie ganz und gar nicht armselig seien, sondern mächtig. Die Orakel konnten per Gedankenkraft von einem Ort zum anderen »springen« – so, wie sie es in den Teich der Trideage getan hatten –, und sie besaßen Wissen.