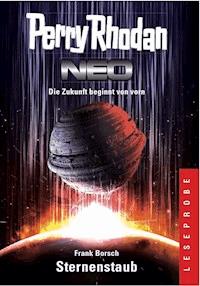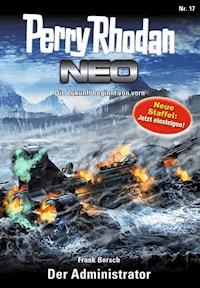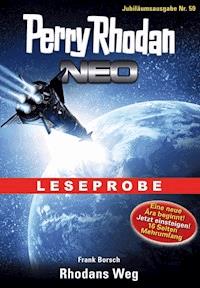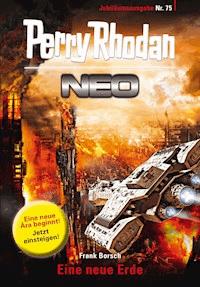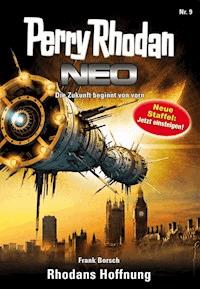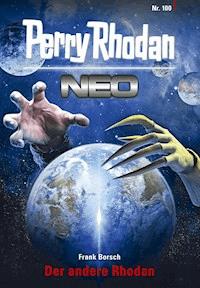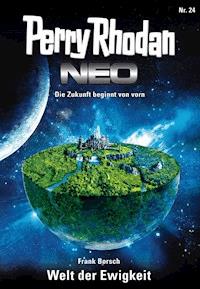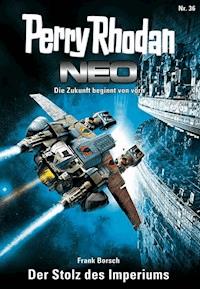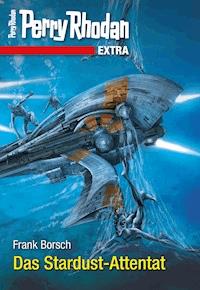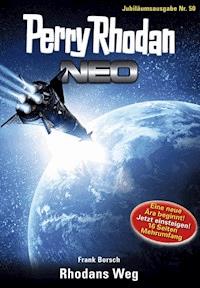
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Mai 2037: Seit Perry Rhodan auf dem Mond die menschenähnlichen Arkoniden getroffen hat, stoßen die Erdbewohner schrittweise in die Milchstraße vor. Das größte Sternenreich der Galaxis ist das Arkon-Imperium, zu dem Tausende von Planeten gehören. Aber was für ein Mensch ist Perry Rhodan eigentlich? Was treibt den Mann an, der die Menschheit zu den Sternen bringen will? Dieser Roman gibt spannende Einblicke in sein Leben vor dem Mondflug. Und er offenbart ein Rätsel: Kosmische Mächte scheinen bereits vor dem Start der STARDUST ihren Fokus auf Rhodan gerichtet zu haben. Zudem spitzt sich die Situation in Terrania zu: In der neuen Hauptstadt der Erde revoltieren die Mutanten. Ihr Amoklauf droht, die Welt in einen Abgrund der Vernichtung zu stürzen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 50
Rhodans Weg
von Frank Borsch
Mai 2037: Seit Perry Rhodan auf dem Mond die menschenähnlichen Arkoniden getroffen hat, stoßen die Erdbewohner schrittweise in die Milchstraße vor. Das größte Sternenreich der Galaxis ist das Arkon-Imperium, zu dem Tausende von Planeten gehören.
Aber was für ein Mensch ist Perry Rhodan eigentlich? Was treibt den Mann an, der die Menschheit zu den Sternen bringen will? Dieser Roman gibt spannende Einblicke in sein Leben vor dem Mondflug. Und er offenbart ein Rätsel: Kosmische Mächte scheinen bereits vor dem Start der STARDUST ihren Fokus auf Rhodan gerichtet zu haben.
Prolog
Es ist ein blauer Planet.
Eine Insel des Lebens in der Unendlichkeit.
Eine von Milliarden und zugleich einzigartig.
Als das Schiff sich zur Landung anschickt, hältst du dich an diesem Wort fest: einzigartig. Du wirst nicht abgeschoben. Dein Herr weiß, was er tut. Das Ringen verlangt Opfer von allen, die in ihm gefangen sind.
Das Exil auf dieser Welt ist dein Opfer.
Du wirst allein sein auf der Erde, wie die Menschen ihre Heimat nennen.
Sie sind stolz auf die Erde. Sie kennen keine andere Welt. Sie ahnen die Existenz anderer Welten, träumen davon, die Unendlichkeit des Alls zu durchqueren und sie mit eigenen Augen zu erblicken.
Aber die Zivilisation der Menschen steht auf der Schneide. Sie bekriegen einander. Sie verbrennen die Schätze ihrer Welt. Und das Feuer, das sie entfacht haben, heizt ihren Planeten auf, droht binnen weniger Generationen die Grundlage ihrer Zivilisation zu zerstören.
Noch ist es nicht zu spät, ist das Schicksal der Erde und der Menschheit nicht unausweichlich.
Es ist deine Aufgabe, es zum Besseren zu wenden.
Indem du einen Menschen auf seinem Weg begleitest.
1.
Mai 2007
Manchester, Connecticut
Ein Junge stand an der Haltestelle.
Maximo Mendez, der die Linie 91 in den Norden seit vierzehn Jahren fuhr, sah ihn von Weitem. Er verlangsamte. An der Spencer Street wartete selten jemand auf den Bus. Und schon gar nicht an einem Samstagvormittag, wenn die Leute von Manchester, Connecticut, in den Shopping Malls an den Rändern der Stadt ihr Geld ausgaben, als gäbe es kein Morgen.
Niemand wartete an einem Samstag an der Spencer Street auf den Bus – und schon gar nicht ein schlaksiger Junge mit einem viel zu großen, prall gestopften Rucksack, der ihn jeden Augenblick in die Knie zu zwingen drohte.
Maximo Mendez fragte sich, was der Junge an der Haltestelle wollte.
Der Junge musste verabredet sein, sagte er sich. Mit seinem besten Freund und dessen Familie. Sie würden in einem der State Parks campen. Angeln. Abends am Lagerfeuer die gefangenen Fische braten und das Zusammensein genießen. Mendez hatte hin und wieder mit seinen Söhnen gezeltet, bis ihnen die Fliegen zu viel und die dünnen Schlafmatten zu hart geworden waren. Inzwischen waren sie erwachsen, bauten Häuser in Kalifornien und schrieben ihm gelegentlich Mails, in denen sie ihm rieten, seine Ersparnisse in Immobilien anzulegen.
Der Junge bemerkte den Bus. Er sah Mendez aus großen graublauen Augen an. Einen Moment lang wirkte er wie eingefroren, dann riss er einen dünnen Arm hoch und winkte mit der hektischen Dringlichkeit, mit der nur Kinder winken konnten.
Mendez trat auf die Bremse, bog in die Haltebucht ein. Ein empörtes Hupen zeigte ihm an, dass er es zu abrupt getan hatte.
Der Bus kam zum Stehen. Mit einem leisen Zischen glitt die Vordertür auf. Warme Luft strömte in den Bus. Es war der erste Tag im Jahr, der sich nach Sommer anfühlte.
Der Junge packte den abgewetzten Haltegriff am Einstieg, setzte ein Bein auf die Trittstufe und wuchtete sich mit ganzer Kraft hoch. Das Gewicht auf seinem Rücken drohte ihn nach hinten wegzuziehen, aber der Junge biss die Zähne zusammen, zog sich auf die zweite Stufe – und wurde jäh abgestoppt, als eine der Schnüre seines Rucksacks sich an einer Kante verfing. Er japste, machte einen Schritt zurück, löste die Schnüre hastig. Seine Finger zitterten.
»Wohin willst du, Junge?«, fragte Mendez und lächelte. Er mochte Kinder.
»N... nach South Hadley, Sir.«
»Das ist eine ganz schöne Strecke. Über die Grenze, in Massachusetts.«
»Ich weiß.« War da ein Unterton der Empörung? Der Busfahrer besah sich den Jungen genauer. Der Junge war keine zehn. Er hatte ein langes, schmales Gesicht. Helle Haut, aber jetzt gerötet vor Anstrengung. Und seine Augen ... Hatte er eben geheult?
»Was willst du in South Hadley?«, fragte Mendez.
»Meinen Onkel Karl besuchen.«
»Deinen Onkel Karl ...«
»Ja!«
»Weiß dein Onkel, dass du kommst?«
»Er hat eine Farm. Mit ganz vielen Autos und Kühen! Ich besuche ihn oft.«
Eine Farm mit ganz vielen Autos und Kühen ... Der Busfahrer überlegte. Es ging ihn nichts an, wohin der Junge wollte, solange er den Fahrpreis bezahlte. Einerseits. Andererseits ... Mendez musste an seine Kindheit zurückdenken. Seine Eltern hatten ihn über alles geliebt. Aber ihre Liebe war die von Einwanderern gewesen, die ihre gesamten Hoffnungen dem einzigen Sohn aufgebürdet hatten. Eines Tages war Maximo die Last unerträglich geworden. Er hatte alle Habseligkeiten, die ihm etwas bedeuteten, eine Flasche Cola und zwei Packungen Oreo-Kekse in eine Tasche gepackt und war abgehauen ...
»Wissen deine Eltern, dass du deinen Onkel ...«
»Karl!«, sagte der Junge laut. »Mein Onkel heißt Karl!«
»... dass du deinen Onkel Karl besuchen fährst?«
»Natürlich.«
Sein Ausbüxen war Mendez nicht gut bekommen. Die Polizei hatte ihn drei Tage später ausgehungert und erschöpft aufgegriffen. Und seine Eltern hatten den Schluss gezogen, dass sie ihren Jungen zu lax erzogen hatten ...
»Wie heißt du?«, fragte er den Jungen.
»Perry.«
»Und mit Nachnamen?«
»Rhodan.«
»Perry Rhodan?« Mendez musste kichern.
»Wie... wieso lachen Sie, Sir?«, fragte der Junge.
»Weil ... Na ja, dein Name gefällt mir. Perry Rhodan. Klingt wie ein Held.«
»Wirklich?« Der Junge strahlte plötzlich.
»Wirklich«, bestätigte der Busfahrer und behielt für sich, weshalb er gekichert hatte. Ja, »Perry Rhodan« klang wie ein Held. Aber wie einer aus einer schlechten Serie aus den Fünfzigern oder Sechzigern. Hatte es nicht einen »Perry Mason« gegeben? Oder einen Weltraumhelden, der so ähnlich hieß? Aber dafür konnte der Junge nichts, ebenso wenig wie Mendez für den seinen. Seine Eltern hatten ihm »Maximo« als unerreichbare Vorgabe mit ins Leben gegeben.
Mendez fischte das Handy aus der Tasche. »Weißt du eure Nummer, Perry?«
»Ja. Wieso?«
»Sag sie mir bitte.«
Der Junge nannte ihm eine Nummer in Manchester. Mendez wählte sie, während der Junge aufgeregt das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagerte.
Eine Frauenstimme meldete sich. »Hallo?«
»Hallo, spreche ich mit Mistress Rhodan?«
»Ja – was ist?«
»Es geht um Ihren Sohn Perry. Ich bin Busfahrer auf der Linie 91, und Ihr Sohn ist eben zugestiegen. Allein. Er will nach South Hadley, sagt er. Zu seinem Onkel.«
»Und?«
»Hat das seine Richtigkeit?«
»Natürlich. Perry verbringt die Wochenenden oft bei Karl auf der Farm.«
»Dann ist es gut. Ich danke Ihnen, Mistress Rhodan. Entschuldigen Sie die Störung.«
Mendez legte auf. »Alles in Ordnung. Entschuldige, Junge. Ich wollte nur sichergehen ...«
Der Busfahrer beugte sich vor, tippte »South Hadley« in den Kassencomputer des Busses.
»Manchester nach South Hadley einfach. Das macht elf Dollar, dreißig Cent.«
Der Junge langte tief in die Hosentasche und holte das Geld heraus. Passend, als hätte seine Mutter es für ihn abgezählt. Mendez tippte den Touchscreen an, riss das Ticket ab, das aus dem Gerät glitt, und gab es dem Jungen.
»Danke, Sir!« Der Junge nahm das Ticket, drückte sich an dem Busfahrer vorbei und wollte ganz nach hinten zur Rückbank gehen.
Mendez sagte aus einer Eingebung heraus: »Wieso bleibst du nicht vorne bei mir, Junge?«
Der Junge zögerte. Es war ihm anzusehen, dass er sich viel lieber in den letzten Winkel des Busses verkrochen hätte. Aber einem Erwachsenen zu widersprechen ...
»Du kannst hinter mir sitzen«, sagte Mendez. »Ist der beste Platz im ganzen Bus.«
»Wirklich?«
»Ja, mit der besten Sicht. Und du kannst zusehen, wie ich steuere.«
Der Junge legte den Rucksack auf den Sitzen der zweiten Reihe ab und setzte sich hinter den Busfahrer. Mendez fuhr los. Er hatte fünf Minuten verloren, aber das machte nichts. Samstagvormittags fuhr er oft den ganzen Weg von Manchester nach Greenfield ohne einen einzigen Passagier. Mendez hielt dann öfters für ein paar Minuten an und rauchte eine Zigarette, um nicht den Fahrplan zu überholen.
Die Ausläufer von Manchester, die an eine einzige große Baustelle erinnerten, blieben nach und nach zurück. Mendez lenkte den Bus auf die Interstate 291 und nach einigen Kilometern auf die Interstate 91. Seine Route führte das Tal des Connecticut River hinauf, verband die Städte, die den Fluss säumten.
Um elf schaltete Mendez das Radio für die Nachrichten ein. Die Hauspreise stagnierten, zum ersten Mal seit Jahren. Jennifer Aniston hatte einen neuen Freund. In Bagdad hatte eine Selbstmordattentäterin einen Checkpoint der Armee in die Luft gesprengt.
»Sie haben einen Sohn in der Army?«, fragte der Junge.
Mendez sah auf, musterte den Jungen im Innenspiegel. »Wie kommst du darauf?«
»Sie ... Sie haben das Radio lauter gedreht.«
»Habe ich das?« Mendez hatte es nicht bemerkt. »Du hast recht, Junge. Mein Jüngster ist im Irak.« Julio hatte sich freiwillig gemeldet, angewidert von seinen älteren Brüdern, die nur noch das schnelle Geld im Kopf hatten und ein Haus nach dem anderen kauften, um es nach ein paar Wochen für einen höheren Preis weiterzuverkaufen. Julio wollte für etwas stehen im Leben.
»Wie alt bist du, Perry?«
»Sieben ... beinahe.«
»Ich habe dich älter geschätzt.«
»Das tun viele.«
»Das freut dich, nicht?«
»In der Schule kriege ich oft Prügel von den anderen Jungs.« Er zog die Schultern hoch, als wolle er sich schützen.
Mendez nickte. »Kann ich mir vorstellen. Menschen mögen es nicht, wenn man zu clever ist für sein Alter.«
Der Busfahrer wandte seine Aufmerksamkeit dem Verkehr zu, wechselte auf die Ausfahrt nach Thompsonville.
»Gehst du gern zu deinem Onkel?«, fragte er, um den Jungen von seinen trüben Gedanken abzubringen.
Perry nickte.
»Du hilfst ihm?«
»Ab und zu.«
»Das macht dir Spaß, was? Deshalb gehst du so gern zu ihm.«
»Nein. Onkel Karl, er ...«, der Junge suchte nach Worten, »... er lässt mich einfach sein. Verstehen Sie?«
»Ich denke schon.« Mendez fädelte den Bus in die Elm Street ein. »Was willst du werden, wenn du groß bist? Farmer wie dein Onkel?«
Der Junge schüttelte energisch den Kopf. »Nein! Ich will Astronaut werden! Zum Mond fliegen!«
Mendez musste laut loslachen.
»Wieso lachen Sie mich aus?« Der Junge lief rot an, als Wut und Scham in ihm miteinander wetteiferten.
»Ich lache dich nicht aus! Ehrlich!« Mendez hob eine Hand, machte eine beschwichtigende Geste. Er hatte den Jungen nicht verletzen wollen. »Ich lache mich selbst aus. Ich wollte auch mal Astronaut werden.«
»Wirklich?« Der Junge beugte sich vor. »Wieso sind Sie es nicht geworden?«
»Weil ...« Mendez überlegte, wie er seine Antwort so formulieren konnte, dass ihn der Junge verstand. Keine leichte Aufgabe. Der Busfahrer war sich nicht sicher, ob er die Antwort überhaupt selbst kannte. »Ich schätze, mir kam das Leben dazwischen«, sagte er schließlich. Den Rest behielt er für sich. Martha, die ungewollte Schwangerschaft, dann die Zwillinge.
Sie passierten das große Macy's-Kaufhaus. Der Parkplatz war bis auf den letzten Platz belegt – und an der Haltestelle stand eine Frau.
Es war eine Schwarze. Übergewichtig. Prall gefüllte Plastiktüten in beiden Händen.
Der Junge sah sie, und ihm entschlüpfte ein politisch unkorrektes »Wow, ist die fett!«
Die dicke Frau sah den Bus kommen, wuchtete einen oberschenkeldicken Arm hoch und winkte mit ihren Tüten. Mendez stoppte und öffnete die Tür.
»Halten Sie in Springfield?«
»Natürlich.«
Die Frau – sie war so stark geschminkt, dass sie Mendez an eine Puppe erinnerte – legte ihre Tüten in der ersten Reihe auf der Beifahrerseite ab, bezahlte die Fahrkarte und ließ sich neben ihre Einkäufe fallen.
»Diese Hitze ist einfach zu viel für mich.« Sie tupfte sich die Schweißperlen von der Stirn. Ihre Hand strich über eine Augenbraue und wischte sie weg. Sie war lediglich aufgemalt.
Mendez mochte Gesellschaft, unterhielt sich gerne mit seinen Passagieren. Aber diese Frau ... Der Busfahrer wusste nicht, weshalb, aber er mochte sie nicht.
Sie griff in eine Tasche und hielt Perry einen Schokoriegel hin. »Hier, Junge. Du siehst ja halb verhungert aus.«
Perry beäugte den Riegel argwöhnisch, dann schnappte er ihn mit einer blitzartigen Bewegung, als befürchtete er eine Falle, dass die Frau ihn festhielte.
»Das ist ein ganz schön großer Rucksack«, meinte die Frau.
»Ja«, murmelte Perry. Der Junge öffnete den Riegel nicht, sondern steckte ihn in eine Seitentasche des Rucksacks.
»Deiner?«
»Nein. Ist von meinem Vater.«
»Dachte ich mir.« Die Frau sah sich suchend um. »Und wo ist dein Vater?«
»Zu Hause.«
»Und was tust du hier?«
»Ich besuche meinen Onkel.«
Mendez konzentrierte sich auf den Verkehr, der immer mehr zunahm, je näher sie Springfield kamen. Ein flaues Gefühl hatte sich in seinem Magen breitgemacht. Wieso?, fragte er sich und verfolgte, wie die dicke Schwarze den Jungen aushorchte. Es war nur eine gemütliche Mama, die nett zu einem Kind war. Sie meinte es gut.
Er stieß auf die Antwort, kurz bevor sie das Zentrum von Springfield erreichten. Ein Sonnenstrahl wurde vom Spiegel eines Lasters zurückgeworfen, blendete Mendez und seine Passagiere. Er hielt die Hand vor die Augen, sah im Rückspiegel, wie der Junge es ihm gleichtat – aber nicht die Frau. Sie saß da, ungerührt. Ihre Augen waren kalt und leblos.
Der Bus erreichte die Haltestelle. »Springfield, Dwight Street«, rief Mendez.
»Ah, schon?« Die Frau wuchtete sich aus dem Sitz, raffte ihre Tüten zusammen und arbeitete sich schwer atmend die Stufen hinunter auf den Asphalt. »Ich danke Ihnen«, wandte sie sich an Mendez. »Und dir alles Gute, mein Junge! Genieß die Zeit mit deinem Onkel.«
Mendez fuhr los. Im Rückspiegel verfolgte er, wie die Frau ein Handy aus der Hosentasche pulte und eine kurze Nummer wählte. Er blickte zu dem Jungen. Es war Perry anzusehen, dass er froh war, dass die Frau weg war.
»Ist nicht mehr weit bis zu deinem Onkel«, sagte Mendez.
Er lenkte den Bus zurück auf die Interstate. Sie schwiegen. Nach einigen Minuten kramte der Junge ein Taschenbuch hervor. Es war ein Science-Fiction-Roman. »Die lange Reise« von Robert A. Heinlein. Nicht die Art von Buch, die man für gewöhnlich bei einem Noch-Sechsjährigen erwartete.
Aber Mendez war nicht überrascht. Es passte zu diesem Jungen.
Der Junge vertiefte sich in die Lektüre. Als Mendez eine Viertelstunde später verkündete: »South Hadley, wir sind gleich da!«, schreckte er hoch.
Die Interstate blieb hinter ihnen zurück. Nach einigen Minuten kam die Haltestelle in Sicht. Ein Auto parkte am Rand der Haltebucht. Ein Polizeiwagen.
Das Buch fiel dem Jungen aus der Hand, als er den Wagen sah – und in diesem Moment wurde es Maximo Mendez schlagartig klar, was er längst geahnt hatte: Perry Rhodan war ein Ausreißer. Die Frau, mit der er telefoniert hatte, war nicht seine Mutter gewesen. Und jetzt waren ihm seine Eltern auf die Schliche gekommen. Oder hatte die dicke Schwarze die Polizei benachrichtigt? Aber wieso hätte sie das tun sollen?
»Du bist davongelaufen, nicht?« Aus dem flauen Gefühl im Magen des Busfahrers war ein Knoten geworden.
»J-ja.«
Auch auf den Ausreißer Mendez hatte die Polizei gewartet. Und jetzt, Jahrzehnte später, erkannte er, dass es dieser Punkt gewesen war, an dem seine Träume gestorben waren und er sich gefügt hatte. An dem aus dem Astronauten Maximo Mendez, der das Universum hatte stürmen wollen, der Busfahrer geworden war, der tagaus, tagein dieselbe Strecke fuhr und hoffte, sich so viel absparen zu können, dass er seinen Lebensabend nicht in Armut verbringen musste.
»Wieso bist du davongelaufen?«, fragte er. »Schlagen dich deine Eltern?«
»Nein. Aber sie wollen nicht, dass ich träume.«
Mendez hielt an, die Tür glitt zischend zur Seite. »Danke!«, sagte der Junge. Er war bleich. »Sie waren gut zu mir.« Er schulterte den Rucksack, stieg aus und ging den beiden Polizisten entgegen, die ihren Wagen verlassen hatten.
Als ihn noch eine Handvoll Schritte von den Polizisten trennten, hielt der Junge an. Er verdrehte den linken Arm, nestelte an der Seitentasche seines Rucksacks. Er bekam den Schokoriegel zu fassen und warf ihn weg, ohne hinzusehen.
Dann setzte Perry Rhodan seinen Weg fort – und in diesem Moment wusste Maximo Mendez, dass dieser Junge mit dem Namen eines altertümlichen Romanhelden seine Träume nicht aufgeben würde.
2.
14. Mai 2037, früher Morgen
VEAST'ARK, am Goshun-See
Die Hitze, die ihn von innen verbrannte, verwandelte sich schlagartig in Kälte.
»Wie fühlst du dich, Allan?«, flüsterte eine vertraute Stimme.
»Als hätte mich ein Pferd geknutscht«, brachte er hervor. Es war ein alter Reflex. Je mieser er sich fühlte, desto flapsiger seine Sprüche.
Es roch. Nach Krankenhaus. Und fremd zugleich. Wie nicht von dieser Welt.
»Keine Angst«, sagte die Stimme. »Du bist auf der VEAST'ARK. Unter Freunden.«
Allan D. Mercant schlug die Lider auf. Er lag in einem Bett. Sein Blick war trüb. Ein Schemen vor ihm verwandelte sich langsam in ein Gesicht. Eine Frau. Ein Pflaster über einer Schläfe. Blasse, aber volle Lippen. Ein herausforderndes, freches Funkeln in den Augen. Er kannte dieses Funkeln, es war ... sie ...
»Iga«, half die Frau ihm auf die Sprünge. »Ich bin es, Allan. Iga.«
Ihr Name brachte die Erinnerung zurück ...
... das Wasser des Goshun-Sees stand ihm bis über die Knie. Neben ihm war Iga. Sie blutete aus einer Wunde über der Schläfe. Hinter ihr erhob sich die Kuppel aus Energie, die wie ein glitzernder Dom über dem aufragte, was vom Lakeside-Institut, der Heimat der Mutanten, geblieben war. Dazwischen der arkonidische Schweber. Er hatte sich mit dem Bug in den Sand und das Geröll der Gobi gebohrt. Der Schweber brannte. Eine der Paraentladungen hatte ihn erwischt. Und neben ihnen stand dieser Junge – wie lautete sein Name gleich? Swen. Ja, Swen – als ginge ihn das alles nichts an. Dabei war alles seine Schuld! Er war ein Mutant. Iga hob die Injektionspistole, um den Jungen zu betäuben. Doch stattdessen presste sie die Pistole an seinen Hals und drückte ab ...
»Iga!«, stöhnte er. »Du hast ...«
»Ich habe getan, was zu tun war.« Sie hob den rechten Arm. In der Hand hielt sie eine Injektionspistole. »Und damit du es gleich weißt: Ich werde es wieder tun. Du bist ein Mutant, Allan D. Mercant. Eine Gefahr für dich selbst und deine Mitmenschen.«
»Nein!« Mercant schüttelte den Kopf, stellte die Bewegung ruckartig ein, als ein stechender Schmerz durch seinen Schädel raste. »Fulkar, Manoli, Haggard, die übrigen Ärzte. Sie haben mich getestet. Ein Dutzend Mal. Das Ergebnis war negativ. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch!«
»Das wage ich zu bezweifeln.« Iga grinste breit. Sie trug wie immer ihren Blaumann, darunter ein kariertes Hemd. Beides hatte schon länger keine Waschmaschine von innen gesehen. »Von deinen anderen Qualitäten ganz zu schweigen, bist du ein überaus gerissener Fuchs. So schien es. Inzwischen wissen wir, wie wenig wir gewusst haben. Die Paraentladungen haben in derselben Sekunde aufgehört, in der ich dich betäubt habe. Das ›überaus‹ hat sich als Paragabe herausgestellt.«
»Ihr seid verrückt! Ich ...« Mercant brach ab, als ihm klar wurde, dass Iga die Wahrheit sagte. Und das bedeutete ... »Wieso habt ihr mich dann aus der Bewusstlosigkeit geholt? Jeden Augenblick kann meine Gabe von Neuem erwachen, und ich ...«
»Unwahrscheinlich«, schnitt sie ihm das Wort ab. »Es ist Haggard, Fulkar und Manoli gelungen, das Antivirus herzustellen, dessen Bauplan uns André Noir hat zukommen lassen. Du hast es vor dreiundzwanzig Stunden bekommen. Nach menschlichem Ermessen ist in deinen Genen Ruhe eingekehrt. Und für den Fall, dass wir uns irren ...« Iga hob die Injektionspistole an. »Verstanden?«
»Verstanden.«
»Bestens. Und jetzt komm!«
»Wohin?«
»Zu den anderen. Wir brauchen dich. Die Kacke, die Fulkar so hochtrabend ›Genesis-Krise‹ getauft hat, ist weiter mächtig am Dampfen ...«
Iga stützte ihn, als er das Krankenzimmer verließ. Auf dem Korridor vertraute Mercant sich einem der Laufbänder an, die das weitläufige Schiff erschlossen. Gegen seine Gewohnheit, doch Mercant fühlte sich zu wacklig, sowohl was seine Knie anging als auch psychisch. Er horchte in sich hinein. Das Virus hatte seine sogenannte Junk-DNA manipuliert, hatte einige Gene aus-, andere eingeschaltet. Das Antivirus hatte der Manipulation ein Ende gesetzt – aber sie nicht rückgängig gemacht.
Hatte er immer noch eine parapsychische Gabe? Und wenn ja, welche? Er schloss die Augen und konzentrierte sich. Nichts geschah.
»Unheimlich, was?«, bemerkte Iga. Die Truckerin gab sich schroff, aber das war nur eine Maske, hinter der sich ein außergewöhnlich einfühlsamer Mensch verbarg. Sie ahnte, was in ihm vorging.
»Ja.« Er versuchte sich an einem Grinsen. »Ich weiß nicht, ob ich mir selbst noch trauen kann.«
»Kann ich mir vorstellen. Aber das wird schon wieder. Wir trauen dir.« Sie drückte seinen Arm.
»Danke!«
»Nichts zu danken.« Sie drehte den Kopf weg, wohl damit er nicht sah, wie sie rot anlief, ihre Maske verrutschte. Sie holte tief Luft, dann sagte sie: »Was willst du zuerst hören, die guten oder die schlechten Nachrichten?«
»Die guten.« Mercant schwor eigentlich darauf, dem Unangenehmen ins Auge zu schauen. Aber er spürte, dass er an diesem Tag etwas Aufmunterung brauchte, bevor er dazu in der Lage war.
»Okay. Also: In Lakeside ist es ruhig. Die letzte, kleine Paraentladung liegt zweiundzwanzig Stunden zurück.«
»Die Mutanten haben eingesehen, dass wir ihnen nicht ans Leder, sondern ihnen helfen wollen?«
»Schön wär's. Nein. Unter dem Schirm, den wir über das Trümmerfeld gelegt haben, das von dem Institut noch übrig ist, herrscht Totenstille. Niemand zu sehen. Die Mutanten haben sich in die unterirdischen Anlagen zurückgezogen. Keiner hat eine Ahnung, was sie dort treiben. Sicher ist nur eins: Sie stricken keine Pullover für den nächsten Winter ...«
»Wir haben keinen Kontakt?«
»Nein. Sie rühren sich nicht. Die Hershell-Zwillinge haben den Funkverkehr mit den über den Globus verstreuten Mutanten eingestellt. Die Frequenz ist tot. Und möglicherweise auch die Zwillinge.«
Ein schlechtes Zeichen. Der »Mutantenfunk« hatte in den letzten Stunden eine wichtige Informationsquelle für sie dargestellt. Die Mutanten hatten geglaubt, ihre Verschlüsselung wäre sicher – tatsächlich hatten Mercants Leute sie geknackt.
»Hört man uns?«
»Möglich. Aber wenn du mich fragst, will man uns nicht hören. Der Schock über die Quarantäne sitzt tief. Und wer weiß, was das Virus in den Mutanten noch anstellt.«
»Aber wieso haben die Entladungen aufgehört? Hat das Virus sie umgebracht?«
Sie zuckte die Achseln. »Keiner weiß irgendwas. Nur, dass wir den Schirm nicht einfach abschalten und nachsehen können. Was, wenn die Mutanten nur auf diesen Augenblick warten? Über sechzig sind in Lakeside eingeschlossen. Einige werden den Entladungen zum Opfer gefallen sein. Bleiben noch fünfzig oder mehr – wenn sie ihre Kräfte bündeln, dann gnade uns der Herrgott, an den ich nie geglaubt habe!«
Vor ihnen kam der Umriss eines Riesen in Sicht. Einer der Naats, die die Besatzung der VEAST'ARK bildeten. Das über drei Meter hohe Wesen verzog seinen verblüffend kleinen Mund zu einem vertikalen Strich und sagte einen Gruß in seiner Muttersprache, als sie es passierten. Die Naats waren Krieger. Wenn Administrator Adams den Befehl geben sollte, Lakeside zu vernichten, würden sie nicht zögern, ihn zu befolgen. Ein einziger Feuerschlag des Schlachtschiffs, das am Goshun-See gelandet war, würde genügen.
»Übrigens haben wir Ras Tschubai gefunden und paralysiert«, fuhr Iga fort. »Er war in den Keller in Terrania geflüchtet, in dem der Körper Ernst Ellerts gelegen hat.«
»Wieso ›hat‹? Habt ihr Ellert ...«
»... wegbringen lassen?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, schön wäre es. Er ist einfach verschwunden.«
»Das ist unmöglich!«
»Ich weiß, aber ehrlich gesagt, Allan, das ist im Augenblick ein unwichtige Kleinigkeit. Bai Jun hat gestern Abend die Evakuierung Terranias angeordnet. Unter der Bevölkerung überschlagen sich die Gerüchte. Bai Jun hat eines streuen lassen, das gerade die anderen verdrängt. Dass in Lakeside ein geheimer arkonidischer Reaktor außer Kontrolle zu geraten droht.«
»Diesen Mist glauben die Leute?«
»Scheint so. Und wieso auch nicht? Klingt überzeugender als ›die Regierung der Terranischen Union hat vor eurer Haustür eine Art Supermenschen zusammengezogen, die jetzt Amok laufen und drohen, kraft ihres Geistes, die schicke neue Hauptstadt der Erde in einen Krater aus glühender Lava zu verwandeln‹, wenn du mich fragst.«
»Da ist was dran. Die Wahrheit ahnt niemand.«
»Ahnen schon. Aber sie geht in den wildesten Vermutungen im Netz unter. Und das ist unser Glück: Stell dir vor, was geschehen würde, wenn sie sich verbreitete. Hexenjagd nach Mutanten in allen Winkeln der Erde ...«
»Womit wir bei den schlechten Nachrichten wären?«
»So ist es.« Sie versetzte ihm einen spielerischen Stoß in die Seite. »Das Virus hat dir deinen legendären Spürsinn nicht ganz genommen, was?«
»Dazu braucht es keinen Spürsinn. Wie sieht es aus?«
»Lausig. Hätten wir eine Weltkarte vor uns, sie wäre übersät mit Brandherden. Bislang sind wir auf einhundertdreizehn unbekannt gebliebene Mutanten gestoßen, und stündlich kommen weitere hinzu. Das Ganze läuft nach immer demselben Muster ab. Es kommt zu unerklärlichen Geschehnissen – meistens zum Glück ohne allzu viele Tote und Verletzte –, und der Mutant folgt einem Drang und versucht, nach Terrania zu kommen. An dem Punkt fangen wir die meisten ab. Terrania liegt in der Gobi ... und die Gobi wiederum am ungemütlichen A... – du weißt schon – der Welt. Hierhin kommst du nicht zu Fuß, sondern nur über Transportsysteme. Und die überwachen wir.«
»Was ist mit denen, die wir nicht abfangen?«
»Sieht es nicht so gut aus. Sie verlieren die Kontrolle über ihre Gabe, lösen in zunehmend engerem Abstand Paraentladungen aus. Wenn es gut läuft, sind unsere Leute rechtzeitig da und betäuben die Mutanten. Wenn es schlecht läuft, erschießt sie die örtliche Polizei. Und wenn es richtig bescheiden läuft, dann ...« Iga hob eine Hand, und das Laufband hielt an.
»Was geschieht dann?«
»Sieh es dir an.«
Eine Tür öffnete sich vor ihnen. Der Raum war zweigeteilt. Die vordere Hälfte lag im Dämmerlicht. Das Licht stammte von holografischen Elementen, die einen unscheinbaren Mann mit schwarzen Haaren umringten.
Die Hände des Mannes waren in Bewegung. Unentwegt packten sie die Schöpfungen aus Licht und schoben sie hin und her, ordneten sie, als handele es sich bei ihnen um reale, fassbare Gegenstände.
Mercant erkannte Eric Manoli, den ehemaligen Bordarzt der STARDUST.
Manoli dreht den Kopf zur Seite, als Mercant und Iga eintraten. »Allan! Willkommen zurück unter den Lebenden!«
»Danke, Eric!«
Er warf Iga einen fragenden Blick zu. Was soll ich hier?
Sie deutete in die hintere Hälfte des Raums. Der Boden lag etwa einen Meter tiefer. Der Bereich war durch eine Scheibe abgetrennt. Oder war es eine Art Energieschirm? Auf jeden Fall drang kein Schein von dem grellen, kalten Licht auf der anderen Seite durch die transparente Barriere.
Zwei Männer in weißen Arztkitteln standen in dem Licht. Der eine war groß und so dürr, dass es ungesund wirkte, und sein kahler Schädel glänzte wie poliert. Der andere Mann war einen Kopf kleiner, dafür aber muskulös und mit einer dichten, dunkelblonden Haarpracht ausgestattet, die Mercant, der die sechzig längst hinter sich gelassen hatte, einen gewissen Neid abnötigte.
Das ungleiche Paar waren der Ara Fulkar und der Australier Frank Haggard. Fulkar war der einzige Angehörige seiner Kultur auf der Erde. Einer Kultur, die sich seit Jahrtausenden der Medizin verschrieben hatte. Mercant war weder Arzt, geschweige denn Wissenschaftler, und es stand ihm nicht zu, die Qualifikation Fulkars zu beurteilen. Fest stand aber: Selbst wenn Fulkar einer der miserabelsten Ara-Ärzte der Milchstraße sein sollte – wofür es kein Anzeichen gab –, er wäre jedem irdischen Arzt noch immer um Jahrhunderte voraus gewesen.
Haggard wirkte dagegen fehl am Platz. Der Australier sah so gut aus, als hätte man ihn für die Hauptrolle einer schmalzigen Arztserie gecastet. Doch der Schein tat ihm unrecht: Haggard war Nobelpreisträger für Medizin und einer der führenden Virologen der Erde – und nebenbei ein begeisterter Rugby-Fan, der es sich nicht nehmen ließ, jede freie Minute auf dem Spielfeld zu verbringen. Haggard war erst vor Kurzem aus Edinburgh zurückgekehrt, von einem Match Menschen gegen Naats, das der halbe Planet verfolgt hatte.
Auf einem Tisch zwischen den beiden Männern lag, ungefähr in Bauchhöhe, ein Mensch. Er war nackt, verkrümmt und ganz offensichtlich tot.
»Was ... wer ist das?«, fragte Mercant.
»Joaquin Romeny«, übernahm Manoli es zu antworten. »Ein Angestellter aus Santiago de Chile.«
»Was ist mit ihm passiert?«
Mercant trat näher an die unsichtbare Barriere. Der Tote mutete ihm bleich und gerötet zugleich an, schlaff, in einer unmöglichen Position erstarrt. Seine Haut wirkte wie faltiges, ausgetrocknetes Pergament. Sein Mund war weit geöffnet, ja aufgerissen und entblößte ein mit dunklen Plomben durchsetztes Gebiss.
Welchen Tod Joaquin Romeny auch immer gestorben sein mochte, es war ein grausamer gewesen.
»Das versuchen wir eben herauszufinden.« Manoli flüsterte beinahe. Als Arzt war er den Tod gewohnt, doch das Schicksal Romenys schien ihn nicht unberührt zu lassen. »Aber ich kann Ihnen zeigen, wie er gestorben ist.«
»Ja, bitte.« Mercant wandte sich um.
Manoli packte eines der leuchtenden Holos und warf es aus dem Reigen. In der Mitte des Raums blieb es stehen und entfaltete sich. Als es ungefähr Mannshöhe erreicht hatte, formte es ein Bild.
Es zeigte Joaquin Romeny in besseren Zeiten: einen etwas fülligen Mann Ende dreißig, der in einem Park mit einer Handvoll Kindern Fangen spielte.
»Eine Privataufnahme«, kommentierte Manoli. »Beim siebten Geburtstag seiner ältesten Tochter vor einigen Monaten. Das hier nur zum Vergleich.« Die Kamera zoomte an Romeny heran, das Bild fror ein. Das Holo ruckte zur Seite, als Manoli ein neues in die Mitte des Raumes warf. »Dies hier ist Joaquin Romeny vor vierzehn Stunden.«
Mercant brauchte einen Moment, um den Mann, den das neue Holo zeigte, als denselben zu erkennen, der den Geburtstag seiner Tochter feierte. Romeny trug einen Anzug, doch er war viel zu groß, hing wie ein Sack an dem Mann, der nur noch aus Haut, Knochen und Sehnen zu bestehen schien. Seine Augen waren groß, schienen beinahe aus den Höhlen treten zu wollen – und in ihnen flackerte etwas, das Mercant zutiefst berührte, aber er dennoch nicht zu benennen vermochte. Angst? Wut? Wahnsinn? Oder alle Emotionen zusammen?
Romeny stolperte über einen Platz, der mit Palmen bestanden war, hielt sich nur mit Mühe auf den Beinen.
»Die Plaza de Armas in Santiago de Chile«, sagte Manoli. »Romeny war auf dem Weg von der Arbeit, als seine bislang verborgen gebliebene Paragabe außer Kontrolle geriet.«
»Wie hat sich die Gabe geäußert?«, fragte Mercant.
»Skurril. Er brachte im gesamten Bürogebäude, in dem er arbeitete, den Kaffee zum Gefrieren. Aber innerhalb kürzester Zeit brach sie sich Bahn in den mittlerweile vertrauten Paraentladungen. Die Explosionen zerstörten die Kathedrale der Stadt und ein halbes Dutzend weitere Gebäude. Bevor Romeny noch weitere Zerstörungen anrichten konnte, geschah das ...«
Der Mann im Holo bäumte sich auf, als hätte er die Worte Manolis gehört. Er stieß einen Schrei aus, klappte zusammen und fiel zu Boden, wo er bebend liegen blieb. Aus seinem weit geöffneten Mund drang ein verzweifeltes Gurgeln.
»Joaquin Romeny starb auf dem Weg ins Krankenhaus«, sagte Manoli.
»Er ... er ist durchgedreht wie Tako Kakuta?« Mercant versuchte, sachlich zu klingen. Der Tod des japanischen Mutanten lastete auf seinem Gewissen – und hätte Iga nicht eingegriffen, wäre es jetzt sein eigener Leichnam, den die Mediziner untersuchten. Iga trat neben ihn, fand seine Hand und drückte sie.
»Ja und nein«, antwortete Manoli. »Tako hatte die Kontrolle über seine Paragabe weitgehend verloren, als er versuchte, durch einen Energieschirm zu teleportieren. Das hat ihn das Leben gekostet. Bei Joaquin Romeny hat sich die Entwicklung, die das Virus angestoßen hat, ungehindert fortgesetzt.«
Über der Leiche schwebte eine halbe Hundertschaft von Sonden. Mercant hätte sie für einen Schwarm Insekten gehalten, hätte ihm Haggard die Wunderwerke arkonidischer Technik nicht bei einem Besuch in der Klinik Terranias vor einigen Wochen vorgeführt. Es waren Quadrocopter. Winzige Maschinen, in der Luft gehalten von noch winzigeren Rotoren.