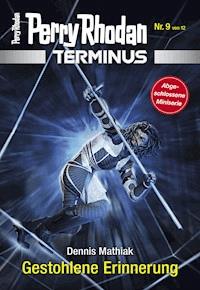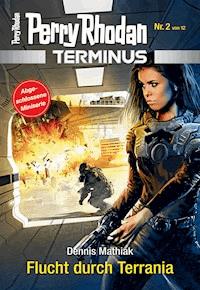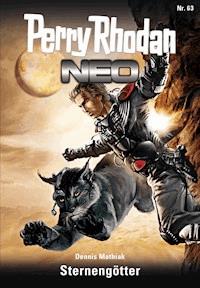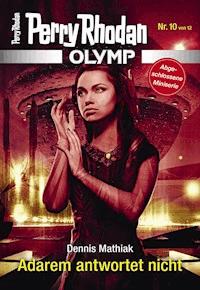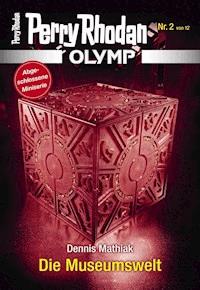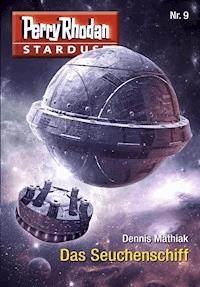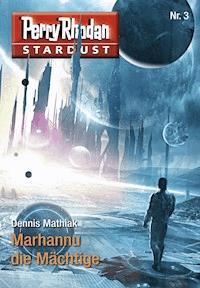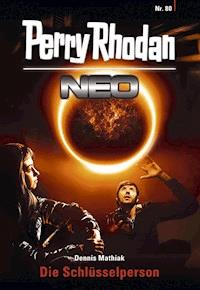
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden gestoßen ist. Im Dezember 2037 ist die Erde kaum wiederzuerkennen. Die Erkenntnis, dass die Menschheit nur eine von unzähligen intelligenten Spezies ist, hat ein neues Bewusstsein geschaffen. Die Spaltung in Nationen ist überwunden, ferne Welten sind in greifbare Nähe gerückt. Eine beispiellose Ära des Friedens und Wohlstands scheint bevorzustehen. Doch sie kommt zu einem jähen Ende - das muss Perry Rhodan feststellen, als er von einer beinahe einjährigen Odyssee zwischen den Sternen zurückkehrt. Das Große Imperium hat das irdische Sonnensystem annektiert, die Erde ist zu einem Protektorat Arkons geworden. Wie viele andere Menschen ist auch der Mutant John Marshall in den Untergrund gegangen, um gegen die Besatzer zu kämpfen. Als er erfährt, dass die Arkoniden eine Totgeglaubte in ihre Gewalt gebracht haben, bricht er auf, um sie zu befreien ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 80
Die Schlüsselperson
von Dennis Mathiak
Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden gestoßen ist. Im Dezember 2037 ist die Erde kaum wiederzuerkennen.
Die Erkenntnis, dass die Menschheit nur eine von unzähligen intelligenten Spezies ist, hat ein neues Bewusstsein geschaffen. Die Spaltung in Nationen ist überwunden, ferne Welten sind in greifbare Nähe gerückt. Eine beispiellose Ära des Friedens und Wohlstands scheint bevorzustehen.
Doch sie kommt zu einem jähen Ende – das muss Perry Rhodan feststellen, als er von einer beinahe einjährigen Odyssee zwischen den Sternen zurückkehrt. Das Große Imperium hat das irdische Sonnensystem annektiert, die Erde ist zu einem Protektorat Arkons geworden.
Wie viele andere Menschen ist auch der Mutant John Marshall in den Untergrund gegangen, um gegen die Besatzer zu kämpfen. Als er erfährt, dass die Arkoniden eine Totgeglaubte in ihre Gewalt gebracht haben, bricht er auf, um sie zu befreien ...
1.
John Marshalls Pod vibrierte. Mit einem Schnippen gegen das Mundstück schaltete er die Cigarillo Electrónico ab und steckte sie in die Innentasche der Jacke. Schnell schloss er den Magnetsaum, weil der kalte Dezemberwind sein dünnes Hemd durchdrang. Die Wärmekammern im Innenfutter heizten stärker, stellten die gewünschte Temperatur wieder her.
Auch ohne Nikotin eine dumme Angewohnheit, dachte John. Sollte ich mir abgewöhnen. Stress hin oder her.
Marshall nahm das Gespräch an, indem er auf den Pod tippte, der nicht dicker als ein Bierdeckel war und den er um sein Handgelenk gewickelt hatte.
»Du hast eine Voicemail empfangen.« Die leicht rauchige Altstimme des Pods erklang aus den hauchdünnen Lautsprechern, die in Marshalls Gehörgang klebten, blendete alle Nebengeräusche aus. »Soll ich die Nachricht abspielen?«
»Von wem ist sie?« Der dampfige Geschmack des Melonenliquids, mit dem Marshall die Cigel genannte elektronische Zigarette befüllt hatte, lag ihm noch auf der Zunge.
»Unbekannte Nummer. Sender-ID unterdrückt. Betreff: Voicemail von ›Bea‹. Soll ich abspielen?«
»Ja, bitte.«
»Hallo, Schatz«, sagte eine Frau in spanischer Sprache mit katalonischem Dialekt. Marshall erkannte die Stimme nicht. Bestimmt war sie künstlich generiert worden. »Mir ist endlich eingefallen, wie das Buch heißt, von dem Fermín mir erzählte. ›Das Spiel des Engels‹. Ich muss jetzt zurück an die Arbeit, wollte dir nur rasch Bescheid sagen, falls du dich langweilst. Küss dich.«
Das Display des Pods leuchtete rot auf und erlosch. Die Töne der Stadt stürzten wieder auf Marshall ein. Die hupenden Autos, klingelnden Pedhylecfahrer sowie das Schimpfen und Husten der Fußgänger woben einen dichten Klangteppich.
Das Spiel des Engels ... Marshall dachte nach. Welcher Platz in Barcelona war mit diesem Kodewort bedacht? Er hatte sich die dreißig Verbindungen zwischen Buchtiteln und einschlägigen Lokalitäten eingeprägt. Dann fiel es ihm ein: Es war die Avinguda Portal de l'Àngel im Ciutat Vella. Dort gab es eine Tapas-Bar, deren Keller den Mitgliedern von Free Earth als Treffpunkt diente.
Marshall zog die Nase hoch, blickte in den bleiernen Himmel über der Hauptstadt Kataloniens. Kein schönes Wetter für ein Wiedersehen, das er ebenso herbeisehnte wie fürchtete. Die Gedanken an sie haben Zeit. Morgen treffen wir uns. Jetzt zählt die Mission.
Ein kalter Regentropfen fiel Marshall auf die Stirn. Er senkte den Blick, zog seinen Wasser abweisenden, schmalkrempigen Hut unter der Schulterklappe hervor, setzte ihn auf und vergrub die Hände in den Jackentaschen. Dann reihte er sich in den Strom der Menschen ein. Sie rochen nach Parfum und nassem Stoff. Die Tür zu einer Pasteleria öffnete sich. Der Duft von Butter, Zucker und Zimt stieg Marshall in die Nase, als er an dem Geschäft vorbeischlenderte. Weihnachtsgebäck schmückte die Auslage.
Sein Magen knurrte. Er warf einen Blick auf die Zeitanzeige seines Pods. 17.52 Uhr. Bald war Schichtwechsel im Kommissariat der Terra Police. Es blieb keine Zeit, etwas zu essen, wenn er den Zeitpunkt ausnutzen wollte, um die »Sniffer« genannten Geräte an den Servern des Kommissariats anzubringen. Free Earth versprach sich viel von den Informationen, die sie dadurch abhören könnten, bis die Spionagegeräte entdeckt würden.
Marshall erreichte die Kreuzung zwischen Carrer del Berguedà und Traverssera de les Corts. Die Menschen um ihn herum grummelten Beleidigungen beim Anblick des sandfarbenen Wolkenkratzers auf der gegenüberliegenden Straßenseite, von dem aus die Polizeiaktionen in Katalonien gelenkt wurden. Marshall murmelte ebenfalls eine Schmähung, um nicht aufzufallen.
Ein Mann mit grau melierten Haaren und faltigem Gesicht ballte die Hände und zischte: »Dreckige, arkonidische Mossos!« Er bemerkte Marshalls Blick und verbarg die Fäuste in den Hosentaschen.
»Keine Angst.« Marshall lächelte schmal und humorlos. »Bin kein Sympathisant der Rotaugen.«
Wortlos ging der ältere Herr an ihm vorüber, ließ die Zentrale der Terra Police hinter sich. Das Gebäude ragte mindestens hundert Meter in die Höhe. Die Fassade bestand aus hellem Sandstein, die Fenster waren goldfarben verspiegelt. Über dem mit Ziersäulen geschmückten Eingang prangte das Wappen Kataloniens, ein goldener Wappenschild mit vier roten Pfählen, auf dem eine Krone ruhte. Zwei blaue Buchstaben leuchteten davor – ein T und ein P.
Die Arkoniden sind psychologisch geschickt, erinnerte sich Marshall an Bai Juns Erklärung. Der Leiter des militärischen Widerstandes hatte ihm einige wertvolle Informationen und Ratschläge mit auf den Weg gegeben, als sich Marshall dazu entschlossen hatte, die Free-Earth-Zelle in Südeuropa zu unterstützen.
Die Guardia Civil oder die Policia Nacional sind spanische Institutionen, schon immer in Katalonien und speziell in Barcelona misstrauisch beäugt, hatte Bai Jun ausgeführt. Die Mossos D'Esquadra war zwar für ihr brutales Vorgehen insbesondere gegen die barceloneser Demonstranten in der Wirtschafts- und Sozialkrise Europas bekannt. Nicht umsonst wurde die Truppe Ende der zwanziger Jahre aufgelöst. Aber immerhin ist sie eine katalonische Einheit gewesen. Der Bau der Terra-Police-Zentrale am ehemaligen Standort des Comisaría Mossos D'Esquadra war daher nicht die schlechteste Idee.
Marshall blickte in die angespannten Gesichter der vorbeieilenden Passanten. Im Gegensatz zu Bai Jun war er nicht davon überzeugt, dass sich die Terra Police mit der Standortwahl ihrer katalonischen Zentrale einen Gefallen getan hatte. Zwar war mit diesem Vorgehen eine Verbindung zwischen der Weltpolizei und der ungeliebten spanischen Obrigkeit vermieden worden, aber der verächtliche Begriff »arkonidische Mossos« hatte sich zum geflügelten Wort emporgeschwungen.
Marshall bahnte sich einen Weg vorbei an Menschen, an Elektrorollern und mit Wasserstoffbatterien betriebenen Pedhylecs, die an Metallbögen befestigt waren. Seit knapp einer Woche hielt Marshall sich in Barcelona auf, nachdem er und Perry Rhodan, Thora, Sid González und Sue Mirafiore nur knapp der Falle entkommen waren, die Satrak ihnen gestellt hatte. Der Fürsorger hatte ihnen die Information zugespielt, Rhodanos, das Duplikat Perry Rhodans, wäre noch am Leben und würde in einem Krankenhaus in Belfast behandelt. Doch es hatte sich als eine Lüge erwiesen.
Marshall hatte beschlossen, in Europa zu bleiben, weil er Informationen besaß, dass eine ganz bestimmte Person im Süden des Kontinents untergetaucht war.
Die Suche nach ihr und morgen das Treffen mit ... Bea. Führen hier all die Wege zusammen, die sich in Terrania trennten?
Vor einem leer stehenden Supermercado parkte ein verschrammter, kanarienvogelgelber Seat Alhambra Bùs. Die Verkaufstheke des fahrenden Imbisses verströmte einen penetranten Geruch nach Fritteusenfett, Knoblauch und Fisch. Der missmutig dreinschauende Verkäufer, ein dunkelhäutiger, vierschrötiger Mann mit pomadisiertem Haar, sog an einer Cigel.
»Haben Sie Hamburger?«, fragte Marshall wie vereinbart. Der injizierte Translator ließ ihn das Spanisch akzentfrei sprechen. Was im katalonischen Barcelona nicht von Vorteil war, wie er hatte feststellen müssen.
Der Verkäufer schüttelte den Kopf. »Nur Tapas.«
Marshall rümpfte die Nase. Die ausliegenden Muscheln, Käsestücke und das marinierte Gemüse als Tapas zu bezeichnen, war in seinen Augen die Übertreibung des Jahrhunderts. Aber so war nun mal der Kode. Die Tarnung war immerhin gelungen. Der Seat verdeckte den Kameras des Polizeireviers die Sicht auf den dahinterliegenden Bereich des Bürgersteigs. Der Verkäufer schimpfte auf das elende Wetter und drückte einen Knopf unter der Theke. Eine gelbe Folie fuhr vom Vordach des Wagens herab.
Nun war Marshall auch vor den Blicken der Passanten geschützt. Er schloss die Augen, konzentrierte sich und begann die Parallelwanderung.
John Marshall blinzelte. Die Reise von seinem angestammten Universum in eines der ungezählten Paralleluniversen verlief wie die bisherigen, seitdem er seine neue Gabe als Parallelwanderer entdeckt hatte. Das Gefühl, das ihn bei jeder Exkursion von einer Erde zur anderen beschlich, erinnerte ihn an die Fahrt mit einem Zug. Man saß in seinem Abteil und schaute aus dem Fenster. Die Landschaft veränderte sich, aber nicht so sehr, dass sie sich grundlegend von der Heimat unterschied. Trotzdem fühlte man sich nicht mehr zu Hause.
Marshall atmete durch. Die sich steigernde Fremdartigkeit machte ihm wie immer zu schaffen. Doch er bekam sie mit jeder Parallelwanderung besser in den Griff. Der gelbe Imbisswagen war verschwunden. Marshall konzentrierte sich. Sobald das Polizeigebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite aussah, als könne er es ungefährdet betreten, musste er die Reise durch die Universen stoppen.
Das Heimweh wuchs in unangenehmen Schüben. Marshall dachte an erfreuliche Dinge. An die Frau, die er in Südeuropa vermutete. An jene andere, die sich zur Tarnung Bea nannte. An Tatjana Michalowna, mit der ihn einige gemeinsame Nächte verbanden. Und an Sharon, die kühle, perfekte Schönheit, die die Gelder seiner Stiftung für Straßenkinder verwaltet hatte.
Schatten huschten an Marshall vorbei. Stakkatoartig wechselten die Eindrücke der verschiedenen Barcelonas. Ihn streifte ein warmer Windzug, eisiger Regen und erneut laue Luft. In einem Paralleluniversum schienen die Traverssera de les Corts und die kreuzenden Straßen zur Fußgängerzone erklärt worden zu sein. In einem anderen rollten Panzerfahrzeuge über den welligen, brüchigen Asphalt.
Allmählich wurde das Gefühl der Fremdartigkeit, des weit von zu Hause entfernt sein, unerträglich. Es schnürte Marshall die Kehle zu, trieb ihm Tränen in die Augen. Endlich erreichte er eine parallel existierende Erde, in der das Kommissariat ein verrammeltes Gebäude war. Marshall atmete auf, wollte sich in dieses Universum fallen lassen, seine Parallelwanderung beenden.
Doch er stolperte. Sinngemäß. Metaphorisch. Wie auch immer. Er fand dafür keine Worte. Die Gedanken an die Frauen, mit denen er sich verbunden fühlte, die ihn vor dem erdrückenden Gefühl der Fremdartigkeit hatten schützen sollen, ließen ihn nicht los. Die Universen rasten an ihm vorbei. Sein Magen rutschte ihm bis in die Kehle. Marshall schrie: »Halt!«
Und fiel zu Boden.
»Verdammt!« John Marshall wälzte sich zur Seite. Er griff sich an die Brust, sah zu der Stelle, auf der er eben noch gelegen hatte. Ein spitzer Stein ragte aus dem staubigen Boden. Ein eisiger Windstoß wirbelte Schmutz auf.
Marshall kniff die Augen zusammen, riss die Hände hoch, bedeckte Nase und Mund. Zu spät. Er hustete, spuckte dunkel gefärbten Speichel aus. Ächzend stand er auf, umschlang seinen Körper, rieb sich über die Arme. Dicke, schwarze, graue und wenige weiße Flocken schneiten aus einem dunklen Himmel. Sie schmolzen, stachen eiskalt auf der Kopfhaut.
»Wo bin ich gelandet?«, murmelte Marshall.
Vor ihm breitete sich eine endlose Geröllwüste aus. Kein Leben schien mehr zu existieren. Nicht einmal Ratten oder Insekten konnte er entdecken. Hinter den düsteren Wolken blitzte es. Ein Donnergrollen wälzte sich über die trostlose, hügelige Ebene.
Marshall wischte den schmutzigen Schnee aus dem kurzen Haar, suchte nach seinem Hut. Er fand ihn zwischen zwei Felsen, griff nach der Kopfbedeckung, schnitt sich und zog die Hand zurück. Rasch saugte er das Blut ab, das sich sofort mit dem allgegenwärtigen Dreck vermengte. Er spuckte es aus.
Hoffentlich ist es nicht in die Wunde eingedrungen. Wer weiß, was hier geschehen ist. Sollte das Barcelona sein ... Marshall hoffte, nicht nur in ein anderes Universum, sondern auch örtlich versetzt worden zu sein. Fort von der Erde, auf einen trostlosen, unbelebten Planeten. Er zupfte ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und wickelte es um die Hand. Zwischen den Felsen sah er nach, woran er sich geschnitten hatte.
»Stahl?« Marshall griff nach dem rostigen, verbogenen Stück Metall. Die poröse Oberfläche des fingerdicken Drahtes rieselte bei der Berührung zu Boden. »Das ist Stahlbeton. Ganz klar irdischer Stahlbeton, wie er überall auf der Erde eingesetzt wird.« Er schluckte. Obwohl die Heizkammern seiner Jacke tadellos funktionierten, ihn vor der Kälte des Windes behüteten, fröstelte er. »Das ist Barcelona ... Oder sonst eine irdische Stadt.«
Schwer atmend setzte sich Marshall auf den zerschmetterten Betonblock. Tränen liefen ihm über die Wangen. Was war an diesem Ort geschehen? Um ihn lag eine einzige Wüste aus Staub, zermalmten Beton und Gestein. Hatte die Menschheit sich in diesem Universum selbst ausgelöscht oder hatten die Arkoniden die Erde zerstört? Marshall musterte die Trümmer, entdeckte keinen Hinweis auf den Einsatz von Thermo- oder Desintegratorstrahlen. Was auch immer passiert war ... Zum zweiten Mal nach ihrem gescheiterten Versuch, das Duplikat Rhodans in Belfast aus der Gewalt des Fürsorgers Satrak zu befreien, war er während einer Reise durch die Paralleluniversen auf einer postapokalyptischen Erde gelandet. Das Szenario schien nicht abwegig zu sein.
Marshall atmete tief durch; er musste von hier fort. Seine Kräfte schwanden. Mit zitternden Knien stand er auf, wankte, aber hielt sich auf den Beinen. Der Schreck saß ihm tief in den Knochen. Noch nie hatte er sich so weit von seiner eigenen Realität entfernt.
»Konzentrier dich!«, murmelte er. »Wenn du jetzt versagst, kannst du sonst wo landen. Vielleicht in einem Universum, in dem die Erde gar nicht mehr existiert oder es nie getan hat.« Beinahe übergab er sich bei dem Gedanken. Wie mochte es sich anfühlen, im Vakuum zu enden?
»Nicht daran denken.« Marshall schloss die Augen, konzentrierte sich und spürte, wie er das fremde Paralleluniversum verließ. Er wanderte durch die Universen, kam der Heimat stetig näher.
Als er sich beinahe wie zu Hause fühlte, öffnete er die Augen. Barcelona lag vor ihm, verschneit, verregnet, sonnig, aber doch immer existent. Ihm wehte der Geruch nach Fritteusenfett, Knoblauch und Fisch ins Gesicht. Marshall beendete seine Reise.
Der schmierige Tapas-Verkäufer starrte ihn an. »Sie sind ganz schmutzig. Ihre Hand blutet! Was ist geschehen? Waren Sie ...«
2.
»Die Imperatrice hat den aufrührerischen Naats was angeboten?« Rilash ter Isom sah ihn aus geweiteten Augen an.
In diesem Moment brach die dichte Wolkendecke über den Trümmern Terranias auf. Durch das Panoramafenster von Jemmicos Büro im 49. Stock des Stardust Towers schien die Wintersonne und beleuchtete Rilashs markant geschnittenes Gesicht, die scharfrückige Nase, die hohen Wangenknochen und das schmale Kinn, ehe die Tönung das Licht abschwächte.
»Amnestie.« Jemmico blinzelte nicht, noch gab er auf eine andere Art und Weise zu erkennen, was er vom emotionalen Ausbruch seines Assistenten hielt.
Nun ja, »Ausbruch« ..., dachte der Sicherheitskoordinator der Terranischen Union belustigt. Die meisten Arkoniden würden die Reaktion wohl als unterkühlt bezeichnen. Aber das schätzte Jemmico an dem jungen Mann. Der Offizier handelte rational und hielt seine Emotionen unter Kontrolle. Andere wären bei dieser Information laut geworden. Rilashs Mimik und Tonlage änderte sich nur in Nuancen. Bisher enttäuschte er Jemmico nicht.
Jemmico desaktivierte die Hologramme über dem Arbeitspult, stand auf und ging zu Rilash. Die Stiefelabsätze klackten auf dem schwarzen Schieferboden, hallten von den kahlen weißen Wänden wider. Jemmico stellte sich neben Rilash vor das Panoramafenster. Um sie herum erstreckte sich Terrania, die Hauptstadt der Menschen – oder besser gesagt: was von der Stadt übrig geblieben war. Die terranische Flotte hatte kampflos die Flucht ergriffen, als der Verband des Großen Imperiums über der Erde erschienen war. Doch zweitausend Naats hielten sich in Terrania auf. Den Verrätern war klar gewesen, dass sie keine Gnade zu erwarten hatten. Die Naats hatten ihre Leben so teuer verkauft, wie sie konnten – und Reekha Chetzkel, der militärische Befehlshaber des Protektorats, hatte die Gelegenheit genutzt, ein Exempel zu statuieren.
Im rauchenden Trümmerfeld der Stadt war lediglich der Stardust Tower weitgehend unbeschädigt.
»Ich verstehe nicht«, erklärte Jemmicos Assistent, »weshalb Imperatrice Emthon V. auf diese Art und Weise handelt. Die Naats haben sich gegen das Imperium erhoben. Sie müssten bestraft werden.« Rilash sagte das ganz nüchtern.
Die Sachlichkeit des schlanken, durchtrainierten Adeligen hatte Jemmico bereits während ihres ersten Aufeinandertreffens imponiert. Als die Imperatrice Jemmico zu einem ihrer geheimen Beauftragten ernannt und in das Larsafsystem gesandt hatte, hatte der alte Celista sie gebeten, Rilash ter Isom als persönlichen Assistenten mitnehmen zu dürfen. Emthon V. hatte es ihm ohne Nachfrage gestattet. Seit der gemeinsamen Suche nach einer Verräterin schien sie Jemmico zu vertrauen.
»Prinzipien sind wichtig«, sagte Jemmico. »Aber eine kluge Herrscherin erkennt, wann sie diese flexibel handhaben muss. Das Imperium benötigt schlagkräftige Soldaten. Selbstverständlich hat die Imperatrice die Amnestie jedoch an einen bedingungslosen Treueschwur dem Imperium gegenüber geknüpft.«
Jemmico verschränkte die Hände hinter dem Rücken und musterte die von Raureif bedeckten Ruinen. Erbaut in einer öden Wüste mit extremen Temperaturen.
Ein Ort für Naats, dachte Jemmico. Aber nicht für Arkoniden oder Menschen. Was hat den »legendären« Perry Rhodan dazu bewogen, die Stadt seiner Vision auf diesem Flecken Erde zu gründen? Und was trieb einen Reichen wie Administrator Homer G. Adams, Rhodan dabei zu unterstützen? Vielleicht sollte ich eine Etage höher gehen und Adams persönlich fragen.
Der bucklige alte Mann, der die Geschicke der Menschheit leitete, hatte sein Büro unmittelbar über Jemmico. Es war rundumverglast und bot einen atemberaubenden Blick. Ein bitterer Blick, wie der Celista fand. Was mochte in dem Menschen vorgehen, fragte sich Jemmico von Zeit zu Zeit, wenn er die Trümmerwüste betrachtete? Was, wenn er nur wenige Kilometer entfernt am Ufer des Goshun-Sees den Kelch des Palasts des Fürsorgers langsam in die Höhe wachsen sah? Was löste es in Adams aus, wenn der Komplex des Transitgefängnisses für Menschen immer weiterwuchs?
»Und die Verräter unter uns Arkoniden?«, fragte Rilash.
»Was denken Sie?«
»Wenn ich die Imperatrice korrekt einschätze, wird sie an ihnen ein Exempel statuieren. Man kann diesen Männern und Frauen in Zukunft nie mehr vertrauen. Die Illoyalität eines Arkoniden gegenüber dem eigenen Volk wiegt schwerer als diejenige der Naats am Imperium.«
»Genau. Den Revolutionären wird die gerechte Strafe zuteilwerden. Auch den Rädelsführern, die noch nicht gefasst wurden.«
»Gibt es weitere Neuigkeiten aus der Heimat, die Sie mir anvertrauen können, Jemmico? Ist der Sturm der Methans losgebrochen?«
»Nein, ich glaube nicht. Aber ich habe keinen Zugriff auf alle Daten der Flotte. Es könnte durchaus schon zu Angriffen der Methans gekommen sein.«
»Und wir sind am Ende der Galaxis stationiert.« Rilash lächelte schmal. »Die Imperatrice ist intelligent, sagten Sie, und ich glaube Ihnen. Was also haben wir auf Larsaf III zu suchen? Warum ist es so wichtig, das Handeln von Fürsorger Satrak und Reekha Chetzkel zu überwachen?«
Jemmico lachte lautlos in sich hinein. Es war ein unruhiges Lachen, das in der Magengegend kribbelte. Diese Ruhelosigkeit verspürte Jemmico, seitdem er kein gewöhnlicher Celista mehr war. Doch er verbarg sie gut. Wie er stets seine Gefühle in sich vergrub.
»Setzen wir uns.« Jemmico deutete auf die Stühle zu beiden Seiten des steinernen Arbeitspultes, nahm Platz und orderte zwei Gläser Wasser.
Rilash kam der Aufforderung nach. Im Gegensatz zu Jemmicos üblichen arkonidischen Besuchern hatte er den schlichten Sitzplatz aus Edelstahlrohr und schwarzem Kunstlederbezug niemals abschätzig gemustert, sondern von Beginn an Jemmicos Vorliebe für Schmucklosigkeit akzeptiert. Dann nahm er das Glas, das ihm der Servobot reichte. Kaltes, klares irdisches Wasser. Ein Affront für jeden Arkoniden, der sich für etwas Besseres hielt. Rilash trank, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Warum schickte die Imperatrice also einen Verband ins Larsafsystem, um es unter den Schutz des Imperiums zu stellen? Wieso untersagt uns die Flotte, das weit dichter besiedelte und größere System in nächster Nähe zu besetzen, das von Arkoniden bewohnt ist, die sich ›Ferronen‹ nennen und technologisch deutlich höher stehen als die Menschen? Und weshalb sollen wir Satrak und Chetzkel überwachen?« Jemmico formte mit den Händen eine Raute und legte sie auf das Pult. »Wer weiß das schon? Der Fürsorger und der Reekha am ehesten. Die Imperatrice wird sich etwas dabei gedacht haben. Helfen Sie mir bei der Beantwortung dieser Frage.«
Vielleicht bringt er mich auf neue Ideen, wie ich den geheimen Auftrag der Imperatrice lösen kann, das Geheimnis des Larsafsystems zu lüften. Herauszufinden, weshalb Sergh da Teffron so viel Energie darin investierte, die Koordinaten dieses Sonnensystems in Erfahrung zu bringen. Die ehemalige Hand des Regenten war skrupellos und krank vor Ehrgeiz, aber er war nicht dumm. Sergh da Teffron hat nie etwas ohne Grund getan.
»Ihnen ist es also ebenfalls unbekannt?« Rilash sah nicht überrascht aus. Was Jemmico zufriedenstellte. Seine Fassade als »einfacher« Aufpasser der Imperatrice für Satrak und Chetzkel schien zu funktionieren, wenn selbst sein hochbegabter Assistent darauf hereinfiel.
»Nein. Darin wurde ich nicht eingeweiht. Aber ich möchte gern Licht ins Dickicht unserer Fragen bringen. Es sind doch unsere Fragen, nicht wahr?«
»Ihre Fragen sind meine Fragen.« Rilash sah ihm direkt in die Augen. Das erlaubte Jemmico nur wenigen Personen. »Sofern Sie das wünschen.«
»Ich vertraue Ihnen. Soweit ein Celista anderen vertraut.« Jemmico lächelte schmallippig. »Fassen wir zusammen: Larsaf III ist eine ehemalige Kolonie des Imperiums, die von den Methans im letzten Krieg ausgelöscht wurde. Ich vermute, dass die Menschen Nachkommen jener arkonidischen Siedler sind. Auch wenn sie es sich nicht eingestehen wollen.«
»Sie wollen sich vieles nicht eingestehen«, erwiderte Rilash. »Zum Beispiel, dass ihr Planet ein unwichtiger, unscheinbarer Ort ist. Doch Nachkommen von Arkoniden? Wie erklären Sie sich dann die Rippenbögen statt Brustknochenplatten? Eine derart massive Mutation halte ich für ausgeschlossen ...«
»Eine von vielen Ungereimtheiten, die erklärbar sind. Das hat keine Priorität. Interessanter ist, dass dieser Planet nie hätte besiedelt werden sollen. Das Imperium ist stark und war es damals bereits. Aber das stärkste Imperium hat seine Grenzen. Mit der Kolonie auf Larsaf III hatte es diese überschritten. Jetzt, 10.000 Jahre später, ist das wieder geschehen. Wieso?«
Rilash strich über die dünnen, gepflegten Augenbrauen, als sorge er sich um sein Aussehen. Auf Außenstehende mochte das eitel wirken. Jemmico hatte längst durchschaut, dass es eine Geste war, die Rilash instinktiv tat, wenn er nachdachte. Viele Arkoniden waren selbstgefällig und arrogant. Niemand machte ihnen daraus einen Vorwurf, im Gegenteil. Rilash hatte entschieden, lieber gesellschaftlich akzeptierte Eitelkeit vorzutäuschen, als sein Gefühlsleben zu verraten.
»Soweit ich weiß«, sagte Rilash, »ist weder auf der Erde noch im Sonnensystem etwas von Interesse gefunden worden ...«
Jemmico deutete Rilashs Zögern als unausgesprochene Frage. »Sie sind richtig informiert. Satrak und Chetzkel haben das System und seine Umgebung erkundet. Auf einem Mond von Larsaf VI, den die Menschen Titan nennen, wurde das Wrack eines abgeschossenen arkonidischen Kreuzers aus den Zeiten der Erstbesiedlung gefunden. Mehr nicht.«
Und mehr gibt es auch nicht zu finden, war Jemmico überzeugt.
»Was kann dann so wichtig sein?« Rilash lehnte sich leicht zurück, strich wieder über die Augenbrauen, dann über das glatte, bis zu den Schultern reichende schneeweiße Haar, das er im Nacken mit einer Spange zusammenhielt.
»Die Menschen.«
»Die Menschen?« Rilash lachte leise. »Sie sind ... erbärmlich. Auf ihre Art und Weise beachtenswert, sonst wären sie nicht in alle Lebensräume ihrer Heimatwelt vorgedrungen, würden diese nicht derart dominieren. Aber ihre Zivilisation steckt in einer Sackgasse. Sie frisst ihre Ressourcen auf, wächst immer weiter und steht doch am Abgrund. Wie die Population von Tieren, die zyklisch verläuft; nur dass eine technische Zivilisation wie die Menschheit über Mittel verfügt, sich selbst auszulöschen.«
»Und doch hat die Imperatrice bei der Auswahl von Satrak als Fürsorger und Chetzkel als militärischer Befehlshaber des Protektorats höchste Sorgfalt walten lassen. Die beiden verabscheuen einander mit Inbrunst. Ihre Abneigung stachelt sie zu Höchstleistungen an. Mit ihren diametral entgegengesetzten Positionen über den Umgang mit den Menschen ergänzen sie sich.«
»Ein Spiel auf des Vibromessers glühender Schneide«, sagte Rilash spöttisch.
»Damit eine Katastrophe ausbleibt, bin ich da.« Jemmico löste die Raute seiner Hände auf und legte sie flach auf die dunkel gemaserte Granitplatte des Pults. »Außerdem sollten Sie die Intelligenz der beiden nicht unterschätzen. Nein, die Menschen sind der Schlüssel. Bestimmt. Ein Name steht dafür ganz besonders.«
»Perry Rhodan?« Rilash hob eine Augenbraue.
»Die Menschen waren auf dem von Ihnen beschriebenen Weg«, sagte Jemmico. »Bis vor anderthalb Jahren Perry Rhodan mit einer primitiven Rakete namens STARDUST zum irdischen Mond flog und auf die havarierte AETRON stieß.«
»Das Schiff der Verräter.«
»Verräter gegen den Regenten ...«, gab Jemmico zu bedenken.
»Crest da Zoltral war schon dem Imperator ein Dorn im Auge. Ein Querulant.«
»Aber ein treuer Anhänger des Imperiums. Wie dem auch sei. Die AETRON suchte aus ungeklärten Gründen diesen Sektor der Öden Insel auf.«
»Milchstraße nennen die Menschen die Galaxis«, murmelte Rilash, als ob sie das nicht beide wüssten.
»Unwichtig. Aus ebenso ungeklärten Umständen havarierte die AETRON ausgerechnet auf dem Mond. Und dessen Führung, Crest und Thora da Zoltral, überließ den Menschen arkonidische Hochtechnologie. Gegen alle Vorschriften! Weshalb?«
Weshalb bei den She'Huhan?, hätte Jemmico am liebsten vor lauter Ratlosigkeit ausgerufen. Doch solch einen Gefühlsausbruch gönnte er sich nicht vor seinem Assistenten. Nicht einmal vor sich selbst, wenn er allein im Bett lag und an seine Familie dachte. An seine Frau und seine Tochter, die längst zu den She'Huhan gegangen waren, abgestiegen in das Reich von Irvora, der Sternengöttin der unendlichen Nacht, des Todes.
»Vielleicht haben die Menschen den beiden gedroht?«, riet Rilash.
»Womit?«
»Sie haben immerhin die AETRON zerstört.«
»Noch mehr Fragen. Warum taten die Menschen das? Und wie haben sie es angestellt? Und wie gelang es Crest und Thora dennoch, das Larsafsystem zu verlassen? Die beiden Oppositionellen tauchten Monate später im Imperium auf, nur, um kurz darauf spurlos zu verschwinden. Dieses Mal endgültig.«
»So scheint es.«
Jemmico schwieg. Es kam selten vor, dass er so viele Worte mit einem anderen Arkoniden wechselte. Sehe ich mehr in Rilash als einen jungen Offizier, den es zu fördern lohnt? Jemmico war selbstkritisch genug, sich zu hinterfragen. Schwäche konnte er sich nicht erlauben. Das hatte der Tod seiner Familie ihn gelehrt. Und sollte er väterliche Gefühle für Rilash in sich entdecken, würde er darauf reagieren müssen, und ihn versetzen. Mindestens das.
»Perry Rhodan also«, sagte Rilash.
»Darauf läuft es hinaus«, bestätigte Jemmico.
»Aber er ist verschwunden. Zur Legende avanciert. Die einzigen Fakten sind, dass er in den Augen der Menschen die Erde politisch geeint und es zustande gebracht hat, die 312. Vorgeschobene Grenzpatrouille, die sich aus Naats rekrutierte, zum Überlaufen zu bringen.«
»Bemerkenswert, nicht wahr? Ich würde diesen Rhodan zu gerne befragen, wie ihm all das gelungen ist.«
»Er ist eine Legende«, gab Rilash zu bedenken.
»Er existiert. Es gibt genügend Beweise dafür.«
»Doch er ist verschwunden.«