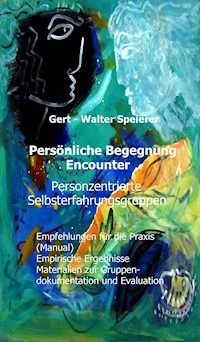
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Persönliche Begegnung (Encounter) kennzeichnet die personzentrierte Selbsterfahrungsgruppe in dem Bemühen um ein gemeinsames Erleben von Sympathie, Vertrauen, Verständnis und Hilfe, Freiheit von Angst und Stress, Offenheit, Auseinandersetzung, Feedback und Selbstöffnung. Die Teilnehmenden werden dabei durch den*die Gruppenmoderator*in wertschätzend, einfühlsam und echt sowie situations- und problembezogen unterstützt. Anwendungsbereiche sind Selbst- und Persönlichkeitsentwicklung in allen Berufsfeldern, in denen Gruppenarbeit und Gespräche bedeutsam sind. Das Buch bietet Wissen und Empfehlungen zur Gruppenteilnahme und deren Ergebnisse, zur Gruppenmoderation sowie Materialien zur Dokumentation von Gruppenentwicklung und Gruppenerfolg, die der Autor über fünf Jahrzehnte als Teilnehmer und Gruppenleiter sowie durch eigene Forschung gewonnen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gert-Walter Speierer
PERSÖNLICHE BEGEGNUNG
Encounter
Personzentrierte Selbsterfahrungsgruppen
Gert – Walter Speierer
PERSÖNLICHE BEGEGNUNG
Encounter
Personzentrierte Selbsterfahrungsgruppen
Empfehlungen für die Praxis (Manual)
Empirische Ergebnisse, Literatur und Materialien zur Gruppendokumentation & Evaluation
Der Autor
Dr. med. habil. Dipl. Psych. Gert - W. Speierer ist Prof. i. R. für Medizinische Psychologie der Universität Regensburg. Er hat 1973 und 1974 mit Carl Rogers im La Jolla Programm San Diego USA in Selbsterfahrungsgruppen gearbeitet. Er ist Mitbegründer, Mitglied des wiss. Beirats und Ausbilder der GwG in personzentrierter Psychotherapie sowie Lehrtherapeut und Supervisor der ÄGG. Wissenschaftliche Arbeitsschwerpunkte und Hauptveröffentlichungen: Dimensionen des Erlebens in Selbsterfahrungsgruppen (1976), Empirische Ergebnisse der ambulanten Gesprächspsychotherapie (1979), Indikationen der gesprächspsychotherapeutischen Einzel- und Gruppenbehandlung (1980, 1982), das patientenorientierte Gespräch (1981), das Differenzielle Inkongruenzmodell der Gesprächspsychotherapie (1994, 4. A. 2018), Regensburger Inkongruenz Analyse Inventar (RIAI) (1997, 2018) und zahlreiche weitere Veröffentlichungen.
© Gert- W. Speierer 2021
Umschlag: GWS, Abbild Natascha Mann: Gespräch
Die erste und zweite Auflage erschien unter dem Titel:
Personzentrierte Selbsterfahrungsgruppen 2006 und 2009 (deutsch, englisch & spanisch) auf CD-ROM Vertrieb Köln: GwG
3. neu bearbeitete und ergänzte Auflage, 2021
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: 978-3-347-15722-4 (Paperback)
ISBN973-3-347-15723-1 (Hardcover)
ISBN 978-3-347-15724-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Edith, Julia, Adam und Viola
Wenn ich … einfach über die Art und Weise schreibe, wie ich mit einer Encountergruppe arbeite, könnte das einen Effekt haben, der diejenigen, die auf diesem Gebiet tätig sind, viel stärker entlastet. Es könnte andere anregen, über den Stil der Förderung zu schreiben, der ihnen angemessen ist. Noch wichtiger, es könnte demjenigen, der neu mit Gruppen arbeitet, mehr Freiheit geben zu glauben, dass er schließlich einen Stil entwickeln kann, der wahrhaft sein eigener ist und daher für ihn selbst am effizientesten ist." Carl R. Rogers (1971)
Inhalt
Überblick
I. Empfehlungen für die Praxis (Manual)
1. Definition, Ziele, Anwendungen, Dauer, Formate
2. Überlegungen und Entscheidungen vor Gruppenbeginn
3. Einladung zur Gruppenteilnahme
4. Die erste Gruppensitzung (Kurzgruppe)
5. Die erste von mehreren Gruppensitzungen
6. Die zweite Gruppensitzung
7. Die dritte und folgende Gruppensitzungen
8. Schwierige Gruppensitzungen
9. Die letzte Gruppensitzung
10. Gruppennacherfahrung Katamnese und Transfer
II. Empirische Ergebnisse
1. Vorbemerkung
2. Gruppendokumentation
2.1 Der Gruppenprozessbogen
2.2 Der Gruppenerwartungsbogen
2.3 Der Gruppenerfahrungsbogen
2.4 Der Gruppennachbefragungsbogen
3. Gruppenentwicklung (Prozessevaluation)
3.1 Das Stadienmodell des Gruppenprozesses und die Entwicklung des Gruppenerlebens
3.2 Einfluss der Gruppenleitung auf Erleben und Erfolg der Gruppenmitglieder
4. Ergebnisse der Gruppenteilnahme
4.1 Was Gruppenteilnehmer*innen erwarten und erfahren
4.2 Erreichbarkeit der Gruppenziele
4.3 Langzeitwirkungen (Katamneseergebnisse)
4.4 Benchmark
III. Literatur
IV. Namenregister
V. Sachregister
VI. Materialien zur Gruppendokumentation und Evaluation
Tab. 1 Gruppenprozessbogen (GRP20)
Tab. 2 Einschätzungsbogen (Erwartungen) (GE13)
Tab. 3 Informationen zur Gruppenarbeit 1-4
Tab. 4 Einschätzungsbogen (Erfahrungen) (GErf13)
Tab. 5 Selbsterfahrungsgruppen Nachbefragungsbogen (GrNB36 1-5)
Tab. 6 Auswertung des Gruppenprozessbogens
Tab. 7 Auswertung des Gruppennachbefragungs-Bogens
Überblick
Im ersten Teil mit den Empfehlungen für die Praxis möchte ich meine Gedanken, Materialien und Erfahrungen zur Erleichterung und Förderung des Gruppengeschehens (der Gruppenleitung) und zur Dokumentation sowie der Ergebnisevaluation von personzentrierten Selbsterfahrungsgruppen (auch Encountergruppen genannt) darstellen. So möchte ich in Form eines kurz gefassten Manuals den Leser*innen einerseits einen Eindruck von meiner Form der Gruppenarbeit, ihren Grenzen und ihren Möglichkeiten vermitteln. Andererseits möchte ich zur Diskussion und zum Austausch entsprechender eigener Erfahrungen anregen.
Im zweiten Teil mit den empirischen Ergebnissen möchte ich einen Teil meiner Erfahrungen als Gruppenteilnehmer und Gruppenmoderator bzw. Facilitator in über 75 personzentrierten Selbsterfahrungsgruppen und meine empirischen Forschungsarbeiten zur personzentrierten Gruppenarbeit, die ich in 55 Jahren gewinnen konnte, zusammenfassend weitergeben.
Im dritten Teil benenne ich die von mir benutzte Literatur. Ich möchte nicht versäumen, auf die von Peter F. Schmid 1996 vorgelegte Darstellung der personzentrierten Gruppenarbeit hinzuweisen. Sie umfasst eine historische und auf die Zeit ihrer Entstehung bezogene Verortung personzentrierter Gruppenarbeit. Schmid entwickelt eine ihr angemessene Theorie und Praxis, die insbesondere die Gedanken des Spätwerks von Rogers aufnimmt. Darüber hinaus werden im personzentrierten Ansatz eher tabuisierte Themen (Aggression, Macht, Sexualität) diskutiert und Überlegungen zu einer personzentrierten Ethik vorgestellt. Ich möchte hier auch "die Theorie und Praxis der Gruppenpsychotherapie" anführen, die Irvin D. Yalom 1995 erstmals vorgelegt und 2005 überarbeitet hat. Seine Darstellung und Kritik der Encountergruppenbewegung der 1960iger und 1970iger Jahre zielt auf zweifelhafte bis schädliche Ergebnisse durch mangelhaft kompetente und unverantwortliche Gruppenleitung. Er betont, die Effektivität einer Gruppe hänge weitgehend von vier Leitungsfunktionen ab: "1. Emotionale Anregung (herausfordernde, konfrontierende Aktivität, eindringliches Beispielgeben durch das Eingehen persönlicher Risiken und weitgehende Selbstoffenbarung), 2. Anteilnahme (Unterstützung, Zuwendung, Lob, Schutz, Wärme, Annahme, Echtheit, Besorgtheit) 3. Sinngebung (erklären, darstellen, interpretieren, der Veränderung einen kognitiven Rahmen geben, Gefühle und Erlebnisse in Ideen übersetzen), 4. Exekutive Funktion (Grenzen, Regeln, Normen, Ziele setzen, Zeit einteilen, das Tempo des Fortschreitens bestimmen, Verfahren anhalten, unterbrechen und vorschlagen)." (Yalom deutsche Ausgabe 2019, S.484, 485). Die drei Rogers'schen Grundhaltungen: Echtheit, Empathie und unbedingte Wertschätzung müssten deshalb ergänzt werden durch kognitive Funktionen wie Anregung und Sinngebung (ebd. 485).
Diese Kritik wird in der Weiterentwicklung der personzentrierten Theorie und Praxis nach Rogers unterschiedlich diskutiert und berücksichtigt. Im Differenziellen Inkongruenzmodell (Speierer 2018) habe ich kognitive Aufgaben von Psychotherpeut*innen und Facilitator* innen auch als Bestandteile der Grundhaltungen angesehen und darin Rogers präzisiert. Wo es mir notwendig erschien, habe ich über die Grundhaltungen hinaus Ergänzungen vorgenommen.
Im vierten Teil finden sich die von mir verwendeten und entwickelten Materialien zur Gruppendokumentation und Gruppenevaluation.
Mit dieser dritten Auflage möchte ich zeigen, dass Encountergruppen im Format der hier vorgestellten personzentrierten Selbsterfahrungsgruppen den Ansatz von Carl Rogers weiter präzisieren und ergänzen und dass sie ihren Platz in der personzentrierten Arbeit durch kontinuierliche Dokumentation und Evaluation ihrer Ergebnisse nicht nur erhalten, sondern verbessern können. Die personzentrierte Encountergruppe steht in deutlichem Gegensatz zur Encountergruppenbewegung, die durch mangelhafte Wirksamkeitsnachweise, Beschädigung von Teilnehmer*innen und dominantes Gruppenleiter*innenverhalten sich selbst diskreditiert hat. (s. a. Yalom 2019).
Danken möchte ich allen Kolleg*innen, und Gruppenteilnehmer*innen, die mich bei der Datensammlung für die empirischen Untersuchungen unterstützt sowie zur Neubearbeitung dieser dritten Auflage ermutigt haben. Dafür und für ihre Durchsicht des Textes danke ich Christiane Hellwig ganz besonders. Schließlich danke ich meinen Familienmitgliedern, denen ich dieses Buch gewidmet habe für ihre Geduld und den Freiraum, den sie mir dafür geschenkt haben.
Liebe Leserin, lieber Leser, danke für Ihr Interesse an meiner Arbeit, auf eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Regensburg im Januar 2021 Gert-W. Speierer
I. Empfehlungen für die Praxis (Manual)
1. Definition, Ziele, Anwendungen, Dauer und Formate
Was ist eine Personzentrierte Selbsterfahrungsgruppe (Personzentrierte Encountergruppe)?
In der Kleingruppe versuchen mindestens fünf bis zu fünfzehn selten wenig mehr Personen, in der Großgruppe versucht eine größere nach oben offene Anzahl von Personen untereinander eine persönliche Begegnung von Person zu Person. Die Teilnehmenden sind bestrebt gegenüber sich und den Anderen wertschätzend, offen und wahrhaftig sowie empathisch verstehend zu sein, zusammen mit einer oder zwei, in der Großgruppe ggf. mehreren Personen, die sie dabei unterstützen. In der Kleingruppe gilt absolute Vertraulichkeit: Offenheit nach Innen, Schweigen nach Außen!
Was sind die Gruppenziele?
Vier Ziele von Personzentrierten Selbsterfahrungsgruppen, können als weithin akzeptiert gelten:
1. Die Teilnehmer*innen lernen einander in einem Personzentrierten Gruppenklima kennen, dessen Hauptmerkmale unbedingtes Akzeptieren, Offenheit und Empathie sind.
2. Die Gruppenteilnehmer*innen erfahren die drei personzentrierten Grundhaltungen einer hilfreichen Beziehung und die Bearbeitung von Inkongruenzen durch beispielhaftes Verhalten des*der Gruppenleiter*in (Facilitator*in) sowie darüber hinaus durch entsprechendes Verhalten von Gruppenmitgliedern.
3. Die Teilnehmer*innen erfahren und erproben die personzentrierten Einstellungen/Grundhaltungen undweitere Möglichkeiten, schwierige und kritische, persönliche sowie zwischenmenschliche Probleme und Situationen zu bewältigen, auch solche, die in der jeweiligen Gruppenkonstellation und Gruppendynamik begründet sind.
4. Die Teilnehmer*innen machen für die personzentrierte Arbeit spezifische, förderliche oder therapeutische





























