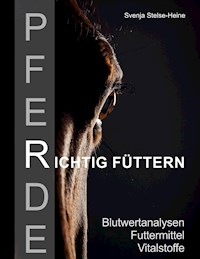
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Ernährung des Pferdes ist ausschlaggebend für dessen Entwicklung und Wohlbefinden. Deshalb sollten Pferde getreu dem Motto - Das Pferd ist, was es frisst - bedarfsgerecht ernährt werden. Mit dem in diesem Buch zusammengetragenen Wissen können Futtermittel und Vitalstoffe - also Mineralien, Spurenelemente, Vitamine und Aminosäuren - bedarfsgerecht und gesund für jedes Pferd zusammengestellt werden. Erfahren Sie, wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Aminosäuren gezielt und therapeutisch eingesetzt werden können. Anschaulich wird der Bedarf in Abhängigkeit von Rasse, züchterischem oder sportlichem Einsatz und weiteren Einflussfaktoren dargestellt. Erkennbare Mangelsymptome werden umfassend beschrieben. Die Analyse von Blutwerten ist eine wichtige Methode, um den Gesundheitszustand des Pferdes zu überprüfen. Was sich hinter Blutwerten verbirgt und welche Rückschlüsse daraus auf die Versorgung des Pferdes gezogen werden können, wird verständlich dargestellt. Aus dem Inhalt: - Futtermittelkunde - Einsatz von Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren - Blutwerte und deren Bedeutung - Planung von Futterrationen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
EINFÜHRUNG IN DIE PFERDEFÜTTERUNG
1.1. W
ORAUS BESTEHT
F
UTTER
?
1.1.1. K
OHLENHYDRATE
1.1.2. E
IWEIßE
1.1.3. F
ETTE
1.1.4. R
OHFASER
1.1.5. M
INERALIEN
& S
PURENELEMENTE
1.1.6. V
ITAMINE
1.2. G
RUNDREGELN DER
P
FERDEFÜTTERUNG
FUTTERMITTEL
2.1. R
AUFUTTER
2.1.1. G
RAS
2.1.2. H
EU
2.1.3. H
EULAGE
2.1.4. S
TROH
2.1.5. H
OLZ
2.2. K
RAFTFUTTER
2.2.1. H
AFER
2.2.2. G
ERSTE
2.2.3. M
AIS
2.2.4. S
OJAEXTRAKTIONSSCHROT
2.2.5. L
UZERNE
2.2.6. Z
UCKERRÜBENSCHNITZEL
2.2.7. H
EUCOBS
2.2.8. E
SPARSETTE
2.2.9. W
EIZENKLEIE
2.2.10. R
EISKLEIE
2.2.11. M
ELASSE
2.2.12. L
EINSAAT
2.2.13. S
ONNENBLUMENKERNE
2.2.14. H
ANFSAMEN
2.2.15. Ö
LE
VITALSTOFFE
3.1. E
INFÜHRUNG
3.2. M
INERALIEN
3.2.1. C
ALCIUM
3.2.2. P
HOSPHOR
3.2.3. M
AGNESIUM
3.2.4. N
ATRIUM
& C
HLORID
3.2.5. K
ALIUM
3.3. S
PURENELEMENTE
3.3.1. Z
INK
3.3.2. M
ANGAN
3.3.3. K
UPFER
3.3.4. S
ELEN
3.3.5. J
OD
3.3.6. C
HROM
3.3.7. K
OBALT
3.3.8. M
OLYBDÄN
3.3.9. E
ISEN
3.4. V
ITAMINE
3.4.1. V
ITAMIN
A
3.4.2. B-V
ITAMINE
3.4.3. V
ITAMIN
B1 – T
HIAMIN
3.4.4. V
ITAMIN
B2 – R
IBOFLAVIN
3.4.5. V
ITAMIN
B3 – N
IACIN
3.4.6. V
ITAMIN
B4 – C
HOLIN
3.4.7. V
ITAMIN
B5 – P
ANTOTHENÄURE
3.4.8. V
ITAMIN
B6 – P
YRIDOXIN
3.4.9. V
ITAMIN
B7 – B
IOTIN
3.4.10. V
ITAMIN
B9 – F
OLSÄURE
3.4.11. V
ITAMIN
B12 – C
OBALAMIN
3.4.12. V
ITAMIN
C
3.4.13. V
ITAMIN
D
3.4.14. V
ITAMIN
E
3.4.15. V
ITAMIN
K
3.5. E
SSENTIELLE
A
MINOSÄUREN
3.5.1. E
INFÜHRUNG
3.5.2. M
ETHIONIN
3.5.3. T
HREONIN
3.5.4. L
YSIN
3.5.5. T
RYPTOPHAN
3.5.6. L
EUCIN
3.5.7. I
SOLEUCIN
3.5.8. V
ALIN
3.5.9. P
HENYLALANIN
& T
YROSIN
3.6. W
EITERE AUSGEWÄHLTE
A
MINOSÄUREN
3.6.1. A
LANIN
3.6.2. A
RGININ
3.6.3. A
SPARAGINSÄURE
/A
SPARTAT
3.6.4. C
ITRULLIN
3.6.5. C
YSTEIN
3.6.6. G
LUTAMIN
3.6.7. G
LUTAMINSÄURE
3.6.8. G
LYCIN
3.6.9. H
ISTIDIN
3.6.10. S
ERIN
3.6.11. T
AURIN
3.6.12. O
RNITHIN
BLUTWERTANALYSEN
4.1. E
INFÜHRUNG
4.2. L
EBERWERTE
4.2.1. A
LKALISCHE
P
HOSPHATASE
4.2.2. AST (GOT)
4.2.3. y-GT
4.2.4. GLDH
4.2.5. B
ILIRUBIN
4.2.6. C
HOLESTERIN
4.3. M
USKELWERTE
4.3.1. LDH
4.3.2. CK
4.4. N
IERENWERTE
4.4.1. K
REATININ
4.4.2. H
ARNSTOFF
4.4.3. SDMA
4.5. B
LUTBILDUNG
4.5.1. E
RYTHROZYTEN
& H
ÄMOGLOBIN
4.5.2. MCH
4.5.3. MCV
4.5.4. MCHC
4.5.5. H
ÄMATOKRIT
4.5.6. L
EUKOZYTEN
4.5.6.1. L
YMPHOZYTEN
4.5.6.2. M
ONOZYTEN
4.5.6.3. E
OSINOPHILE
4.5.6.4. B
ASOPHILE
4.5.7. T
HROMBOZYTEN
4.6. S
PURENELEMENTE
4.6.1. E
ISEN
4.6.2. K
UPFER
4.6.3. Z
INK
4.6.4. M
ANGAN
4.6.5. S
ELEN
4.6.6. J
OD
4.7. M
INERALIEN
4.7.1. C
ALCIUM
4.7.2. P
HOSPHOR
4.7.3. M
AGNESIUM
4.7.4. N
ATRIUM
4.7.5. K
ALIUM
4.8. F
ETTE
& E
IWEIßE
4.8.1. T
RIGLYCERIDE
4.8.2. G
ESAMTEIWEIß
4.8.2.1. A
LBUMIN
4.8.2.2. G
LOBULIN
4.9. B
AUCHSPEICHELDRÜSEN
- / EMS-P
ROFIL
4.9.1. G
LUKOSE
4.9.2. I
NSULIN
4.9.3. G
LUKOSE
-I
NSULIN
-Q
UOTIENT
4.9.4. L
IPASE
4.9.5. A
MYLASE
4.10. C
USHING
-P
ROFIL
4.10.1. ACTH
4.10.2. C
ORTISOL
4.11. S
CHILDDRÜSENWERTE
4.11.1.
F
T4
4.11.2.
F
T3
RATIONSPLANUNG
5.1. E
INFÜHRUNG
5.2. W
IE WIRD EINE
R
ATION GEPLANT
?
5.2.1. W
AS BEKOMMT DAS
P
FERD
AKTUELL
?
5.2.2. W
AS BRAUCHT DAS
P
FERD
?
5.2.3. D
ER
F
UTTERPLAN
FALLBEISPIELE AUS DER PRAXIS
SCHLUSSWORT
DANKSAGUNG
LESETIPPS
Vorwort
Vor vielen Jahren begann ich, meine Pferde auf der eigenen Wiese zu halten und mit Gras bzw. Heu ad libitum in der Annahme zu füttern, dies wäre das gesündeste, was ich für die Tiere tun könnte. Weitere Futtermittel oder Zusatzstoffe, dachte ich, seien nicht nötig. Ein selbstgezogener Jährling mit einem Chip im Sprunggelenk, eine junge Stute mit Sommerekzem und unser an Hufrehe erkranktes Kinderpony brachten mich nach intensiver Befassung mit dem Thema zu der Einsicht, dass ich im Irrtum war. Eine alleinige Heu- und Grasfütterung reicht nicht immer aus, um ein Pferd gesund zu erhalten und so musste ich meine Fütterung kritisch überprüfen.
Für die Gesundheit von Pferden ist es wichtig, ja lebenswichtig, dass die Fütterung bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Ansprüche der Pferde beachtet. Es kommt maßgeblich auf die Balance von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten an. Sie müssen in bedarfsgerechten Mengen und im richtigen Verhältnis gefüttert werden.
Auch Mineralien, Vitamine, Spurenelemente und Aminosäuren müssen untereinander ausgewogen sein und im richtigen Verhältnis stehen. Es treten sonst Mangelsymptome auf, die nicht durch einen echten Mangel, sondern durch Dysbalancen entstehen.
Bei der Fütterung von Pferden existiert kein schwarz oder weiß. Es gibt nicht das eine richtige Futtermittel oder das eine richtige Mineralfutter. Es kommt immer darauf an, mit welcher Rasse, mit welcher Grundfutterqualität und welchen sonstigen Anforderungen wir es zu tun haben.
Aber natürlich sind auch Mängel beispielsweise durch Verarmung der Böden und durch die Ansprüche unserer hochgezüchteten modernen Pferderassen sehr häufig.
In meiner Arbeit als unabhängige Futterberaterin begegnen mir immer wieder Pferde, die schulmedizinisch als austherapiert eingestuft wurden. Tatsache ist, dass solche Patienten in auffälliger Häufigkeit positiv auf eine bedarfsgerechte, ausbalancierte Umstellung der Fütterung unter therapeutischem Einsatz von Vitalstoffen ansprechen.
Mit diesem Buch möchte ich Pferdebesitzer, Tiermediziner, Heilpraktiker, Futterberater und Pferdetrainer dabei unterstützen, die Fütterung der Pferde zu überprüfen und ausgerichtet auf eine optimale Versorgung neu zu planen, dabei Krankheiten und Symptome sowie moderne Laboranalysen richtig zu deuten und folgerichtig zu reagieren. Im zweiten und dritten Teil des Buches verwende ich in Teilen Fachbegriffe, die nicht jedem Pferdehalter geläufig sein werden. So bietet dieses Buch aber auch für Fachleute weiterführende Informationen.
Durch die Erfolge in meiner täglichen Arbeit bin ich davon überzeugt, dass es durch richtige Fütterung gelingen kann, gesunde Pferde gesund zu erhalten und erkrankte Pferde zu einem großen Teil zu heilen oder die Symptome zumindest zu lindern.
1. Einführung in die Pferdefütterung
„Was ist das beste Futter für mein Pferd“? Diese oder ähnliche Fragen werden in den sozialen Medien täglich gestellt. Dazu kann man sagen: Das „eine“ oder „das beste Futter“ gibt es nicht.
Die Grundlage einer gesunden Pferdefütterung ist und bleibt das Raufutter (Gras, Heu, Stroh, Holz). Dabei kommt es schon allein auf Grund der täglich verzehrten Menge unverzichtbar auf eine gute Qualität an. Raufutter, welches eine für das Pferd ungünstige Zusammensetzung hinsichtlich Energie-, Zucker-, Eiweiß- oder Mineralgehalt hat oder dessen Toxingehalte erhöht sind, muss sich schon allein auf Grund der zugeführten Menge im Stoffwechsel negativ auswirken.
Das heißt, mit der bedarfsgerechten Raufutterqualität steht und fällt der Gesundheitszustand des Pferdes. An dieser Stelle muss daher zum einen sehr genau hingeschaut werden, was enthalten ist, zum anderen dürfen nicht zu viele Kompromisse eingegangen werden.
Wenngleich einige Einschränkungen der Raufutterfütterung durch Kraft- und Mineralfutter ausgeglichen werden können, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass dies nur bei Unterversorgung, nicht aber bei Überversorgung oder gar bei Schimmel- oder Toxinbefall möglich ist. Bekommt ein Pferd beispielsweise mit 10 kg Heu täglich zu wenig Eiweiß, kann ein passendes Kraftfutter ergänzt werden und es wird dem Pferd gut gehen. Bekommt das Pferd hingegen mit 10 kg Heu zu viel Eiweiß, können wir einzig durch Änderung der Raufutterquelle oder Raufuttermenge Gesundheitsschäden vermeiden.
Merke:
Der erste Schritt bei der Planung von Futterrationen ist immer ein Blick in das Raufutter. Nur wenn hierdurch die Bedarfe nicht gedeckt werden können, ist es überhaupt erst erforderlich, Kraft- oder Mineralfutter zu ergänzen.
Ein Kraftfutter sollte einzig und allein dazu dienen, Defizite aus der Raufutterfütterung abzufangen.
Wird ein Pferd sehr sportlich geritten, hat es einen höheren Energiebedarf, als es durch Raufutter aufnehmen könnte. In diesem Fall muss als Kraftfutter ein effizienter Energielieferant zugefüttert werden.
Sofern ein Pferd in der Zucht eingesetzt wird oder sich im Wachstum befindet, kann möglicherweise der hohe Proteinbedarf nicht allein mit Raufutter gedeckt werden. Dann ist die Ergänzung mit einem eiweißhaltigen Kraftfutter erforderlich. Dabei muss immer beachtet werden, welche Gesamtfuttermenge ein Pferd individuell täglich fressen kann. Kann ein Pferd am Tag bspw. maximal 15 kg Gesamtfutter aufnehmen, weil es dann schlicht gesättigt ist, würde es wenig nutzen, 15 kg Heu mit 5 kg Kraftfutter ergänzen zu wollen. Dann würde das Pferd voraussichtlich weniger Heu fressen und die Gesamtenergie- oder Proteinbilanz würde nach wie vor nicht stimmen. Es kommt also in der Futterplanung darauf an, das Individuum genau zu betrachten.
Ein Mineralfutter soll Mängel an Mengen- und Spurenelementen, Vitaminen und ggf. Aminosäuren ausgleichen – nicht mehr und nicht weniger. Die häufig gestellte Frage, welches Mineralfutter das beste sei, ist nicht zu beantworten, denn es kann nur für jedes Einzelpferd, abhängig von dessen Fressverhalten und Bedarf sowie für jede individuelle Futterkomposition ein dazu passendes Mineralfutter geben. Andere Versprechungen der Futtermittelproduzenten sind folgerichtig kritisch zu sehen.
Merke:
Kraft- und Mineralfutter dürfen nicht als Selbstzweck, sondern nur zur individuellen Bedarfsdeckung gefüttert werden, wenn die Raufutterversorgung nach genauer Betrachtung nicht ausreicht.
Unsere hochgezüchteten Pferderassen sind nicht mit den Wildpferden von einst zu vergleichen. Moderne Pferderassen sind auf Größe, Bemuskelung, Schnelligkeit, Temperament selektiert, nicht auf optimale Futterverwertung. Selbst der moderne Isländer ist größer und mit mehr Typ2-Muskulatur (Sprintmuskulatur) versehen als sein wilder Vorfahre und muss deshalb anders gefüttert werden. Wer meint, solche den Wildpferden noch vermeintlich nahe Rassen würden kaum Spurenelemente benötigen, da beispielsweise die Isländer auch kein Mineralfutter bekommen hätten, der irrt. Island ist eine Vulkaninsel und das Gras strotzt nur so vor Mineralien und Spurenelementen.
Wir müssen also genau hinschauen, mit welcher Art von Pferd wir es zu tun haben. Haben wir einen rundrumpfigen, kleinen, guten Futterverwerter oder ein schmales, langbeiniges, nervöses Warmblutpferd vor uns, verfügt das Pferd über viel oder wenig Knochenmasse, über mehr Typ1 oder Typ2-Muskulatur, viel oder wenig Fell?
Merke:
Pferd ist nicht gleich Pferd. Jede Rasse und jedes Individuum hat eigene Besonderheiten und Bedürfnisse hinsichtlich der Fütterung.
Ein großer Teil der deutschen Freizeitpferde ist übergewichtig. Im Durchschnitt werden diese Pferde 3-4 Stunden in der Woche geritten. Sie bekommen 24 Stunden Heu und dazu noch Kraftfutter. In der Folge werden viele Pferde adipös und entwickeln Störungen wie Insulinresistenz, Bauchspeicheldrüseninsuffizienz, Hufrehe oder EMS (Equines metabolisches Syndrom). Pferden geht es in dieser Beziehung nicht anders als uns Menschen.
Aber: Es liegt in der Hand des Menschen, die Energiezufuhr der Pferde zu steuern. Dafür sind Pferdebesitzer und Pensionsstallbetreiber verantwortlich. Einem adipösen Pferd geht es ebenso schlecht, wie einem abgemagerten Pferd– womöglich sind die Spätfolgen sogar noch gravierender. Daher ist für viele Pferde eine verringerte Energiezufuhr anzuraten, dabei darf jedoch eine ausreichende Versorgung mit Vitalstoffen – also mit Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren - nicht vernachlässigt werden.
Merke:
Weniger ist manchmal mehr – weniger Gewicht, aber nicht weniger essentielle Vitalstoffe.
Pferde haben abhängig vom Typ, der Anforderung und der Raufutterbasis einen steten Bedarf an Energie und Vitalstoffen. Ihr Verdauungssystem ist extrem empfindlich. Es tut den Tieren daher nicht gut, ständig das Futter zu wechseln oder mal eine Dose hiervon, dann eine Dose davon zu füttern.
Wenn ein Bedarf besteht, dann besteht er langfristig. Nur wenige Ausnahmen, wie z.B. jahreszeitliche Inhaltsschwankungen des Raufutters, wechselnde Anforderungen durch Sport, Zucht oder Erkrankungen führen dazu, dass kurzzeitig veränderte Bedarfe bestehen, auf die mit einzelnen Dosen reagiert werden sollte.
Merke:
Im Normalfall wird es nicht erforderlich sein, beispielsweise ständig ein anderes Müsli oder Mineralfutter zu füttern. Beständigkeit ist in der Regel der bessere Weg, denn das Pferd hat ganz beständig täglich den gleichen Bedarf.
„Du bist, was du isst“
(Ludwig Feuerbach).
Diese weisen Worte sind untrennbar mit der Gesunderhaltung unserer Schützlinge verbunden. Das Wunderwerk eines Körpers kann viel regulieren und regenerieren, wenn ihm dafür alle nötigen Bausteine – nicht zu viel und nicht zu wenig – zur Verfügung stehen. Fehlt ein Baustein, löst dies unweigerlich Kettenreaktionen aus. So sagte Justus Liebig: „Ein Organismus ist im Wachstum durch die im Verhältnis knappste Ressource begrenzt.“
Jeder versteht, dass er ein Steinhaus nur schwerlich ohne Steine bauen kann. Womöglich kann sich der Häuslebauer noch helfen, indem er bei einem Mangel an Steinen diese auf größeren Abstand setzt oder ein Fenster vergrößert. Geht ihm aber eines Tages auch noch der Mörtel aus, wird das Haus nicht halten – der Hausbau wird so durch die knappste Ressource begrenzt.
Genauso ergeht es dem Organismus des Pferdes. Ohne Material kann keine gesunde Haut „gebaut“ werden, die Muskulatur macht schlapp und die Bildung von Abwehrstoffen, Hormonen, Enzymen oder Neurotransmittern ist nicht zufriedenstellend möglich.
Vorübergehend kann der Organismus improvisieren, Vitalstoffe austauschen und durch andere ersetzen. Fehlen diese auch eines Tages, dann bricht das System – genauso wie das Haus - zusammen.
Dabei ist die gesunde und vor allem bedarfsgerechte Fütterung des Pferdes kein Hexenwerk, sondern gründet sich auf das, zugegeben, manchmal komplizierte Zusammenspiel von Futtermitteln und deren Inhaltsstoffen sowie den speziellen Anforderungen des einzelnen Individuums.
1.1. Woraus besteht Futter?
1.1.1. Kohlenhydrate
Was sind eigentlich Kohlenhydrate? Grob gesagt handelt es sich bei Kohlenhydraten um Zucker in verschiedenen Formen. Man unterscheidet Einfachzucker – die Monosaccharide - und Mehrfachzucker – die Polysaccharide. Die verschiedenen Zuckerformen werden durch das Pferd mit dem Futter kontinuierlich aufgenommen, denn: Zucker findet sich zu Hauf in Gras, Heu oder Getreide.
Die Verdaulichkeit der Kohlenhydrate ist sehr unterschiedlich. Im ersten Schritt werden kurzkettige Zucker im Maul des Pferdes durch Speichelenzyme in Einfachzucker zerlegt. Am Anfang des Dünndarms werden Einfachzucker bereits in das Blut abgegeben. Zur Verdauung der Mehrfachzucker gelangen hier zusätzlich die Enzyme Amylase und Maltase in den Dünndarm. Wurden Mehrfachzucker durch diese Enzyme in Einfachzucker aufgespalten, werden sie am Ende des Dünndarms ins Blut aufgenommen. Es verbleibt an dieser Stelle jedoch immer noch ein Teil der Kohlenhydrate im Darm und zwar derjenige, der an Pflanzenfaserstoffe, also an die Rohfaser gebunden ist. Auch Stärke ist bis zu diesem Ort des Verdauungstrakts teilweise noch nicht in Einfachzucker zerlegt. Im Weiteren Verlauf der Verdauung gelangen Rohfaser und Stärke in den Dickdarm, wo sie durch Darmbakterien gespalten und dann ins Blut aufgenommen werden.
Abbildung 1: Formen der Kohlenhydrate
Gelangt Glukose aus dem Darm ins Blut reagiert der Organismus mit einer Ausschüttung des Hormons Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Nur mit Hilfe des Insulins kann Glukose aus dem Blut in jede Körperzelle transportiert werden – Insulin ist sozusagen der „Türöffner“ für die Glukose. In der Zelle angekommen, wird Glukose zur Energiegewinnung in das sogenannte Adenosintriphosphat (ATP) umgewandelt und damit letztlich „verbraucht“.
Wird weniger Glukose verbraucht als zur Verfügung steht, wird sie in der Leber zu Glykogen umgewandelt und sowohl in der Leber, als auch in der Muskulatur eingelagert. Eine andere Variante der Kohlenhydratspeicherung besteht in der Umwandlung in Körperfett.
Wird mehr Glukose verbraucht, als zur Verfügung steht, schüttet die Leber das Hormon Glukagon aus. Dadurch wird das eingelagerte Glykogen wieder zu Glukose rückumgewandelt und steht zur Energiegewinnung zur Verfügung.
Abbildung 2: Verdauung der Kohlenhydrate
Wird dem Pferd insgesamt zu viel oder auch zu viel schwer verdaulicher Zucker zugeführt, kann es erkranken. Ursache ist zum einen eine Verfettung. Zum anderen führen ständig hohe Glukosespiegel zu andauernder Insulinausschüttung. Die dauerhafte Insulinausschüttung ermüdet leider die Bauspeicheldrüse, so dass es langfristig zu einem Insulinmangel kommen kann. Zusätzlich werden Zellen ob des ständigen Insulins „müde“. Es kann eine sogenannte Insulinresistenz entstehen, was bedeutet, dass Glukose nicht mehr in die Zellen aufgenommen wird. In der Folge sinkt der Glukosespiegel nicht ausreichend ab und verbleibt auf hohem Niveau im Blut. Anhaltend hohe Blutzuckerspiegel haben Nierenerkrankungen, Hufrehe, Gefäßverengungen oder Equines metabolisches Syndrom (EMS) zur Folge. Diese Pferde werden schwer krank.
Die Ribose nimmt als Einfachzucker übrigens eine Sonderstellung ein, denn sie hat keinen Einfluss auf den Insulinspiegel.
Für Pferdehalter wichtig zu wissen: Die unterschiedlichen Verdaulichkeiten der
Abbildung 3: Glukosestoffwechsel
Kohlenhydrate können wir in der Fütterung klug nutzen. Mehrfachzucker der Rohfaser – also z.B. Pektin und Cellulose in Heu oder Rübenschnitzeln – erhöhen den Blutzuckerspiegel langsamer und weniger stark als Einfachzucker oder leichtverdauliche Stärke aus zum Beispiel Hafer. Dieser Umstand kann genutzt werden, um Pferde gesund zu erhalten.
Es kann mit diesem Wissen auch eine gezielten Leistungsoptimierung erreicht werden: Rennpferde benötigen schnell und sofortverfügbare Energie z.B. aus Hafer. Distanzpferde hingegen sollten über Stunden eine gleichmäßige Glukosezufuhr zum Beispiel aus Rübenschnitzeln erhalten.
Merke:
Kohlenhydrate aus der Rohfaser erhöhen den Blutzuckerspiegel deutlich langsamer als Einfach- oder Mehrfachzucker.
Auf Grund der oben beschriebenen schweren Verdaulichkeit von Stärke - in Form von Fruktan oder durch Getreidefütterung – sollte der Stärkezufuhr besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Bekommt das Pferd je Mahlzeit mehr als 200 g / 100 kg Pferdegewicht schwer verdauliche Stärke zugeführt, gelangt ein großer Teil unverdaut in den Dickdarm. Die dortigen Darmbakterien reagieren empfindlich auf Stärkeanflutungen und können daraufhin absterben. Tritt der Fall ein, dass eine große Anzahl der Darmbakterien auf einmal abstirbt, kann auf Grund der dabei entstehenden Gifte eine Hufrehe die Folge sein.
Merke:
Die Stärkemenge sollte nicht mehr als 200 g / 100 kg Pferdegewicht je Mahlzeit betragen.
Kohlenhydrate finden sich in allen Futtermitteln. Besonders reich an dem Energielieferanten sind Getreide und Melasse. Jedoch können auch Gras, Heu und Heucobs sehr kohlenhydratreich sein.
1.1.2. Eiweiße
Eiweiße werden auch Proteine genannt. Sie sind elementare Bausteine allen Lebens, sozusagen die Ziegelsteine des Hausbaus: Aus Eiweißen werden Körperzellen, Enzyme, Hormone und mehr - im wahrsten Sinne des Wortes - gebaut. Jede Körperzelle, also jede Haut-, Haar-, Knochen-, Muskel-, Leber- oder Blutzelle besteht aus Proteinen.
Proteine bestehen wiederum aus 100 – 1000 einzelnen Aminosäuren.
Um sich den Aufbau besser vorstellen zu können, wage ich erneut den Vergleich mit einem Haus: Das Haus hat viele Wände, diese stellen wir uns als die Organe des Pferdes vor. Eine Wand wiederum besteht aus Ziegelsteinen und Mörtel, in unserem Beispiel die Proteine. Ein Ziegelstein besteht aus Lehm und Wasser, Mörtel aus Sand, Kalk und Wasser. Diese Bestandteile setzen wir mit den Aminosäuren, sozusagen der „Ursubstanz“ des Hauses, gleich.
Füttern wir das Pferd mit Eiweiß, muss es die Eiweiße zunächst in die einzelnen 100 – 1000 Aminosäuren zerlegen, um diese für den Organismus zielgerichtet wieder einzusetzen. Es muss die Eiweiße z.B. aus Gras in einzelne Aminosäuren zerlegen, um daraus Muskeln oder Haare aufbauen zu können – eine komplizierte Aufgabe.
Die Schlüsselrollen bei der Zerlegung der Eiweiße in Aminosäuren übernehmen Darm und Leber. Ist deren Funktion eingeschränkt, können Eiweiße nicht oder nur eingeschränkt in die einzelnen Aminosäuren aufgespalten werden. Die Bedeutung der Aminosäuren wird im weiteren Verlauf des Buches noch vertieft. An dieser Stelle sei bereits erwähnt, dass zu viel Eiweiß Leber und Nieren belastet.
Merke:
Zu viel Eiweiß in der Fütterung belastet die Niere und gleichzeitig die Leber. Zu wenig Eiweiß stört den Zell-, Enzym- und Hormonaufbau.
Bei Bedarf können Eiweiße in Glukose umgewandelt werden. Auch diese Aufgabe übernimmt die Leber. So kann dem Organismus auch in Hungerzeiten, durch Abbau der Muskulatur, genügend Energie für Bewegung oder Wärme zur Verfügung gestellt werden.
1.1.3. Fette
Auch Fette dienen als Energie- und Wärmelieferant. Sie sind der energiereichste Futtermittelbestandteil. Ihr Einsatz ist jedoch hinsichtlich der Menge auf rund 100 ml / 100 kg Pferdegewicht zu begrenzen. Dennoch werden sie vor allem im Hochleistungssport gerne eigesetzt.
Wenngleich das Pferd nicht über eine Gallenblase verfügt, produziert die Leber dennoch 6 – 10 l Gallensäuren täglich, so dass eine Fettverdauung allen Nachreden zum Trotz umfangreich möglich ist.
Fette liefern dem Pferd essentielle Fettsäuren. Auf Vor- und Nachteil der Ölsorten wird an anderer Stelle vertieft eingegangen.
1.1.4. Rohfaser
Die Rohfaser ist für die Aktivität des Darms unerlässlich. Sie besteht aus Kohlenhydraten und Gerüstsubstanzen der Pflanzenzellen. Ein Grasstängel zum Beispiel enthält viel Rohfaser.
Rohfaser wird durch Enzyme der Darmbakterien zerlegt und enthält, wie bereits erwähnt, Kohlenhydrate, die im Vergleich zu anderen Kohlenhydraten nur zu geringen Blutzuckeranstiegen führen. Dabei sind einige leichter, anderer schwerer verdaulich. Beispielsweise das im Stroh reichlich enthaltene Lignin ist so gut wie nicht verdaulich.
Ein Übermaß, genauso wie ein Mangel an Rohfaser, können sowohl zu Stopfkoliken als auch zu Kotwasser führen. Ursächlich hierfür ist der Einfluss der Rohfaser auf die Darmperistaltik. Optimaler Weise liegt der Gehalt bei 15 % - 35 %.
Merke:
Der Rohfasergehalt sollte bei mindestens 15 % - maximal 35 % der Gesamtfuttermenge liegen.
1.1.5. Mineralien & Spurenelemente
Mineralien und Spurenelemente dienen als Bausubstanz sowie als auch als Katalysatoren für Stoffwechselprozesse. Als Baustein dient beispielsweise das Mineral Calcium für stabile Knochen. In gleicher Weise dienen auch andere Mineralien und Spurenelemente als Bausteine für Zähne, Haut, Haare, innere Organe, Blut, Verdauungssäfte, Hormone und Enzyme.
Zahlreiche Mineralien und Spurenelemente machen durch ihre Anwesenheit bestimmte chemische Reaktionen erst möglich, indem sie als Katalysatoren fungieren. Katalysatoren ermöglichen oder beschleunigen chemische Reaktionen, das bedeutet, sie machen die Bildung von zahlreichen Enzymen, Hormonen oder Eiweißen erst möglich. So wird Zink die Beteiligung an 300 enzymatischen Reaktionen, Magnesium sogar an 600 Reaktionen nachgesagt.
Bei Mangelernährung kann es daher sowohl zu Störungen im Aufbau von Gewebestrukturen als auch zu Störungen in enzymatischen Reaktionen kommen. Dadurch wiederum können ggf. Hormone, Enzyme, Gewebe etc. nicht gebildet werden.
1.1.6. Vitamine
Vitamine werden unterschieden in
wasserlösliche Vitamine und
fettlösliche Vitamine.
Zu den wasserlöslichen Vitaminen gehören Vitamin C und alle B-Vitamine. Diese werden nicht im Gewebe angereichert und können daher kaum überdosiert werden.
Als fettlösliche Vitamine bezeichnet man die Vitamine A, E, D und K. Diese werden im Gewebe gespeichert, weshalb es bei diesen zu Überdosierungen kommen kann.
Merke:
Wasserlösliche Vitamine können kaum überdosiert werden, fettlösliche hingegen schon.
Vitamin E kann das Pferd nicht selbst bilden. Es muss über die Nahrung (bspw. durch Grassamen im Heu) zugeführt werden. Alle anderen Vitamine können Pferde theoretisch selber bilden, wenn denn die Ausgangsstoffe zur Verfügung stehen und die Organe dies bewältigen können. Beispielsweise werden die meisten B-Vitamine im Darm durch Darmbakterien gebildet. Liegt hier eine Störung vor, gerät das Pferd ggf. in eine Mangelsituation.
Als weiteres Beispiel sei Vitamin A genannt. Fehlt das zur Bildung des Vitamin A zwingend notwendige Beta-Carotin, welches im Heu zunächst ausreichend vorkommt, aber stark flüchtig ist, dann kann das Pferd bei reiner Heufütterung in einen Mangel geraten.
Derlei Beispiele und Zusammenhänge sind vielfältig, so dass die Kenntnis um den „Ort“ der Bildung (Organ) und Mangelsymptome für die Pferdefütterung wichtig ist und im Folgenden vertieft wird.
1.2. Grundregeln der Pferdefütterung
Bei der Planung von Futterrationen gibt es einige Grundregeln zu beachten. Dabei sollten folgende Gesamtmengen oder auch Verhältnisse untereinander beachtet werden:
Grundregeln der Pferdefütterung
Heu/Gras
täglich mind. 1-1,5 kg / 100 kg LM
Stroh
täglich max. 0,8 kg / 100 kg LM bzw. max. 1/3 der Gesamtration
Holz
20 – 40 g / 100 kg LM
Rohfasergehalt
mind. 15 %, gut 20-35 % der Gesamtfutterration
Gesamteiweiß
täglich max. 200 g / 100 kg LM
Stärke
max. 200 g/ 100 kg LM je Mahlzeit
Protein (dvP)- Energie-Quotient (P:Q)
5:1 – 10 :1
Ca:P
1,5 -2 : 1
Ca:Mg
2:1
Ca:Ka
1:1
Zn:Mn:Cu
5 : 4 : 1
Fe:Cu
8:1 – 4:1
Fresspausen
weniger als 4 Stunden
Fressdauer
14 – 16 Std. täglich
Raufutter : Kraftfutter
Möglichst nicht unter 70% : 30 %
Futterumstellungen
über 14 Tage
Erhalten Pferde weniger als 1 – 1,5 kg Heu je 100 kg Lebendgewicht, entstehen schnell Fresspausen von mehr als 4 Stunden. In der Folge entwickeln Pferde häufig Magengeschwüre oder Koliken.
Stroh und Holz sind sehr gute Futtermittel, um energiereiche Heuchargen zu ergänzen und so bei ausreichender Fresszeit weniger Kalorien zu füttern. Die angegebenen Höchstmengen sollten aber nicht überschritten werden, um Stopfkoliken zu vermeiden.
Die Gesamteiweißversorgung sollte nicht höher als 200 g / 100 kg Pferd betragen. Andernfalls könnten Leber und Niere überlastet werden, denn diese Organe setzen Eiweiße um. In diesem Zusammenhang sollte das Verhältnis von dünndarmverdaulichem Protein – also dem Protein, dass auch wirklich aufgenommen werden kann - zu Energie nicht mehr als 5:1 betragen.
Die genannten Verhältnisse der Mineralien und Spurenelemente sollten beachtet werden, um Verdrängungseffekte zu vermeiden.
Damit das empfindliche Verdauungssystem des Pferdes keinen Schaden nimmt, sollte der Kraftfutteranteil auch bei höchsten sportlichen Anforderungen nicht mehr als 30 % der Gesamtfutterration umfassen.
2. Futtermittel
2.1. Raufutter
Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass die Fütterung von Raufutter den allergrößten Einfluss auf die Pferdegesundheit hat. Dem entsprechend hat die Qualität des Raufutters den größten Einfluss auf die Höhe der Energiezufuhr, auf Nährstoffgehalte und auf fütterungsbedingte Schadstoffbelastungen.
Als Raufutter stehen Gras, Heu, Heulage, Stroh und Holz zur Verfügung. Insbesondere Stroh und Holz sind energiearm, daher können sie vorteilhaft bei leichtfuttrigen Pferden eingesetzt werden, um deren Fresszeiten bei geringer Energiezufuhr zu verlängern. Das kleine Pony, das nur 2 kg Heu am Tag fressen darf, um nicht zu dick zu werden, könnte beispielsweise zusätzlich mit Holz versorgt werden.
Pferde sollten nahezu rund um die Uhr Raufutter fressen können. Nur so können Magengeschwüre oder Darmprobleme langfristig vermieden werden. Baumgartner et al. (2020)1 legten in ihrer Arbeit jüngst dar, dass Pferde normalerweise innerhalb von 24 Stunden jeweils 12 bis 16 Stunden Futter aufnehmen. Dabei werden 60 - 70 % des Futters am Tag und 30 – 40 % in der Nacht aufgenommen. Sind Pferde aus verschiedenen Gründen gestresst, fressen sie schneller. In der Folge nehmen sie entweder zu viel Futter auf (wenn vorhanden) oder die Fresspausen verlängern sich.
Während das eine Pferde eine Stunde frisst, eine Stunde Pause macht, frisst das andere lieber 3 Stunden und macht erst dann eine 2 - 3-stündige Pause. Ihr Verhalten ist individuell.
Merke:
Pferde haben individuelle Fressintervalle.
Zeitgesteuerte Heuraufen können deshalb für einzelne Pferde zu gravierendem Stress führen. Durch die Zeitsteuerung kann der individuelle Fressrythmus gestört werden. Häufig reagieren Pferde auf diese Art der Raufutterfütterung mit Magenbeschwerden.
Neigen Pferde zu Übergewicht, sollte nach Möglichkeit nicht die Fresszeit reduziert oder künstlich verändert, sondern Art und Energiegehalt des Raufutters angepasst werden.
2.1.1. Gras
Pferde lieben Gras. Jedoch nicht für jedes Pferd ist Gras ein uneingeschränkt gutes Futtermittel. Die Aufnahme lässt sich teilweise schwerer steuern als bei anderen Raufuttersorten, so dass es zu einer zu hohen Energiezufuhr kommen kann. Bei normalem Bewuchs fressen Pferde rund 4 kg Gras je Stunde, bei geringem Bewuchs rund 1-2 kg.
Merke:
Pferde fressen je Stunde ca. 4 kg Gras bei normalem Bewuchs. Bei geringem Bewuchs sinkt die Aufnahme auf 1-2 kg je Stunde.
Im Vergleich zu anderen Raufuttermitteln enthält Gras hohe Mengen der unverzichtbaren Aminosäure Methionin, Vitamin C, Beta-Carotin und B-Vitamine. Für die Funktion des Immunsystems und die Leberentgiftung ist Gras deshalb ein sehr wertvolles Futter. Soweit es der Futter- und Gesundheitszustand eines Pferdes zulassen, sollte jedem Pferd der Zugang zu Gras ermöglicht werden.





























