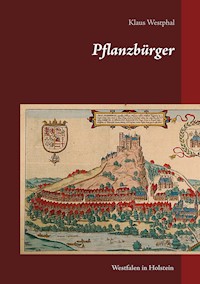
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unter Pflanzbürgern verstand man im Mittelalter Personen, die zu friedlichen Zwecken in ein Land kamen oder in ein Land gerufen wurden. Sie sollten es zusammen mit der einheimischen Bevölkerung neu gestalten, nach Verheerungen und Verwüstungen wieder aufbauen, es zur Sicherung der Lebensgrundlagen im wörtlichen Sinne neu "bepflanzen", es inspirieren, mit Innovationen auf ein neues ökonomisches und gesellschaftliches Niveau heben. Dies geschah immer in sozioökonomischer Beziehung zu den heimisch siedelnden Menschen. Gegenseitige Abhängigkeiten mussten beachtet werden, Sitten, Gebräuche, Rechtsverständnisse, religiöser Glauben, Herrschaftsformen und Ethnien aneinander angepasst werden. Dies geschah nicht ohne Konflikte. Heute spricht man von Migranten, damals von Kolonisten. Dieses Buch handelt von den Wirkungen der Ansiedlungsprozesse, von Kolonisten, die im 12. Jahrhundert an die Ostseeküste gerufen worden sind, um das durch Glaubenskriege der damaligen Zeit verheerte Land zwischen Slawen und Sachsen wieder aufzubauen. Aber auch davon, wie die Umgestaltung des slawischen Wagriens an der Ostsee zur christlichen Grafschaft der Schauenburger missbraucht wurde, um die Christianisierung mit Feuer und Schwert weiter nach Osten in das abotritische Reich voranzutreiben, nachdem die Ausgangsbasis hierfür zunächst auf den Modus friedlich gestellt war. Gezeigt wird dies an Namensträgern der Westfalen, die, aus Westfalen stammend, einem vergleichbaren Kulturkreis zuzuordnen sind wie die Sachsen, Franken, Wenden bzw. Slawen. Sie unterschieden sich in der Religion, kaum in dem Kulturellen und Ethnischen. Begrifflich wird auf Bedeutungsinhalte von Clans Bezug genommen, die, als größere Familienverbände, in einem abgegrenzten Gebiet wohnten und ihre Herkunft auf einen, ggfs. auch auf mehrere Urahnen der betreffenden Familien zurückführten. Im Falle der Westfalen in Norddeutschland waren es also viele Migrantenfamilien, die nach ihrer alten Heimat benannt wurden. Sie brachten Sitten, Gebräuche, handwerkliche, kaufmännische und landwirtschaftliche Fertigkeiten etc., siehe oben, mit. In der neuen Heimat waren sie hochwillkommen, wenn auch nicht immer, bei den Slawen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titelbilder:
Braun- Hogenberg: Siegesburg, https:de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bad
Segeberg Braun Hogenberg.jpg, gemeinfrei
St. Laurentius in Süsel
St. Katharinenkirche zu Lübeck
Vicelin und Kaiser Lothar III. auf dem Kalkberg. Karl Storch 1934
Fotos: Klaus Westphal
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Der Treck
In Wagrien
Slawische Siedlungsformen
Politische Lage im Norden nach Karl dem Großen
Die Schauenburger betreten die Bühne
Das ehemalige Augustiner Chorherrenstift und die Siegesburg
Kampf um den Ostseeraum und Segeberg
Ulrich, der Ziegler
Antje und Pole Deykstra, genannt Holländer
Kirchenbau des 12. Jahrhunderts im ostholsteinischen Raum
Johann Westphal, der Bauer
Waldrodungen
Geschichte Lübecks bis in die erste Hälfte des 13. Jhdts
Bistum Lübeck
Lübecker Klöster
Lübecks Bürger und die ersten belegten Westfalen
Glasmalerei
Frühe Bebauung in Lübeck, erste Namensträger Westphal
1226 Freiheitsbrief Friedrich II, 1227 Bornöved
Gebrüder Ziegler in Lübeck
Die Brauer Johannes Westfal und Helmold Westphal
Die Zirkelgesellschaft
Bürgerschaftskrisen und bedeutende Lübecker Westfalen im 14. und 15. Jahrhundert
Geschlossene Bruderschaften, das Goldschmiedeamt
Einsetzen des neuen Rats 1408
Krieg zwischen Dänemark und der Hanse
Zur Memoria Lübecker Kaufleute im Mittelalter, Hansische Memoria in Flandern, Hansekaufleute in Brügge
Die Pest in Lübeck und in Schleswig-Holstein
Remigration aufs Land, auch in die Klosterbezirke Segeberg 1444 und Ahrensbök, ab 1454
Augustiner Chorherren Stift Segeberg im 15. und 16. Jahrhundert
30 jähriger Krieg und zum wiederholten Mal der Kampf um die Vorherrschaft im Ostseeraum
Segeberg weitgehend im Dornröschenschlaf, Blüte im 19. und, nach den Kriegen, im 20. Jahrhundert
Kartäuserkloster Ahrensbök, Amt Ahrensbök bis ins 18. Jahrhundert
Die Besitztümer des Klosters Ahrensbök
Freiheit für die Bauern
Familiengeschichten in Ostholstein
Der Anfang
In der Zeit des Amtes Ahrensbök und Herzog Friedrich Carl
Lübecker Stadtmilitär
Familiengeschichten aus Hamburg, Lübeck und Bad Segeberg
Literatur und Anhang
Anhang: Capitulare de villis vel curtis imperii Caroli Magni
Einleitung
Unter Pflanzbürgern verstand man im Mittelalter Personen, die zu friedlichen Zwecken in ein Land kamen oder in das Land gerufen wurden. Sie sollten es zusammen mit der einheimischen Bevölkerung neu gestalten, nach Verheerungen und Verwüstungen wieder aufbauen, zur Sicherung der Lebensgrundlagen im wörtlichen Sinne es neu „bepflanzen“, es inspirieren, mit Innovationen auf ein neues ökonomisches und gesellschaftliches Niveau heben. Dies geschah immer in sozioökonomischer Beziehung zu den heimisch siedelnden Menschen. Gegenseitige Abhängigkeiten mussten beachtet werden, Sitten, Gebräuche, Rechtsverständnisse, religiöser Glauben, Herrschaftsformen und Ethnien aneinander angepasst werden. Dies geschah nicht ohne Konflikte. Heute spricht man von Migranten, damals von Kolonisten.
Dieses Buch handelt von den Wirkungen der Ansiedlungsprozesse, von Kolonisten, die im 12. Jahrhundert an die Ostseeküste gerufen worden sind, um das durch Glaubenskriege der damaligen Zeit verheerte Land zwischen Slaven und Sachsen wieder aufzubauen. Aber auch davon, wie die Umgestaltung des slavischen Wagriens an der Ostsee zur christlichen Grafschaft der Schauenburger missbraucht wurde, um die Christianisierung mit Feuer und Schwert weiter nach Osten in das arbotritische Reich voranzutreiben, nachdem die Ausgangsbasis hierfür zunächst auf den Modus friedlich gestellt war. Gezeigt wird dies an Namensträgern der Westfalen, die, aus Westfalen stammend, einem vergleichbaren Kulturkreis zuzuordnen sind wie die Sachsen, Franken, Wenden bzw. Slaven. Sie unterschieden sich in der Religion, kaum in dem Kulturellen und Ethnischen. Begrifflich wird auf Bedeutungsinhalte von Clans Bezug genommen, die, als größere Familienverbände, in einem abgegrenzten Gebiet wohnten und ihre Herkunft auf einen, ggfs. auch auf mehrere Urahnen der betreffenden Familien zurückführten. Im Falle der Westfalen in Norddeutschland waren es also viele Migrantenfamilien, die nach ihrer alten Heimat benannt wurden. Sie brachten Sitten, Gebräuche, handwerkliche, kaufmännische und landwirtschaftliche Fertigkeiten etc., siehe oben, mit. In der neuen Heimat waren sie hochwillkommen, wenn auch nicht immer, bei den Slaven. Nach der Chronica Slavorum von Helmold von Bosau, einem Geistlichen, der die Chronik der Slaven um 1170 in dieser Region geschrieben hat, rief Adolf II. von Schauenburg, dessen Vater mit der Grafschaft Holstein 1110/ 1111 belehnt wurde, Westfalen, Holländer, Friesen, Flandern nach Holstein. Im übertragenen Sinn können aber unter Pflanzbürgern, neben ihrer Tätigkeit als Kolonisten im ländlichen Raum, ebenso aktiv handelnde kaufmännisch orientierte Personengruppen verstanden werden, die von sich aus auf der Grundlage von Risikobereitschaft und Wagemut und unter Einsatz eigenen Kapitals bereit waren, in anderen Ländern Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Sie traten als Fernhandelskaufleute, Großhändler und als Handelsvermittler, als „Hansen“ auf und errichteten international operierende Handelshäuser, die als Unternehmen wuchsen, ihre Blütezeit erlebten und wieder aus dem Marktgeschehen verdrängt wurden. Sie brachten Geld von außerhalb in die eigene Region, sie waren exportbasisorientiert. Dies begann in der frühen Entwicklungsperiode der neuen Stadt Lübeck und setzte sich in der später folgenden Hanse fort. Netzwerke wurden begründet, Wertschöpfungsketten geknüpft und eines der frühesten sehr erfolgreichen Städtenetzwerke1 entwickelt. Im familienbezogenen, realen Teil werden über die Generationen hinweg Einzelpersonen in ihrem jeweiligen Umfeld näher dargestellt, soweit die Quellenlage dies zuließ.
Für fiktive Personendarstellungen gilt generell kursive Schrift
1 Beerbühl, Margrit Schulte: Das Netzwerk der Hanse, 2011, EGO, Europäische Geschichte Online
1. Der Treck
„Gürtet Euch, ihr starken Söhne und kommt, all ihr Kriegsleute. Die Heiden sind schlimm, aber ihr Land ist sehr gut an Fleisch, Honig, Geflügel und Mehl und, wenn es bebaut wird, voller Reichtum der Ernten vom Lande. Daher, oh ihr Sachsen und Franken, Männer aus Lothringen und Flandern, ihr berühmten Bezwinger der Welt, hier könnt ihr Eure Seele retten und, wenn es Euch so gefällt, das beste Land zum Bewohnen gewinnen.“2
Dieser Aufruf zum östlich gerichteten Kreuzzug von sächsischen Geistlichen und weltlichen Herrschern spiegle die Stimmung im 12. Jahrhundert gut wider, sagte Matthias Hardt bei seinem Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung am 29. Juni 2016. Der Historiker am befasste sich mit der Zuwanderung zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert nach Ostmitteleuropa. Dass die Migranten aus den Niederrhein- und Rheinlanden, aber auch aus Franken und Sachsen tatsächlich in die Gegend östlich von Elbe und Saale kamen, davon zeugten zahlreiche Ansiedlungsurkunden, Ortsnamen und archäologische Überreste, so Hardt.
Weil sie den Boden anders bearbeiteten, bewirkten die Zuwanderer eine grundlegende Umstrukturierung der Region. Sie rodeten Wälder und bauten Getreide an, führten den Fruchtwechsel ein und die Dreifelderwirtschaft, erklärte der Historiker. Auch ein Städtenetzwerk neuen Typs entstand, die Hanse. „Dieser Prozess hat die Gebiete östlich von Elbe und Saale tiefgreifend wirtschaftlich, demografisch, sozial, ökologisch und sprachlich verändert“, fasste Hardt zusammen.
Wie eine Bevölkerungsgruppe dem Land mehr abringen konnte als eine andere, zeigte Hardt auch am Beispiel der Holländer an der unteren Weser. Sie wandten sich zu Beginn des 12. Jahrhunderts an Friedrich, Erzbischof von Bremen und Hamburg, um sumpfiges Land von ihm zu erhalten. Der stimmte zu unter der Bedingung, dass sie einen Anteil von Vieh und Getreide und Geld entrichteten. Die Holländer bauten Gräben, Fleete, Deiche und Dämme, hielten sie instand und sorgten so dafür, dass das Land nutzbar wurde. Die Zuwanderer in Ostmitteleuropa, etwa in Brandenburg, kamen auch aus dem niederländischen Westen, aber zu größeren Teilen aus dem sächsischen Harzvorland, sagte Hardt. Anders als der zu Beginn zitierte Aufruf glauben machte, anders als manche „Propaganda“- Ortsnamen wie „Schöndorf“ vermuten ließen, ging es den Migranten nicht von Beginn an gut. Sie mussten hart arbeiten und litten Not. Häufig gelang es erst der dritten Generation von neuem Wohlstand zu profitieren.
Ostmitteleuropa erfuhr durch die neuen Bewohner einen Aufschwung. „Letztendlich war die Zuwanderung eine Erfolgsgeschichte“, betonte Hardt. Sie habe aber auch negative Folgen für die autochthone, überwiegend slawische Bevölkerung mit sich gebracht. Sie wurden vertrieben oder mussten sich anpassen. „Dem Modernisierungsprozess fiel Kultur und Sprache der Elbslawen weitgehend zum Opfer“, konstatierte der Historiker. Die westlichen Zuwanderer hätten ihre Sprache und materielle Kultur durchgesetzt, weil sie Förderung und Protektion von Kirche und Herrschaft genossen, die von der Umstrukturierung ihrerseits profitierten.
Die Situation der Zuwanderer damals unterscheide sich deutlich von der der heute Geflüchteten, so Hardt. Er schloss mit der Feststellung: „Migranten, im Hochmittelalter ebenso wie in der Gegenwart, sind Akteure in sozialökonomischen Prozessen, die sich beeinflussen, aber nicht in jeder Hinsicht steuern lassen.“ Wie sie eine Gesellschaft veränderten, sei nicht gesetzmäßig oder vorhersehbar. Dennoch sei in Bezug auf die gegenwärtige Migrationssituation angemerkt, dass die heutigen Migranten in hohem Umfang aus nicht verwandten Ethnien stammen und teils gravierende Glaubensunterschiede zu bestätigen sind, Umstände also, die eine erfolgreiche Integration deutlich schwerer machen.
Schon 1108 rief der Magdeburger Erzbischof Adelgot Siedler in die slavischen Lande östlich der Elbe, wie oben an dem Vortrag von Mathias Hardt, deutlich wurde. Auch Adolf II. berief sich auf diesen Aufruf von 1108 und bewarb ab 1141 Wagrien als ein wiederaufzubauendes Land mit sehr guten landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen für Menschen, die aus ihrer Heimat heraus den Aufbruch zu neuen Ufern mit besseren wirtschaftlichen Grundlagen wagen wollten. Schon damals wurden Mittel und Instrumente des Regionalmarketings und der Wirtschaftsförderung angewandt. Steuerliche Vorteile, Privilegien und niedrige Kosten für den Anbau auf Grund und Boden sind verbrieft. Heute würden wir solcherart regional-ökonomisch ausgewiesene Zonen als Sonderwirtschaftszonen bezeichnen. Im Vordergrund seiner Ansiedlungsstrategie standen Familien aus Westfalen, seiner engeren Heimat, den benachbarten Adressaten in Friesland, Holland, Utrecht, Flandern. Wer diese Adressaten sind, bleibt bei Helmold von Bosau unklar. Gesucht wurden Personen mit innovativen Ideen für die Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Handel und Handwerk. In seiner Zielgruppe standen natürlich auch wirtschaftlich schon erfolgreiche Personen, die für sich nach guten beherrschbaren Herausforderungen suchten, um im Russland-, Schonen-, Dänemark-, Norwegen- und Baltikumhandel, somit in der Neugründung von international tätigen Grosshandelshäusern ihr Glück suchen wollten.
Wenden wir uns zunächst den landwirtschaftlich geprägten Berufszweigen zu, wie den Bauern selbst, den Meiern, den Viehzüchtern, den Wasser- und Deichbauern, den Trockenlegern von Sümpfen und in deren Folge den Landgewinnern. Westfalen und Holländer waren für die Landwirtschaft und Viehzucht sehr gut geeignet, die Holländer und Friesen für Wasserbau und Moortrockenlegung, Anlegung von Entwässerungsgräben und Deichen.
Der 25 jährige Hinnerke Westphal lebte mit seiner Familie auf dem väterlichen Hof in Möllenbeck bei Rinteln, in der Nähe des Stammsitzes der Schauenburger Grafen, der Schauenburg, auf der nördlichen Seite des Weserbogens. Er war an dritter Stelle geboren, konnte deshalb die väterliche Hufe nicht übernehmen, da sein Bruder Arnold den Hof als Erstgeborener übernahm und seine Schwester Eilika in den neuerrichteten Beginenhof in Minden ging, die im 12. Jahrhundert in ganz Westeuropa entstanden. Dieser Schritt verlangte der Famiie erhebliche Abstandsleistungen für Eilikas weitere Leben ab, wenn auch bei Weitem nicht so viel wie in den adligen Klöstern, in die von vornherein keine Chance auf Aufnahme für Nichtadlige bestand. Eilika hatte für sich das Kapitel auf Einheirat in einen Nachbarhof abgeschlossen weil sie keinen passenden Lebenspartner, einen Hoferben, gewinnen konnte. Deshalb hatte sie für sich entschieden, ein dem christlichen Glauben zugewandten Lebensweg im neu eröffneten Beginenkonvent aufzunehmen. Sie wollte Eltern und ihrem Bruder Arnold auf lange Sicht auch nicht auf der Tasche liegen. So hatte sie ihren Stolz. Hinnerke war ebenso gezwungen, sich auf eigene Füsse zu stellen. Er war durchaus im heiratsfähigen Alter und beriet sich mit seinen Eltern und seiner Verlobten Ann-Christin, das Wagnis nach Wagrien zu gehen, auf sich zu nehmen. Hinnerke war ein kräftiger junger Mann, 1,80 m groß, schlank und von athletischer Figur, geformt durch die vielen körperlichen Arbeiten auf dem Hof. In allen anfallenden alltäglichen Dingen war er praktisch veranlagt und konnte als zukünftiger Bauer gut anpacken, mit Tieren umgehen, er kannte sich in der Gewinnung von Saatgut für das Getreide bestens aus. Wenngleich er keine Ausbildung in den Artes Liberales, im Rechnen und Schreiben wie die Kleriker in seiner Jugend genossen hat, so stehen bei ihm beherrschbarer Wagemut und praktische Veranlagung für alle anfallenden Arbeiten auf dem Hof, die er auch gut anderen Personen erklären konnte, im Vordergrund. Ann-Christin hatte als 21 jährige langes brünettes herabfallendes Haar, war gut 10 cm kleiner als Hinnerke, schlank und mit ihren tiefen braunen Augen eine außerordentlich gutaussehende Erscheinung, sie war hübsch. Als junge Frau beherrschte sie die anfallenden Arbeiten im Haus, hatte gute Kenntnisse in der Versorgung des Viehs im Stall, in Pflanzen und Heilkräutern, Gartenarbeit, in der Herstellung von tierischen Eiweißprodukten, wie z.B. Käse.
Als älteste Tochter ihrer Familie unterstützte sie die Erziehungs- und Anlernarbeit ihrer Mutter nach Kräften für die jüngeren Geschwister. Mit anderen Worten, für Hinnerke war sie die vortrefflich geeignete Partnerin um mit ihm zusammen eine neue Familie zu gründen und das sollte im fernen Wagrien an der Ostsee geschehen.
Die Entscheidung fiel zugunsten des Aufbruchs zu neuen Ufern. Erfahren hatten sie, wie viele andere auch in ihrer Region, von dem Aufruf ihres Landesherren Adolf II. in der Kirche zu Rinteln, die zum Bistum Minden und zum Erzbistum Hamburg – Bremen gehörte, dessen Erzbischof Adalbert II. war, der gerade seinem vertrauten Mönch Vicelin den Auftrag gegeben hatte, Wagrien für die Christenheit zu missionieren. Darüber hinaus war Hinnerke und Ann Christin bekannt, dass Graf Adolf II. von Adolf I., seinem Vater, die 1110 von Lothar zu Supplingburg belehnte Grafschaft Holstein - Stormarn, geerbt hatte. Adolf II. nahm neue Siedler dem Aufruf zu Folge unter seinen besonderen Schutz, ebenso wie Herzog Heinrich der Löwe von Bayern und Sachsen, der mit Adolf nahezu gleichaltrig und ihm sehr verbunden war. Sie wurden somit durch ihre Entscheidung zu Urahnen von Migranten aus Westfalen in ihrer neuen Heimat. Clanbegründer eben. Die neue Siedlungspolitik in den slawischen Landen geht schon auf das erfolgreiche Wirken Heinrichs Großvater mütterlicherseits, Kaiser Lothar III. zurück.
“Hast Du alle für die Reise notwendigen Sachen beisammen, so dass ich sie gut auf dem Wagen verstauen kann?“ Ann-Christin überlegte kurz, was sie Hinnerke antworten sollte, denn die meiste Arbeit des Zusammensuchens und Bereitstellens der notwendigen Reiseutensilien lastete auf ihren Schultern. Sie hätte sich gern gewünscht, wenn ein guter Teil der gemeinsamen Verantwortung auf beide Partner gleichverteilt worden wäre, aber Hinnerke war selbst in den letzten Tagen vor dem Aufbruch über Gebühr in den elterlichen Hof eingespannt. Insofern antwortete sie milde: „ Ja, sie stehen alle in der Diele und sind transportbereit. Sei bitte so gut und überprüfe die einzelnen Sachen noch einmal, auch auf Vollständigkeit“. „Prima, ist schon in Ordnung“. Hinnerke kam es neben dem notwendigen Proviant, dem Futter für die beiden Pferde, dem notwendigsten Hausrat und das Werkzeug für den neuen Hof in der neuen Heimat in Wagrien auch auf die im Kloster Corvey hergestellte Kopie des wertvollen Folianten Capitulare de Villis (CV) an, welches im Auftrag von Karl dem Großen schon im späten 9. Jahrhundert für seine Königspfalzen verfasst worden war. Er nahm sich ausgiebig Zeit, um sie Ann-Christin eingehend zu erklären. „Das CV ist eine genaue standardisierte Beschreibung der Mindestausstattung der Königspfalzen und Krongüter und spart nicht die wirtschaftliche Seite für normal auszustattende Höfe aus, in dem genaue Listen und Anweisungen für Aussaat und gärtnerische bzw. landwirtschaftliche Pflege von Kulturpflanzen aufgezeichnet werden“.
Damit wollte Hinnerke seinen neuen Hof in Wagrien, wenn man so will als Mustergut, aufbauen. Hinnerke informierte kurz über die Inhalte : „Das Capitulare, ist schon vor gut 250 Jahren geschrieben worden und wird uns bei dem Aufbau unserer neuen Existenz sehr gute Hilfestellung leisten. Es ist eine Landgüterverordnung, die Kaiser Karl als detaillierte Vorschrift für die Verwaltung der Krongüter erließ und beweist auch in der Ägide der jetzigen Supplingburger Herrscher noch immer seine überragende Bedeutung. Dieses Kapitular ist eine berühmte Quelle für die Wirtschafts-, speziell die Agrar- und Gartenbaugeschichte. Sie zeichnet die Dreifelderwirtschaft, den Weinbau, die Obstpflege, die Zucht von Haus- und Herdenvieh, Pferden, Rindern, Schafen, Schweinen, Ziegen, Bienen, Fischen bis ins einzelne als Bestandteile vorbildlicher Musterwirtschaften vor. Dabei greift sie auch auf noch vorhandenes Wissen über die römische Landwirtschaft zurück. Die Vorschriften in den einzelnen Abschnitten der im Stil insgesamt doch recht kurz und knapp dargestellten Verordnung sind detailliert verfasst. So wird vorgeschrieben, wie lange die Stuten zu den Hengsten geführt werden, welche Inventare über Werkzeuge zu führen sind, dass Wein in Fässern, nicht in Weinschläuchen aufzubewahren ist, und dass die Trauben wegen der Reinlichkeit nicht mit den Füßen zu entsaften sind.
Der Erlass über die Krongüter sollte die Versorgung Karls des Großen und seines großen Hofes sichern, der sich immerwährend auf Reisen befand. Es galt die königlichen Pfalzen mit entsprechenden Vorräten auszustatten. Im Vorfeld seiner Reisen durch sein immens großes Reich hatte es zuweilen Nahrungsmittelengpässe gegeben, die durch eine straffe Organisation der Güter vermieden werden sollten. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der genauen Anweisung der Verwalter. Die Ertragssteigerung und -sicherung ruhte vor allem auf der Organisationsverbesserung und der Einführung einer genauen und regelmäßigen Buchhaltung. Mit Nachdruck legte das Capitular auch fest, in welcher Weise der Verwalter mit königlichen Lehnsleuten umzugehen hatte. Er musste sich ebenso an sehr strenge Regeln halten. Selbst bei Verstößen seiner Lehnsleute konnte er nicht direkt strafen, sondern musste sie vor das örtliche Gericht bringen. Vorschriften über Anbaumethoden fehlen dagegen. Es ist nicht davon auszugehen, dass alle beschriebenen Pflanzen und Einrichtungen für alle Krongüter bindend waren. Dazu waren allein die geographischen und klimatischen Voraussetzungen im Reich zu unterschiedlich. In den nachfolgend benannten Kapiteln werden wichtige Pflanzen und ihre Nutzung behandelt: Kapitel 22: Weinbau, Kapitel 34: Malz (aus Gerste), Kapitel 43: linum (Flachs), waisdo (Waid), vermiculo (Scharlach), Kapitel 44: milium (Kolbenhirse), panicium (Fenchelhirse), napos insuper (Frühkohl), Kapitel 62: canava (Hanf). Im 70. Kapitel werden schließlich 73 Nutzpflanzen (einschließlich (Heil)kräutern) und 16 verschiedene Obstbäume genannt, die in allen kaiserlichen Gütern von den Verwaltern angepflanzt werden mussten, wenn es die klimatischen Gegebenheiten zuließen“. Abschließend bemerkte Hinnerke: „In Wagrien wird es für unseren neuen Hof mit den Anbaulisten der Pflanzen, der von uns schon hier gesammelten Saat, den für die Reise vorsorgend zusammengestellten im CV benannten Werkzeugen für den Aufbau unseres Hofes ein unschätzbarer Ratgeber sein.“
Hinnerke belud nunmehr sorgfältig den Planwagen, auf dem er dort ebenso für Ann-Christin und sich selbst eine Schlafkoje freihielt, die für die nächsten 20 bis 25 Tage ihr zu Hause werden sollten, je nach dem, wie lange sie für die Reise ins ferne Wagrien benötigen sollten. „Schatz, schau doch bitte ob unsere gemeinsame komfortable Kammer auf dem Planwagen Deinen Wünschen wenigstens annäherungsweise entspricht. Falls ja, dann könnten wir sie doch auch jetzt schon gemütlich einweihen,“ bemerkte Hinnerke mit einem vielsagenden die Augenwinkel erreichenden Lächeln. Anneke ließ sich die Aufforderung nicht nehmen. Schnell und geschmeidig kletterte sie auf den Planwagen und warf sich auf das vorbereitete Bett. „Zumindest hättest Du es ja auch schon mit Leinen beziehen können, aber es ist wie immer, alles muss man selbst machen. Doch zur Beruhigung, das spare ich mir für später auf“. Beide lagen zur Probe auf dem unvollständigen Bett, küssten sich lang und intensiv, trennten sich jedoch nach kurzer Zeit wieder voneinander, bevor ungewollte Zuschauer sie, von typischen Geräuschen angelockt, beide mitten am Tage belauschten bzw. belustigt begafften. Die Tagesetappen waren auf 2 Meilen, bzw. 15 km pro Tag, bemessen. Von Möllenbek aus fuhren sie nach gebührender Verabschiedung durch Eltern, Geschwistern und Freunden mit den besorgten Worten: „Passt gut aufeinander auf, helft Euch gegenseitig im Treck, geht keine Risiken ein und versucht eine Botschaft an uns nach eurer Ankunft in Wagrien abzusetzen, wie es Euch ergangen ist auf der weiten Reise, geht mit Gottes Segen.“. Zunächst fuhren sie mit ihrem Planwagen allein nach Minden, wo noch 20 weitere Neusiedlerfamilien sich dem Treck anschlossen. Die etwa 5 m langen und meist 2 m breiten Planwagen wurden in der Regel von 2 Pferden gezogen und hatten gerade hinreichend Platz für die Neusiedlerfamilien, bestehend aus Erwachsenen und Kindern, im Schnitt 4 Personen. Proviant war immer regelgerecht platz- und gewichtsparend auf gut zwei Tage bemessen, dann musste in den festgelegten Übernachtungsorten nachgekauft werden. Nur der notwendigste Frachtraum für weiteren Hausrat, Baumaterialien, Werkzeugen, Bewaffnung aus Schwert, Lanze, Harnisch, Helm sowie Ausrüstungsgegenständen stand für die erste Zeit in Wagrien zur Verfügung. Der wertvolle Platz auf dem Wagen war somit sehr knapp bemessen. Die Planwagen waren leicht, aber stabil konstruiert, deren Räder mit einer leichtgängigen Naabe und schlanken aber hochfesten, meist aus Eschenholz kunstgerecht angefertigten Speichen und Radsegmenten, versehen. Jeweils ein 5 cm breiter und einen halben cm starker Eisenring spannte sich unter dem Rad gut ein. Gewichtseinsparung zu Gunsten guter Wendigkeit des Fuhrwerks war ein wichtiges Konstruktionsprinzip.
Hinnerke hatte sich intensiv auf die einzelnen Etappen vorbereitet und berichtete den Mitreisenden kurz wissenswertes über Minden. „Es lässt sich nachweisen, dass Minden bereits seit dem 3.Jahrhundert v. Chr. besiedelt ist. Seit dem 1. bis 4. Jahrhundert n. Chr. ist eine kontinuierliche Siedlungsentwicklung nachweisbar. Auf Grund der Lage am Übergang vom Niedersächsischen Bergland in die Norddeutschen Tiefebene kreuzten sich schon in prähistorischer Zeit an der Furt über die Weser bedeutende Nord-Süd und Ost-West Verkehrsachsen. Der alte Handelsweg Hellweg vor dem Santforde schließt sich hier östlich an den Westfälischen Hellweg an, die Weser ermöglicht Transport und Verkehr zur Nordsee. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Minden („Minda“) im Jahre 798 in den sogenannten Reichsannalen, einer fränkischen Chronik, als Ort einer Reichsversammlung Karls des Großen. Um 800 gründete er in Minden ein Bistum. Im Jahr 977 wurden der Stadt Markt-, Münz- und Zollrecht verliehen. Der vom Bischof eingesetzte Wichgraf wurde gleichzeitig Oberhaupt und Verwaltungsleiter der Stadt. Durch die Lage am Fluss konnte die Kaufmannschaft mit dem Stapelrecht privilegiert vorbeifahrende Schiffe zum Ausladen der Ware zwingen. Im Getreidehandel war die Stadt äußerst aktiv und erfolgreich. Die erste Weserbrücke ist, wie wir sehen werden, im Bau, ebenso wie das für das sich steigernde Selbstbewusstsein der Mindener Bürger enorm wichtige Rathaus in der Innenstadt, welches direkt neben der Domimmunität errichtet wird.“
Begleitet wurde der Treck von einer aus zwölf gräflichen Reitern bestehenden Eskorte, jeweils zwei für Vor- und Nachhut, acht für die Mittelabschnitte des Trecks, zur Sicherung vor unliebsamen Überraschungen. Das Kommando über den Treck mit gut bewappneter Vor- und Nachhut hatten zwei mit modernen gefechtstauglichen Kettenhemden ausgestattete Panzerreiter der gräflichen Truppen. Die Neusiedler kamen ausschließlich aus der Heimatgrafschaft von Adolf II, dem Schauenburger Land, aus Bückeburg, Rinteln, Möllenbek, Herford, Oeynhausen, Bünde, Melle, Lemgo. Sie stammten somit aus den Landschaften des Wiehen- und des Wesergebirges, den Ausläufern des Teutoburger Waldes, dem Deister, Süntel und dem Ith.
Der Treffpunkt in Minden war auf der westlichen Weserseite mit Ende April, Anfang Mai 1141 festgelegt. Alle Mitglieder des Trecks trafen rechtzeitig ein. Sie wurden von den Panzerreitern auf ihre im Treck einzunehmenden Plätze, auf die interne Ordnung sowie auf gemeinsam zu erfüllende Aufgaben, von Fall zu Fall unterschieden, knapp eingewiesen. Weitere ausführliche Einweisungen folgten zu Beginn der Tagesetappe. Pünktlich am 2. Mai machte sich der gut zusammengestellte Treck auf die beschwerliche Reise. Die Anführer der Eskorte sorgten dafür, dass sich die Planwagen der 20 Familien aus Westfalen hintereinander in den Treck einreihten. Die Ordnung des Trecks wurde genauestens überwacht. „Achtet immer auf guten Abstand zum vorausfahrenden Planwagen, damit immer genug Zeit für unvorhersehbare Bremsmanöver bleibt, wenn es notwendig ist,“ kam die Ansage von der Führung der Eskorte, den gräflichen Panzerreitern. Schon vor der geplanten Abfahrt aus Minden hatte Graf Adolf Listen für die Auswanderer mit den wünschenswerten Ausrüstungsgegenständen in Umlauf gegeben, an die sich die Mitglieder des Trecks verbindlich zu halten hatten. Heute kann man die Anforderungen an die Auswanderung mit einer Zusammenstellung der Ausrüstungsgegenstände einer gut organisierten Expedition vergleichen. Das ist nicht zu weit hergeholt, denn die Migration im 12. Jahrhundert war durchaus mit einem Aufbruch ins Unbekannte und Ungewisse zu vergleichen. Die Landschaften Westfalens, die der Treck verließ, waren für ihre Zeit hochentwickelt, aber auch stark übervölkert. Sie umfaßten aus heutiger Sicht politischgeografisch das Gebiet der ehemaligen preußischen Provinz Westfalen. Kulturgeografisch reichte es, besonders im Norden und Nordosten, zum Teil weit über die Grenzen des heutigen Landesteils hinaus. Vor dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 war Westfalen in eine große Zahl kleinerer Gebiete zerstückelt, welche, je nach ihrer geografischen Lage, in den angrenzenden Westen, Norden und Osten, teilweise aber auch in den Süden reichten. Das gesamte Osnabrücker Land war rein westfälischer Natur, während das Siegerland als fränkisches Siedlungsgebiet galt. Der westfälische Einfluß reichte entlang der Ems und in Niedersachsen bis weit in die Heide und ging bis in das Oldenburgische und Hannoversche hinein. Die räumliche Abgrenzung belegt die Naturräumliche Gliederung Westfalens: Südergebirge, Weserbergland, Westfälisches Tiefland: Schaumburger Land, Mindener-, Barenburger-, Diepholzer-, Bersenbrücker-, Lingener-, Rheiner-, Bentheimer Land, bzw. Westfalen, Engern und Ost-Westfalen, die alten Herzogtümer Sachsens.
Kontakte untereinander im Treck ergaben sich naturgemäß sofort. Sie waren auch überlebensnotwendig. Kinder und Jugendliche schlossen Freundschaften, die jüngeren Erwachsenen ebenso, wenn die Chemie untereinander stimmte. Wichtig war eine gut und postiv auf das Ziel ausgerichtete Gruppendynamik. Lagebespechungen mit der Festlegung des jeweiligen Tagesabschnittes, die Organisation von Beköstigung, die Neuanschaffung von Proviant und die Unterstützung der Trecksicherung standen turnusgemäß auf der Tagesordnung. Das Zusammenspiel mit der Eskorte gestaltete sich harmonisch. Die Gesamtverantwortung oblag den gräflichen Panzerreitern Guido und Luitpold. Beide gehörten zur Elitetruppe des Grafen Adolf. Guido war der Jüngere von beiden, 23 Jahre alt gut 6 Ellen groß, von kräftiger, athletischer Figur, rotblonde Haare und braune Augen zierten das länglich asketische Gesicht. Luitpold, ebenso wie Guido gut 1,8 m groß gewachsen, austrainiert, auffallend seine blonden Haare und seine stechend graublauen Augen. Ihre Stimmen waren, situativ bestimmt, samtweich aber auch herrisch, durchsetzend, laut, moderat oder leise, einfühlsam. Sie bestimmten die Wacheinteilung und die jeweiligen Wachabschnitte des Trecks bei Nachtlagerungen außerhalb von Unterkünften, teilten die zusätzliche Sicherungsarbeit neben die der begleitenden Soldaten akribisch in verbindliche Listen ein, jeder Treckteilnehmer hatte mit Bedacht seine Aufgaben zu erledigen: Wachen, Verpflegungsvorbereitungen, den Frauen oblag meist die Feldküchenarbeit, die Einrichtung der Nachtlager. Denn das zu durchquerende Gelände war überwiegend bewaldet, sehr oft sumpfig, aber auch durch trockene Heideflächen führend, wengleich auch mit einigermaßen gut befestigten Heerwegen ausgestattet. Sicher aber war es in keinem Fall in bezug auf Überfälle durch Raubritter und marodierendes Gesindel, Wegelagerern. „Passt bei unerwarteten, plötzlichen Überfällen besonders gut aufeinander auf. Helft Euch wehrbereit und umsichtig gegenseitig, sucht vor den Angreifern sofort Deckung hinter den Wagen und unterstützt uns. Nur mit sichtbarer und geschlossen wirksamer Stärke gegen Angreifer können wir uns mit Erfolg gemeinsam verteidigen. Männer und Frauen, bildet innerhalb des Trecks sieben Schutz- und Wehrabschnitte mit jeweils drei Wagen, die wir dann militärisch stützen. Die Verteidigungsfähigkeit des sonst zu langen Trecks wird durch geordnete Wehrabschnitte und gut aufeinander abgestimmtes Verhalten stark verbessert. Und sorgt bitte innerhalb der Wehrabschnitte in eigener Verantwortung für die Führung“ so die Ansage von Guido und Luitpold. „Schmiedet auch Freundschaften untereinander, damit verstärken wir die Einheit und Wehrfähigkeit im Treck.“
Hinnerke und Ann-Christin brauchten der letzten Aufforderung nicht zu folgen, denn sie befreundeten sich ohnehin mit Uta und Gerold aus dem Nachbarort Rinteln, sie waren mit zwei Kindern Christin und Mathildis, sechs und acht Jahre alt, unterwegs; Uta war im vierten Monat schwanger. Sie verstanden sich auf Anhieb. Die schwierigen ersten drei Monate hatte sie gut überstanden. Sie strahlte als erfahrene Mutter großes Selbsbewusstsein aus und schaute mit Zuversicht in die nähere Zukunft. Ann-Christin war sehr um Uta bemüht und erkundigte sich täglich nach dem Wohlergehen von Mutter und Kind. Oft kümmerte sie sich auch um Christin und Mathildis. Christin war ihrem Vater aus dem Gesicht geschnitten, während Mathildis eher nach Uta kam. Beide Mädchen waren temperamentvoll und liebten die den Zug begleitenden Pferde, die sie alle bei ihrem Namen benennen konnten. Außerdem waren sie geschickt im vorsichtigen Umgang mit den Tieren und fühlten sich besonders für ihr eigenes Pferd verantwortlich. Sie halfen beim striegeln, der Verpflegung der Tiere und beim auf- und abzäumen. „Vielen Dank, das macht ihr aber prima“ hörten sie anerkennend oft von den eskortierenden Soldaten, aber auch von ihren Eltern. Auf den langen Streckenabschnitten bemühte sich Christin um Fingerfertigkeit beim Sticken auf ihrem Stickrahmen. Als Vorlagen dienten ihr die Jungfrau Maria, Heiligenfiguren, aber auch berühmte Ritter ihrer Gegenwart. Uta und Ann-Christin unterhielten sich häufig über das unbekannte Land Wagrien an der Ostseeküste. Beide waren in großer Herzlichkeit in ihren Vorstellungen und Wünschen miteinander verbunden. Nur selten kamen Zweifel und Ängste auf, und, wenn diese Überhand nahmen, dann sprachen sie miteinander Gebete und vertrieben so demotivierende Gedanken. Die Männer tauschten sich an den langen Abenden am Feuer ebenfalls über ihre Wünsche und Hoffnungen, aber auch über ihre Ziele aus. Gerold war Zimmermann und hoffte auf angemessenen Einsatz bei den in Mode kommenden kirchlichen Großbaustellen, den Bauhütten.
Der erste Tagesabschnitt führte am Westufer der Weser nach Petershagen. Mittags erreichten sie es. Nach ausgiebigem Mittagessen mit Brotsuppe und warm temperiertem Bier führte der Weg weiter nach Hävern durch überwiegend schwer passierbares und sumpfiges Gelände. Alle Männer des Trecks hatten alle Hände voll zu tun, um die Wagen in der Spur zu halten und, wenn es stockte, die Zugpferde zu unterstützen, damit es langsam und sicher weitergehen konnte. Dieser Streckenabschnitt war beschwerlich genug, zum Glück stellte sich kein Regen ein. Es dauerte gut eine Stunde, bis Luitpold und Guido sich entschieden hatten, an welcher Stelle die gut achtzig Meter breite Weser zwischen Hävern und Döhren passiert werden konnte. „Hier wollen wir die Weserfurt nutzen. Wir werden zunächst mit unseren Pferden die Furt prüfen, das wird voraussichtlich ein bischen dauern. In der Zwischenzeit bereiten sich die ersten drei Wagen auf die Überquerung vor. Kontrolliert die gute Verzurrung und Sicherheit der Ladung und gewöhnt die Zugpferde an das Wasser. Wenn wir wieder zurück sind, und die Furt als gut passierbar getestet haben, dann fährt zunächst ein Wagen mit zwei Zugpferden und mit dreier Begleitung der Eskorte durch die Furt und gibt die Erfahrung anschließend weiter.“ Guido und Luitpold prüften die Furt, stellten fest, dass, von der Strömung und kleineren Strudeln abgesehen, keine Gefahren für die Wagen ausgehen werden und schickten den ersten Wagen anschließend durch die Furt. Das Übersetzen an dieser Furt war die erste Bewährungsprobe des Trecks. Die Wassertiefe betrug an den tiefsten Stellen etwa sechzig bis achtzig cm, im Uferbereich leicht ansteigend bzw. abfallend. Der Untergrund erwies sich nach der ersten Querung als fest, nur vereinzelt schlammig aber nicht tiefgründig. Auch die erste Wagenbegleitung stellte nach der sich doch kürzer als gedacht gestaltenden Überfahrt fest, „Die Strömungsgeschwindigkeit der Weser ist gering und die Wasserstrudel sind ungefährlich“.
Nach nochmaliger gemeinsamer Einschätzung sei die Strömung keinesfalls geeignet, Pferde und Wagen sowie die Menschen in Gefahr beim Überqueren der Furt zu bringen. Luitpold gab deshalb nochmals seine Anweisungen: „Bitte auf den Planwagen die Ladung nocheinmal gut sichern und festzurren, damit sie bei der Passage nicht verrutschen kann. Wir können nunmehr alle fünf Planwagen einer Gruppe hintereinander die Furt passieren lassen. Die Wagen werden wiederum von zwei Reitern begleitet. Ein bis zwei Pferde werden zum gesicherten Ziehen der Planwagen eingesetzt. Die Frauen sitzen ab und durchwaten die Furt. Kinder werden hoch zu Ross über die Furt gebracht. Bitte sehr langsam und mit geschärften Sinnen langsam aber zügig voranschreiten. Anhalten möglichst vermeiden, wir sorgen als begleitende Reiter dafür, dass innerhalb der Furt kein gefährlicher Stopp geschieht.“ Insgesamt musste die Furt nach der Anzahl der Wagen in vier Gruppen passiert werden. Weil die erste Passage auf Anhieb glückte und sich gut durchführen ließ, konnten die folgenden Planwagen zwar mit Abstand, aber gut hintereinander getaktet, über die Weser gesetzt werden. In gut zweieinhalb Stunden mit gemeinsam organisierter Kraftanstrengung war die Furt bewältigt, in einem Gebet dankten die Migranten Gott für den Beistand der ersten Bewährungsprobe und nun konnte in bester Laune zum letzten Tagesabschnitt übergeleitet werden, dem Weg zur rund 8 km entfernten Luccaburg, wo die erste Übernachtung vorgesehen war.
Hinnerke informierte über das Etappenziel: „Die Reste der Luccaburg befinden sich in einer Art Erdhügelburg in der Niederung der Fulde. Die Burg ist nach dem Geschlecht derer von Lucca benannt worden. Ihre Entstehungszeit wird im 9. oder 10. Jahrhundert vermutet. Von der Burganlage, die aus einem aufgeschütteten kreisrunden Hügel von 40 Meter Durchmesser bestand, sind noch oberirdische Steinreste vorhanden. Sie wurde mittels einer 2 Meter starken und fast 3 Meter tief in den Boden hineinreichenden Ringmauer geschützt. Erst vor kurzem wurde sie aufgegeben, ist aber für unsere gesicherte Übernachtung von gutem Wert. In ihrer Nachbarschaft befindet sich jedoch ein Fronhof, dass heißt ein herrschaftlicher Gutshof inmitten einen Ortschaft.“ Erst im Jahr 1163 kamen ein Abt, begleitet von zwölf Mönchen aus dem thüringischen Zisterzienserkloster Volkenroda, nach Loccum, um hier eine neue Niederlassung ihres Ordens zu gründen. Die Ansiedlung der Mönche erfolgte durch eine Stiftung von Graf Wilbrand I. von Loccum Hallermund. Um 1250 beschrieb ein Loccumer Mönch in der sogenannten Vetus narratio de fundatione Monasterii Luccensis, also der „Alten Erzählung von der Gründung des Loccumer Klosters“, die Lebensumstände der ersten Mönche als dramatisch schlecht. Danach hätten die Mönche sich an einem „Ort des Schreckens und weiter Einsamkeit“ niedergelassen, einem Ort „des Aufenthalts von Räubern und Wegelagerern“.
Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse seien so gewesen, dass die Gründerväter Loccums in Hunger und Durst die Armut Christi nachgeahmt hätten. Sie trotzten Kälte und Hitze und arbeiteten mit großer Anstrengung, bis sie aus der Räuberhöhle ein Haus des Gebets gemacht hatten. Diese Zustände hätten durchaus den in den Statuten der Zisterzienser festgelegten Idealen entsprochen. Aber die Beschreibung entsprach jedoch nicht den wahren Umständen. Die nähere Umgebung des Klosters war besiedelt. Es ist umstritten, ob die Luccaburg, die den Kern der Stiftung bildete, noch bewohnt war. Die Nennung des zur Burg gehörenden Fronhofs in der Stiftungsurkunde des Mindener Bischofs spricht dafür. Ausweislich der Stiftungsurkunde gehörten zum Stiftungsgut zusätzlich drei namentlich bekannte Ortschaften. Auch war die Gegend nicht so unwirtlich wie beschrieben, denn in der Umgebung Loccums hatte die landwirtschaftliche Erschließung der Sumpf- und Waldgebiete bereits begonnen. Ein vom Klosterstifter zum Schutze des Klosters eingerichteter Ministerialensitz dürfte die 1183 erwähnte Burg Monechusen auf dem Haarberg (zwischen den heutigen Orten Rehburg und Winzlar) gewesen sein, dem Stammsitz des Adelsgeschlechtes derer von Münchhausen. Die heute noch stehende Kirche wurde erst 1240 als Bau begonnen. Die Mönche erschlossen vor allem in der unmittelbaren Umgebung des Klosters sowie um den Grinder Wald größere Flächen für die Landwirtschaft. Bereits 1279 hatte das Kloster Loccum Hausbesitz in Hannover. Nach zwei ersten Buden am dortigen Hokenmarkte kam 1293 ein Hof in der Osterstraße hinzu, der vor allem dem Verkauf der eigenen Getreideernte dienen sollte. Diesen Besitz erweiterte das Kloster durch den Ankauf eines weiteren Grundstückes zum Loccumer Hof, auf dem bis ins 20. Jahrhundert hinein Geschichte geschrieben wurde. Loccum unterstand dem direkten Schutz des Reiches sowie des Papstes. Es führte den Titel eines Freien Reichsklosters. Von Loccum ausgehend, wurde 1186 das Kloster Reinfeld, in der Nachbarschaft von Lübeck belegen, von Zisterziensern besetzt. Für Loccum lassen sich im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts Anzeichen einer sich zuspitzenden Krise feststellen. Bereits seit 1206 hatte man begonnen, Land an Bauern zu verpachten. Was anfangs noch Ausnahmecharakter hatte, wurde dann im 14. Jahrhundert zur Regel. Es gab auch in Loccum nicht mehr genug Konversen, um die Grangien weiter in Eigenregie zu bewirtschaften, die Ländereien mussten aufgeteilt und an Ordensfremde ausgegeben werden. Grangien bilden die vorherrschende Gutsform der Zisterzienser und stellen dort von Laienbrüdern (Konversen) bewirtschaftete Großgüter im Umfang von 50–400 ha (Durchschnittsgröße 150–200 ha) dar. Die Konversen leiteten die Grangien und stützten sich in ihrer Arbeit auf Klostergesinde (Klosterhörige) und Lohnarbeiter, waren aber ihrerseits dem Abt und dem Cellerar des Klosters selbst rechenschaftspflichtig.
In der Frühzeit des Ordens entstanden Grangien oft dadurch, dass den Zisterziensern bisher unbebautes Land (Wälder, Sumpfgebiete) gestiftet wurde. Diese Gebiete erschlossen die Konversen dann durch eigene Arbeit, aber auch durch den Einsatz von Lohnarbeitern für den Ackerbau und richteten dort ihre Wirtschaftshöfe ein. In späterer Zeit aber waren die Gegenden, in denen die Zisterzienser-Klöster lagen, nicht zuletzt aufgrund der Tätigkeit des Ordens, keine dünn besiedelten Einöden mehr. Nun kam es zunehmend häufiger vor, dass den Mönchen bereits bewohntes Pachtland gestiftet wurde. Das konnte dazu führen, dass die bisher dort lebenden Bauern verdrängt wurden: Befand sich unter dem geschenkten Land Pachtland, setzten die Zisterzienser nicht selten alles daran, die Pächter abzufinden, zum Beispiel durch die Zahlung von Geld, die Lieferung von Vieh oder von Gebrauchsgegenständen und anderem. Die Pächter mussten dann das Land verlassen oder als Lohnarbeiter für die Zisterzienser arbeiten. Das bisherige Dorf mit seinen Bauernhöfen wurde dann bis auf einen als Grangie genutzten Hof abgebrochen und die Felder von der Abtei in Eigenbewirtschaftung genommen. Die Wirtschaftsform der Grangien, die im 12. und 13. Jahrhundert ihren Höhepunkt hatte, war durchweg modern: Als Reaktion auf die unrentabel werdende und mehr und mehr zersplitterte traditionelle Grundherrschaft strebten die Zisterzienser nach abgerundetem Landbesitz und rechtlicher Einheitlichkeit, die zusammen mit rationellen Betriebsformen geeignet waren, Gewinne zu erzielen. Grangien produzierten ihre Erzeugnisse für den lokalen Markt der nahen Städte und setzten sie über die Stadthöfe der Klöster ab.
Die entstandene Grundherrschaft des Klosters unterschied sich nicht mehr von der eines herkömmlichen Benediktinerklosters. In dieser Phase endete das wirtschaftliche Wachstum des Klosters und der Konvent geriet in immer größere wirtschaftliche Schwierigkeiten. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts musste sich Loccum verschulden, um den Unterhalt der noch verbliebenen 20 Mönche und zehn Konversen zu finanzieren. Einen Tiefpunkt stellt dabei im Jahr 1424 die Verpfändung von Messkelchen und einer Handschrift an das Kloster Scharnebeck dar, zumal die Pfänder nicht wieder ausgelöst werden konnten. Es gibt auch direkte Hinweise auf die innere Krise des Klosters im 14. Jahrhundert. Mehrfach gab es mit Herren der Umgebung gewaltsame Auseinandersetzungen und Fehden, bei denen es vor allem um den Klosterbesitz ging. 1320 kam es im Verlauf eines solchen Streits zwischen dem Kloster und Konrad von Wendessen so weit, dass drei Loccumer Brüder den Sohn ihres Widersachers entführten und töteten. Der Tief- und Wendepunkt der Krise wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts erreicht. Dabei war das Jahr 1454 entscheidend, in dem die Wahl eines neuen Abts anstand. Da sich in Loccum kein geeigneter Kandidat fand, setzte der Abt des Gründungsklosters Volkenroda die Ernennung des Abts Heinrich II. aus dem Kloster Marienrode durch. Der neue Abt begann die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Einer seiner Nachfolger, Abt Arnold Holtvoigt (1458–1483), öffnete den Konvent für nichtadelige Chormönche, sein Nachfolger Abt Ernst (1483–1492) war selbst ein Bürgerlicher. Daraufhin verließen die adeligen Mönche das immer noch arme Kloster. Eine solche Tendenz zur „Verbürgerlichung“ des Konvents ist typisch für die Ordensreformbewegung und nicht nur auf Loccum beschränkt. Der Erfolg der Reformen ist dokumentiert im 1504 entstandenen Visitationsbericht des Abts Nicolaus von Volkenroda anlässlich der Einführung des neuen Abts Boldewin Clausing. Nun lebten wieder 40 Chormönche in Loccum, und die wirtschaftlichen Verhältnisse waren gut. Das lässt sich unter anderem am großen, in dem Dokument aufgeführten Viehbestand ablesen.
Die Loccumer Bewohner des Fronhofs erwiesen sich gegenüber den Migranten als sehr gastfreundlich. Sie erkundigten sich über den bisherigen Verlauf der Reise und erfragten die Motive der Migranten, sich in einen völlig neuen Lebensabschnitt zu stürzen. Ann-Christin und Hinnerk berichteten über ihren Wunsch ein Mustergut als Beispiel auch für die Wagrier zu errichten, Uta und Gerold erhofften sich mehr Freiheit und auch ein eigenständigeres Leben in der neuen Heimat einschließlich besserer beruflicher Chancen im Handwerk für sich und ihre Kinder. So ähnlich berichteten, gefragt zu ihren Wünschen, viele andere Familien auch ihre Erwartungen für das neue Leben. Nicht abzustreiten ist aber auch eine gute Portion Abenteuerlust, verbunden mit dem christlicher-seits zwingend auferlegten Missionarisierungsauftrag. Der Feudalherr gewährte Ihnen am folgenden Morgen ein sehr willkommenes Frühstück. Nachdem sich alle Migranten herzlich bei ihren Gastgebern für die Gastfreundschaft bedankt hatten, wurden sie mit einem fürsorglichen Gebet zum guten Gelingen der Reise, einer guten Ankunft in dem fernen Wagrien an der Ostsee sowie dem Wunsch nach einer friedlichen Christianisierung der Wagrier mit Gottes Segen auf den weiteren Weg geschickt.
Der Treck verließ Loccum in den Morgenstunden des dritten Mai 1141 mit dem Ziel, das 20 km entfernte Nienburg zu erreichen. Auch dieser Tagesmarsch war gekennzeichnet duch die Durchquerung von Waldgebieten und Sümpfen. Die Rodung von Waldgebieten und deren Umwandlung in Ackerflächen war nur in geringem Umfang fortgeschritten, Hofstellen rar. Die Gefahr Wegelageren in die Hände zu fallen lag im überaus wahrscheinlichen Bereich. Dennoch unterblieben sie, weil potentielle Angreifer bemerkten, wie gut der Treck durch die sehr gut armierte Eskorte aber auch durch die geschickte Aufteilung des Trecks in sieben Wehr- und Schutzabschnitte durch die Treckmitglieder geschützt war. Die Herausforderung des zweiten Tages lag jedoch in den völlig aufgeweichten und tiefgründig-schlammigen Wegen auf denen die Gefährte, öfter als es ihnen lieb war, stecken blieben. Mehrmals musste Luitpold eingreifen: “Bleibt in der Spur, schiebt mit an, achtet auf die Gefahr des Umsturzes eines oder auch mehrerer Wagen, falls es nicht anders geht, muss zum Flottmachen des Wagens ein Teil der Ladung abgeladen werden. Nach dem Freilauf des Planwagens kann und muss sofort wieder aufgeladen werden.“
Ungeahnte Kräfte mussten von jedem Einzelnen in die Waagschale gelegt werden, um das Gefährt wieder flott zu bekommen. Vormittags, bei triefendem Regen, erforderte die Anstrengung ein zweimaliges Durchleiden, nachmittags dreimal, wenn auch nur noch unter Nieselregen. Nienburg wurde demzufolge, also planmäßig, nicht erreicht. Die unerfreulichen Witterungsumstände und die nicht effizient und zielführend nutzbare Zeit durch ewiges Befreien der steckengebliebenen Wagen zwangen dazu, das Nachtlager risikobehaftet außerhalb der Herberge, im Freien aufzuschlagen. Die Mitglieder des Trecks waren am zweiten Tag schon an die Grenzen ihrer Kräfte gelangt. Was halfs. Die Wagen mußten in nächtliche Verteidigungsstellung gebracht, an offenem Feuer das Abendessen vorbereitet und gegart, die nassen Kleidungsstücke im Planwagen bzw. am Feuer getrocknet und Stoßgebete für besseres Wetter und günstigere Wegestrecken gen Himmel geschickt werden. Als gegen Neun der Regen nachließ, fand jedoch dieser sehr beschwerliche Tag einen versöhnlichen Abschluss um rund um das Lagerfeuer zu singen und dem Herrn zu danken. Die Nacht verlief ruhig und am 4. Mai um 6 Uhr wurde das Lager in Richtung Nienburg verlassen.
Nienburg ist tausend Jahre Stadtgeschichte und waches Gegenwartsbewusstsein, niederdeutscher Menschenschlag und buntes Völkergemisch, Stadt am Fluss und Stadt zwischen Marsch und Geest, Nienburger Spargel und Bärentatzen, Scheibenschießen und Altstadtfest, bodenständige Verwurzelung und internationale Städtepartnerschaft, königliches Kaufmannstum und Glasindustrie, Sängerbund und Frauenzentrum, barocke Festung und Stadt im Grünen, Weserrenaissance und Neue Sachlichkeit, so berichtet ein Stadtführer aus heutiger Zeit. „All dies ist Nienburg, all dies und mehr, verpackt in den Äußerlichkeiten und durchdrungen von der Identität des Gemeinwesens, das in dieser sich wandelnden Welt seinen Platz zu behaupten weiß.“ Diesmal berichtete Gerold über Nienburg:
„Ausschlaggebend für die Entstehung der Stadt und ihre Herausbildung zum größten Ort im Mittelwesergebiet war die günstige Lage am Schnittpunkt früher Wanderungs- und Handelsstraßen und an einer wichtigen Weserfurt. Der Name Nienburg ist bereits aus dem Jahre 1025 überliefert und bedeutet "Neue Burg". Ihre Aufgabe: Schutz der Furt.“ Jüngste archäologische Funde belegen, dass schon Jahrhunderte vorher auf der Düne im Aue-Weser-Dreieck eine nennenswerte spätsteinzeitliche Siedlung bestand.
Graf Heinrich I von Hoya machte Nienburg, um 1215 in den gräflichen Besitz eingegliedert, zur Residenz der Grafschaft. Seit jener Zeit ist für den Ort die Bezeichnung "civitas" nachgewiesen. Daraus lässt sich das Vorhandensein einer Stadtbefestigung und einer wehrhaften Bürgerschaft ableiten, was bald danach auch in der schriftlichen Überlieferung erscheint. Noch heute marschieren alljährlich die Bürgerschützen am Montag nach Johanni zur traditionellen Wehrübung, dem Scheibenschießen, aus. Burg und Stadt waren nun Sitz der Grafen von Hoya, denen die Bürgerschaft zahlreiche Privilegien abtrotzte: Markt- und Münzrechte und andere Freiheiten und Gerechtsame. Als die Grafenfamilie im Jahre 1582 ausstarb, fiel ihr Besitz an die welfischen Herzöge von Braunschweig-Lüneburg. Bis 1866 blieb Nienburg bei den Welfen, abgesehen von einigen Jahren französischer Herrschaft von 1803 bis 1813.
Bis in die Gegenwart ist der Stockturm, Teil der ehemaligen Burganlage, sichtbare Erinnerung an die Jahrhunderte, in denen Nienburg als Festung den bedeutendsten Weserübergang zwischen der Porta Westfalica und Bremen bewachte. Blütezeit jener Epoche waren das späte 16. und frühe 17.Jahrhundert. Auf dem geistigen Boden der durch die Gräfin Anna von Gleichen, Gattin Jobsts II. von Hoya, geförderten Reformation und dem dadurch bedingten anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung des Gemeinwesens, florierten Handwerk und Gewerbe. Der Dreißigjährige Krieg brachte der Stadt beträchtliche Zerstörung und Verluste an Menschen, setzte aber auch neue Entwicklungen in Gang. Das innerstädtische Straßensystem entstand im Zuge des Wiederaufbaus, und die Festungsanlagen wurden wieder in Stand gesetzt. Erst in der napoleonischen Ära, in den Jahren 1807/08 wurden die Stadtwälle endgültig beseitigt, was in den Friedensjahren des neunzehnten Jahrhunderts ein rasches Anwach-sen über das historische Weltbild hinaus ermöglichte. Mit der Eröffnung der Bahnlinie Bremen-Hannover 1847 und der zunehmenden Bedeutung der Weserdampfschifffahrt begann die Ansiedlung wichtiger Industrien, die nach wie vor innerhalb des Kreisgebietes in Nienburg am stärksten konzentriert sind. Chemiebetriebe, Düngemittelhersteller, Metallverarbeiter und allen voran die Nienburger Glashütten begründeten eine industrielle Entwicklung, die bis heute Nienburg als einen der Markt-, Handels- und Produktionsstandorte der Großregion prägen. Unser Treck erreichte die neue Burg Nienburg in der Mittagszeit und nahm dort Unterkunft und deckte sich mit ausreichend Proviant ein.
Das nächste Etappenziel war Verden an der Aller, gut fünfunddreißig km von Nienburg entfernt. Innerhalb zwei Tagen sollte es am 7. Mai erreicht werden. Die Tagesetappen erwiesen sich als nicht sonderlich schwierig, weil der Weg häufig durch gut passierbare, trockene Heideflächen führte. Es war sonnig, heiter und warm. In Verden mußte eine Fähre über die Aller genommen werden, vergleichsweise komfortabel zu den Furtdurchfahrten, die aber auch möglich gewesen wäre. Hinnerke informierte wieder, nunmehr schon zur Gewohnheit geworden, über die Stadtgeschichte: „Die Stadt liegt in der Mittelweserregion an der Aller unmittelbar vor deren Mündung in die Weser“. Sie trägt als Zentrum der Pferdezucht und des Pferdesports den Beinamen Reiterstadt. Der Zusatz „Aller“ hat sich zu einer Zeit eingebürgert, in der im deutsch-sprachigen Raum für die französische Stadt Verdun ebenfalls der Name „Verden“ gebräuchlich war. „Sie liegt günstig an einer Furt durch die Aller, nahe einer wichtigen Handelsstraße, geschützt durch die Burg. Ferdi in Saxonia, unter dieser Bezeichnung wird Verden in einer Urkunde Karls des Großen zum ersten Mal erwähnt. Der Name weist ebenfalls auf Furt oder Fähre hin“. Uta ergänzte: „782 fand im Raum Verden die Unterwerfung der Sachsen im Verlauf der Sachsenkriege durch Karl den Großen einen grausamen Höhepunkt: Angeblich 4500 Bewohner der damals dünnbesiedelten Region wurden bei dem sogenannten „Verdener Blutgericht“ hingerichtet, nachdem sie sich geweigert hatten, sich dem Frankenkönig Karl zu unterwerfen und den christlichen Glauben anzunehmen. Um 850 wurde das Bistum Verden errichtet.“
Die kirchliche Diözese ging erst in der Reformationszeit unter. In den folgenden Jahrhunderten wuchs die Stadt aus zwei Siedlungskernen zusammen: der Norderstadt mit Rathaus und Johanniskirche und der Süderstadt mit dem geistigen Zentrum um den Dom, dem die Fischersiedlung an der Aller angegliedert war. Daneben bestand noch die Nikolaikirche am Sandberg. Vom 11. Jahrhundert bis 1648 bestand das Fürstbistum Verden als eigenständiges Territorium, in dem die Verdener Bischöfe und deren lutherische Rechtsnachfolger als Reichsfürsten herrschten. Am 12. März 1259 wurde Verden durch bischöfliches Privileg das Stadtrecht nach bremischen Recht verliehen. 1476 gründete Berthold II. von Landsberg das Benediktinerinnen-Kloster Mariengarten „unser leven Frouven Rosengarten“ in der Norderstadt, in dessen Räume Franz Wilhelm von Wartenberg 1630 die Jesuiten einziehen ließ, sodass die Nonnen in das Kloster Frankenberg ziehen mussten. Im 15. Jahrhundert wurde Verden freie Reichsstadt bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. 1568 wurde die Reformation im „Stifte Verden“ durch den Landesherrn und evangelischen Bischof Eberhard von Holle (geb. 1531 in Uchte) eingeführt. Von 1517 bis 1683 fanden in Verden Hexenverfolgungen statt. 80 Frauen und neun Männer gerieten in Hexenprozesse, 26 Frauen und sechs Männer wurden verbrannt. Margarethe Sievers, 15 Jahre, Tochter eines Steinhauers, vermutlich nervenkrank, angezeigt von den eigenen Eltern, wurde 1618 enthauptet. Sechs Frauen starben unter der Folter, fünf in der Haft. Im Jahr 1606 wird bei 16 Prozessen vermerkt: Flucht, Prozessausgang unbekannt. Heinrich Rimphoff, ab 1642 Superintendent über das Bistum Verden, war für die Wiederaufnahme der Hexenverfolgungen im Bistum Verden verantwortlich. Zusammen mit dem Verdener Domkapitel, dem Magistrat und der juristischen Fakultät der Universität Rinteln war er 1647 treibende Kraft in einem Hexenprozess, der für mehrere Frauen mit dem Tod endete.
Der Prozess gegen Catharine Wolpmann war der Auslöser für das Verbot dieser unmenschlichen kirchlichen Gerichtsverhandlungen einschließlich des hochnotpeinlichen Verhörs, der Folterung, 1649 im schwedischen Königreich, zu dem Verden an der Aller damals gehörte, durch die Königin Christina. Durch den Westfälischen Frieden fiel das Bistum Verden als Reichslehen an die schwedische Krone. 1667 wurden die Norder- und Süderstadt durch die schwedische Krone zwangsvereint. Im Schwedisch-Brandenburgischen Krieg wurde 1675 Verden in einem Feldzug durch mehrere Staaten des Heiligen Römischen Reiches und Dänemark erobert und blieb bis zum Kriegsende 1679 in alliiertem Besitz. Im Zuge des Friedens von Saint-Germain im Jahr 1679 fiel Verden wieder an Schweden. Durch Kauf kam Verden dann nach kurzer dänischer Herrschaft 1719 zum Kurfürstentum Braunschweig Lüneburg, welches umgangssprachlich auch als Kurhannover bekannt war. Von März bis Dezember 1810 war Verden Distrikthauptstadt im Departement der Elbe- und Weser-Mündung, einem Teil des Königreichs Westphalen. Dann wurde es vom Kaiserreich Frankreich annektiert und war bis Ende 1813 ein Teil des Departement der Wesermündungen. 1814 kam Verden wieder zu Kurhannover, das auf dem Wiener Kongress zum Königreich Hannover erhoben wurde. Der Treck übernachtete abends am 7. Mai auf der Burg.
Rotenburg, an der Wümme gelegen, wurde innerhalb eines Tagemarsches, überwiegend durch Wald- und Heideflächen führend, am 8. Mai erreicht. Das Wetter meinte es gut mit dem Treck, denn strahlender Sonnenschein begleitete sie den ganzen Tag über. Alle waren in guter Stimmung, als man am späten nachmittag das heutige Rotenburg erreichte, welches erst 1195 als Burg gegründet wurde. 1141 war es allenfalls ein kleines Dorf mit günstiger Belegenheit nahe der Furt über die Wümme, wie alle Treckmitglieder übereinstimmend feststellten. Die Überquerung der Wümme war mit keinerlei negativen Vorkommnissen verbunden. Der 9. Mai nahm die südlich der Elbe gelegenen verbleibenden Streckenabschnitte in Angriff, welche in zwei bis drei Tagesetappen bis zur Elbe bei Artlenburg, der alten Ertheneburg führen sollte. Bis Toostedt, Winsen und nach Artlenburg waren es jeweils gut dreißig km. Die Etappen führten durch die nördliche Lüneburger Heide und eher sumpfigem Gelände östlich von Winsen nach Artlenburg. Dort wurde am 12. Mai per Fähre, jeweils mit zwei Planwagen beladen, über die Elbe übergesetzt. Einer besonderen Herausforderung musste sich dennoch der Treck stellen. Der sehr steile Hang des hohen Elbufers bei Lauenburg mußte überwunden werden. „Passt auf die Wagen auf, lasst sie um Gottes willen nicht den Hang herunterrutschen, packt alle mit an, sichert die Planwagen, schiebt gegenseitig an, sonst geraten wir in ein heilloses Durcheinander und sind außerdem fast hilflos Wegelagerern ausgeliefert, gellten mehrere verzweifelte Schreie über den Zug,“ der Schreck fuhr allen in die Glieder, wurde aber schnell durch entschiedenes Entgegenstemmen und unter Aufbieten aller Kräfte überwunden. Der Name Artlenburg rührt von der auf dem gegenüberliegenden Ufer der Elbe liegenden Ruine der Ertheneburg her, die den Elbübergang der Alten Salzstraße von Lüneburg nach Lübeck sicherte. Abgeleitet ist der Name Ertheneburg von dem in der Nähe der heutigen Ortschaft Artlenburg befindlichen und noch im Jahre 1228 erwähnten, heute aber nicht mehr existierenden Fluss Erthene. Dem Namen Erthene, der vielleicht noch aus vorgermanischer Zeit stammt, könnte der indo-europäische Gewässername ard zugrunde liegen. Wenn diese Deutung richtig ist, wäre das Gebiet um Artlenburg möglicherweise kontinuierlich seit der Steinzeit besiedelt, im Gegensatz zum Gebiet der heutigen Region Holstein Lauenburg, das seit der Abwanderung germanischer Siedler um 500 n. Chr. unbesiedelt war bis zum Einzug der Slawen im 7. und 8. Jahrhundert n. Chr.. Durch das Artlenburger Privileg im Jahre 1161 wurden Streitigkeiten zwischen den deutschen und skandinavischen Kaufleuten gelöst, indem Lübecker Kaufleute den bisher im Ostseehandel dominierenden gotländischen Kaufleuten rechtlich auf Gegenseitigkeit gleichgestellt wurden. Dieses in seiner Wirkung so bedeutende Privileg bildete die Grundlage für die Ausbreitung der Hanse über die Ostsee.
Nach einem ausgiebigem Tag zum Ausruhen und Dankgebeten für die glückliche Querung der Elbe konnte der Treck am 14. Mai von der nördlichen Uferseite der Elbe aus seinen Weg nach Norden entlang des Limes Saxoniae weiter fortsetzen. Die Planung sah vor, Segeberg in gut zwei bis drei Tagesetappen zu erreichen, sofern keine Zwischenfälle Verzögerungen herbeiführten. Das war nicht auszuschließen, denn das Gebiet nördlich der Elbe galt als Grenzgebiet zwischen den christlichen Sachsen und den weitgehend heidnischen slawischen Stämmen. Es gab allerdings auch schon Christen in der slawischen Bevölkerung.
Dennoch wurde die Passage durch die nord-elbischen Landschaften neben der unsicheren politischen Lage ebenso durch Wegelagerer und Räuber erschwert, die auf Beute auswaren. Ziel war somit auch der Treck mit Ann-Christin und Hinnerk. Und sie wurden angegriffen. Vier Räuber stürmten auf den Treck ein. Zu wenig, um den Treck ernsthaft zu gefährden. Auch hier zeigte sich wieder die exquisite Kampfkraft der Eskorte und die vorausschauende Sicherungsassistenz der Migranten. Es gab nur unbedeutende materielle Verluste und leichte Verwundungen. Sie hatten Glück gehabt, Todesfälle waren nicht zu beklagen.





























