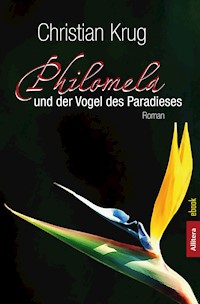
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Liebe zwischen der Ornithologin Philomela und einem schriftstellernden Kellner beginnt im bayerischen Tierpark und endet in der letzten unerforschten Gegend dieses Planeten: im tiefsten Dschungel Neu-Guineas. Als Philomela dorthin reist, um nach dem sagenumwitterten »Vogel des Paradieses« zu suchen, ahnt sie nicht, dass sie in eine Welt gerät, in der die Gesetze der Zivilisation noch keinerlei Gültigkeit besitzen. Wo es Naturvölker gibt, die noch nie Kontakt mit anderen Menschen hatten. Philomela kehrt nicht zurück. Als es nach Monaten Lebenszeichen von ihr gibt, macht sich der Mann, der sie liebt, auf, um sie zu finden. Doch seine grauenvolle Vorahnung scheint sich zu bewahrheiten … Eine literarische Gratwanderung zwischen Abenteuerroman, Liebesgeschichte und Reisebericht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es ist Liebe auf den ersten Blick, als sich die junge Philomela und der Erzähler dieser Geschichte in einem bayerischen Tiergarten treffen. Zwischen der ehrgeizigen Ornithologin und dem Kellner, der eigentlich Schriftsteller sein will, entsteht eine leidenschaftliche Beziehung, die aber von einem folgenschweren Entschluss Philomelas unterbrochen wird: Mit einer Forschergruppe bricht sie auf in eine der letzten unerforschten Gegenden der Erde: in den Dschungel Papua-Neuguineas. Dort, so hoffen sie, werden sie den sagenumwitterten »Vogel des Paradieses« finden. Sie ahnen nicht, dass sie in eine Welt geraten werden, in der die Gesetze der Zivilisation noch keinerlei Gültigkeit besitzen, in der es Naturvölker gibt, die noch nie Kontakt mit anderen Menschen hatten. Philomela kehrt als Einzige aus der Gruppe nicht zurück. Als es nach Monaten der Ungewissheit endlich ein Lebenszeichen von ihr gibt, macht sich der Mann, der sie liebt, auf ihre Spuren. Doch seine grauenvolle Vorahnung scheint sich zu bewahrheiten …
Christian Krug, 1968 in Augsburg geboren, hat Mittelalterliche Geschichte und Indogermanistik studiert und arbeitet als Schriftsteller, Schauspieler und Dozent. »Philomela und der Vogel des Paradieses« ist sein erster Roman. Unter dem Titel »Auf heiligen Spuren« ist sein Reisebericht über einen 1700 Kilometer langen Fußmarsch durch Indien erschienen. Er lebt in München.
Christian Krug
Philomela und der Vogel des Paradieses
Roman
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter: www.allitera.de
Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
2. Auflage August 2014 Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2006 Buch&media GmbH, München Umschlaggestaltung: Alexander Strathern Herstellung: Books on Demand GmbH, Norderstedt Printed in Germany · ISBN 978-3-86520-207-9
Inhalt
ERSTES KAPITEL
Die Flügelschläge des Schicksals
Zweige einer Begegnung
Stimmen aus dem Dschungel
Der Herzschlag der Natur
Sie
Die Mythen
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
Halbwertszeit des Vergessens
Tropische Begrüßung
Gleichheit der Seelen
Der Balzruf des Vogels
Erstes Kapitel
Die Flügelschläge des Schicksals
»Ich habe die Schönheit entdeckt! Verzeih mir! Ich werde dich nie wieder sehen!«
Es waren ihre letzten Worte an mich. Eine letzte Nachricht, irgendwo aus dem Dschungel Papua-Neuguineas als E-Mail über ihr Handy in den Himmel gesendet, irgendwo von einem Satelliten empfangen und irgendwie in meinen Computer eingespeist.
An einem Tag, an den ich mich nicht mehr erinnern möchte.
Und danach? Nichts mehr. Keine Nachricht. Nicht ein einziges Wort. Nur noch ihre Fotokamera, ihr Zelt und ihr Schweigen als vermeintlicher Gruß und als unwiderruflicher Befehl, dem ich mich widersetzt habe.
Natürlich musste ich Philomela suchen. Natürlich wollte ich wissen, ob sie den Vogel des Paradieses gefunden hatte.
»Ich habe die Schönheit entdeckt!«
Sie war ihm erlegen, dem Mythos vom unentdeckten Paradiesvogel in den unzugänglichsten Wäldern dieses Planeten – Papua-Neuguinea: Land der Masken und der furchterregenden Bemalungen, Land der riesigen Köpfe aus Lehm und der hölzernen Penisfutterale. Land der unentdeckten Menschen und Vögel. Ein unbekanntes Land.
»Verzeih mir!«
Ja, Philomela, ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir, dass du weggegangen bist. Aber ich verzeihe dir nicht, dass ich dafür die Hässlichkeit entdecken musste. Das fahle Antlitz dieser Welt, die grauen Grimassen des Menschen, wenn er quält, und die Hässlichkeit, die sich hinter der Abhängigkeit der Liebe wie ein lauerndes Raubtier versteckt hält. Kurz und schmerzlos kann der Biss des Raubtieres sein, kurz und schmerzlos wie eine unerwartete, wunderbare Begegnung, die aus dem Nichts auftaucht und wieder dorthin verschwindet, aber lang und schmerzvoll ist das Leiden des Zurückgelassenen, bis endlich das Vergessen eintritt.
Wann tritt endlich das Vergessen ein?
Die Straßenzüge, die ich sehe, wenn ich meine Wohnung verlasse, sind schattiert, alle möglichen Töne von Grau. Hell und dunkel, klar und verschmutzt, immer in Konkurrenz mit dem Himmel, der zumeist bedeckt ist.
Ich habe Alpträume, seit ich erfahren habe, was die Ängste des Dschungels bewirken. Was sie erzwingen. Wozu Menschen fähig sind. Fürchterliche Alpträume, in denen sich Grau mit Grün vermischt. Die Farbe, mit der Blinde die Welt sehen!
»Ich werde dich nie wieder sehen!«
Nur eine mir unbekannte Neugierde und eine Hingabe, die alle Grenzen sprengt, müssen einen Menschen beflügeln, solche Worte zu schreiben, zu denken und sie wahrhaftig in die Tat umzusetzen.
Trotz der Alpträume will ich Philomela nicht vergessen. Ich will ihre Stimme nicht vergessen. Ich rieche ihren Hals und ihre Haare, ich spüre ihre Finger und ihren Atem, ich sehe ihre Augen und ich sehe die Schönheit in ihren Augen. Die Schönheit, nach der ihre Augen immer gesucht haben.
Ich habe die Schönheit dieser Welt in Philomelas Augen entdeckt.
Nicht, dass sie mir oder ich ihr oder wir uns gegenseitig grenzenlos verfallen gewesen wären. Ein Haus, eine Familie, eine gesicherte Existenz – all das interessierte uns während der kurzen Zeit unseres Beisammenseins nicht im Geringsten. Im eigentlichen Sinne des Wortes gab es kein »Ziel«, dem wir, ich muss mich korrigieren, dem ich entgegenstrebte, nacheiferte, für das es mit dem geflügelten Wort »zu kämpfen lohnte«.
Philomela hatte ein Ziel, dem ich mich nie als gleichwertiger Gegner stellen konnte: Ich gegen die Vögel. Das Austauschbare gegen das Einmalige. Chancenlos!
Trotzdem: Ich für meinen Teil hatte mit Philomela einen vermeintlichen Höhepunkt meines Lebens erreicht und hätte am weiteren Dasein mit ihr größten Gefallen empfunden. Oh Augenblick verweile doch und so weiter: Spaß – Freude – Leichtigkeit – das sind vielleicht Wörter, die der ganzen Sache am Nähesten kommen.
Als ich mich bei unserer ersten Begegnung vor dem Seehundgehege des Tierparks vorstellte, konnte sie ein Schmunzeln kaum verbergen. Im Gegenteil. Sie wollte es nicht verbergen. Philomela war die humorvollste Frau, die ich jemals kennen gelernt habe.
»Schriftsteller. Und Kellner.«
»Oho! Und womit verbringt man mehr Zeit?«
»Mit dem Schreiben!«
»Und wofür bekommt man mehr Geld?«
»Für das Kellnern!«
Sie schmunzelte. »Und was macht mehr Spaß?«
Ich dachte einen Augenblick nach. »Ich glaube, das eine wäre ohne das andere langweilig. Nein. Es wäre unerträglich. Den lieben, langen Tag nur sitzen und schreiben – eine grässliche Vorstellung. Aber den lieben langen Tag, besser gesagt die halbe Nacht fremden Menschen, so nett sie auch sein mögen, ein Bier hinstellen, das würde mir auch den Rest geben.«
»Die rauchgeschwängerte Luft in einer Kneipe ist doch für einen Schriftsteller sicherlich ungeheuer inspirierend«, sagte sie provozierend.
»Die rauchgeschwängerte Luft in einer Kneipe ist unendlich ungesund und für einen ehemaligen Raucher, der es als die größte Leistung seines Lebens ansieht, diesen Scheißdreck nach fünfzehn Jahren aufgegeben zu haben, nicht inspirierend, sondern quälend.«
Philomela lachte und sagte: »Das ist die erste und wichtigste Voraussetzung für eine vielleicht sehr inspirierende Kommunikation. Als Nichtraucherin halte ich es wie Omar Sharif, der damit nach fünfzig Jahren aufgehört hat und in einem Interview sagte: ›Wenn ich eine Raucherin küsse, habe ich jetzt das Gefühl, ich küsste den Tod.«
Wenn ich sie jetzt sofort küsse, dann sterben wir vielleicht im nächsten Augenblick, dachte ich. Ein Seehund schnappte nach einem Hering, den der Wärter ihm zuwarf. Die anderen Seehunde wurden unruhig.
»Extreme müssen manchmal im Leben sein«, sagte ich. »Sie ziehen sich gegenseitig an, stoßen sich ab. Eine gesunde Mischung, ja, das ist es, was mich zufrieden stellt.«
»Je weiter die Extreme auseinander liegen, desto eher trifft man sich in der Mitte, oder?«
»Was ist denn die Mitte zwischen unendlich und nichts?«, fragte ich.
»Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Manchmal liegen die Extreme so weit voneinander entfernt, dass eine Verständigung nicht möglich ist.«
Bis zu diesem Moment hatten wir beide es vermieden, uns mit »Du« oder »Sie« anzusprechen. Neutralität schwang noch in der Luft, die aufgespannt war, um einen möglichen Absturz aufzufangen. Philomela hüpfte mit einem Satz hinunter und schwang sich elegant, wie ein weiblicher Tarzan an einer Liane, zur nächsten Stufe unserer Verständigung.
»Stell dir vor: Menschen, die noch niemals in ihrem Leben eine Kneipe gesehen haben, werden von einer Sekunde zur nächsten aus ihrer vertrauten Umgebung herausgeholt und am Freitag Abend um zehn Uhr in einer vollen Kneipe abgestellt. Menschen, die irgendwo leben, wo nicht geraucht wird.«
»Gibt es solche Orte noch?«
»Ich glaube schon. Und wenn nicht, stelle ich es mir jetzt vor. Orte, wo nicht geraucht wird. Zumindest nicht Zigaretten. In der Wüste zum Beispiel. Bei den Buschmännern. Oder im Dschungel. Im Amazonas–Dschungel die Yanonami. Sie sehen sich in der Kneipe um und sehen fünfzig erwachsene Menschen in einer dichten, stickigen Luft sitzen, die Herzklopfen und Brennen in den Augen verursacht. Da denken sich doch diese Menschen: Was für ein dummes, unzivilisiertes Volk sitzt hier? Warum machen die die Fenster nicht auf? Warum machen die das überhaupt?«
»Und dann ist zufällig noch ein Pneumologe in der Kneipe«, ergänzte ich, »der die Röntgenaufnahmen all dieser Gäste dabeihat, die die Schatten auf den Lungen, die Karzinome und die verstopften Herzkranzgefäße zeigen, und den Wilden erklärt, dass dieser Rauch verantwortlich ist für viele böse Geister, die den Körper ein Leben lang quälen.«
»Und einer der Gäste steht auf, hebt seine Hose und zeigt den Indianern sein zerfressenes Bein.«
»Und ein anderer steht auf, das heißt, steht nicht auf, sondern rollt zu den Indianern und erklärt ihnen, dass ihm beide Beine amputiert wurden, weil er jahrzehntelang diese Zigaretten geraucht hat. Weil sie ihm geschmeckt haben!«
Wir flogen nun beide mit unserer Phantasie im Einklang mit den elegant schwimmenden Seehunden, die sich fröhlich tummelnd um die letzten Heringe stritten.
»Ich denke«, sagte Philomela schließlich, »dass die Indianer nur den Kopf schütteln und sagen: ›Ich möchte wieder zurück in meinen Dschungel. Bei diesen primitiven, dummen Menschen will ich nicht bleiben!‹«
»Und sie husten dabei.«
»Ja, genau.«
»Nur eines dürfen wir nicht vergessen.«
»Was denn?«, fragte sie.
»Auch bei den Eingeborenen im Dschungel ist es stickig. Rotunterlaufene Augen vom immer währenden Rauch in den Hütten. Weil sie nicht in der Lage sind, einen richtigen Abzug zu bauen.«
Sie schwieg und schaute mich an. Ich sah in ihre Augen, ohne zu weichen. Irgendetwas schlich sich da irgendwie in mein Leben, irgendwo durch ein Türchen, das ich nicht kannte.
»Dann werde ich den Herrn Schriftsteller kurz darüber aufklären, damit er keinen Fehler in seinen Romanen verzapft. Schlecht recherchiert ist doppelt verloren! Oder anders gesprochen: Besser rotunterlaufene Augen, die brennen, als Malaria, die verbrennt. Tatsächlich ist es so, dass Menschen im Dschungel durchaus wissen, wie sie mit Feuer und Rauch umgehen müssen. Auf eine schön durchräucherte Küche haben Moskitos nun einmal keinen Appetit.«
»Wovor schützen sich dann die Menschen in einer durchräucherten Kneipe in Deutschland?«
»Vielleicht vor der herumschwirrenden Frage, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen.«
»So pessimistisch? Was machen Sie in Ihrem Leben? Das heißt natürlich: Was machst du?«
»Ich heiße Philomela und bin Ornithologin.«
Welcher Teufel mich auch immer geritten hatte, ich hätte ihm die Füße dafür küssen können, dass er mich an jenem Tag in den Tierpark geführt hatte. Wir standen noch immer vor dem gekachelten Bassin mit den Seehunden, es war ein kalter, windiger Tag. Die Tiere fühlten sich sichtlich wohl. Kaum jemand war unterwegs, für Mütter mit ihren Kindern war es zu kühl, die Restbevölkerung war in der geregelten Arbeit. Wir hatten den Seehunden zunächst teilnahmslos jeder für sich zugeschaut, dann ein erster verstohlener, zwei weitere viel tapferere Blicke, dann ein Lächeln.
Philomela war mir zuvor gekommen. »Auch zu viel Zeit oder sind Seehunde ein interessantes Forschungsobjekt?«
Das waren ihre ersten Worte, die sie an mich gerichtet hatte.
Ihre letzten: »Ich habe die Schönheit entdeckt! Verzeih mir! Ich werde dich nie wieder sehen!«
Ich hatte vom ersten Augenblick an geahnt, dass ich niemals genügen werde.
Noch vor dem Seehundgehege erfuhr ich, dass sie in München wohnte und nur für einen halben Tag angereist war. Im hiesigen Vogelhaus wollte sie eine bestimmte Taubenart, die Fächerkrontaube, beobachten und Studien am Gefieder vornehmen, Vorbereitungen für eine Reportage in einem Fachmagazin.
Natürlich bestand ich vor dem Seehundgehege darauf, dass sie mir etwas von ihren Kenntnissen erzählt, dass sie mich ein Stück mitnimmt und mit mir in ihre Welt abtaucht. Sie hakte sich wie selbstverständlich bei mir unter und führte mich in das Vogelhaus, gleich gegenüber vom Seehundgehege.
»Im Gefieder eines Vogels können geheime Botschaften verborgen sein. Die Ästhetik der Natur, der Drang zu immer größerer Vollkommenheit, die Sucht nach Harmonie. Betrachte dieses Federkleid und du kannst hinabtauchen in die unverfälschte Farbenpracht des Lebens. In die unverfälschbare!«
Wir schlenderten durch das Vogelhaus, blieben vor dem ersten Fenster stehen, setzten uns später vor dem zweiten nieder.
»Betrachte eine einzelne Feder, das Arrangement der Flugfedern, das Überlappen der Halsfedern, das Zusammenspiel der einzelnen Schattierungen, und der Spruch aus der Bibel von König Salomons Gewändern, ihrer Farbenpracht, seinem Reichtum und seiner trotzdem unaufhaltsamen Hinfälligkeit wird verständlich.«
Beim dritten Fenster klopfte sie in einem bestimmten Rhythmus an die Scheibe. Der Vogel reagierte auf diesen ihm scheinbar vertrauten Ton, kam herbeistolziert und beäugte den Finger auf der anderen Seite der Scheibe wie einen Konkurrenten.
»Ich könnte ihn mit diesem Rhythmus zur Weißglut bringen. Und mit einem anderen Rhythmus wieder besänftigen. Die Sprache der Natur ist für jeden erlernbar, der sich auf sie einlässt.«
»Wie verhält er sich, wenn er in Rage gerät?«, fragte ich.
»Ich würde es nicht darauf ankommen lassen. Manchmal sind die unscheinbarsten Gegner die gefährlichsten.«
An einem anderen Fenster verwies sie auf die ungewöhnliche Sitzposition eines Vogels, der scheinbar schwerelos, wie ein Seiltänzer auf einem dünnen Ast balancierte.
»Natürlich ist diese Position ungewöhnlich. Mit der Zeit wird er bei dieser Haltung ernsthafte Schäden mit seiner Wirbelsäule davontragen. Diese Rasse lebt eigentlich im Dach der Regenwälder, dreißig, vierzig Meter über dem Boden. Sie wissen nicht, was Erdboden ist. Wahrscheinlich hat dieser Bursche hier im Käfig genau das gegenteilige Gefühl von dem, was wir als Schwindel kennen: Ihm ist der Boden zu nahe. Wir haben Angst, in die Tiefe zu stürzen, es sei denn wir sind nordamerikanische Ureinwohner, die keine Höhenangst kennen und beim Bau von Wolkenkratzern ohne Sicherung auf Stahlträgern herumbalancieren. Dieser Vogel möchte sich in die Tiefe stürzen und Platz haben, um zu fliegen. In der freien Natur glaubt er, diese Tiefe höre nie auf. Aber hier hat er Angst aufzuschlagen. Gallier haben Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Er hat Angst, dass ihn der Erdboden erschlägt.«
»Wovor hast du Angst?«
Sie schaute mich überrascht an. »Meinst du nicht, dass es ein bisschen früh ist, darüber jetzt schon .«
»Du hast also Angst vor zu intimen Fragen!«
»Das nun auch wieder nicht, Herr Direkt! Aber bitte, von mir aus, wenn du unbedingt wissen willst: Ich habe Angst, einem Vogel zu begegnen, dem ich nicht widerstehen kann!«
Ich spürte es sofort: Trotz des ironisierenden Untertons hatte sie eine fürchterliche Wahrheit gesagt.
Der Vogel drehte seinen Kopf und machte den Eindruck, uns in sein Visier zu nehmen, als hätte er uns verstanden und könne nicht recht glauben, was er gehört hatte. Ich konnte nicht glauben, dass es möglich sein kann, sich so schnell zu verlieben. Gleichzeitig begriff ich auch, dass wir schnell von dieser Tiefsinnigkeit weg mussten, sonst hätten wir uns plötzlich in einer Ernsthaftigkeit wiedergefunden, aus der es kein Entrinnen gibt. Zumindest nicht in diesem leichten verspielten Moment, als uns zu allem Überfluss ein verliebtes Kakadu–Pärchen aus der Ecke des gleichen Vogelhauses beäugte.
»Woher weißt du, dass der Bursche da drin ein Männchen ist und kein freches kleines Vogelmädchen?«
»Na hör mal! Das sieht man doch auf den ersten Blick! Abgesehen davon ist das kein Vogelmännchen, sondern ein sehr reifer, ausgewachsener Mann. Bei dir täusche ich mich doch hoffentlich auch nicht!«
Verstehe es, wer es will, aber ich hatte in diesem Moment Herzklopfen.
Zu fast jeder Art wusste Philomela etwas zu berichten. Und es war nicht nur eingepauktes, heruntergeleiertes wissenschaftliches Fachwissen, das ich in jedem Lexikon oder bei Brehm und Grzimek hätte nachlesen können. Es waren vor allem Geschichten, die sie bei eigenen Beobachtungen erlebt oder von Kollegen gehört hatte und nun mir mit einer mich umgarnenden Stimme vortrug. Im Gegensatz zu den ersten Momenten draußen vor dem Vogelhaus hatte sie eine gewisse Strenge verloren, hatte etwas tropisch Warmes angenommen. Sie entlud sich gleich bleibend, ohne Kraft zu verlieren. Sie hatte eine Stimme, die der Harmonie ihres Gesichtes, ihres Teints, ihrer ganzen Erscheinung entsprach. Eine Stimme wie der kraftvolle Flügelschlag eines Schwans.
Ich erfuhr weiter, dass sie schon im zarten Alter von zehn Jahren ihre ersten Fallstudien an Tauben auf Stadtplätzen durchgeführt hatte.
»Ich hatte eine Freundin, die an einer echten Taubenphobie litt. In München ging das ja noch. Aber einmal fuhren wir mit unseren Eltern zusammen nach Venedig. Sie fing an zu heulen, als sie die Tauben auf dem Markusplatz nur von Weitem sah. Ich aber sprang auf den Platz, als würde ich mich in ein warmes Meer mit herrlichen Wellen stürzen. Ich schloss die Augen, denn ich hatte nicht die geringste Angst. Ich drehte mich im Kreis, spürte das Flattern der Flügel auf meinem Gesicht und hörte deutlich ihr Gurren, als ob diese Tauben mir etwas erzählen wollen. Dann blieb ich stehen und wartete mit ausgestreckten Armen, bis sich die ersten auf mir absetzten. Erst dann machte ich die Augen wieder auf und schaute einer Taube direkt in das elegante, strenge Gesicht.«
Mit neunzehn, während eines Aupair–Aufenthalts in Australien hatte sie beim Besuch eines »national sanctuary« beschlossen, ihre Leidenschaft, ihre Berufung zum Beruf zu machen. Während ihres Studiums der Biologie arbeitete sie bei verschiedenen Zeitungen.
»Am liebsten schrieb ich für Fachzeitschriften. Aber das brachte kaum Geld ein. Deswegen musste ich mich auf fremdes Terrain wagen: Lokalblätter. Klatschpresse. Kannst du dir das vorstellen? Es war manchmal furchtbar. Ich musste mich in diese In–Szene einschleichen und wie ein Paparazzo auf Sensationen lauern. Denen war nichts heilig. Wenn der Fußballer oder die Schauspielerin von den Kammerspielen einen Pfurz ließen, dann mussten wir darüber schreiben. Wenn einer der Stars ein besonders schweres Schicksal, eine Krankheit zu ertragen hatte, war es der Renner. Dann werden viele Bedürfnisse befriedigt: Mitleid und Schadenfreude und Neugier. Ein gieriges Volk. In gewisser Hinsicht sind das Menschenfresser. Sie verschlingen Intimitäten. Hast du jemals für so ein Blatt geschrieben?«
»Nicht dass ich wüsste. Aber ich kann mir vorstellen, dass man dort das knappe Schreiben lernen kann. Nicht um den heißen Brei reden. Zur Sache kommen.«
»Das kann man auch woanders lernen!«
Mit sechsundzwanzig galt sie aufgrund ihrer elegant geschriebenen Reportagen innerhalb der Fachkreise der Vogelkunde als eine aussichtsreiche Nachwuchsjournalistin. Und nun, mit dreiunddreißig, konnte sie es sich aussuchen, welche Aufträge einschlägiger Magazine und Fachblätter sie annahm und mit welchen Fotojournalisten sie zusammenarbeiten wollte.
»Insofern haben wir ja etwas gemeinsam: Du schreibst über Vögel … und ich …«
»Ja, über was schreibst du eigentlich?«
Ja, über was schreibe ich eigentlich? Oder, wenn ich jetzt darüber nachdenke: Worüber schrieb ich eigentlich? Worüber habe ich geschrieben, bevor ich Philomela kennen gelernt habe?
Ich wollte schon zu sagen: »Über die wichtigen Dinge des Lebens«, konnte mir diese reichlich alberne Platitüde aber gerade noch verkneifen.
»Nun, worüber? Oder sind es Geheimnisse? Vielleicht Heimatromane für ›Julia‹ und ›Frau Aktuell‹?«
Um Zeit zu gewinnen und mir eine intelligente Antwort auszudenken, antwortete ich: »Nein, sicher nicht. Allerdings muss man dazu Talent, ungeheure Leidensfähigkeit und eine an Selbstgeißelung grenzende Selbstdisziplin besitzen. Aber ich werde darüber nachdenken. Vielleicht werde ich irgendwann einen Heimatroman schreiben, der nicht in unserer Heimat spielt, sondern in einer exotischen Fremde. Denn Heimat – was ist das?«
»Lenk nicht ab! Worüber schreibst du?«
Ich wollte nicht antworten, dass ich überhaupt kein Konzept, keine Stilrichtung, kein Genre habe, das ich besonders gern bediene. Mein Repertoire umfasste zu diesem Zeitpunkt ausschließlich unveröffentlichte, leidenschaftliche Liebesgeschichten mit dem Bemühen, ekstatische Momente bis zur völligen Selbstaufgabe einzufangen, ohne sich in pornographischer Detailverliebtheit zu verlieren oder daran zu ergötzen. Dies Philomela zu sagen erschien mir in diesem Moment zu anzüglich, zu zweideutig. Ich rang nach Originalität und sagte schließlich: »Ich schreibe von den Flügen der Seele und den Flügelschlägen des Schicksals!«
Ich werde nichts mehr schreiben! Ich werde diesen Bericht abschließen und nichts mehr schreiben. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich sehe jede Nacht die Hässlichkeit in meinen Alpträumen und erahne die Schönheit.
Worte würden fortan am Ziel vorbeischießen.
»Von den Flügelschlägen des Schicksals? Manchmal wagt sich das Schicksal so hoch hinauf, dass die Seele in diesen Höhen keine Luft mehr bekommt!«
»Das sind genau die Momente, über die es zu schreiben lohnt. Über die ich schreiben will. Als geschützter Leser kann man sich hinter den Buchseiten verstecken und droht nicht allzu weit abzustürzen. Trotzdem darf man sich mit jeder Zeile weiter hinaufschwingen in Gefilde, die die eigene Phantasie nicht zu erreichen vermag oder in die sie sich nicht wagt. Doch herausgekitzelt vom Autor wird das Unerlebbare erlebbar.«
»Dann glaubst du, dass man in der Phantasie, beim Lesen, beim Träumen zu mächtigeren Gefühlen in der Lage ist als im wirklichen Leben?«
Philomela hielt mir, ohne es wahrscheinlich zu wissen, mit dieser Frage eine Rettungstür offen, durch die ich nun hätte hindurchgehen können, um dahinter allein mein weiteres Dasein zu fristen. Ich wollte aber bleiben, bei ihr, wollte weiter mit ihr sprechen und fliegen.
»Man kann auch zusammen im Buch des Lebens lesen«, sagte ich und fand im nächsten Moment diese fade, wenig originelle Metapher misslungen.
Doch Philomela griff das Bild auf und machte das Beste daraus. »Das Schwierigste beim gemeinsamen Lesen ist doch, immer zusammen und einvernehmlich die Seite umzublättern. Meist hängt einer hinterher, liest langsamer oder vielleicht auch gründlicher. Oder verweilt an einer besonders schönen Stelle, um diese noch länger zu genießen.«
»Manchmal liegt es aber auch nicht an dem, der langsam liest, sondern an demjenigen, der zu schnell liest. Zu schnell wissen will, wie es ausgeht.«
»Also gilt es zu jedem Zeitpunkt des tatsächlichen Lebens Kompromisse einzugehen?«
»Was ist denn das tatsächliche Leben?«, fragte ich. »Oder was ist das Gegenteil vom tatsächlichen Leben? Der Tod?«
»Nun bitte keine Wortklaubereien, Herr Schriftsteller. Du weißt, was ich meine. Es gibt die Zeit der Illusionen. Wenn man liest. Und es gibt das tatsächliche, das reale Leben.«
»Du hast selbstverständlich Recht. Wahrscheinlich bedarf es immer eines Kompromisses! Außer man zieht sich in eine Berghöhle zurück und meditiert bis ans Ende aller Tage radikal und rücksichtslos«, sagte ich.
»Ich kann gut verstehen, dass du schreibst. Da möchte ich doch zu gerne einmal in deinen Kopf hineinsteigen und klammheimlich an den einzelnen Gehirnwindungen hinaufklettern. Irgendwie ist das auch eine Höhle, in die du dich zurückziehst. Eine enge, fruchtige Höhle von Melonengröße.«
»Sehr poetisch! Das Schönste und zugleich das Traurigste am Schreiben ist, dass es die einsamste Tätigkeit der Welt ist. Aber zugleich kann es dir gelingen, dich mit der ganzen Welt zu vereinen.«
Ich fühlte mich in Philomelas Nähe wohl. Ich spürte, dass ich einer Frau gegenüberstand, der ich eine Leidenschaft nicht verheimlichen brauchte, sondern die ich mit dieser Leidenschaft neugierig machen konnte.
»Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr spannend ist, etwas zusammen zu schreiben. Gemeinsam lesen ist schon schwer, aber gemeinsam schreiben? Ist das möglich, Philomela?«
Zum ersten Mal sagte ich ihren Namen, und ich begriff, dass ich hundert Jahre nachdenken könnte, ohne dass mir ein eleganterer Name einfallen würde. Ich dankte insgeheim ihren Eltern.
»Schreibst du mit der Hand?«, fragte sie plötzlich.
»Nein, mit dem Computer.«
»Schade. Ich hätte sehr gern deinen Stift fest in die Hand genommen.«
Wir schauten uns an. Anzüglichkeiten waren nicht ihr Stil. Humor und Leichtigkeit schwangen mit, immer begleitet von einem Lächeln.
Ich verkläre nichts. Philomela war einzigartig.
Wir bemühten uns, so schnell wie möglich das Haus der Vögel zu verlassen. Als wir die Glastür öffneten, um hinauszutreten, blieb Philomela stehen, nahm meine Hand und sagte: »Ja, ich habe wirklich vor etwas Angst.«
»Wovor?«
»So eingesperrt zu sein wie diese Vögel. Nicht mehr das ausleben zu dürfen, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Sie wurden geboren, um zu fliegen. Eingesperrt sein und dabei noch beglotzt werden. Ja, davor habe ich wirklich Angst.«
»Am meisten vor den Pressegeiern der Schmierblätter.«
»Du bereitest mir Alpträume«, erwiderte sie hastig. »Ja, das wäre das Schlimmste. Selbst wenn es mit der Berühmtheit verbunden wäre, die vorhanden sein muss, um diese Aasgeier anzulocken!«
»Also ist Eingeschlossensein deine größte Angst?«
»Ja, ich glaube schon.«
»Es gab einen hohen Beamten am Hofe des Kaisers Friedrich II. Der Sizilianer…«
»Das Kind aus Apulien«, fiel sie mir ins Wort, »ja, ich weiß, ein faszinierender Mensch. Er hat das erste Buch über die Kunst der Vogeljagd geschrieben. Und ein Buch über Falken. Wenn du so willst, war er der erste Ornithologe.«
»Dann weißt du auch über Petrus Vinea Bescheid?«
»Nein, ich habe mir nicht alles gemerkt.«
»Er wurde eingekerkert. Von seinem Herrn, dem Kaiser. Weil dieser vermutete, Petrus habe ihn vergiften wollen. In einem Kerker, in den angeblich kein einziger Laut von außen eindrang. Für Petrus war die Gefangenschaft so furchtbar, dass er sie nicht ertragen konnte. Denn sie war doppelt. Er war im Verlies eingekerkert und in sich selbst.«
»In sich selbst?«
»Ja, Friedrich hat ihn geblendet. Petrus Vinea sah nichts und hörte nichts. Was tust du, wenn du keinen Strick, kein Gift, kein Messer zur Verfügung hast, gefangen bist und nicht mehr leben willst?«
»Ich weiß es nicht.«
»Petrus hat sich den Kopf an der Mauer seines Kerkers selbst zertrümmert. Er nahm Anlauf und … Tun sie dir nicht Leid, diese Vögel dort drin? Hinter Glas und in ständiger Furcht, der Käfigboden könne sie erschlagen, so nah wie er ist? Hast du nicht Angst, sie könnten sich den Kopf an der Glasscheibe einschlagen?«
Philomela schaute zu Boden, dann wieder zu mir, und in ihren Augen entflammte Leidenschaft.
»Ein schreckliches Schicksal. Aber du solltest es nicht miteinander vergleichen. Zoologische Gärten haben auch ihre Berechtigung. Diese Vögel sind keine lebenden Hüllen. Ich habe jeden einzelnen dieser Vögel in mein Herz geschlossen. Aber meine Aufgabe ist es nicht, die Welt zu verändern geschweige denn zu verbessern. Das ist vielleicht die Aufgabe eines Schriftstellers.«
»Dann verrate ich dir nun eine meiner Ängste: Dass jemand von mir erwartet, die Welt zu verbessern.«
»Gut gekontert.« Noch standen wir. Dann sagte Philomela: »Du kannst dir immerhin eine bessere Welt ausdenken und beschreiben«. Sie packte meine Hand und riss mich fort in eine bessere Welt. Die Welt mit Philomela.
»Ich habe vor noch etwas Angst: davor, keine Zeit zu haben, den Augenblick richtig zu genießen!«, rief sie und sprang hinaus.
Frische Luft schlug uns entgegen.
Zweige einer Begegnung
Die Flügelschläge des Schicksals warfen mich in den folgenden Wochen und Monaten immer wieder zu Boden. Ich lag manche Nacht, noch mehr manchen Morgen erschlagen im Bett, erschlagen von den leidenschaftlichen Zusammenkünften mit Philomela oder erschlagen von der Sehnsucht, sie wieder zu sehen, wenn sie nicht in München war, sondern irgendwo herumreiste, Vorträge hielt und ich in meinem oder ihrem Bett in den Kissenfalten nach ihr suchte.
Was gibt es zu berichten von unserer weiteren Kennenlern– und Annäherungsphase? Ich habe den Eindruck, sie glitt noch während und unmittelbar nach unserem gemeinsamen Tierparkbesuch übergangslos in diese Phase des Einverständnisses und der Abgeklärtheit, in diesen Zustand, der eine ungekannte Zuversicht verspricht.
An jenem Nachmittag, an dem wir uns kennen gelernt hatten, schlenderten wir nach den Vogelhäusern weiter durch den Tierpark und amüsierten uns bei den Schimpansen, bedauerten die unruhig herumirrenden Tiger, stritten über die Herkunft des Ozelot, wobei Philomela mit Südamerika Recht behielt, und beschlossen dann, nach einer Tasse Tee auch noch den botanischen Garten in direkter Nachbarschaft zu besuchen.
Philomela war entzückt, als sie dort einen Käfig mit Kolibris entdeckte. Sie bestaunte die kleinen herumschwirrenden Perlen und meinte, dies sei eine erstaunliche Auswahl für eine solche Stadt. Noch dazu, weil es sich eher um ein dekoratives Beiwerk im Tropenhaus handelte, das gewöhnlich nur im Vorbeischlendern wahrgenommen wird.
»Echte Vogelfreunde wären begeistert, wenn sie das hier sehen dürften. Was heißt dürften? Hier steht eine echte Vogelfreundin und ist begeistert.«
Vor dem Kolibrikäfig stand eine Bank und Philomela setzte sich, ohne ihren Blick von den Kolibris abzuwenden.
»Es ist schon eine erstaunliche Tatsache, dass die Flügel dieser Kolibris etwa zwanzig bis dreißig Mal pro Sekunde schlagen, nicht wahr?«
»Entschuldige, wenn ich deine Begeisterung nur bedingt teile. Aber ich denke, dass das Tierreich mit noch faszinierenderen Superlativen aufwarten könnte«, sagte ich. »Eine Schmeißfliege. Oder eine Honigbiene. Die bringen es doch sicherlich auf einige Hundert unsichtbare Flügelschläge.«
»Natürlich, ja, du hast Recht«, stimmte sie zu. »Aber ist uns der Kolibri mit seinen winzig kleinen Knöchelchen und Gelenken nicht doch etwas vertrauter, etwas verständlicher als ein Insekt mit chitinhaltigen Hautflügeln, riesigen Facettenaugen und einem sonderbaren dreiteiligen Korpus? Sind uns Vögel nicht überhaupt sehr vertraut?«
»Das ohne Zweifel. Was glaubst du? Empfindet ein Kolibri bei jedem einzelnen Flügelschlag genauso viel wie ein Blauwal, wenn seine mächtige Rückenflosse ein einziges Mal durch das kalte Wasser des Atlantik schwingt?«
»Ein wahrer Poet! Alles ist die Sprache der Natur. Man muss nur hinhören. Hinschauen.«
Bei uns beiden brauchte es in diesen Stunden nicht viel des Hinschauens und Hinhörens, um zu begreifen, dass da zwei Liebhaber der verschlungenen verbalen Annäherung am Werk waren. Nur nicht zu weit vor. Aber auch keinen einzigen Schritt mehr zurück. Die Zeit schritt unaufhaltsam voran, wir mit ihr. Mir erschien nicht eine einzige Sekunde mit Philomela in diesen Momenten zu lang.
Die Kolibris hatten es Philomela besonders angetan, mehr als die Fächer–krontaube, wegen der sie eigentlich aus München gekommen war und der sie dann nicht die Aufmerksamkeit entgegengebrachte, die sie zuvor angekündigt hatte. Wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, hätte ich nur zu gern einen dieser kleinen schwirrenden Edelsteine aus dem Käfig gestohlen und vor ihren Augen aus dem Ärmel gezaubert.
Später gingen wir in einer Kneipe etwas essen, die uns wegen ihrer rauchgeschwängerten Luft dazu zwang, bald wieder zu gehen und an der Peripherie der Innenstadt noch einen ausgedehnten Spaziergang anzuhängen, um uns und unseren Lungen frische Luft zu gönnen. Meine Vertrautheit mit den Toren, der Stadtmauer und den engen Gässchen der Altstadt erlaubte mir, einen Weg einzuschlagen, der uns von einem verschwiegenen Platz zum nächsten führte. Auf diesem mir vertrauten Terrain fühlte ich mich sicher. Trotzdem wollte ich Philomela nicht fragen, wann sie nach München zurückzufahren gedenke, ob sie mit dem Zug oder mit dem eigenen Auto unterwegs sei. Die Zeit, die am frühen Nachmittag mit dieser unerwarteten Begegnung vor dem Seehundgehege eingeläutet worden war, tickte unablässig auf einen unhörbaren Countdown zu.
Manchmal zähle ich noch immer die Sekunden, spätnachts, wenn mich graugrüne Farben beschleichen und ich darauf warte, endlich aufzuwachen, um diese Farbe mit dem dunklen Grau meines Zimmers zu vertauschen.
Philomela spürte, während sie sich bei mir einhakte, meine steigende Unruhe und schaute irgendwann auf die Uhr.
»Eigentlich müsste ich jetzt langsam in Richtung Bahnhof zurücklaufen. Um zwanzig nach kommt der nächste Zug.«
»Aber das ist doch nicht der letzte!«
»Nein. Dann fährt noch einer um dreiviertel, einer um elf, dann wieder um zwanzig nach.«
»Wann fährt der letzte?«
»Der letzte Zug?«
»Ja.«
»Nun, ich denke, wenn die Welt untergeht«, sagte sie. »Danach fährt keiner mehr. Aber nach dem Zug um elf fährt heute – wahrscheinlich – noch der um zwölf und um zwanzig nach zwölf. Und dann gibt es noch den um eins und…«
»Ich meinte heute den letzten Zug. Oder musst du morgen nicht in München sein?«
»Doch. Schon.«
»Wann?«
»Rechtzeitig!«
»Rechtzeitig wann?«
»Pünktlich!«
»Du willst nicht zu spät kommen?«
»Nein!«
Das verdammte Spiel der Geschlechter erschien mir wie ein Seiltanz: ich mit der langen Stange in den Händen, links und rechts ein Abgrund, links und rechts viele Möglichkeiten des Lavierens, dabei sah ich doch direkt vor mir das klar definierte Ziel: Philomela, die mich anschaute und wartete.
Zu viel oder zu wenig, ein olympischer Betrachter lächelt sicher zehntausend Mal pro Tag und Nacht, wenn er wieder Zeuge des heldenhaften Aufbietens aller Kräfte wird, die im Seiltänzer schlummern, wenn er unter Trommelwirbel zum letzten Sprung ansetzt.
»Du könntest natürlich auch bei mir übernachten.«
Sie wartete ein, zwei Sekunden und sagte dann das einzig Richtige: »Ich hoffe, dass du eine Einzimmerwohnung hast, damit wir uns gar nicht erst fragen müssen, wer in welchem Zimmer schläft.«
Nichts hatte ich erwartet, nichts geahnt, und plötzlich überrollte mich diese Unbekannte, die noch in derselben Nacht Vertraute wurde. Innerhalb weniger Atemzüge vom bloßen Gegenüber zur Seelenverwandten verwandelt, einfach eingebrochen: Ich habe Philomela einfach zu mir eingeladen, und sie hat sich einfach auf mich eingelassen. Ich habe ihr ein knielanges T–Shirt zum Schlafen angeboten. Sie hat es abgelehnt.
Es war ohne Zweifel ein erhebendes und schon lange nicht mehr erfahrenes, vielleicht vergessenes, vielleicht noch nie erlebtes Erlebnis. Ein Hin– und Herschwingen zwischen allen Sinnen, bis wir uns in völliger Dunkelheit dort hinaufkatapultierten, von wo niemand zurückkehren will, jeder zurückkehren muss.
»Das Spiel des Lebens.«
»Ja, das ist das Spiel des Lebens!«
Wer es so als Erster genannt hatte, vermag ich nicht mehr zu sagen. Begonnen hat es mit einer Eröffnung im Licht, sie mit dem T–Shirt in der Hand und der anderen Hand endlich an meinem Hals. Bis dahin nur Tasten mit Worten und flüchtigen Berührungen, die schon erahnten, worauf es hinauslaufen würde. Umso schöner dann der Kuss, mit dem sie in meinen Mund hineinsteigen wollte. Ich sah Amseln vor mir, die ihre Jungen füttern, sah diese Jungen ihre kleinen Köpfchen bis zum Schlund hineinstoßen, um den Wurm zu angeln, der tief unten zappelt. Schnell waren ihre Bewegungen während des Ausziehens, zielsicher ohne Schnörkel, schnell waren meine Bewegungen und mein Bemühen, sie einzuholen, wir zogen uns um die Wette aus, noch immer im Licht, ihr Körper im Schattenspiel der Bewegungen, noch war Musik um uns, eine CD mit Barockmusik, noch hing der Duft eines Räucherstäbchens in der Luft, noch mehr wollte ich von ihr und schmeckte ihre Haut, sie ließ es gewähren, bot sich an, ließ mich mehr schmecken und hören von ihr, ihr Genießen, ließ mich noch mehr von ihr sehen, sie öffnete sich, kippte ihren Duft über mir aus.
Dann irgendwann, viel später und nach dem Überfluten aller Sinne, löschte sie das Licht und flüsterte: »Nun sei nur noch du! Und lass mich ich sein!«
Wir tobten durch die Nacht, in der Schwerelosigkeit.
Am Morgen nach vielen Stunden intensiven Wachseins in abwechselnd heller und dunkler Umgebung und nach nur wenigen Stunden gemeinsamen Schlafs, der aber, wie jeder weiß, die ergiebigste Form aller Möglichkeiten ist, neue Kraft zu tanken, stand sie auf und bat mich, sie nicht zur Wohnungstür zu begleiten.
»Das ist so, als sei ich schon sehr oft hier gewesen«, sagte sie, während sie sich anzog. »Noch schöner, noch vertrauter wäre es, wenn ich jetzt in deine Küche gehen könnte, alle Schränke aufreiße, um dann den Kaffee zu machen. Aber dafür bleibt heute keine Zeit.«
»Aber ich könnte dir doch noch schnell einen Kaffee kochen.«
»Jetzt? Ich muss zum Zug. Ich habe wirklich einen Termin!«
»Nicht jetzt, aber vielleicht morgen?«
»Aber dann bei mir.«
»Wo sonst.«
Ich wollte aufstehen, aber Philomela drückte mich zurück ins Bett.
»Ich erwarte dich. Am Abend.« Sie nahm einen Stift von meinem Schreibtisch und schrieb mir eine Adresse auf den linken Unterarm. »Du befindest dich in bester Umgebung bei mir. Ich wohne in der Nähe vom Goetheplatz.« Sie küsste in meine halb geöffnete Hand hinein.
»Bis später!«
»Bis später!«
Ich verbrachte den Tag erfolgreich damit, es zu vermeiden, nicht jeden Menschen auf der Straße zu umarmen.
Um sechs fuhr ich mit dem Auto nach München und genoss den ungerechten Stau, dem ich es verdankte, eine Sendung mit Erläuterungen über Strawinskys »Feuervogel« bis zum Schluss anhören zu können. Ich war in einer so euphorischen Laune, dass ich sogar dieser mir bisher nicht zugänglichen Musik etwas abgewinnen konnte. Ich hörte auf einmal Harmonien voller Spannung und Erwartung, neu und fremdartig, mutig und mit waghalsigen Manövern jenseits aller Konvention.
Als ich im dritten Stock vor Philomelas Wohnungstür stand, öffnete sie sehr theatralisch. Sie hatte ein enges blaues Kleid an.
»Ich hätte jetzt beiläufig die Tür aufmachen und dann gleich wieder in die Küche gehen können. Das wäre dann so gewesen, als ob du schon hundert Mal hierher gekommen wärst. Ich möchte dich aber heute offiziell begrüßen. Sei willkommen! Und fühle dich wie zu Hause.«
Wir küssten uns auf der Schwelle zwischen draußen und drinnen. Als ich ihre Wohnung betrat, verließ ich meine nun schon längst vergessene Vergangenheit und betrat eine Zukunft, die ich noch immer nicht abzuschätzen vermag: eine Zukunft, die ich nur mit Hilfe einer Präposition beschreiben könnte, die eine Verschmelzung der Wörter »mit Philomela« und »ohne Philomela« zugleich sein müsste.
Philomela schloss die Tür hinter mir. Damit fing alles an.





























