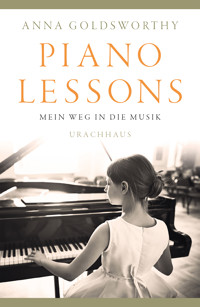
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Anna Goldsworthy ist neun Jahre alt, als die aus Russland emigrierte Klavierlehrerin Eleonora Sivan sie in den Kreis ihrer Schüler aufnimmt. Schon bald bemerkt Anna, dass Mrs. Sivan eine ganz besondere Lehrerin ist. Sie begleitet Anna im Laufe der Jahre nicht nur durch die Sternstunden und Tiefpunkte einer musikalischen Laufbahn, sondern lehrt sie auch die unendliche Weisheit, die in der Musik verborgen liegt. Offen und humorvoll beschreibt die australische Pianistin Anna Goldsworthy die Hoffnungen und Ungewissheiten ihrer eigenen Jugend, immer das Ziel vor Augen, eine große Pianistin zu werden. Piano Lessons ist ein faszinierender Beleg dafür, wie ein außergewöhnlicher Lehrer ein Leben vollkommen verändern kann. Ein Buch, das alle Musikliebhaber und jeden, der jemals eine Musikstunde gehabt hat, tief berühren wird. Piano Lessons ist eine liebevolle Huldigung an eine großartige Lehrerin und das Wunder der Musik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANNA GOLDSWORTHY
Piano Lessons
MEIN WEG IN DIE MUSIK
Aus dem Englischen von Dieter Fuchs
Inhalt
TEIL I
KAPITEL 1 Bach
KAPITEL 2 Mozart
KAPITEL 3 Schostakowitsch
KAPITEL 4 Debussy
TEIL II
KAPITEL 5 Beethoven
KAPITEL 6 Schubert
KAPITEL 7 Mozart
KAPITEL 8 Chopin
KAPITEL 9 Liszt
KAPITEL 10 Prokofjew
TEIL III
KAPITEL 11 Bach
KAPITEL 12 Rachmaninow
KAPITEL 13 Beethoven
KAPITEL 14 Schostakowitsch
KAPITEL 15 Khatschaturian
CODA
KAPITEL 16 Mozart
KAPITEL 17 Chopin
TEIL I
KAPITEL 1
Bach
Es war mein Großvater, der sie entdeckt hat. Er sprach ihren Namen mit einem extravagant französischen Akzent aus, was sie ebenso geheimnisvoll wie glamourös erscheinen ließ.
Mrs. Si-van.
Sie war erst vor Kurzem mit ihrem Mann und einem Sohn im Teenageralter nach Adelaide gekommen und gab Klavierunterricht an einer Highschool in einem westlichen Vorort der Stadt. Mein Großvater war der regionale Oberschulamtsleiter und hatte sie bei einer Routine-Inspektion kennengelernt.
»Er war richtige Gentleman, natürlich, sehr charmant«, erzählte sie mir später, »aber mit echte Autorität.« Sie zog die Augenbrauen zusammen und zeigte mit dem Finger auf mich: »Sie werden meine Enkelin unterrichten.«
Ich war neun Jahre alt und hatte Klavierunterricht bei einem Jazzpianisten aus unserer Gegend. Nach der Stunde kam er gern zu meinen Eltern in die Küche, drehte merkwürdig riechende Zigaretten und redete über Stevie Wonder. Mein Vater hatte der echten Autorität meines Großvaters jahrelang getrotzt und sah keinerlei Grund, etwas an diesem Arrangement zu ändern, bis eines Nachmittags der Jazzpianist eine Zigarette drehte und meinte, es sei an der Zeit für mich, einen Schritt weiter zu gehen.
»Sie hat das erste Klavierjahr mit ’nem A bestanden, Mann! Wo soll sie denn von da aus noch hin?«
Es war nicht länger nur die Idee meines Großvaters: Mein Vater konnte sie beruhigt aufnehmen.
»Mrs. Sivan stammt aus Russland«, erzählte er mir an diesem Abend beim Essen. »Sie ist auf der Liszt-Liste.«
»Was ist denn die List-Liste?«
»Die Liszt-Liste. Liszt unterrichtete den Lehrer der Lehrerin ihrer Lehrerin.«
»Und wer ist dieser Liszt?«
Er warf mir einen seiner typischen Blicke zu. »Ein sehr berühmter Komponist.«
Das hörte sich gut an. Wenn ich bei Mrs. Sivan Unterricht hätte, dann wäre auch ich auf der Liszt-Liste. Das passte gut zu dem großen Roman, als den ich mir mein Leben vorstellte.
Eine Woche später fuhr mein Großvater mit mir zu Mrs. Sivans Haus, wo ich vorspielen sollte. Meine Mutter saß neben ihm, im lavendelfarbenen Hosenanzug und nach Chanel duftend. Während wir die North East Road entlangfuhren, empfahl er mir, genau auf den Weg zu achten.
»Wir erreichen jetzt die Ascot Avenue, auch Portrush Road genannt. Hier biegen wir rechts ab.«
Diese Strecke sollte sich in den folgenden Jahren in meinen Körper einschreiben, denn ich fuhr sie anfangs einmal wöchentlich, dann zweimal wöchentlich, und in der Folge hin und wieder auch täglich. Jetzt war es aber so, dass mein Großvater mich genauso gut auf eine intergalaktische Reise hätte mitnehmen können, fort aus meiner Kindheit in einem Vorort von Adelaide und irgendwohin ganz weit weg.
»Womit wir das Ziel unserer Reise erreicht hätten«, verkündete er, als wir vor einem cremefarbenen Backstein-Bungalow anhielten. »Das Heim der berühmten Mrs. Eleonora Si-van, vormals tätig am Leningrader Konservatorium.«
An der Haustür gab es freundliches Nicken und Händeschütteln allerseits, wobei mein Großvater und meine Mutter viel zu laut sprachen.
»Und wie gefällt Ihnen Ihr neues Haus, Mrs. Sivan?«, fragte mein Großvater.
»Ja, uns gefällt enorm. Sehr viel gemütlicher als Pennington-Migrantenheim.«
Alle lachten, deshalb nahm ich all meinen Mut zusammen und schaute zu ihr auf. Wie soll ich sie beschreiben? Für mich ist sie weniger eine Person als vielmehr eine Naturgewalt. Die Musik ist in ihr mit einem Druck aufgestaut, der eine Artikulation erfordert, und von dem Moment an, in dem sie die Tür öffnete, redete sie ununterbrochen. Sie muss etwa um die vierzig gewesen sein, war aber nicht viel größer als ich selbst mit meinen neun Jahren und hatte die pfirsichartige, elastische Haut eines Kleinkinds. Ich begegnete ihrem energischen Blick, wurde rot und sah schnell wieder zu Boden.
»Wir unterrichten nicht Klavierspiel«, sagte sie. Ihr Englisch war noch ziemlich ungeübt, und ich war mir nicht sicher, ob ich richtig verstanden hatte. »Wir unterrichten Philosophie und Leben und Musik verdaut. Musik gehört dir. Instrument bist du. Kommen Sie herein, bitte. Kommen Sie.«
Sie ging mit uns ins Wohnzimmer und führte mich zu einem alten Klavier mit vergilbten Tasten.
»Musik ist logisch erzeugte Phantasie«, fuhr sie fort. »Wenn ich gebe Information, dann kommt diese zum Schüler zu Verdauung. Wenn Verdauung beginnt, Nahrungsaufnahme ist seine eigene – ist nicht meine.«
Ich ließ den Blick durch das Zimmer schweifen, um etwas aus der mir bekannten Welt zu entdecken und mich daran festhalten zu können. Das Klavier stand direkt an einer Wand, die in einem knallig-metallischen Pink gestrichen war. In der Mitte dieser Wand hing ein Kalender, und an den heftete ich jetzt meine Hoffnungen.
»Was ist Ergebnis von kluge, sehr kluge Herz plus eine freundliche und großzügige Gehirn?«
Ich schaute zu meiner Mutter in der Hoffnung, sie würde mir die Antwort abnehmen, aber sie wich meinem Blick aus.
»Ist kluge Hände!«, verkündete Mrs. Sivan.
»Das stimmt in der Tat«, sagte mein Großvater. »Und jetzt würden Sie sicher gern hören, wie Anna ihre Mozart-Sonate spielt.«
»Natürlich. Bitte, mach dir bequem. Denkst du immer zuerst an Musik, und nicht uns zu beeindrucken. Und nie du fängst an, bevor du nicht bist fertig. Das ist erste Künste in jeder Musik: Lernst du zu hören die Stille, atmosphärische Stille. Nur dann wir können verstehen Zukunft und Perspektive.«
»Womit soll ich anfangen?« Meine Stimme war nicht mehr als ein Piepsen.
»Wie bitte?«
Mein Vater hatte gemeint, ich solle unbedingt mit dem langsamen Satz beginnen, weil ich ihn »sehr musikalisch« spielte. »Soll ich mit dem zweiten Satz anfangen?«
Sie schien schockiert. »Immer beste, Geschichte von vorne zu erzählen, ja? Natürlich muss sein erste Satz.«
Damals empfand ich ein Klavierstück als ein Hindernisrennen für die Finger, bei dem es darum ging, möglichst unversehrt bis ans Ende zu gelangen. Der erste Satz der Mozart-Sonate war unsicheres Gelände, aber es gelang mir, ein paar Kollisionen im Durchführungsteil zu umschiffen, und schaffte es bis zum Doppelstrich.
Im Raum herrschte Stille. Ich sah zu meiner Mutter, die zu meinem Großvater sah, der wiederum zu Mrs. Sivan sah.
»Danke«, sagte sie dann. »Du magst Schokolade, ja? Komm mit und ich gebe dir herrliche Schokolade.«
Meine Mutter nickte mir aufmunternd zu, und ich folgte Mrs. Sivan hinaus in die Küche, wo sie mir eine in Silberpapier gewickelte Baci-Praline gab, dann noch eine, und daraufhin gleich noch einmal zwei. »Du bist brave Mädchen und musst jetzt Leben genießen.« Sie rief ihren etwa 15-jährigen Sohn Dimitri, damit er mir Gesellschaft leistete, und ging zurück ins Wohnzimmer, um mit meiner Mutter und meinem Großvater zu sprechen.
Ich schaute mich um, während mir das Herz bis zum Hals schlug. An den Wänden hingen gerahmte Fotos von Hunden, die Brillen und Hüte trugen.
»Wer hat diese Bilder gemacht?«, fragte ich Dimitri. Er hatte schwarze Haare und freundliche Augen.
»Mein Onkel.« Er zählte mir nacheinander auf, was für Hunde das waren.
»Kommst du aus Russland?«
»Ja.«
Zu mehr Smalltalk war ich nicht in der Lage, also aß ich schweigend meine Schokopralinen.
Schließlich kam Mrs. Sivan wieder in die Küche. »Ich dir gebe Kuss«, sagte sie. »Neunjährige Mädchen, die gibt so viel Mühe. Natürlich du musst dürfen lernen. Aber denkst du immer daran, Klänge sind emotionale Antwort und Nachdenken über Inhalte von Herz und Verstand. Musik ist nicht nur Spielen von richtige Noten in richtige Zeit, aber Verdauung ganz wichtig. Ist enorme Arbeit, aber so bereichernd, und so macht Leben lebenswert!«
Auf dem Heimweg herrschte im Auto eine geradezu festliche Atmosphäre.
»Das war großartig!«, sagte meine Mutter. »Mein kluges Mädchen.«
»Meine Liebe, man kann dir nur gratulieren, dass du einen derart guten Eindruck hinterlassen hast«, verkündete mein Großvater.
Später erklärte mir Mrs. Sivan, sie hätte Mitleid gehabt. Ein Kind, das sich derart schlecht gerüstet durch eine Mozart-Sonate kämpfte, hatte einfach verdient, dass man es unterrichtet.
»Ihr Einverständnis ist an gewisse Bedingungen geknüpft«, fuhr mein Großvater fort. »Mrs. Sivan erwartet von dir, dass du mehr übst. Zwei Stunden täglich. Aber nicht am Stück. Vierzig Minuten vor der Schule, vierzig Minuten am Nachmittag und vierzig Minuten am Abend.«
Zwei Stunden pro Tag. Das klang bedrohlich, aber auch aufregend.
Der Jazzpianist hatte mir aufgegeben, jeden Tag fünf Minuten zu spielen.
Fünf Minuten an jedem Tag der Woche? Für den Rest meines Lebens, bis ich tot war? Ich wusste nicht recht, ob ich mich auf so etwas einlassen wollte.
»Du nimmst dir täglich Zeit zum Zähneputzen«, sagte er, aber schon das war ja eine kaum erträgliche Verpflichtung. So wenig er die Einhaltung dieses Übungsplans tatsächlich einforderte, so sehr folgte er auch im Unterricht einem Laissez-fair-Ansatz, summte leise mit, was ich spielte, und kritzelte nur ab und zu etwas in meine Noten: Dynamik. Einmal sagte er, ich solle zum Erreichen hoher Noten nicht meinen Arsch von der Klavierbank heben. Arsch. Ich musste kichern.
Nur einmal verlor er die Fassung, nämlich als mein Vater ihm erzählte, ich würde Stevie Wonders »Lately« hassen. »Was hast du denn gegen ›Lately‹?«, fragte er. Seine Hippie-Augen wurden ganz groß, und sein Kopf bewegte sich ungläubig im Zeitlupenrhythmus hin und her. »Wow. Das ist so ein toller Song.«
Ich konnte nicht erklären, warum ich ›Lately‹ hasste, genauso wenig wie ich erklären konnte, warum ich Milch hasste, oder Züge, oder den Werkraum. Irgendetwas an der Chromatik des Songs störte mich, auch war mir die Art zuwider, mit der mein Vater ihn spätabends am Klavier schmetterte: Lately I’ve been havin’ the strangest feelings with no vivid reason here to find.
»Ich hasse ihn einfach. Er ist Iiiih«, sagte ich.
Mit sechs war mein erstes Lieblingsstück eine anonyme Gigue aus dem Vorbereitungsheft der Australischen Musikprüfungskommission gewesen. Am Höhepunkt erfolgte ein Abstecher in die Zwischendominante, wie ich dann später lernen sollte. Das hatte etwas Pikantes, denn das B dehnte sich hinauf in das H und behauptete sich erst danach wieder. Es war die beste Stelle dieses Musikstücks, eine Art rudimentärer Version dessen, was George Sand als die Note bleue Chopins bezeichnete. Ich spielte die beiden Takte ohne Unterlass – ich wollte sie mir geradezu in die Haut einreiben. Nach allzu vielen Wiederholungen verloren sie aber ihren Zauber, und ich musste an den Anfang des Stückes zurück, um sie wieder neu aufzuladen.
Als wir eines Sonntags bei meinen Großeltern zum Mittagessen waren, zogen sich die Männer ins Musikzimmer zurück, um ihren wöchentlichen Chopin-Wettbewerb durchzuführen. Mein Großvater begann mit einem spritzigen Walzer, dann spielte mein Vater die Polonaise, die immer mein Einschlaflied war, und schließlich übertrumpfte mein Onkel sie beide mit dem Fantaisie-Impromptu.
»Bravo!«, applaudierte mein Großvater.
»Mein oberschlaues Brüderchen!«, rief mein Vater und sprang von seinem Sitz auf. »Das jetzt gleich mal den Teppich küsst!«
Während sie miteinander rangen, schob ich mich auf den Klavierhocker und spielte in der Hoffnung, sie zu besänftigen, meine Gigue.
»Ganz reizend, Herzchen«, sagte meine Großmutter, die gerade mit dem Tee hereinkam.
»Wir müssen dringend einen besseren Lehrer für sie suchen«, erklärte mein Großvater, ohne zu merken, was da eigentlich geschah.
Als wir von meinem Vorspiel nach Hause kamen, rief ich meinen Vater in der Gemeinschaftspraxis meiner Eltern an, um ihm von meinem Erfolg zu berichten.
»Gut gemacht, Honey Pie! Was hast du gespielt?«
Ich gestand ihm, dass ich nur den ersten Satz gespielt hatte, was zu einem Schweigen am anderen Ende der Leitung führte. »Denk nur, welchen Eindruck du mit dem langsamen Satz gemacht hättest!«, brummte er schließlich.
Meine erste Unterrichtsstunde bei Mrs. Sivan war für die darauf folgende Woche angesetzt, und meinem Vater zuliebe nahm ich den zweiten Satz mit. Nun, da ich das Vorspiel bestanden hatte, fühlte ich mich viel sicherer: Das Gröbste lag ja schon hinter mir. Ich stellte die Noten aufs Klavier und platzierte meine Hände über einem G-Dur-Akkord.
»Das nicht!«, rief sie. »Halt!«
»Ich habe doch noch gar nicht angefangen.«
»Natürlich Musik hat schon angefangen!« Sie beugte sich zu mir und nahm meine Hand. »Die Finger sind die Orchestermusiker. Der Ellbogen muss hier sein, damit kann dirigieren. Müssen wir hören Klang vorher, und sofort wir entspannen uns.«
Sie spielte für mich eine chromatische Tonleiter, und dabei hatte ihre Hand die Anmut eines kleinen Tieres.
»Aber ich bin entspannt«, gab ich zurück und machte es ihr nach, wobei mein kleiner Finger steil nach oben stand, wie eine verräterische, aufmüpfige Erektion.
»Das nicht. Du spielst. Aber du hörst nicht.«
Das war etwas, das sie noch jahrelang wiederholte, bevor ich es irgendwann verstand. Nur wenn man einen Klang zuerst in der Vorstellung hört, entspannt man sich. Und nur die Entspannung ermöglicht, dass man den Klang auch richtig hört, ihn bewusst wahrnimmt und als einen Klang in zeitlichem Zusammenhang versteht, im Kontext einer Vergangenheit und einer Zukunft.
»Das nicht. Nicht so. Das ist Spaghetti-Finger.«
Beim Spielen glitt ich über die Oberfläche der Tastatur, aber dann nahm sie meine Finger und machte sie mit dem Grund der Tasten bekannt, sodass ich die Sicherheit der Schwerkraft spürte, den Kontakt mit der Erde.
»Hier, da spürst du den Grund.«
Nach und nach lernte ich, dort zu leben und diesen sicheren Boden von einem Ton auf den nächsten zu übertragen, ohne etwas davon zu verlieren.
»Du musst starke Finger haben!« Sie grub ihre Fingerspitzen in meinen Oberarm, dass ich fast vom Stuhl fiel. »Mein Herzchen, tut mir leid! Vergesse ich, wie stark ich bin.« Sie lachte. »Denkst du immer, müssen sprechen deine Hände. Deine Hand und Instrument sind eine, nicht zwei, und deine Musik ist in dir drin.«
Irgendwie gelang es ihr in den folgenden Jahren, ein körperliches Wissen von ihren Händen auf meine zu übertragen. Man formt seine Hände nicht bewusst zu Klängen, ebenso wenig, wie man seinen Mund formt, um ein Wort zu bilden. Man berührt das Instrument und spricht.
»Jede Note ist wichtig«, sagte sie. »Jeder Ton sagt etwas.«
Unsicher betrachtete ich die Noten und überlegte, was wohl dieses Fis sagte oder was jene Verzierung bedeuten könnte.
»Jedes Stück erzählt Geschichte«, schloss sie. »Nächste Woche ich will, dass du erzählst mir Geschichte von diese zweite Satz.«
Daheim legte ich die Mozart-Noten auf den Küchentisch, starrte verzweifelt den zweiten Satz an und wartete darauf, dass er endlich anfing, mit mir zu reden.
»Was für eine Geschichte?«, fragte meine Mutter, während sie eine Gemüsepfanne vorbereitete.
»Du bist doch gut mit Geschichten. Warum erfindest du nicht einfach eine?«
»Aber was für eine?«, fragte ich.
Sie hörte auf, ihr Gemüse zu schneiden, und kam zu mir, um einen Blick in die Noten zu werfen. »Keine Ahnung. Ein kleines Mädchen geht in den Zoo, etwas in der Art.«
Also erfand ich eine Geschichte und ordnete sie dem zweiten Satz der Sonate zu. Hier kauft ein kleines Mädchen Zuckerwatte, hier setzt es sich in die Rotunde, bei der Reprise begegnet es einem Nashorn.
Welche Vorstellung hatte ich damals von der Musik, als ich noch nichts von ihr wusste – als sie noch eine Sprache war, die ich nicht beherrschte? Eigentlich träumte ich davon, Sängerin zu werden, und verbrachte meine Freizeit damit, im Arbeitszimmer »You Light up my Life« zu singen und zwischen den Strophen dramatisch herumzuwirbeln, während mein Vater mich am Klavier begleitete. An meiner Grundschule gab es ein Mädchen, Erica, mit einer sehr schönen Stimme. Wie herrlich, wenn man so gut singen konnte! Das war noch besser, als übernatürliche Kräfte zu haben! In meiner Phantasie sah ich Erica und mich gemeinsam mit Tiny Tina und Little Joey aus der Fernsehshow Young Talent Time, wie wir weiß gekleidet auf einer rotierenden Bühne unter einer Discokugel sangen. Wir sahen aus wie Engel, und manchmal waren wir sogar welche.
Beim Liederabend in der Schule sang Erica »The little Drummer Boy«. »Denkst du, ich werde auch einmal so singen können?«, fragte ich meine Mutter auf dem Heimweg mit gespielter Bescheidenheit.
Sie dachte nach. »Nein, mein Schatz, das glaube ich nicht.«
Den Rest der Fahrt schwieg ich völlig schockiert. Das hatte ich nicht von ihr hören wollen.
Ein paar Wochen später probierte ich es noch einmal. »Glaubt ihr, dass ich auch einmal bei Young Talent Time auftreten kann?«, fragte ich meine Eltern, die gerade die Abendnachrichten anschauten. Wenn ich sie überraschte, würde ich vielleicht die von mir gewünschte Antwort erhalten.
Sie sahen sich nachdenklich an.
»Vielleicht wenn du richtig viel Klavier übst«, sagte mein Vater schließlich.
Mein Bruder und ich hatten eine Babysitterin, die behauptete, die Mondschein-Sonate spielen zu können. In ihrer Version transponierte sie den ersten Satz nach e-moll, ließ die linke Hand und die Sopranstimme weg und verzichtete außerdem auf jede harmonische Fortschreitung, bis nichts mehr übrig war außer einem gebrochenen e-moll-Akkord in der zweiten Umkehrung, der endlos wiederholt wurde.
»Willst du die Mondschein-Sonate hören?«, fragte ich unsere Besucher in Vorbereitung auf Young Talent Time. Ich spielte diesen gebrochenen Akkord immer wieder, immer schneller, bis meine Hand sich vor lauter Anstrengung verkrampfte. H–E–G, H–E–G, H-E-G, HEG, HEGHEGHEGHEG.
»Die Mondschein-Sonate ist pipi-einfach«, sagte ich treuherzig. »Sie besteht nur aus H, E, G.«
Das war mein Basiswissen. Damit ging ich zu meinen ersten Stunden bei Mrs. Sivan. Am Leningrader Konservatorium hatte sie ihre Schüler auf internationale Wettbewerbe vorbereitet, und bevor sie nach Adelaide kam, hatte sie noch nie Kinder unterrichtet. Bei unserer zweiten Stunde erzählte ich ihr meine Geschichte vom Zoo.
»Hier sieht das kleine Mädchen einen Schimpansen«, sagte ich und zeigte auf eine chromatische Verzierung. Meine Stimme versagte. Nicht einmal ich glaubte das.
Sie nahm meine Hand: »Mein Herzchen, wir müssen hinsetzen und arbeiten.«
Nach den ersten paar Stunden tauschten meine Eltern ihre Schichten in der gemeinsamen Arztpraxis, damit mein Vater mich zu Mrs. Sivan bringen konnte. In den nächsten acht Jahren begleitete er mich jeden einzelnen Dienstagnachmittag zum Klavierunterricht, hörte zu, träumte vor sich hin, machte sich Notizen. Mrs. Sivan war die geborene Darstellerin und genoss seine Anwesenheit. Jetzt, wo ich selbst unterrichte, spüre ich das auch: diese zusätzliche Spannung, die ein Publikum im Raum erzeugt.
»Lass uns über die Finger reden«, sagte Mrs. Sivan. »Dieser hier, der Zeigefinger, ist gute Schüler. Dieser, der Mittelfinger, ist sehr – wie sagt man? – zuverlässig. Aber der hier … oi!« Sie schüttelte den Kopf. »Ringfinger ist sehr faul!«
Ihre Worte waren zwar bildhaft, für mich aber dennoch vollkommen abstrakt. Im Lauf der Jahre übernahm es dann mein Körper, sie zu verstehen.
»Es ist der Daumen, der einen Pianisten macht«, sagte sie und zeigte mir, was der Daumen kann, indem ihre Hände über die Tastatur wirbelten, sie durchkneteten und Klänge von beeindruckender Intensität erzeugten.
Mit der Zeit lernte ich, dass der Daumen der Schlüssel zur Entspannung der Hand ist, ihr Kontrollpunkt, Steuermann und Dirigent. Ein menschlicher Instinkt ist, mit dem Daumen zu greifen, wodurch er aber zur Bremse wird. Pianistische Flüssigkeit entsteht erst, wenn man es schafft, loszulassen, der Hand zu vertrauen.
Dann nahm sie meinen kleinen Finger in die Hand: »Es ist der kleine Finger, der einen Künstler macht.« Sie winkte mir mit ihrem kleinen Finger zu und zeigte mir so seine Unabhängigkeit. »Wie wenn man winkt eine Freund: Auf Wiedersehen.« Ich machte die Bewegung nach und winkte zurück, aber am Klavier setzte ich meinen kleinen Finger nach wie vor als ungefähre Grenze der Hand ein. Ich brauchte zehn Jahre, um seine Möglichkeiten zu begreifen: die kleinen Leuchtkörper, die er an die Spitze einer Melodie setzt, seine Schlittenglöckchen, seine Koloratur, seine Fundamente und Aufforderungen in der linken Hand.
Als Erstes beschäftigten wir uns mit Bachs kleinen Präludien.
»Bach ist Grunde genommen Vater von ganze Musik«, erklärte sie mir. »Er hat gewaltigen Einfluss auf jedermann. Er war Erzieher von Chopin, von Beethoven, von Schumann. Und sogar ganze moderne Jazz bereits hier. Versuchst du, was du möchtest, und Bach hat bereits gemacht. Natürlich hat Bach nie gekannt Klavier.«
»Warum nicht?«
»Klavier noch nicht erfunden.«
Ich schaute ungläubig zu meinem Vater, der jedoch zustimmend nickte.
»Aber Klavier absolute Instrument von Vorstellung, und hier wir können alles erzeugen. Diese zum Beispiel ganz klar Orgel.« Sie spielte eines der Präludien an. »Denkst du immer, dass Bach repräsentiert Gott in diese Welt, mit seiner Weisheit, seiner Akzeptanz, seiner Vergebung. Wie wenn immer dich segnet.«
»Dieses Präludium kann ich schon«, erklärte ich ihr, denn nach meiner damaligen Vorstellung war es möglich, ein Stück zu vollenden. »Ich habe es mit meinem alten Lehrer abgeschlossen.«
»Bach ist niemals abgeschlossen. Leben in diese Musik ist endlos.« Sie nahm meinen Finger und tauchte damit in die Taste. Er sank zu Boden mit dem exakten Gewicht eines Kugellagers. »Und hier sehr wie Cembalo-Klang. Was gibt Bach? Friede, natürlich, und Glocken.«
Die Ebenmäßigkeit, die sie verlangte, lag weit jenseits der körperlichen Fähigkeiten eines faulen Ringfingers oder aufmerksamkeitsheischenden Daumens. Es war eine Ebenmäßigkeit des Denkens, eine spirituelle Disziplin. »Wir spielen mit unseren Ohren«, erinnerte sie mich. »Sehende Ohren, hörende Augen. Kluges Herz, warmes Gehirn.«
Meine Hände, gebräunt von der australischen Sonne, trippelten neben den ihrigen über die Tastatur, rosa und rund wie Seesterne.
»Das nicht«, sagte sie, als ich einen Klang erraten wollte, nahm meine Hand und führte meine Finger zum richtigen Anschlag. Oft registrierte ich nicht einmal, wie unterschiedlich sie die Töne jeweils anschnitt. Ich war so unsensibel für die verschiedenen Nuancen wie ein Mensch, der eine fremde Sprache spricht. Für mich waren die Tasten des Klaviers immer noch Ein/Aus-Schalter, die entweder laut, leise oder irgendetwas dazwischen gespielt werden konnten.
Zu Hause übte ich längst keine zwei Stunden täglich, auch wenn ich das oft behauptete. Als wir einmal mit unseren Nachbarn einen Campingausflug machten, berichtete ich am Lagerfeuer ausführlich über mein Leben als junge Konzertpianistin. Auf der Heimfahrt am nächsten Tag waren mein Bruder und mein kleines Schwesterchen dann neben mir eingenickt. Ich schloss die Augen und tat, als würde ich ebenfalls schlafen, um hören zu können, was meine Eltern vorne sotto voce redeten.
»Lizzie findet, wir überfordern Anna«, sagte meine Mutter. »Dass ihr die Kindheit genommen wird.«
»Das ist doch Unsinn«, erwiderte mein Vater. »Hast du ihr gesagt, wie viel Spaß ihr das Klavierspielen macht?«
»Ich habe ihr von den kleinen Geschichten erzählt, die sie zu ihren Stücken erfindet. Aber Lizzie meint, das würde nur unterstreichen, was sie vermutet. Dass sie damit die Kindheit erzeugt, die sie verpasst. Sie sagt, etwas derartig Tragisches sei ihr noch nie untergekommen.«
Ich lag auf dem Rücksitz und versuchte, mir das zu merken. Tragisch. Ich. Verpasste Kindheit. Das Melodramatische an all dem gefiel mir. Eine Träne exquisiten Selbstmitleids formte sich in meinem Auge und lief dann meine Wange hinunter. Ich ließ sie auf der Haut trocknen. Würde ich sie abwischen, dann wäre das ein Zeichen, dass ich gelauscht hatte.
In Wahrheit zwangen sie mich so gut wie nie zum Klavierspielen. »Übung macht den Meister«, sagte meine Mutter nur gelegentlich. Ich wusste nicht, ob ich ihr wirklich glauben sollte, aber ich nahm es vorerst einmal an, wie so vieles in der Kindheit. Manchmal saß mein Vater neben mir, wenn ich übte, manchmal hinter mir an seinem Schreibtisch und verfasste Gedichte.
Meist machte mir das Klavierspielen Spaß. Ich war ein motorisch unkoordiniertes Kind, und das Erlernen eines Instruments ermöglichte mir den Erwerb von mehr körperlicher Beherrschung: Es war ein kleiner Bereich, in dem Meisterschaft möglich war. Abend für Abend nahmen meine Eltern mich mit in den Garten, um durch Ballspiele an der Koordination zu arbeiten.
»Die Hände nach oben«, kommandierte meine Mutter, und mein Vater warf vorsichtig einen Fußball in meine Richtung. Das Ding näherte sich mit der Präzision einer Wärmesuchrakete, während die schwarzen und weißen Sechsecke auf mein Gesicht zuwirbelten.
»Und jetzt fangen!«, riefen sie unisono.
Im entscheidenden Moment verlor ich jedes Mal die Nerven.
»Du wirst ihn nie fangen, wenn du ihn nicht ansiehst«, sagte meine Mutter noch, bevor sie ins Haus rannte, um ein Handtuch zu holen. Ich wartete, bis das Nasenbluten vorbei war, dann setzte ich mich wieder ans Klavier.
Es kam aber durchaus auch vor, dass ich keine Lust hatte, dann erinnerte ich mich an Lizzies Worte. Eines Samstagvormittags trommelte ich die Kinder aus der Nachbarschaft für ein neues Geschäftsmodell zusammen. Wir durchsuchten die nachbarliche Einfahrt nach Steinchen von besonderer Schönheit und Form, bemalten sie mit Wasserfarben – als Saphire, Amethyste, Rubine oder Smaragde – und boten sie den Leuten, die zufällig vorbeigingen, als »wertvolle Edelsteine« zum Kauf an. Noch vor dem Mittagessen hatten wir vier Säckchen verkauft, eins davon sogar an einen Fremden, und insgesamt zwölf Cent Gewinn gemacht, da musste ich hinein und Bach üben. Mein Vater saß hinter mir im Arbeitszimmer und tippte eine Kurzgeschichte, hinter ihm wiederum umrahmten drei Fenster einen samstäglichen Himmel. Einen Himmel, der blau vor lauter Möglichkeiten war – einen Himmel, der meine verpasste Kindheit enthielt.
Ich knallte den Klavierdeckel zu: »Ich hasse Bach.« Die Worte fühlten sich blasphemisch an im Mund. Ich wusste sofort, dass dies eine viel größere Sünde war, als Stevie Wonder abzulehnen.
In der Stunde am folgenden Dienstag sah mein Vater mich sorgenvoll an und wandte sich dann Mrs. Sivan zu.
»Anna hat gesagt, sie hasst Bach.«
»Das habe ich nicht!«
Mrs. Sivan blieb ganz ruhig. »Natürlich du hast nicht. Ist unmöglich. Bach entscheidet selbst, wen er mag und wen nicht.«
Später im Jahr sollte es ein Konzert in der Elder Hall der Universität von Adelaide geben.
»Der Abend hat exzellente Titel«, sagte Mrs. Sivan. Sie sammelte neue Ausdrücke wie kleine Münzen, und ihr Vorrat übertraf mittlerweile sogar meinen. »Ein Spektrum der Klaviermusik.«
»Das ist in der Tat ein exzellenter Titel«, sagte mein Vater.
»Ihnen gefällt, ja?« Sie errötete leicht und drehte sich zu mir. »Bühne muss sein wie zusätzliche Zimmer in deinem Haus. Wenn du gehst hinaus, du lächelst für deine Freunde, du verbeugst, du freust zu teilen deine Musik. Du fühlst wie Fisch.«
»Ein Fisch im Wasser?«
»Natürlich.«
Mit neun Jahren hielt ich mich für einen alten Hasen in der Unterhaltungsbranche, schließlich hatte ich im Singspiel der dritten Klasse die Hauptrolle der Feenkönigin übernommen. Meine Mutter hatte mir meine erste Diven-Robe genäht, mit seidenem, paillettenbesetztem Oberteil und einem Tüllröckchen. Ausgerüstet mit einem glitzernden Pappzauberstab, hatte ich die Bühne betreten und mich sofort wie zu Hause gefühlt. Am Abend der Aufführung, als ich Mrs. Vaughan am Klavier einen Blumenstrauß überreichte, hatte ein Lächeln von meinem Gesicht Besitz ergriffen und gedroht, sich auf den gesamten Kopf auszudehnen.
Ein Spektrum der Klaviermusik versprach ähnlichen Erfolg. Das Konzert sollte am 18. September stattfinden, und alle anderen Tage des Kalenders existierten ab jetzt nurmehr in Beziehung zu diesem. Im Unterricht bewegten wir uns durch die kleinen Präludien über das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach bis hin zu den Inventionen und Sinfonien. Mrs. Sivan führte mich wiederholt durch jeden der Teile, besprach mit mir die Intention jeder einzelnen Note, die Anziehung, die sie mit ihren Nachbarn verband. Es war nicht genug, dass ich jeden Teil spielte, ihn in meinen Händen spürte: Ich musste ihn im Kopf singen, seinen Konturen folgen, seine Geschichte erzählen. Wenn ich die Teile dann zusammenfügte, konnte ich wie durch ein Wunder alles auf einmal hören. Es war, als hätte ich drei Köpfe oder drei Paar Ohren, die parallel arbeiteten.
Als das zum ersten Mal passierte, drehte ich mich verblüfft zu ihr. Mein Bewusstsein hatte sich erweitert. Ich spürte, wie Luft in die unbenutzten Winkel meines Gehirns eindrang.
»Ganz genau!«, sagte sie. »Ansonsten würde sein furchtbar!«
Je näher das Konzert rückte, desto länger wurde der Unterricht. Nach einer Stunde in den Ferien ging ich zum Haus meiner Freundin Sophia, bei der eine Übernachtung geplant war.
»Wo bleibst du denn so lange?«, fragte sie. »Wir wollten doch Thriller sehen!«
»Meine erste Doppelstunde«, erklärte ich wichtigtuerisch.
In den Stunden saß Mrs. Sivan immer neben mir, nahm meine Hand und korrigierte sie, indem sie meine Finger in die richtige Haltung brachte. Oder sie spielte zwei Oktaven höher mit mir mit, wobei die Intensität ihrer Töne meine Ohren klingeln ließ: »Weißt du, wie klein ist Unterschied? Aber gewaltig, gewaltig. Das wir nennen Wissenschaft in Künste. Je mehr du verstehst jede kleine Ding, je mehr du verstehst Gesamte.«
Während ich spielte, redete sie oder sang zur Musik. Manchmal sagte sie, ich solle zur Seite rutschen, und spielte dann für mich, aber das war die Ausnahme. »Ich will nicht, dass du kopierst, wie Affe.«
Sie erklärte mir den Quintenzirkel, setzte eine Quinte auf die andere, immer heller werdend, bis wir wieder in der Tonart angekommen waren, mit der wir begonnen hatten. Ich saß da und konnte es nicht fassen: Das war genauso unmöglich wie eine Grafik von Escher. Aus diesem Labyrinth rettete sie uns durch Quarten, und wir bewegten uns rückwärts über Ges-Dur und Ces-Dur mit ihren endlosen B-Vorzeichen bis hin zum Tageslicht von C-Dur. Diese mathematische Logik begeisterte mich.
»Hast du verstanden?«, fragte sie.
»Ja«, antwortete ich.
Strahlend wandte sie sich zu meinem Vater. »Noch nie habe getroffen so intelligente neunjährige Kind, das kann verstehen bei erste Erklärung Quintenzirkel.«
In solchen Momenten verließ ich den Unterricht groß wie ein Riese, völlig unangreifbar. An anderen Tagen fühlte ich mich kleiner. Wenn ich müde wurde, unterbrach sie mich und redete streng mit mir.
»Was wir brauchen, ist unsere Geist zu nähren, ständig. Und zu nähren uns mit Essen von andere Leute, ist keine gute Ernährung für unsere Seele. Muss verdauen. Siehst du manchmal, wie Leute älter werden und entsteht Weisheit innen. Ist Anfang von was ich nenne verdaute Weisheit.«
In der ersten Zeit verwirrten mich diese Erklärungen, weshalb ich mit gesenktem Blick dasaß und versuchte, mich so unsichtbar wie möglich zu machen. Wenn die Gewalt ihrer Rede dann bei einem Fragezeichen zum Halten kam, wagte ich ein vorsichtiges Ja oder Nein, nachdem ich zuvor versucht hatte, in ihrer Miene die richtige Antwort zu lesen.
»Du bist viel zu intelligente Mädchen, um zu raten«, ermahnte sie mich einmal. »Was kommt nach Übersetzung? Interpretation. Zuerst du musst übersetzen Wünsche von Komponist ganz genau, aber dann du bist frei zu machen Interpretation, sonst du bist automatisch eingeschränkt.«
Als sie das sagte, sah ich kurz auf die Uhr. Bald würde ich wieder mit meinem Vater im Auto sitzen und die dunklen Straßen entlang nach Hause fahren, wo meine Mutter schon das Abendessen vorbereitete. Dann konnte ich es mir vor dem Fernseher bei Vorabend-Sitcoms gemütlich machen, und erst sieben Tage später hätte ich dann meine nächste Stunde.
Die Generalprobe für Ein Spektrum der Klaviermusik fand an einem sonnigen Frühlingsnachmittag statt, doch es war ziemlich düster in dem imposanten Konzertsaal mit seinen Sitzen aus dunklem Holz und rotem Plüsch. Mrs. Sivans Schüler von der Highschool waren im ganzen Auditorium verteilt und strahlten eine halbwüchsige Coolness aus. Ich kam an der Hand meiner Mutter herein und bereute auf der Stelle meine knallrosa Latzhose.
Als ich an der Reihe war, stieg ich auf die Bühne, grinste in Richtung meiner frenetisch applaudierenden Mutter und begann mit einer Bach-Sinfonia. Ich hatte den Anfang mit Mrs. Sivan geübt, bis mir die Glöckchen ihres moto perpetuo schließlich in Fleisch und Blut übergegangen waren und mein Gehör sich so geweitet hatte, dass Platz genug für die drei Stimmen war. Aber als ich mich der zweiten Zeile näherte, machte sich eine Sorge breit: Was tut die linke Hand als Nächstes? Stell dir vor, du hast einen Aussetzer vor all diesen Jugendlichen aus der Highschool! Die einzelnen Teile verloren ihre erkennbare Form, und die drei Dimensionen zogen sich wieder zu einer einzigen zusammen.
»Du musst hören!«, verkündete Mrs. Sivan aus dem Zuschauerraum.
Ich brach ab und fing noch einmal von vorne an.
»Das nicht!« Sie rief mir etwas zu, das ich aber nicht verstehen konnte, deshalb spielte ich weiter.
»Niemals nur spielen, sondern hören innen!«, rief sie gellend, aber da meine Großeltern beim sonntäglichen Mittagessen gesagt hatten, ich hätte die Sinfonia hervorragend gespielt, fuhr ich einfach fort.
»Wir werden arbeiten!«, rief sie und kam vom Zuschauerraum auf die Bühne.
Als sie anfing, mit mir wieder über den Grund zu sprechen oder über das Nicht-Sitzenbleiben oder über Atempausen oder über alles andere, was ich falsch machte, fühlte ich mich vollkommen überfordert und fing an zu weinen.
»Mein Herzchen, was ist das?« Sie legte den Arm um meine Schultern. »Immer kann sein besser, immer gibt Wachsen. Musst du nicht weinen, außer sind gute Tränen, wenn du bist so gerührt von Musik.«
Gegen meinen Willen flossen meine schlechten Tränen weiter. Ich schämte mich so, vor all diesen Jugendlichen weinen zu müssen, dass ich anfing, wie ein Schlosshund zu heulen. Meine Mutter kam auf die Bühne.
»Ich denke, ich gehe mit ihr ein wenig an die frische Luft.«
»Natürlich«, sagte Mrs. Sivan. »Genießen Sie herrliche Tag, und dann wir machen weiter.«
Meine Mutter nahm mich an der Hand und ging mit mir durch den Zuschauerraum, vorbei an den glotzenden Jugendlichen und hinaus in den Frühlingstag.
»Ich verstehe das nicht«, jammerte ich, nachdem mein peinliches Geheimnis jetzt öffentlich war.
Sie drückte mich an sich und wiegte mich hin und her. »Sei doch kein Hasenhase«, sagte sie, während die Nachmittagssonne auf uns herunterbrannte, meine rosa Latzhose mich im Schritt beengte und die Welt der ahnungslosen Erwachsenen sich unverändert weiterdrehte, als wäre gar nichts passiert.
Als wir wieder in den Saal kamen, legte Mrs. Sivan den Arm um mich, führte mich zurück auf die Bühne und holte sich einen Stuhl, damit wir arbeiten konnten.
»Mein Herzchen, Leben in Musik immer lernen, immer wachsen. Was ist Unterschied zwischen gute und großartige Musiker?«
Mittlerweile wusste ich die Antwort, auch wenn ich sie noch nicht verstand.
»Kleinigkeiten«, sagte ich.
»Ganz genau!«, erwiderte sie freudig. »Kleine bisschen mehr hören, kleine bisschen mehr Freiheit.«
Sie musste mir alles erklären. Sie musste dieses alternative Universum für mich einrichten, Wort für Wort, Klang für Klang. Es reicht nie, einem Schüler etwas einmal zu erklären: Unterrichten ist ständiges Wiederholen, ständiges Korrigieren. Sie wiederholte ihre Lektionen und Anekdoten so, wie ein Musiker sein Repertoire wiederholt: jedes Mal neu interpretiert und auf diese Art neu gemacht.
Auf der Bühne der Elder Hall führte sie mich erneut durch die Atempausen und führenden Linien dieser Sinfonia. Ich spielte mit schwerfälliger Interpunktion und markierte jeden musikalischen Satz am Ende mit einem fetten Punkt. »Bleib nicht sitzen«, ermahnte sie mich. »Bach hält nie an.« Bei Bach bedeutet jedes Ende gleichzeitig einen neuen Anfang – erst mit der Zeit verstand ich die Ruhe, von der dieses moto perpetuo im Grunde erfüllt ist.
In den ersten Jahren behielt sie manches für sich, auch wenn sie mir so viel zumutete, wie ich vertrug – und noch ein bisschen mehr. Nach und nach lernte ich ihre Überzeugungen auswendig. Als ich sie irgendwann richtig verstand, waren sie Teil meines Körpers geworden, und ich konnte nicht mehr sagen, wo ihre Überzeugungen anfingen und meine aufhörten.
»Das ist gut«, sagte sie später zu mir. »Es bedeutet, dass dieses Wissen ist zu dir gekommen. Es ist Intuition.« Sie lächelte angesichts dieses nagelneuen Begriffs. »Intuition ist Eingabe. Ein-gabe. Also Gabe, die ist gekommen hinein.«
Beim Konzert am Freitagabend standen im Warmspielraum drei Stühle nebeneinander. Eine von Mrs. Sivans erwachsenen Schülerinnen, Debra Andreacchio, betreute die Aufführenden hinter der Bühne und ließ uns von einem Stuhl zum nächsten rücken, immer näher in Richtung der Bühne. Als ich auf dem dritten Stuhl saß, überlegte ich, wie es sein würde, auf dem ersten zu sitzen, dann saß ich auf einmal darauf, und plötzlich war ich auf der Bühne und zwang mich, für meine Freunde zu lächeln, mich zu verbeugen und mich über das Teilen meiner Musik zu freuen – und dann war auch schon alles vorbei. Es war leichter als die Probe gewesen, und niemand hatte mich unterbrochen. Durch das transformative Ritual eines Auftritts war die Elder Hall zu einem warmen, einem Ort des Siegs geworden.
In der Pause zog Mrs. Sivan mich in eine wohlriechende Umarmung, dann setzte ich mich zu meinen Eltern und Großeltern, um die zweite Hälfte anzuhören. Als der letzte Vorspiel-Kandidat von der Bühne ging, beugte sich mein Großvater nach vorne.
»Es kommt mir fast so vor, als hätte niemand eine Rede vorbereitet«, konstatierte er und ging mit energischen Schritten Richtung Bühne.
»Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einer Inspektion des Musikschwerpunkts an der Woodville Highschool hatte ich das große Glück, Zeuge von Mrs. Sivans erstaunlichen Unterrichtsmethoden zu werden, und kam schlagartig zu der Überzeugung, dass sie eine außerordentliche Klavierlehrerin sein musste. Nach den herrlichen Vorführungen des heutigen Abends habe ich das Gefühl, dass mein damaliger erster Eindruck wahrhaftig nicht unberechtigt war.«
Mein Vater zwinkerte meiner Mutter zu. Mein eigener Triumph brannte in meinem Inneren still vor sich hin. Der Rhythmus meines Erwachsenenlebens hatte eingesetzt.
KAPITEL 2
Mozart
Im nächsten Monat absolvierte ich das Abschlussvorspiel für Klasse drei im Haus von Mrs. Sivan. Die Prüferin, Miss Stokes, unterrichtete eigentlich am Konservatorium. »Sehr gute Prüfer, wirklich«, erklärte mir Mrs. Sivan. »Gewissenhaft, respektvoll und anständig.«





























