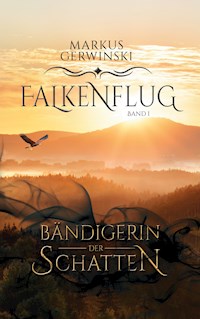Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Sagittarius-Krieg
- Sprache: Deutsch
Mit den Erkenntnissen der Mission auf Magellan setzt Commodore Normand Kurs auf ein neues Ziel: die Befreiung von Regimegegnern des Supremats, die in einer Sträflingskolonie auf einem wahren Höllenplaneten vegetieren. Gerade rechtzeitig bricht das Unionsgeschwader auf, um eine überlegene Streitmacht des Supremats abzuschütteln, die ihm bereits dicht auf den Fersen war. Doch neue Gefahr droht dem Geschwader von innen. Der Suprematin Loralys ist es trotz ihrer Kriegsgefangenschaft gelungen, von Magellan eine Verbündete mitzunehmen: Awakeena, eine Jugendliche, die unerschütterlich an sie als Göttin glaubt ... und die sich, im Gegensatz zu Loralys, frei an Bord der 'Wahrhaftigkeit' bewegen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 915
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Silke, die vom Weltraum genauso fasziniert ist wie ich
MAGELLAN-FELDZUG– Milit. Operation während des Sagittarius Kriegs. durchgeführt vom 11. Geschwader der Unionsflotte unter dem Kommando von Normand (zu diesem Zeitpunkt im Rang eines Commodore). Unter Historikern gilt es als Konsens, als Beginn des M.F. die Schlacht bei Drake 4 zu betrachten, auch wenn dieser bereits mehrere Operationen des Geschwaders bei gleicher Zusammensetzung und Kommandostruktur vorangegangen waren. [...]
Namengebend für den M.F. war der Vorstoß gegen das Magellan-System, seinerzeit eine wirtschaftlich bedeutende Kolonie des Supremats. An Einzeloperationen in dieser Phase hervorzuheben sind die Schlacht bei Isabella sowie eine Kommandomission auf Magellan selbst (vgl. Mandrin-Jannigan-Mission). [...]
Nach diesen Ereignissen im Magellan-System trat der M.F. in eine neue Phase. Maßgeblichen Einfluss auf die Stoßrichtung des Feldzugs über Magellan hinaus erlangte Awakandra d. Awanandi, ursprünglich aus ihrer Stellung als Erwählte heraus (vgl. Supremat, kultische Hierarchie) [...]
- klerikale Enzyklopädie der Kurflotte
Inhaltsverzeichnis
Über das Buch
Teil I Neuausrichtung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Teil II Schattenflug
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Teil III Raumgefecht
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Teil IV Bodenoffensive
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Worterklärungen
Weitere Informationen
Teil I Neuausrichtung
1
Sie fühlte sich wie im Traum; und sie vermochte selbst nicht zu sagen, ob es ein Wunschtraum war oder ein Albtraum.
Es kam Awakandra unwirklich vor, dass sie jetzt tatsächlich in einer der Himmelsbarken saß wie jene, in denen auch ihre falschen Götter zur Welt herabzusteigen pflegten. Als das Summen eingesetzt hatte, das sie ihr Leben lang immer nur gehört hatte, wenn eins dieser Gefährte im Tempel niedergegangen war, hatte sich ein Teil von ihr geweigert, daran zu glauben, dass sie jetzt wahrhaftig zu der Reise aufbrach, die sie seit so vielen Kalenden hatte antreten wollen.
Und dieser Teil von ihr zweifelte selbst jetzt noch, da bleierne Schwere sie in den gepolsterten Sitz drückte und die Welt, in der sie ihr ganzes Leben verbracht hatte, vor ihren Augen eine wundersame Wandlung durchmachte. Hinter dem Fenster zu ihrer Rechten waren Wälder und Ebenen, Flüsse und Berge zu einem vielfarbigen Muster zusammengeschrumpft, feiner gezeichnet, als es je ein Maler hätte vollbringen können. Der Horizont hatte sich im gleichen Maße nach unten weggekrümmt, in dem der Himmel von Abendrot zu dunklem Purpur verblasst war und schließlich zu jenem vor Sternen funkelnden Schwarz, von dem ihr Geliebter ihr erzählt hatte.
Nun war ihre Welt eine Kugel, so tief unter ihr, dass sie fast die Stirn an die Fensterscheibe legen musste, um noch einen Blick auf ihren Rand zu erhaschen. Es war wirklich alles genau so, wie ihr Geliebter es dem ehrfürchtigen, jungen Ding erzählt hatte, das sie gewesen war – doch darüber hinaus von einer Schönheit, die Worte nicht hatten erfassen können. Über grau-grünes Land und pfirsichgoldene Ozeane zogen sich Wolkenwirbel wie weiße Pinselstriche. Diese Pracht wiederum schwamm in einem Sternenmeer, das die klarsten Nächte beschämte, die sie je erlebt hatte.
Und das alles war echt, bekräftigte sie sich innerlich. Nach all den Kalenden war sie endlich zu dieser unglaublichen Reise aufgebrochen, um ihren Geliebten aus den Kerkern derer zu befreien, die sich als Götter ausgaben.
Es war wie im Traum.
Und dass sie ihre Tochter nie wiedersehen würde, war ein Albtraum.
Ein Stöhnen zu ihrer Linken rief ihre Gedanken in die Gegenwart zurück. Auf der Liege, zu der sie den Sitz an der gegenüberliegenden Wand ausgeklappt hatten, regte sich Hensley. Die untersetzte Fremde mit den vereinzelten silbernen Strähnen im schwarzen Haar war bewusstlos gewesen, seitdem Garanau und Unjadie – oder vielmehr Jadie, wie sie inzwischen ihren richtigen Namen offenbart hatte – sie zum Lagerplatz geschleppt hatten. Jadie hatte auch den größten Teil der Nacht bei ihr gewacht und ihr gelegentlich mit einer seltsamen Vorrichtung, die sie einen ,Injektor' genannt hatte, Arznei verabreicht.
Und auch jetzt war es Jadie, die sofort an Hensleys Seite sprang. Hinter sich hörte Awakandra die Schließen dieser eigentümlichen Sitzgurte klicken und im nächsten Moment war die junge, rothaarige Fremde neben der Liege ihrer älteren Gefährtin auf ein Knie niedergegangen. „Hensley?“, fragte sie besorgt. „Alles in Ordnung?"
„... ansprechbar“, murmelte Hensley. „Etwas benommen. Durstig."
Ohne den Blick von ihr zu wenden, tat Jadie eine rasche Gebärde. Awakandra selbst und die vierte Person in der Barke zuckten zusammen, als von einer Art Wandregal ein Surren ertönte. Die kleine, zierliche Kiqabi gehörte zu den besten Leuten aus Garanaus Bande, eine hartgesottene Dirne und Messerstecherin aus den finstersten Gassen von Qatuacra; jetzt aber, in einem Sessel auf einer fliegenden Barke festgeschnallt und umgeben von der Magie der Fremden, war ihr Gesicht so leichenblass, dass sich das kurze, blonde Haar regelrecht dunkel davon abhob. Mit angstvoll geweiteten Augen verfolgte sie den Becher aus blauem Licht, der von dem Regalfach her durch den Raum schwebte, genau in Jadies ausgestreckte Hand.
Awakandra fühlte keine Angst, nur das gleiche kindliche Staunen wie damals, als ihr Geliebter ihr ähnliche Kostproben jener Zauberei gezeigt hatte, die nach seinen Worten nichts mit Göttlichkeit zu tun hatte, sondern allen Menschen zu Gebote stand – wenn nicht seine Leute sie ihnen vorenthielten. Fahrig tasteten Hensleys Finger nach dem Becher, den Jadie ihr hinhielt, und mit einem halblauten „Danke“ setzte sie ihn an die Lippen. Ihr Schlucken tönte in das Summen hinein, das den kleinen, ovalen Raum ausfüllte.
Sie machte sich nicht die Mühe, den Becher zurückzugeben; er löste sich zwischen ihren Fingern auf, als sie sich mit flatternden Lidern an Jadie wandte: „Was ist passiert?“
„Dich muss irgendwas gestochen haben“, erwiderte Jadie. „Ein Insektoid oder so was. Garanau sagte, es gebe einige davon, deren Stich betäubende Wirkung hätte.“
„Garanau?“ Verwirrt zog Hensley die Augenbrauen zusammen. „Wo ist er?“
„In dem anderen Shuttle“, sagte Jadie. „Zusammen mit Yuran, Blance und diesem Minensklaven, Hagulan.“
„Anderes Shuttle?“ Die Verwirrung auf Hensleys sonst so ausdrucksloser Miene ging allmählich in Erschrecken über, während sie die Augen von ihrer Gefährtin löste und über die Umgebung huschen ließ.
Jadie nickte. „Die Wahrhaftigkeit hat uns gleich zwei runtergeschickt, weil wir nicht alle ...“
Mit einem Ruck fuhr Hensley in die Höhe, soweit es die Gurte ihrer Liege erlaubten. „Ich bin in einem Shuttle?!“
„Ruhig, Hensley.“ Jadie tätschelte ihr die Schulter. „Es ist alles in Ordnung. Unsere Mission ist vorbei ...“
„Ich bin die Proskopin von Magellan, geweiht im Namen der heiligen Mutter Erde!“, rief Hensley aus. „Ich darf den Planeten nicht verlassen!“
Für einen Moment kam es Awakandra vor, als weiche Jadie dem Blick ihrer älteren Gefährtin aus.
„Oh“, meinte sie endlich mit einem Achselzucken. „Naja, das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Du warst bewusstlos und konntest nicht viel dazu sagen. Und wir mussten starten.“
Einen Moment lang starrte Hensley noch mit fassungslos geöffnetem Mund um sich, ehe sie in einem langen Zug den angehaltenen Atem entweichen ließ und zurück auf ihre Liege sank. Erneut füllte allein dieses ätherische Summen das Schweigen.
„Ist Yuran wohlauf?“, fragte sie endlich.
„Dem geht’s gut“, lachte Jadie etwas verkrampft. „Er freut sich auf seine Mutter.“
„Blance?“
„Unverwüstlich. Du kennst sie doch.“
„Skayle?“
Betretenes Schweigen senkte sich von Neuem über den Innenraum der Barke.
„Wir haben nichts Neues von ihm gehört“, murmelte Jadie halblaut.
Bevor Hensley darauf antworten konnte, tönte unvermittelt die körperlose Stimme des Mannes durch den Raum, der jenseits dieser unwirklich glatten, blauen Glaswand in seinem Sessel saß und die Himmelsbarke lenkte. „Bitte alles zurück auf die Plätze und anschnallen“, verkündete er. „Mikrogravitation in zwei Minuten.“
Jadie erhob sich und verschwand mit zwei schnellen Schritten wieder in Awakandras Rücken. Während erneut die Schließen ihrer Gurte klickten, fragte Kiqabi in einem trotzigen Versuch, selbstbewusst zu klingen: „Mikro... was?“
„Mikrogravitation“, kam es von Jadie. „Schwerelosigkeit. Der Pilot wird gleich den Antrieb abschalten und das Shuttle wenden. In dieser Zeit werden wir hier drin kein Gewicht haben.“
„Die Älteste Blance hatte doch davon erzählt“, warf Awakandra mit einem Blick über die Schulter ein. „Erinnerst du dich nicht?“
Kiqabi schüttelte den Kopf. „Sie hat so vieles erzählt und das meiste davon war so verwirrend ...“
Unter versonnenem Nicken drehte Awakandra das Gesicht wieder nach vorn. Es hatte geholfen, dass ihr vieles von Blance’ Erzählungen nicht neu gewesen war. Ihr Geliebter hatte ihr von dieser ,Schwerelosigkeit' erzählt – davon, dass es dort, wo er herkam, kein Oben und kein Unten gab ...
Ein Anflug von Trauer überkam sie, als sie daran dachte, wie sie mit eben diesen Worten Skayle geprüft hatte, den freundlichen, sanftmütigen Spielmann, der mit seinem Leben dafür bezahlt hatte, dass seine Freunde aus Qatuacra entkommen konnten. Damit sie unbehelligt die Stadt hatten verlassen können, hatte er die Tempelgarde auf seine eigene Fährte gelockt ...
„Mikrogravitation in fünf Sekunden“, verkündete die körperlose Stimme.
... und war gefangen worden, dachte Awakandra den Gedanken zu Ende. Was das für ihn bedeutete, nachdem er die Garde mit seinen Zauberkräften in Angst und Schrecken versetzt hatte, konnte sie sich nur zu gut ausmalen.
„... drei ... zwei ... eins ...“
Das Summen im Raum erstarb und im selben Augenblick erfasste Awakandra genau das Gefühl, gegen das sie sich gewappnet hatte ... und auf das doch noch so viele Worte sie nicht hatten vorbereiten können.
„Aber ...“, hörte sie schräg hinter sich ein erschrockenes Keuchen von Kiqabi. „Wir fallen! Wir fallen!“
„Nur die Ruhe“, erwiderte Jadie. „Das ist normal.“
„Normal?!“ In Kiqabis Stimme schwang ein hysterischer Unterton mit, den Awakandra noch nie von ihr gehört hatte. „Wie hoch oben sind wir?! Wir fallen!“
Awakandra spürte selbst, dass ihr von der Empfindung flau im Magen wurde, doch sie konzentrierte sich auf ihre Atmung und schaffte es sogar, streng zu mahnen: „Kiqabi! Genau davon hatte die Älteste Blance gesprochen – dass es sich anfühlen werde, als ob wir fallen!“
„Ich will nicht sterben!“, schrie Kiqabi. „Nicht so! Nicht eingesperrt in ein ... ein dämonisches Fass, das gleich zerschellt! Wir werden alle –
„Schub setzt ein in fünf“, erscholl etwas genervt die Stimme des Steuermanns. „Vier ... drei ... zwei ... eins ...“
Das Summen schwoll von Neuem an und wie eine Decke, die vom Scheitel bis zu den Zehen über sie gebreitet wurde, legte sich wieder Schwere über Awakandras Körper. Unsanft fiel ihr Ellbogen auf die Armlehne herab – sie hatte überhaupt nicht bemerkt, dass er emporgeschwebt war. Mit einem tiefen Durchatmen schluckte sie die Übelkeit herunter, die ihr bereits in der Kehle aufgestiegen war.
Schräg hinter sich hörte sie Kiqabi stoßweise hecheln. Augenblicklich klickten wieder die Schließen von Jadies Gurten, gefolgt von zwei raschen Schritten auf dem Teppichboden. „Hyperventilation“, murmelte Jadie ruhig. „Kiqabi, sieh meinen Finger an ... gut so. Jetzt tief ausatmen ... tief einatmen ... ausatmen ... einatmen ...“
Überrascht verdrehte Awakandra erneut den Kopf über die Schulter. Das Letzte, was sie an der streitbaren Kriegerin von den Sternen erwartet hätte, waren Heilfähigkeiten. Nun aber gab Jadie geduldig mit langsamem Auf und Ab ihres Fingers den Takt vor, auf den Kiqabi in gepressten, tiefen Zügen ihren Atem verlangsamte.
„Sehr gut“, stellte sie schließlich fest und tätschelte Kiqabis Schulter. „Kleiner Tipp, konzentrier dich beim nächsten Mal von Anfang an auf deine Atmung.“
„Beim nächsten Mal?“, kam es, immer noch ungewohnt schrill, von Kiqabi. „Wir müssen das noch mal durchmachen?!“
„Vor dem Ankoppeln ans Mutterschiff“, erklärte Jadie. „Für die letzten Manöver müssen wir frei treiben.“
„Sind wir gerade sehr tief gefallen?“, setzte Kiqabi nach. Sie klang den Tränen nahe.
Lachend schüttelte Jadie den Kopf, dass ihr kupferner Pferdeschwanz flog. „Wir sind überhaupt nicht gefallen“, entgegnete sie. „Jedenfalls nicht nach unten. Schau mal aus dem Fenster. Magellan ist jetzt über uns.“
„Was?!“ Awakandra sah hinaus. Es stimmte, unter ihnen erstreckte sich nur mehr Schwärze voller vielfarbiger Sterne. Erst, als sie sich zur Seite beugte und den Kopf etwas einzog, um am oberen Rand des Fensters vorbeizuspähen, fand sie die pfirsichgoldene Murmel wieder, die ihre Welt war. „Wir haben Oben und Unten vertauscht?!", platzte sie ungläubig heraus.
Jadie seufzte. „Wenn wir erst an Bord sind, werdet ihr eine Menge über Physik und Raumfahrt lernen müssen. Allein schon, um euch bei uns zurechtzufinden.“
Lernen, dachte Awakandra. Oh ja. Die Lektion fortführen, die ihr Liebster einst mit ihr begonnen hatte. All das lernen, all das sehen, was ihre falschen Götter ihr zu verhehlen suchten! Für einen Moment brandete die altvertraute Wissbegier in ihr auf wie eine Woge.
Sie verebbte an ihrer engen Kehle. Lernen, ja. Aber um welchen Preis? Schon jetzt hatte einer der Fremden für ihre Wissbegier sein Leben gelassen. Und Awakeena würde älter sein als sie selbst, wenn sie sich wiedersähen – falls sie sich jemals wiedersähen.
So saß Awakandra in einer Himmelsbarke, umgeben von einer Unendlichkeit aus Wundern, und rang beim Gedanken an ihre Tochter mit den Tränen.
Eine Treppe aus rotem Licht. Awakeena stand wie gelähmt davor und fragte sich, ob sie nur träumte; ob sie am Ende alles nur träumte, auch Mutters Verschwinden vor einigen Tagen.
Doch sooft sie auch blinzelte, vor ihr glomm die Treppe und führte zur Kante des Monolithen empor. Die Abendbrise strich ihr über die Wange und spielte mit einer schwarzen Strähne, die ihr unter der Kappe hervor in die Stirn lugte. Aus den Augenwinkeln gewahrte sie die vielfarbige Menge der Geistlichen, Tempelgarden und Gotteskinder, deren gespanntes Schweigen über dem großen Platz hing wie Gewitterluft.
So zwang sie ihre zitternden Beine in Bewegung und begann den Anstieg.
Unter ihren Sandalen fühlten sich die Stufen solide an wie Marmor. Was hast du auch erwartet, Närrin?, schalt sie sich innerlich. Hast du so wenig Vertrauen in die Göttin, die vor deinen Augen diese Treppe erschuf? Sie hob den Kopf, um zur gold leuchtenden Gestalt der Hargit-nal-Raja aufzublicken, die ihr vom oberen Ende her entgegensah.
Hastig senkte sie das Gesicht wieder. Noch immer hallten ihr die Warnungen der Göttin in den Ohren: dass Mutters Rettung ihr mehr abverlangen würde, als sie ahnte ... dass sie Gefilde würde betreten müssen, die ihr Begreifen weit überstiegen ... Sie hätte am liebsten kehrtgemacht und wäre die Treppe wieder hinabgerannt, quer durch das Tempelgelände bis in ihre Gemächer im Heim der Erwählten.
Wo Mutter nicht auf sie warten würde. Niemals wieder, wenn Awakeena zuließe, dass sie den Dämonen anheimfiele.
Für einen Moment verharrte sie mit geschlossenen Augen, einen Fuß schon auf der nächsten Stufe, und atmete tief durch, ehe sie sich straffte, um entschlossen das letzte Stück der Treppe hinanzusteigen. Durch die Menge hinter sich auf dem Tempelplatz hörte sie ein Raunen gehen. Gütig lächelnd nickte die Hargit-nal-Raja ihr zu, als Awakeena bei ihr anlangte und, ihrer deutenden Hand folgend, zur offenen Pforte der Himmelsbarke schritt. Als sie das schattige Innere betrat, tönte hinter ihr gedämpft der Abschied der Göttin an die Menge: „So kniet denn nieder, geliebte Kinder der Götter und empfanget meinen Segen ...“
Während sie noch mit sich rang, ob auch sie niederknien sollte, gewöhnte sich ihr Auge allmählich an den Dämmer in der Barke und sie erkannte Einzelheiten. Der Innenraum erinnerte ein wenig an eine sonderbare, recht große Sänfte. Entlang der gewölbten Wände war ein halbes Dutzend Sessel angebracht, deren gerundete Kanten eine üppige Polsterung ahnen ließen. In dem freien Gang dazwischen aber lag auf dem Teppichboden reglos, mit durchgedrückten Beinen und eng an den Körper gepressten Armen der fremde Zauberer – Unskayle oder Skayle oder wie auch immer er sich nannte –, den die Göttin vom Altar weg in ihren Gewahrsam genommen hatte.
Neugierig trat Awakeena an ihn heran und sah auf ihn hinab. Er war in Ohnmacht gefallen oder vielleicht hatte auch die Göttin ihn in Schlaf versetzt. Jedenfalls lag er mit geschlossenen Augen da, ein entspanntes Lächeln auf den gefälligen Zügen, die Atmung flach und gleichmäßig. Kopfschüttelnd ließ Awakeena den Blick vom widerspenstigen, sandfarbenen Haarschopf über das jungenhafte Gesicht mit der knochigen Nase herabwandern und weiter über den mageren, drahtigen Leib in der weißen Tunika. Ohne das Wissen, dass er sich mit dämonischen Mächten eingelassen hatte, fiel es so leicht, ihn für freundlich und harmlos zu halten.
Wie es ihrer Mutter zweifellos geschehen war.
„Awakeena?“
Sie fuhr herum. Zu vertieft war sie in ihre Betrachtung gewesen, um zu bemerken, dass die Hargit-nal-Raja die Himmelsbarke betreten hatte. Langsam schloss sich hinter der golden glimmenden Gestalt der Göttin die Pforte – von selbst, ohne Zutun eines Dieners. Obwohl Awakeena die Götter schon weitaus größere Wunder hatte wirken sehen, fühlte sie sich plötzlich von der Heiligkeit ihrer Umgebung schier erdrückt. Nicht bewusste Entscheidung war es, die sie auf die Knie fallen ließ; die Beine gaben unter ihr nach.
„Erhabene Unsterbliche“, stieß sie zittrig hervor. „Ich ... bin hier, wie du mir geboten hast.“ Sie schluckte. „Was kann ich tun, um Mutter zu retten?“
Abwehrend hob die Göttin eine Hand. „Ich werde es dir erklären, Gotteskind“, sprach sie. „Später. Für den Moment nimm Platz und warte."
Sie deutete auf einen der Sessel und hastig rappelte Awakeena sich vom Boden hoch, um sich hineinzusetzen. Näher, als sie einer Gottheit je gewesen war, trat die Hargit-nal-Raja an ihr vorbei – fast verwunderte es Awakeena, keine Hitze von ihrem Glanz ausgehen zu fühlen. Staunend betrachtete sie aus der Nähe das goldene Haar der Göttin, das fließend in die wallenden, goldenen Gewänder überging, ihre ganze Erscheinung in ein Licht getaucht, das nicht von dem Dämmerschein herrührte, der durch die kleinen Glasfenster hereinfiel.
Im Gehen tat die Göttin einen Wink und Awakeena zuckte zusammen, als einer der Sessel an der gegenüberliegenden Wand sich von selbst zu bewegen begann. Während noch die Rücklehne herabklappte und sich eine Fußstütze hervorschob, schwebte auf weitere Gesten der Göttin hin der Zauberer vom Boden empor, zur Seite und auf die Liege nieder, in die sich der Sessel verwandelt hatte. Wie Schlangen wanden sich von beiden Seiten Gurte um seinen Leib und zogen sich unter dem Klicken metallener Schließen fest. Für einen Moment verharrte die Göttin und sah auf ihn hinab.
Dann führte sie zu Awakeenas Erstaunen eine Hand an sein Gesicht und strich ihm sanft mit dem Fingerknöchel über die Wange.
„Gotteskind“, wandte sich die Göttin ihr so abrupt zu, dass Awakeena erneut zusammenfuhr. „Es ist Zeit, dich für den Antritt deiner Reise bereit zu machen. Sei ohne Furcht. Ich werde dich jetzt anschnallen.“
Verwirrt blinzelte Awakeena sie an. Während sie noch eine Frage zu formulieren versuchte, fühlte sie bereits, wie ihr auf eine Handbewegung der Göttin hin Riemen über die Schultern herab und um die Hüfte krochen. Starr vor Schreck, sah Awakeena in ihren Schoß hinab, wo sich die metallenen Schließen der Gurte mit einem Klicken ineinanderhakten.
Mit halb geöffnetem Mund schaute sie wieder zur Göttin auf, die ihr beruhigend zulächelte. „Du wirst gleich einige Augenblicke allein sein“, erklärte sie. „Wenn wir deine Welt verlassen, wirst du Dinge sehen, hören und fühlen, die dich vielleicht ängstigen. Denk daran, dass du weiterhin unter meiner Obhut stehst und dir nichts geschehen kann. Ich werde in Kürze wieder bei dir sein.“
Fassungslos gaffte Awakeena ihrer Göttin hinterher, die an ihr vorbeischritt – dorthin, wo der Innenraum der Barke nach wenigen Schritten an einem großen, gewölbten Fenster endete. Einen frei stehenden Sessel sah sie dort, umgeben von einem halbrunden Tisch, in den etwas wie große, polierte Kacheln und zahllose Juwelen eingelassen waren. „A-aber erhabene Unsterbliche“, hörte sie sich selbst stammeln, „wohin w-willst du denn
Es verschlug ihr vollends die Sprache, als die Hargit-nal-Raja mit einer Gebärde, als ziehe sie einen Vorhang zu, eine rot glitzernde Wand hinter sich erschuf. Sessel, Tisch und Fenster waren mitsamt der Göttin auf einen Schlag ihrem Blick entzogen.
Mit geübtem Griff und etwas Schleiereinsatz raffte sie das goldene Gewand so, dass sie in den Pilotensitz passte. Für einen Augenblick saß sie aufrecht, die Finger über die Kontrollen gespreizt, und betrachtete ihr Spiegelbild als Hargit-nal-Raja in den dunklen Displayschirmen.
Dann stützte sie die Ellbogen auf die Kante der Konsole und ließ schwer die Stirn in die Hände sinken. Loralys, dachte sie, was hast du dir gerade eingehandelt?!
Unschlüssig betrachtete sie die Kontrollen. Sie hatte wahrscheinlich schon Startfreigabe durch die Kammer des Himmelsgeleits. Nicht dass es darauf angekommen wäre – ihre Priester-Fluglotsen im Tempel hätten niemals gewagt, einer ihrer Gottheiten den Moment vorzuschreiben, in dem sie ihren Aufstieg begann.
Doch vom Orbit aus stand sie zudem unter Beobachtung durch die Sensoren der Wahrhaftigkeit. Und sie konnte schon von Glück reden, wenn Captain Caldore nur fünf Minuten Geduld mit ihr hatte.
Sobald sie aber gestartet war, lief die Uhr. Um ihre eben erst eingesammelte Verbündete hinten im Shuttle zu briefen, blieb ihr genau die Zeit des Fluges – keine Minute länger. Nur, was zum Kollektiv sollte sie jetzt mit ihr anfangen?!
Sie brauchte einen Plan. Und das schnell.
Angefangen mit einem Skript für einen überzeugenden Auftritt vor dieser Awakeena. Noch immer die Stirn in den Händen, sah sie an den goldenen Stoffmassen ihres Kleides herab. Bis zum Wendemanöver musste sie es abgelegt haben – es war nicht empfehlenswert, in der Schwerelosigkeit in einem wallenden Götterkostüm die Pedale eines Shuttles bedienen zu wollen. Awakeena aber würde nach dem Start erwarten, sie in diesem Gewand zu sehen. Sicher, sie konnte sich vom Bordschleier in ein Abbild davon hüllen lassen, aber wenn es überzeugend aussehen sollte, müsste sie einige Minuten lang Bewegungsstudien des Faltenwurfs scannen. Minuten, die sie nicht hatte.
Schweiß kribbelte zwischen ihrer Stirn und ihren Handflächen. Unbarmherzig vergingen die Sekunden. Denk nach, Loralys!, ermahnte sie sich selbst. Denk nach!
Im ersten Moment, in dem sich eine grobe Idee in ihrem Hinterkopf zu formen begann, schnellten ihre Hände zur Konsole herab, um den Standby-Modus zu beenden. Sofort flammte im Komm-Display die grüne Meldung der Startfreigabe auf. „Ihr Amauta für Himmelsbarke Julia sieben“, sprach sie ins Funkgerät, die Finger bereits auf den Kontrollen für die Startsequenz. „Ihr seid erhört.“
Awakeena hatte längst aufgehört, die rasenden Herzschläge im Hals zu zählen, als jenes Summen anschwoll und sie umfing, das sie ihr Leben lang nur von weitem gehört hatte – wann immer eine Himmelsbarke in den Tempel herab- oder daraus aufgestiegen war.
Unwillkürlich hielt sie den Atem an, als der Sessel, in dem sie saß und selbst der Boden unter ihren Sandalen zu zittern begannen. Durch die Wände des göttlichen Gefährts ging ein leises, eher spürbares denn hörbares Ächzen.
Dann begann hinter dem Glasfenster zu ihrer Rechten die Umgebung zu versinken.
Zunächst nur langsam schob sich das Dach der großen Halle mit seinen Götzenbildern und Domen nach unten. Als Awakeena sich vorbeugte, um hinabzusehen, erblickte sie rings um die Empore die bunte Menge der Laien, die den Tempelplatz bis in den letzten Winkel ausfüllte. Auf der Empore wiederum wimmelten die Geistlichen in den Farben ihrer Orden, die Tempelgarden im metallenen Glanz ihrer Rüstungen und die Gotteskinder im selben leuchtenden Rot wie Awakeena selbst. Überall aber sah sie unterschiedslos die nach oben gewandten Gesichter wie Tupfen auf dem Farbenmeer der Kleider. Ganz Qatuacra, so schien es, sah ihr hinterher, wie sie gemeinsam mit der Hargit-nal-Raja in den Himmel aufstieg.
Ihr Götter!, durchfuhr es Awakeena. Sie schwebte! Sie schwebte tatsächlich!
Ihr Herz setzte einen Schlag aus, als ihr die Säule aus leerer Luft bewusst wurde, die sich jetzt unter ihr befand. Allein die Macht ihrer Göttin bewahrte sie vor einem tiefen Fall! Mit fest geschlossenen Augen begann sie Gebete zu murmeln: „Hargit-nal-Raja, erhabene Unsterbliche, behüte mich. Mein Leben liegt allein in deiner Hand, ich bin dir untertan, ich vertraue dir ...“
Es gelang ihr, ihren Atem zu beruhigen und erneut den Blick aus dem Fenster zu richten. Im gleichen Maße, in dem sich bleierne Schwere auf alle ihre Glieder legte, sackte schneller und immer schneller das Land unter ihr weg – das Heiligtum, das sie zum ersten Mal in ihrem Leben von oben sah, Qatuacra, dessen Straßen und Dächer sich zu einem unfassbar fein gearbeiteten Mosaik wandelten. Der im Abendrot glühende See, der binnen weniger Atemzüge zu einer Pfütze im Grün, Gelb und Braun der Landschaft zusammenschrumpfte – waren die rechteckigen Flicken vielleicht Äcker? Wie Schlangen wanden sich in den See aus allen Richtungen die Flüsse, deren Breitester der Mayuqi sein musste ...
Awakeena fuhr zusammen, als unvermittelt mitten im Raum die Stimme der Hargit-nal-Raja ertönte: „Ich werde dir nun wieder erscheinen, Gotteskind. Erschrick nicht vor dem, was du siehst!“
Mit einem tiefen Durchatmen straffte Awakeena den bleischweren Rücken, den Blick fest auf die rot schillernde Wand geheftet, hinter der die Göttin verschwunden war. „Ich bin bereit, erhabene Unsterbliche.“
Doch ihrem guten Vorsatz zum Trotz kniff sie erschrocken die Augen zusammen, als die Wand sich verflüchtigte und dahinter eine Silhouette aus grellem Licht zum Vorschein kam.
„H-Hargit-nal-R-Raja?", hörte sie sich angsterfüllt stammeln, während sie unter Tränen in die blendende Helle der Erscheinung blinzelte.
„Noch keiner Sterblichen hat sich je offenbart, was du nun siehst“, sprach die Lichtgestalt mit der sanften Stimme der Göttin. „Ich bin ein Aspekt der Hargit, als deren unverhüllte Wirklichkeit du mich erschaust.“
Wie von selbst wollte Awakeena vor ihr auf die Knie fallen, doch die Gurte hielten sie in ihrem Sessel. Kaum hatte sie den Blick auf die metallenen Schließen gesenkt und angefangen, daran herumzufingern, als die Göttin auch schon fortfuhr: „Höre nun gut zu, Gotteskind, welche Prüfung deiner harret!“
„Prüfung?“ Awakeena sah auf. „Du meinst ... erhabene Unsterbliche, du meinst, um Mutter zu retten?"
„Die Erlösung deiner Mutter ist ein kleiner Teil eines viel größeren Unterfangens“, erwiderte die Lichtgestalt. „Wisse, Awakeena, Tochter des Nalad-ra-Yorem und der Awakandra, dass die Götter im Krieg liegen mit den Dämonen!“
„Im ... Krieg?" Verwirrt blinzelte Awakeena sie an. „Ich verstehe nicht, erhabene Unsterbliche ... Welcher Feind vermag, den Göttern zu widerstehen, dass sie ihn nicht einfach hinfort fegen?"
„Der Krieg findet in den Seelen der Menschen statt“, erklärte die Göttin. „In jenen Abgründen, in denen das Böse sein Zuhause findet. Dort ist es, dass die Dämonen erstarkt sind. Dorthin haben wir Götter sie verfolgt, um sie zu stellen und zu besiegen.“
„Zu besiegen?“, echote Awakeena. „Heißt das, die Götter sind im Begriff, das Böse aus der Welt zu tilgen?"
Das Schweigen dehnte sich und Furcht stieg in Awakeena auf, die Göttin mit ihrer Frage irgendwie verärgert zu haben. Um so erleichterter atmete sie auf, als die Hargit-nal-Raja fortfuhr:
„Dies ist eine komplexe Frage und für eine Sterbliche schwer zu begreifen, selbst für ein Gotteskind.“
„Aber erhabene Unsterbliche, wenn ich dir dienen will, muss ich verstehen –“
„Die Zeit drängt, Awakeena“, fiel die Göttin ihr ins Wort. Eine ihrer Hände aus Licht hob sich und deutete auf das Fenster neben ihr. „Sieh hinaus.“
Awakeena folgte ihrem Befehl und zuckte zurück.
Der Himmel war schwarz! Angefüllt von Sternen zwar, ansonsten aber von tieferer Schwärze als die lichtloseste Nacht! Weit unten erstreckte sich ein seltsames Muster in weierlei Farben – Pfirsichgold, Grün, Braun, Gelb und blendendes Weiß, all das auf einer gekrümmten Fläche wie eine riesige Kugel.
„Was ist das, erhabene Unsterbliche?“, stieß sie gepresst hervor.
„Das Geisterreich“, antwortete die Göttin. „Wir folgen deiner Mutter in den schwarzen Abgrund des Bösen. Dorthin bringen die fremden Zauberer sie, in eine Festung der Dämonen.“
„Aber warum?!“, brach es aus Awakeena heraus. „Warum Mutter? Unter den Erwählten war sie immer die Untadeligste von allen!“
„Sag du es mir.“
Awakeena fuhr herum. „Was?"
„Kannst du dir wahrhaftig kein Begehren vorstellen, das deine Mutter den Dämonen in die Arme getrieben haben könnte? Irgendetwas, das sie so sehr ersehnte, dass sie dafür jedes Gebot übertreten würde?"
Ihre Worte rührten an eine Erinnerung dicht unter der Oberfläche von Awakeenas kreisenden Gedanken. Nachdenklich verdrehte sie den Kopf über die Schulter, hin zu dem Zauberer, der immer noch schlafend dalag. Eine Aura aus rötlichem Licht umgab ihn nun, vor der Awakeena unter anderen Bedingungen erschrocken wäre; doch sie fühlte, dass es sich um einen Bann handelte, den die Göttin um ihren gefangenen Feind gewoben hatte.
„Als ich Skayle im Kerker aufsuchte“, murmelte sie, eher zu sich selbst als zu ihrer Göttin, „sagte er etwas davon, Mutter wolle zu meinem Vater.“ Fest sah sie der Hargit-nal-Raja ins gleißende Gesicht. „Zum Nalad-ra-Yorem.“
Das Haupt der Göttin ging in einem langsamen Nicken auf und ab. „Das also ist es, was die Dämonen ihr versprochen haben.“
„Das muss es sein!“, fuhr Awakeena auf. „Oh ihr Götter, welche Verworfenheit! Die reinste, prächtigste Liebe zu missbrauchen, um Mutter auf diesen finsteren Pfad zu verleiten!“
„Ich sehe, du begreifst“, stellte die Göttin fest. „Und hoffentlich begreifst du auch, dass gegen solche Heimtücke die Götter nicht einfach gewaltsam mit purer Macht angehen können, ohne dass die Seele deiner Mutter Schaden nähme. Allein deine Liebe wird sie erretten können – und um dir beizustehen, müssen selbst die Götter zur List greifen.“
„Zur List?“ Fragend sah Awakeena die Lichtgestalt an.
„Mir, der Hargit-nal-Raja, ist es gelungen, mich in jene Festung der Dämonen einzuschleichen. Sie halten mich für eine Sterbliche ... und für ihre Gefangene. Und nur als solche wirst auch du mich dort sehen, sobald wir erst angekommen sind.“
Während Awakeena noch versuchte, den Sinn dieser Worte zu erfassen, streckte die Lichtgestalt die Arme aus. Das Gleißen verblasste und erlosch. Für einige Augenblicke sah Awakeena nichts weiter als grelle Nachbilder vor dem viel zu dunklen Inneren der Himmelsbarke.
Als sich ihre Augen an den Dämmer gewöhnt hatten, stand vor ihr eine gewöhnliche, menschliche Frau mit dem Gesicht der Hargit-nalRaja.
Fassungslos bestaunte Awakeena dieses neuerliche Wunder. Die Frau war noch immer von außergewöhnlicher Schönheit, doch nur wenig älter als sie selbst. Das Haar, das ihr auf die Schultern fiel, glänzte in sattem Goldblond. Ein seltsames, graues Gewand, das Jacke und Beinlinge in sich vereinte, umschmeichelte eng eine schlanke, wenngleich athletische Figur. Doch die göttliche Aura des Erhabenen war verflogen. Selbst im Tonfall lag nur mehr das verschmitzte Lachen einer jungen Frau, als sie erneut zu sprechen anhub: „Dies ist meine Gestalt in der Festung der Dämonen.“
„Oh erhabene Unsterbliche
Die junge Frau hob die Hand. „Schweig! Uns bleibt nur die Zeit bis zur Ankunft, um miteinander zu reden. Sind wir erst bei den Dämonen, dann werden sie jedes Wort belauschen, das ich zu dir sage.
Also hör mir zu und präge dir gut ein, was du in der Festung der Dämonen wirst tun müssen ...“
Zumindest ließen sie ihn und Awakandra lang genug warten, um sich an die Umgebung zu gewöhnen, dachte er sarkastisch. Wenn das überhaupt möglich war.
Garanau wusste kaum, in welche Richtung er sehen sollte, um nicht irre zu werden. Die Ecke, in die sich Kiqabi und Hagulan verkrochen hatten, wirkte nicht wie die schlechteste Wahl. Zwar erinnerte sie daran, wie eng der Korridor war, in dem sie empfangen werden sollten, aber wenigstens gab es dort nichts Verstörenderes zu sehen als eine metallene Tür in einer metallenen Wand.
Allein das hätte gereicht, um Garanau fassungslos zu machen: Dieses ganze, riesige Himmelsschiff bestand aus Metall. Tausendmal die Rüstungen der ganzen Tempelgarde von Qatuacra wären nicht genug gewesen, um daraus dieses Bauwerk zu schmieden!
Hatte er darüber noch bloß ehrfürchtig gestaunt, so schien alles andere an diesem Ort den Hirngespinsten eines Wahnsinnigen entsprungen. Wenn er auch Hagulan für die Feigheit gerügt hatte, die ihn während des Fallens in der Himmelsbarke ergriffen hatte, musste Garanau doch eingestehen, dass sogar ihm dabei mulmig gewesen war – obgleich er an Klippensprünge im Sattel eines Whirlers gewöhnt war.
Und jetzt, inmitten dieses Mahlstroms aus Magie, legte der einstige Minensklave einen Gleichmut an den Tag, um den ihn Garanau beneidete. Ihm selbst prickelte unter dem Helm der Schweiß und er wagte kaum, den Blick zur Seite zu wenden. Hagulan hingegen hatte sich offenbar recht schnell an die bizarren Eigenheiten der Umgebung gewöhnt. Zwar war er zwischen den Büscheln, in die seine Peitschennarben Haar und Bart zerteilten, noch immer etwas grünlich im Gesicht, doch sah er sich erstaunlich unbefangen um – im Gegensatz zu Kiqabi, die verbissen den Blick in die Ecke gesenkt hielt.
Mit einem Kreisen der Schulter prüfte Garanau den Sitz seines Harnischs. Er hatte die Rüstung seit Kalenden nicht getragen – als gejagter Verbrecher in verwinkelten Gassen hatte er keine Verwendung dafür gehabt. Heute aber, zur Anbahnung eines Bündnisses mit den Feinden seiner falschen Götter, wollte er ganz als der Adlige auftreten, als der er geboren war.
Um so mehr ergrimmte es ihn, dass die Fremden ihn warten ließen.
„Wie lange brauchen deine Anführer denn noch?“, wandte er sich in halblautem Knurren Jadie zu, die gelassen an dem Geländer auf der anderen Seite des Korridors lehnte. Er konnte nicht vermeiden, dass dabei sein Blick an ihr vorbei fiel, durch die Glaswand hinaus in den labyrinthischen Aufbau des Schiffs. Eine Wand aus Glas!, dachte er einmal mehr in fassungslosem Staunen. Kristallklares Glas in ungeheuren Mengen, riesige Scheiben und jede davon perfekt so gewölbt, dass sie sich passgenau in den runden Querschnitt des Korridors einfügte! Obwohl er sich als Mäzen der Linsenschleifer auch ausgiebig mit dem Handwerk seiner Lieferanten befasst hatte, konnte er sich die Methoden zur Fertigung dieses Wunders nicht einmal erträumen.
Auf seine Worte hin fasste Jadie an ihre Zaubertasche, die sie jetzt offen am Leibgurt über ihrer hellblauen Tunika trug, schaute kurz ins Leere und schüttelte den Kopf. „Ihr Terminstatus ist immer noch unverändert“, sagte sie.
Garanau schnaubte. „Ist es bei deinem Volk üblich, Gäste so lange warten zu lassen?“
„Nein, eigentlich nicht“, erwiderte Jadie achselzuckend. „Sicher ist ihnen was dazwischengekommen. Commodore Normand musste erst vom Flaggschiff hierher übersetzen, vielleicht gab es Probleme mit seinem Shuttle. Und dass Hensley bei uns ist, war ursprünglich gar nicht geplant. Soweit ich weiß, haben sie extra für sie noch schnell einen Repräsentanten der Kurflotte dazugeholt.“
Vor ihrem eindringlichen Blick presste Garanau verstimmt die Lippen aufeinander. Sie beide waren die einzigen, die den wahren Hergang kannten, auf dem Hensley mit ihnen hierher gelangt war. Ansonsten konnte sich nicht einmal Hensley selbst erinnern – Jadie hatte ihn eingeweiht, dass sie ihrer älteren Kameradin eine „Vergessensdroge“ verabreicht hatte. Dennoch war Garanau nicht wohl bei dem Gedanken, dass er sein Bündnis mit den Fremden damit einleitete, dass er eine ihrer Würdenträgerinnen verschleppt hatte – was auch immer eine „Proskopin“ sein mochte.
Er blickte die untersetzte, schwarzhaarige Fremde an, die in niedergeschlagener Haltung auf das Geländer gestützt stand und mit dem Blick der bunt gemusterten Kugel folgte, zu der die ganze Welt, die er kannte, zusammengeschrumpft war. Gemächlich kreiste sie draußen hinter der Glaswand als ein Teil des Panoramas der Sterne, die unablässig eine Art Radachse im bizarren Gefüge des Himmelsschiffs umrundeten – ein mächtiges Rohr aus Stahlgitter, halb verdeckt von gewaltigen Tonnen und wulstigen Rädern, das hoch über ihnen waagerecht in die Schwärze hinausstach; „Zentralschacht“ hatte die Älteste Blance es genannt.
Schon drohte ihm vom ständigen Drehen des Himmels, dem Wandern der Schatten und der Lichtreflexe wieder schwindlig zu werden; so schaute er hastig weiter zu Awakandra, die neben der Fremden am Geländer lehnte und sich anscheinend an den Eigentümlichkeiten dieses Ortes gar nicht sattsehen konnte. Bei allen Gefallenen, er hoffte inständig, dass ihr kindliches Staunen nicht die Schärfe ihres Verstandes trübte! Als er beschlossen hatte, die Feinde der Götter aufzusuchen, hatte er sich auf Awakandra als die kluge und umsichtige Bundesgenossin verlassen, als die er sie in all den harten Kalenden als Gejagter zu schätzen gelernt hatte. Sie war diejenige, die den Fremden gegenüber einen Trumpf in der Hand hatte – den Namen jenes Sterns, den sie so dringend erfahren wollten. Er selbst hatte nicht mehr zu bieten als den Speer in seiner Hand, eine Schmugglerbande und Beziehungen quer durch alle Stände von Qatuacra. All dies war ihm auf einen Schlag winzig und unbedeutend erschienen, sobald er die Gesamtheit seiner Welt von der Himmelsbarke aus erschaut hatte.
Der einzige andere Trumpf, den sie je in der Hand gehabt hatten, war im Grunde bereits ausgespielt. Nachdenklich sah Garanau auf den braunen Lockenkopf von Yuran hinab, der zappelig die Hand der Ältesten Blance hielt und mit vorfreudigem Strahlen den Korridor entlang spähte. Mit diesem Kind als Geisel hatten sie sich überhaupt erst Zugang zu diesem Himmelsschiff erpresst.
Und je länger sie hier standen, desto mehr nagte an Garanau der Zweifel, ob dies eine gute Idee gewesen war.
„Ah, endlich“, unterbrach ein Stoßseufzer von Jadie sein Brüten. „Sie kommen.“
Unwillkürlich sah Garanau den Korridor entlang – ein Fehler, denn nicht einmal das beständige Drehen des Himmels draußen setzte ihm so sehr zu wie der aufwärts gebogene Flur ... und dass die Wachposten darin mit wachsender Entfernung zunehmend geneigter standen. Mindestens dreimal hatte die Älteste Blance geduldig versucht, es ihm zu erklären und dabei kluge Worte wie „Rotation“, „Fliehkraft“ und „Habitatring“ gebraucht; trotzdem wollte ihm nicht in den Kopf, dass jede der Wachen an ihrem Standplatz ein eigenes „Unten“ hatte. Der erfahrene Krieger in ihm konnte nicht anders, als sich dagegen zu wappnen, dass der entfernteste Wachposten gleich umkippen, herabrollen und seine Kameraden mit sich reißen würde; und dass er selbst in dem schmalen Gang keine Möglichkeit hätte, auszuweichen.
Er riss den Blick davon los und sah Jadie an, die gerade wieder die Finger von ihrer Zaubertasche nahm. „Ein, zwei Minuten, dann sind sie hier“, informierte sie ihn.
Garanau nickte und streckte einen Arm in Richtung seiner Gefolgsleute aus. „Hagulan, meinen Schild!“
Etwas unbeholfen streifte ihm der ehemalige Minensklave den reich bemalten Rundschild über den Arm. Hagulan war den Gassenkampf mit dem Messer gewohnt oder das Handgemenge mit Knüppel und Spitzhacke, doch die Waffen der Edlen waren ihm unvertraut. Garanau hatte lange überlegt, ob er nicht doch einen Gebildeteren aus seiner Bande hierher hätte mitnehmen sollen; aber ohne die geringste Ahnung, was ihn hier erwartete, hatte er sich letztendlich für seinen ergebenen Freund entschieden, der ihm schon in wahrhaft verzweifelten Situationen den Rücken gedeckt hatte.
Nicht dass er damit rechnete, dass Hagulans Kampfstärke heute vonnöten sei ... oder von Nutzen. Als Garanau sich vor seine Leute stellte und mit aufgestütztem Speer Haltung einnahm, überkam ihn einmal mehr Unbehagen angesichts der Wachen, deren Reihe sich den Korridor entlang- und die Krümmung hinaufzog. Sie alle trugen eng anliegende, blaue Gewänder, vom Schnitt her seinem eigenen Reitzeug aus Blasenleder nicht unähnlich, nur vereinten sie Jacke und Beinlinge in einem Stück. Wo er jedoch über dem Reitzeug seinen Harnisch trug, waren diese Wachen ungerüstet. Zweifellos verließen sie sich ganz auf ihre Zauberwaffen – und nach dem, was er Skayle damit hatte bewirken sehen, nicht zu unrecht.
Er täte also gut daran, sie ernst zu nehmen ... auch die Frauen, die rund die Hälfte der Wachen ausmachten, was sich für Krieger so falsch anfühlte, dass es ihn innerlich schüttelte. Doch waren selbst sie von hünenhafter Statur – viele der Frauen auf Augenhöhe mit Hagulan und die meisten Männer einen halben Kopf größer oder mehr. Vor allem aber ihre groteske Erscheinung gemahnte ihn, wie wenig er seine Gastgeber einzuschätzen wusste: Einige der Gesichter, die er sah, waren schwarz, andere totenbleich, wieder andere grellbunt gemustert. Nachdem er sich so viele Kalenden daran gewöhnt hatte, seine vermeintlichen Götter als Menschen anzusehen, beschlich ihn nunmehr Argwohn gegenüber den Beteuerungen seiner Gastgeber, tatsächlich Menschen zu sein.
Auch das Grüppchen, das nun endlich hinter der Wölbung der Korridordecke in Sicht kam, zeigte sich ähnlich vielgestaltig. Zwar besaß der Mann, der vorneweg schritt, ein erfrischend normales, rosiges Gesicht, doch war von den beiden Frauen dicht hinter ihm die eine blass und silberhaarig, die andere tiefschwarz mit hässlichen, weißen Flecken im Gesicht. Ein halbes Dutzend weitere folgten ihnen – die genaue Zahl war schwer zu schätzen, da sie in der Enge des Korridors eine gedrängte Kolonne bildeten. Was er jedoch von den Gesichtern erhaschte, deckte einmal mehr die ganze Vielfalt der Farben ab.
Zügig kamen sie den Gang entlang und hielten kurz vor jener weißen Linie am Boden an, von der Jadie ihn gemahnt hatte, sie nicht zu überschreiten, da dort die „dekontaminierte Zone“ ende. Obgleich es sich bei den Neuankömmlingen um die Anführer der Fremden handeln sollte, trugen sie keinerlei Ornat; nur die gleichen blauen Gewänder mit dem weißen Lorbeerkranz auf der Brust wie die Wachen. Lediglich flache, blaue Mützen bedeckten ihre Häupter und Garanau war sich sicher, dass der Vorderste darunter eine Glatze verbarg.
Jener war es auch, der nun das Wort ergriff und dabei von ihm zu Awakandra und zurück blickte: „Meine Damen, meine Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord der Wahrhaftigkeit. Bitte entschuldigen Sie unsere Verspätung, aber es gab überraschende Neuigkeiten, die unsere persönliche Aufmerksamkeit erforderten. Seien Sie versichert, dass Ihr Besuch für uns höchste Priorität besitzt. Ich bin Commodore Normand, Oberkommandierender dieses Geschwaders.“
Garanau war froh, sich mit Awakandra darauf geeinigt zu haben, dass sie heute gar nicht erst versuchen würden, die Umgangsformen der Fremden zu imitieren – angefangen mit dieser merkwürdigen Sitte, einen Menschen mit „Sie“ anzureden. Schon von der Umgebung war er verunsichert genug, ohne auch noch seine eigenen Worte und Gesten überdenken zu müssen.
So trat er vor und erwies diesem ... „Commodore“ die gleiche Ehre wie einer hochrangigen Kamachi. Den Schild zur Seite gespreizt, ging er auf ein Knie nieder und sprach: „Ruhm und Heil sei dir, ehrenwerter Normand! Ich bin Garanau, Sohn der ehrenwerten Garyadi und ich spreche zu dir als Herold der Awakandra, Erwählte des Naladra-Yorem, Tochter der Awanandi. Von dir und den Deinen in deinem Himmelsschiff empfangen zu werden, ist uns eine Ehre, die uns mit Stolz erfüllt. Wir sind gekommen, um Frieden und Bund zu besiegeln durch Rückgabe der Geiseln.“
Es entstand ein verlegenes Schweigen, das Garanau zwang, ungewohnt lang auf dem Knie zu verharren. Gebrochen wurde es – eigentlich hätte er nicht überrascht sein dürfen – von einer Frau. Die Silberhaarige war es, die an die Seite des Commodore trat und erwiderte: „Ruhm und Heil sei dir, ehrenwerter Garanau und dir, Erwählte Awakandra. Wir sind Reisende von weit her und so seht es uns bitte nach, wenn wir mit euren Sitten nicht vertraut sind. Erhebe dich bitte, Garanau, wenn es dir angemessen erscheint. Ich bin Jannigan ... Tochter der Sabyn und ich spreche als Herold meines Geschwaders.“
Die Bräuche dieser Fremden waren so verdreht wie ihre Korridore, dachte Garanau bei sich, als er sich wieder aufrichtete und Haltung annahm. Die Macht in Händen eines Mannes, doch als dessen Herold sprach eine Frau. Nun, sie war eine fremdartige Riesin, eine Handbreit größer als Hagulan. Und es standen auch Frauen als Krieger vor ihm, da kam es auf diese Absonderlichkeit mehr nicht weiter an.
Er selbst hielt sich strikt an die Tradition der großen Häuser Qatuacras, indem er fortfuhr: „Ich rufe zu Zeugen eure Gesandten Blance, Jadie und Hensley, dass Yuran wohlauf ist und ihm als Geisel in unserer Haft nicht Schmach noch Schaden zugefügt wurde.“
Peinlich berührt schloss er die Augen, als schrägrechts hinter ihm völlig unzeremoniell Jadies Stimme erklang: „Sie haben ihn gut behandelt, Sir. Das kann ich bestätigen.“
Barbaren von den Sternen!, schoss es ihm durch den Kopf. Das sollten seine Verbündeten sein!
Mit einem Durchatmen überging er den Umstand, dass die Zeugen mit nichts geantwortet hatten, das einer feierlichen Formel auch nur nahekam, und leitete zum Schluss über: „So ist es meiner Herrin Awakandra eine Freude, Yuran nun zurückzugeben in die Obhut seines Hauses und seiner Mutter, der ehrenwerten Mee.“
Auch wenn diese Mee nach allem, was die Fremden ihm erzählt hatten, eine einfache Schneiderin war und gewiss keine „ehrenwerte“ Adlige. Doch nachdem ihm selbst seine Mutter schon lange das Recht entzogen hatte, sich als ihr Sohn vorzustellen, war dieser Teil des zeremoniellen Akts ohnehin eine Farce.
„Wo ist denn Mama?“, fragte Yuran im selben Moment, in dem er sich zwischen Garanau und Awakandra hindurchdrückte.
„Sie wartet in der Krankenstation auf dich“, lächelte die Silberhaarige auf den kleinen Jungen herab und streckte ihm die Hand entgegen. „Komm her. Commander Pyre wird dich hinführen.“
Als Yuran die weiße Linie übertrat, die ihn noch von seinen Leuten trennte, erzitterte um ihn her die Luft, als sei er durch eine Wasserfläche getaucht. Es erforderte Garanaus ganze Selbstbeherrschung, nicht zurückzuzucken.
„Was ist das?“, platzte neben ihm Awakandra heraus. Mit einem raschen Schritt war sie an Garanaus Seite getreten und verharrte mit der Hand nur eine Fingerbreit vor der Erscheinung. Schon war das Wanken der Sicht auf Commodore Normand und sein Gefolge nahezu wieder abgeebbt.
„Meinen Sie die Schleierbarriere?“, fragte die Silberhaarige.
„Eine Barriere?“, entfuhr es Garanau in aufflammendem Argwohn. Sollten die fremden Zauberer ihm und seinen Gefährten eine Falle gestellt haben?
Beschwichtigend hob die Silberhaarige eine schlanke, bleiche Hand. „Nur eine Filterbarriere“, erklärte sie. „Zu Ihrem – Ich meine, zu eurem Schutz vor Krankheitskeimen. Blance hat euch doch von der Quarantäne erzählt?“
„Sie hat uns erzählt, dass wir eine Zeit lang nur einen kleinen Teil eures Schiffs werden betreten dürfen“, setzte sich Awakandra nun endgültig über das Protokoll und ihn als ihren Herold hinweg. „Weil sonst die Gefahr besteht, dass wir erkranken.“
„Heißt das, ihr kommt noch gar nicht mit?“, rief Yuran aus dem Pulk der blauen Gewänder heraus.
„Das ist richtig“, lächelte die Silberhaarige auf den Jungen herab, der sich wieder an ihre Seite wühlte. „Unsere Gäste müssen eine Weile in der Quarantänezone bleiben. Und Blance, Hensley und Jadie mit ihnen, als Kontaktpersonen.“
„Aber seien Sie unbesorgt“, mischte sich der Commodore wieder ein, indem er zuerst Awakandra, dann Garanau ins Gesicht sah. „Wir haben Ihre Zone so großzügig angelegt wie nur möglich. Leider ist dies nach wie vor ein Kriegsschiff und etwas beengt. Zögern Sie also bitte nicht, uns zu sagen, wenn Sie etwas brauchen.“
Mit einem Räuspern zog Garanau Awakandras Aufmerksamkeit auf sich. Sie warf ihm ein entschuldigendes Lächeln zu und trat wieder hinter ihn als ihren Herold zurück.
„Die Älteste Blance war bereits so gütig, uns über diese Maßnahme in Kenntnis zu setzen“, nahm Garanau das Wort wieder an sich. „Wie lange wird sie andauern?“
„Sechs Wochen“, antwortete die silberhaarige Heroldin. „So lange braucht es leider, bis die Impfungen wirken, die unsere Ärzte euch geben werden.“
Garanau runzelte die Stirn. Wochen? Wie lang ist das?“
„Verzeihung“, lächelte die Silberhaarige. „Ich vergaß. Sechs Wochen unserer Zeitrechnung entsprechen etwa fünf Pentaden der Euren. In dieser Zeit werdet ihr auch Gelegenheit haben, euch an die Länge unserer Tage zu gewöhnen.“
Tage von anderer Länge? „Impfungen“? In Garanaus Kopf stauten sich die Fragen und ehe es ihm gelang, eine davon zu formulieren, hatte der Commodore wieder das Wort ergriffen: „Nach Ablauf dieser Zeit wird es einen offiziellen Empfang geben, vor den Augen der gesamten Crew und mit einem gemeinsamen Bankett. Ich bedaure, dass wir Ihnen das nicht jetzt schon bieten können, aber für eine Reise auf einem Sternenklipper müssen Sie vorbereitet sein.“
Garanau dachte an den Ritt in der kleinen Himmelsbarke – die bleierne Schwere zu Beginn, das Gefühl des Fallens in der Mitte und am Ende – und unwillkürlich drängte sich ihm die Frage auf, welche Torturen ihn beim Flug mit diesem gewaltigen Himmelsschiff erwarten mochten. So beschränkte er seine Reaktion auf ein Nicken.
Mit einem Seitenblick auf den Commodore hob erneut die Silberhaarige die Hand. „Ehrenwerter Garanau“, sprach sie ihn an. „Erlauben es die Sitten eures Volkes, dass wir nun ein paar Worte an unsere eigenen Gesandten richten?“
Wenigstens sie war um Wahrung der Form bemüht, soviel musste Garanau anerkennen. So drehte er sich zur Seite, um zwischen sich und Awakandra eine Handbreit Platz zu öffnen.
„Mutter Hensley“, sprach der Commodore an ihm vorbei, „Ihre Vorgesetzten haben mich autorisiert, Ihnen mitzuteilen, dass Sie für die Dauer der Quarantäne von Ihren Pflichten als Proskopin freigestellt sind. Danach wird verhandelt werden, ob der Abbruch Ihres Aufenthalts auf Magellan in irgendeiner Form geahndet werden muss.“
„Danke, Commodore“, kam es gewohnt ausdruckslos von Hensley. „Auch wenn ich es vorziehen würde, über diesen Punkt so schnell wie möglich Klarheit zu haben.“
„Offenbar wollen Ihre Vorgesetzten die Angelegenheit lieber gründlich beurteilen als schnell. Sie gestehen Ihnen die vollen sechs Wochen zu, um Ihren Bericht über Ihren Aufenthalt abzufassen ... und über die Umstände, unter denen Sie Magellan verlassen haben.“
Hensley nickte nur.
„Dann, meine Damen, meine Herren“, wandte sich der Commodore mit einem plötzlichen Strahlen an sie alle, „habe ich Ihnen eine erfreuliche Mitteilung zu machen: Fähnrich Skayle lebt und befindet sich in diesem Augenblick auf dem Rückweg zur Wahrhaftigkeit.“
Wäre in ihrer Mitte der Blitz eingeschlagen, die Wirkung hätte nicht größer sein können. Garanau selbst erstarrte vor Staunen; auf den Gesichtern von Skayles Gefährtinnen – andeutungsweise sogar auf Hensleys – malte sich ungläubige Freude.
„Onkel Skayle lebt?!“
Das Jauchzen des kleinen Yuran löste den Bann. Für einen Moment riefen Jadie, Blance und sogar Hensley ihre Fragen wild durcheinander. Selbst, nachdem der Commodore abwehrend beide Hände gehoben hatte, dauerte es einen Moment, bis das Geplapper abebbte.
„Sie werden die Einzelheiten schon bald erfahren“, erklärte er schmunzelnd. „Es war übrigens diese Neuigkeit, die uns auf dem Weg hierher aufgehalten hat. Und sie betrifft auch Sie, Erwählte Awakandra.“
„Diese Nachricht erfreut mich in der Tat, ehrenwerter Commodore“, erwiderte Awakandra mit hörbarer Erleichterung. „Skayles Freundlichkeit als Gesandter gereichte deinem Fähnlein ebenso zur Ehre wie sein Mut als Krieger. Ich hätte ihn in der Tat betrauert, wäre er verloren gewesen.“
„Das freut mich zu hören“, sagte der Commodore. „Doch die Neuigkeit betrifft Sie auch in anderer Hinsicht. Fähnrich Skayle kommt nicht allein zurück an Bord.
Er ist in Begleitung Ihrer Tochter.“
2
Die Sanitäter der Union ließen nichts zu wünschen übrig. Sobald Loralys den Kopf aus der Schleusenluke streckte, fand sie sich in einer Schleierkabine aus bläulichem Licht wieder, auf deren Seiten grell die Aufschrift „DEKONTAMINIERT“ leuchtete – die sie von innen natürlich in Spiegelschrift las. Sechs Mann in blauen Schutzanzügen umringten sie; die eine Hälfte mit Medikamentenschachteln, Injektoren und einem Sammelsurium von Apparaten, die andere mit griffbereiten Schockern.
„Mach dich bereit, Awakeena!“, rief sie in die Luke hinab. „Schließ die Augen und atme ganz ruhig!“
„Jawohl, erha-... Loralys“, tönte es kläglich von unten.
Ein letztes Mal genoss Loralys das Gefühl, die Kontrollen ihrer eigenen Schleiertasche zu bedienen. Weich und fließend fühlte sich das Bedienfeld unter der Geste an, mit der sie den Transportkokon erzeugte und zu sich nach oben zog. Fast sofort kam Awakeena aus der Luke emporgeschwebt, die Augen fest zusammengekniffen, beide Fäuste auf den Magen gedrückt.
„In Ordnung, Sie können rein“, wandte sich Loralys an den nächststehenden Sanitäter, während sie den Kokon auflöste und Awakeena um die Schultern fasste. „Fähnrich Skayle liegt noch im Dämpfungsfeld.“
Als der Mann einen Schritt in die Lukenöffnung tat und sich fallenließ, trat einer der Bewaffneten mit ausgestreckter Hand auf sie zu. „Willkommen zurück, Miss Loralys“, tönte eine vertraute, freundliche Altstimme aus dem Helmlautsprecher; als Loralys genauer hinsah, erkannte sie hinter dem spiegelnden Visier das Gesicht von Private Reon. „Ich muss Sie leider bitten, Ihre Schleiertasche wieder abzugeben.“
„Natürlich“, lächelte Loralys und ließ Awakeena behutsam los, um sich die Tasche von der Hüfte zu lösen. Sekundenlang verharrte sie mit dem Gerät in Händen, betrachtete wehmütig das silberne GalaxisEmblem auf der roten Hülle, strich liebevoll mit den Fingern darüber; dann legte sie es in den Handschuh von Private Reon.
Ein Keuchen zog ihre Aufmerksamkeit zurück zu der schwankenden Awakeena. Als Loralys sie festhielt, umklammerte die Gottestochter ihren Oberarm wie eine Ertrinkende ein Stück Treibholz. „Loralys“, keuchte sie, „was ist das? Wir fallen nicht mehr, aber mir ist noch immer, als würde ich ... rutschen, einen steilen Hang hinab schlittern...“
„Ruhig, Awakeena.“ Loralys tätschelte ihr die Schulter. „Wir sind nah an der Achse des Schiffs. Hier ist alles nicht einmal ein zehntel so schwer wie normal.“
Zum Glück für Skayle, fügte sie innerlich hinzu, als der noch immer bewusstlose Rückkehrer des Missionsteams aus der Luke herausgeschwebt kam. Ihn liegend unter voller Schwerkraft aus dem Shuttle zu bringen, wäre um einiges aufwendiger gewesen. Bei weniger als einem zehntel g konnten sie den Verletzten ohne weiteres kurz hochkant stellen und durch die Deckenluke schieben.
Trotzdem brachten sie ihn als erstes in die liegende Position, sobald er sich ganz im Gang befand. „Ist inzwischen geklärt, wohin wir ihn bringen sollen?“, fragte der Sanitäter, der ihm durch die Luke nachfolgte.
Ja, zur Krankenstation im Fock-Ring“, antwortete ein anderer.
„Was denn, jetzt doch? Obwohl die zur Quarantänezone für die Besucher gehört?“
Der andere hob die Schultern, sodass es selbst im bauschigen Schutzanzug erkennbar war. „Anordnung von Dr. Mandrin.“
„Und Captain Caldore?“
„Hat ihm bislang zumindest nicht widersprochen.“
Während sie redeten, war einer der Bewaffneten, der das Abzeichen eines Sergeant am Kragen trug, durch die Luke abgetaucht, nur um wenige Sekunden später mit zerfledderten Fetzen goldenen Stoffes in der Hand wieder heraufzukommen. „Haben Sie eine Erklärung hierfür?“, wandte er sich grimmig an Loralys.
Sie zuckte die Achseln und konzentrierte sich ansonsten darauf, die bebende Awakeena an sich zu drücken. „Ich musste mich unterwegs sehr schnell umziehen“, erklärte sie. „Da war es am einfachsten, das Kleid mithilfe des Bordschleiers aufzureißen.“
„Warum diese Eile?“, fragte der Sergeant kühl.
Loralys seufzte. „Weil meine Zeit unmittelbar nach dem Start dafür draufging, einen Schwerverletzten und eine total verstörte Passagierin zu betreuen. A propos, können wir bitte zügig zu dieser Quarantänezone aufbrechen?“ Beruhigend streichelte sie Awakeena über den Arm.
„Fähnrich Skayle und unser ... Gast brechen gleich zur Quarantänezone auf, erklärte der Sergeant entschieden. „Sie gehen zurück in Ihr Quartier!“
Ruckartig riss Awakeena den Kopf in die Höhe, um den Mann aus panisch geweiteten Augen anzustarren. „Nein!“, entfuhr es ihr schrill. „Nein, bitte trennt mich nicht von ihr! Ich flehe euch an!“
Einen langen Augenblick fühlte Loralys nur ihren eigenen, jagenden Puls in der Kehle, während die spiegelnde Visierscheibe des Sergeant starr auf sie gerichtet blieb.
Dann trat er einen halben Schritt zurück und tippte sich auf Höhe des Ohrs an den Helm. „Commander Dr. Mandrin für Security fünf, kommen!“
Während der Sergeant neue Befehle einholte, fragte Reon: „War mit Ihrem Kleid alles in Ordnung?“
„Alles bestens“, nickte Loralys. „Tut mir leid, dass ich es zerstören musste, aber Sie haben ja mitbekommen ...“
Reon winkte ab. „Kein Problem. Ich hatte sowieso Befehl, es nach Gebrauch zu vernichten. Und wir können es Ihnen jederzeit neu erzeugen, wir kennen ja jetzt Ihr Dateiformat.“ Der Helm ruckte kurz deutend in Skayles Richtung. „Danke, dass Sie ihn rausgeholt haben! Ich werde es Ihnen nicht vergessen.“
Loralys warf einen Blick auf die liegende Gestalt, die von den umeinanderschwärmenden Sanitätern größtenteils verdeckt wurde. „Schon gut ...“, erwiderte sie zögernd. „Ich war ihm das schuldig ...“
„Also schön“, meldete sich der Sergeant mit deutlichem Widerstreben in der Stimme erneut zu Wort. „Miss Loralys, Sie dürfen Ihre Passagierin bis zur Quarantänezone begleiten.“
„Du hast es gehört, Awakeena“, sagte Loralys beruhigend zu dem zitternden Mädchen in ihrem Arm. „Ich bleibe bei dir.“
„Okay“, rief einer der Sanitäter. „Transportbereit.“ Skayle schwebte nun in Hüfthöhe waagerecht auf einer durchscheinend blauen Schleierliege. Kleine Sensorwürfel hingen überall an seinem Körper wie terranische Blutegel. Die Luft über ihm schwirrte vor Anzeigefenstern mit Zahlen und Diagrammen.
Als sich auf eine Geste des Sergeant hin die dekontaminierte Schleierkabine mitsamt allen ihren Insassen in Bewegung setzte und den Korridor entlangzugleiten begann, vergrub Awakeena das Gesicht an Loralys’ Brust.
Zufrieden lächelte Loralys.
Ihre Zufriedenheit hielt an, bis sie die Quarantänezone erreichten. Als sich die Kabine nach zwei Umformungen – zuerst beim Eintritt in den Liftschacht, dann zur Anpassung an den Habitatring – ihrem Ziel näherte, sahen ihr von der Grenzlinie her zwei Gestalten entgegen. Die Kleinere war eine Frau Mitte dreißig, mit dem gleichen schwarzen Haar und bronzenen Teint wie Awakeena; allerdings hatte sie im Gegensatz zu dem zierlichen Mädchen eine eher pummelige Figur, die auch das weite, blau-beige gemusterte Gewand nicht ganz verbergen konnte, das sie gemäß magellanischer Mode als vornehme Persönlichkeit auszeichnete.
Die Größere trug zwar noch immer eine hellblaue Tunika und knielange, weiße Hosen nach Machart von Qatuacra, aber am Gürtel Schleiertasche und Schocker. Loralys erkannte „Kupferbiest“ Jadie, noch ehe sich das Gesicht der zickigen Pilotin unter dem Oberhorizont hervorschob.
An der Grenzlinie kam die Kabine zum Stillstand. Als sich ihre Vorderfront auflöste, um mit der Barriere der Quarantänezone zu verschmelzen, drückte sich Awakeena mit einem erneuten Keuchen an Loralys. Bevor irgendjemand ein Wort sagen konnte, hasteten die Sanitäter schon mit dem liegenden Skayle durch die erste Tür auf der linken Seite.
„Awakeena, mein Kind!“ Die pummelige Frau streckte ihre Arme nach ihr aus. „Komm zu mir!“
Widerstrebend drehte Awakeena das Gesicht weit genug von Loralys’ Schulter weg, um unter ihren schwarzen Strähnen hindurch nach der Frau zu spähen. „Mutter?“, wimmerte sie. „Bist das wirklich du?“
„Wie kannst du das fragen?!“ Die Stimme der Frau klang belegt. „Wer sollte ich sonst sein?“ Zögernd trat sie einen Schritt näher, die Arme noch sehnsüchtiger ausgestreckt. „Bitte, komm zu mir!“
„Sie ist es wirklich“, raunte Loralys. „Geh ruhig.“
Erst auf diese Worte hin löste Awakeena sich zögernd von ihr, verharrte aber immer noch mit den Fingerspitzen an ihrer Schulter. Nicht einmal das lange, rote Kleid konnte ihre weichen Knie verbergen, als sie mit schrillem Unterton fragte: „Wie kannst du an diesem Ort so ohne Furcht sein?“
Überrascht sah die Frau ihre Tochter an, ehe sie mit schwachem Lächeln einen Blick zur Panoramascheibe hinauswarf. Hinter dem G-Gerüst, in dem sich gerade ein Montageteam tummelte, drehte sich gleichförmig das All.
„Ich fürchte mich“, erwiderte sie endlich. „Aber ich wusste schon vorher genug über diesen Ort, um zu begreifen, dass meine Furcht allein meiner Unwissenheit entspringt. Bitte, Awakeena, komm zu mir und ich erkläre dir alles!“ Sie schluckte. „Komm zu deiner Mutter!“
Endlich ließ Awakeena auch die letzte Berührung ihrer Göttin fahren und stolperte auf zitternden Beinen auf ihre Mutter zu, die atemlos jeden ihrer zögernden Schritte verfolgte wie einen Countdown. Als Awakeena ihr mit lautem Aufschluchzen in die Arme sank, liefen der Frau die Tränen.
„Die Hargit-nal-Raja ...“, wandte sich Awakeenas Mutter endlich erstickt an Loralys. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll ...“
Kühl musterte Loralys das runde Gesicht der Frau und verwarf in ihrem Hinterkopf Antworten wie: Du solltest mich ,erhabene Unsterbliche“ nennen und mir auf Knien ein Dankgebet darbringen, dass ich dir deine Tochter gebracht habe! oder: Du undankbare Verräterin solltest mir erst einmal erklären, wie du als Erwählte eines Gottes dich freiwillig zu den Dämonen begeben konntest!
„Ein einfaches ,Danke“ genügt“, sagte sie endlich schroff.
Die Frau nickte vorsichtig. „Danke“, echote sie und vergrub noch einmal die Nase im schwarzen Haar ihrer Tochter, ehe sie sich behutsam mit ihr umwandte. „Komm mit, Awakeena“, sagte sie zärtlich. „Ich zeige dir, wo wir hier untergebracht sind ..."
Einige Sekunden sah Kupferbiest ihnen hinterher, ehe sie den Blick auf Loralys richtete. „Ich soll Ihnen mitteilen“, erklärte sie steif, „dass Sie in der Quarantänezone der Sicherheitsstufe 3C unterliegen werden, wohingegen Sie in Ihrem alten Quartier wieder auf 2A herabgestuft würden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.“
Loralys runzelte die Stirn. „Das bedeutet, Sie bieten mir mehr Bewegungsfreiheit, wenn ich mich dafür von der Quarantänezone fernhalte?“
„Wenn Sie es so formulieren wollen“, nickte Kupferbiest.
Nach kurzem Überlegen schüttelte Loralys den Kopf. „Danke, aber Awakeena braucht mich. Ich ziehe es vor, in ihrer Nähe zu bleiben.“
„Wie Sie wollen“, meinte Kupferbiest achselzuckend und wandte sich an ihr vorbei an die Eskorte: „Ich bin bereit, die Gefangene zu übernehmen.“
„Gefangene ist übergeben, Ma’am“, schnarrte hinter ihr der Sergeant.
Kupferbiest trat zur Seite und deutete mit einer auffordernden Kopfbewegung den Korridor entlang.
Kaum dass Loralys an ihr vorübergeschritten war, vergewisserte sie sich mit einem Blick über die Schulter, dass die andere ihr dichtauf folgte. Aus dem Augenwinkel sah sie die Kabine sich auflösen und die Filterbarriere der Quarantäne zone flirrend in ihre vorherige Position schnappen. Zu Fuß begaben sich die Wachen in ihren Schutzanzügen auf den Rückweg den Korridor entlang.
Das angespannte Schweigen hielt ein paar Sekunden, bis Kupferbiest es überraschend brach: „Eine Frage, Miss – Wie haben unsere Vorgesetzten Sie dazu gebracht?““
„Bitte?“ Verwirrt blickte Loralys erneut über die Schulter zurück.
„Skayle rauszuholen.“ Es fiel Kupferbiest sichtlich schwer, diese Frage hervorzupressen. „Was haben Caldore und Mandrin und unser ganzer Stab mit Ihnen angestellt, dass Sie den Job übernommen haben?“
Stirnrunzelnd blickte Loralys in diese blauen Augen, ohne darin die gewohnte Feindseligkeit zu finden. Für einen Moment erschien es ihr, als sei Fähnrich Jadie aufrichtig an ihren Beweggründen interessiert.
Sie überspielte ihre Überraschung mit einem ironischen Lächeln. „Wenn Ihre Vorgesetzten Sie nicht darüber informiert haben“, erwiderte sie kühl, „dann steht es mir als Gefangener wohl kaum zu, mich über diese Entscheidung hinwegzusetzen.“
Sekundenlang musterte Jadie sie neutral, ehe sie mit einem Schnauben zurück zur vertrauten, verächtlichen Miene wechselte. „Wie Sie meinen“, knurrte sie. Die nächsten beiden Worte klangen wie hochgewürgt: „Trotzdem danke.“