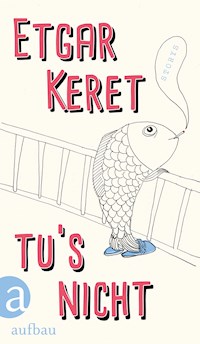8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Von all den großartigen Büchern, die Etgar Keret geschrieben hat, ist das sein allerbestes.« Jonathan Safran Foer.
Mit einer grandiosen Kurzgeschichtensammlung meldet sich der israelische Meistererzähler Etgar Keret zurück. Wir begegnen einem sprechenden Goldfisch, der Wünsche erfüllt, einem pathologischen Lügner, der feststellen muss, dass alle seine Lügen wahr sind, und einer Frau, die einen Reißverschluss im Mund ihres Geliebten entdeckt. Etgar Keret kondensiert ganze Leben in ein paar Sätze, witzig, überraschend, immer zugleich surreal und nah an der Wirklichkeit. Er schreibt über Nostalgien und Sehnsüchte – mit unwiderstehlicher Phantasie und großer menschlicher Tiefe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
»Von all den großartigen Büchern, die Etgar Keret geschrieben hat, ist das sein allerbestes.« Jonathan Safran Foer.
Mit einer grandiosen Kurzgeschichtensammlung meldet sich der israelische Meistererzähler Etgar Keret zurück. Wir begegnen einem sprechenden Goldfisch, der Wünsche erfüllt, einem pathologischen Lügner, der feststellen muss, dass alle seine Lügen wahr sind, und einer Frau, die einen Reißverschluss im Mund ihres Geliebten entdeckt. Etgar Keret kondensiert ganze Leben in ein paar Sätze, witzig, überraschend, immer zugleich surreal und nah an der Wirklichkeit. Er schreibt über Nostalgien und Sehnsüchte – mit unwiderstehlicher Phantasie und großer menschlicher Tiefe.
»Und Gott schuf Etgar Keret, den besten Kurzgeschichten-Autor seit Kafka und Hemingway.« Maxim Biller
Über Etgar Keret
Etgar Keret, geboren 1967 in Ramat Gan, Israel, ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller Israels. Er gilt als Meister der Kurzgeschichte, seine Short-Story-Bände sind in Israel Bestseller und werden in 40 Sprachen übersetzt. Sein neuester Band »Tu's nicht« wurde mit dem National Jewish Book Award ausgezeichnet. Etgar Keret schreibt auch Drehbücher und Graphic Novels. Er lebt mit seiner Familie in Tel Aviv. Mehr zum Autor unter www.etgarkeret.com.
Barbara Linner, geboren 1955 in München, studierte Judaistik, Orientalistik und südosteuropäische Geschichte. Sie ist Übersetzerin von u. a. David Grossman, Assaf Gavron und vielen anderen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Etgar Keret
Plötzlich klopft es an der Tür
Storys
Aus dem Hebräischen von Barbara Linner
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Plötzlich klopft es an die Tür
Lügenland
Jesus Christ
Simion
Mit geschlossenen Augen
Gesundheitsfrühstück
Ein Team
Pudding
Gerade in der letzten Zeit steht er mir aber
Der Stich
Der höfliche Junge
Mystique
Kreatives Schreiben
Schnupfen
Den Kukuriku beim Schwanz packen
Wähl eine Farbe
Der blaue Fleck
Was haben wir in den Taschen?
Schlechtes Karma
Ilan
Die Hündin
Eine schlagende Geschichte
Eine schlagende Geschichte II
Eine satte Portion
Das Überraschungsei
Der Goldfisch
Nicht ganz allein
Nach dem Ende
Ein großer blauer Autobus
Die Hämorride
September das ganze Jahr
Dschouzef
Das Trauermahl
Mehr Leben
Paralleluniversen
Aufwertung
Die Guajave
Das Überraschungsfest
Welches Tier bist du?
Quellennachweis
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Plötzlich klopft es an die Tür
Lügenland
Jesus Christ
Simion
Mit geschlossenen Augen
Gesundheitsfrühstück
Ein Team
Pudding
Gerade in der letzten Zeit steht er mir aber
Der Stich
Der höfliche Junge
Mystique
Kreatives Schreiben
Schnupfen
Den Kukuriku beim Schwanz packen
Wähl eine Farbe
Der blaue Fleck
Was haben wir in den Taschen?
Schlechtes Karma
Ilan
Die Hündin
Eine schlagende Geschichte
Eine schlagende Geschichte II
Eine satte Portion
Das Überraschungsei
Der Goldfisch
Nicht ganz allein
Nach dem Ende
Ein großer blauer Autobus
Die Hämorride
September das ganze Jahr
Dschouzef
Das Trauermahl
Mehr Leben
Paralleluniversen
Aufwertung
Die Guajave
Das Überraschungsfest
Welches Tier bist du?
Quellennachweis
Impressum
Für Schira
Plötzlich klopft es an die Tür
»Erzähl mir eine Geschichte«, befiehlt der bärtige Mann, der bei mir im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt. Die Lage, ich gestehe es, ist nicht gerade erfreulich für mich. Ich schreibe schließlich Geschichten, ich erzähle sie nicht. Und auch das mache ich nicht auf Bestellung. Der letzte Mensch, der mich gebeten hat, ihm eine Geschichte zu erzählen, war mein Sohn. Das war vor einem Jahr. Ich habe ihm etwas von einer Fee und einer Wühlmaus erzählt, ich weiß nicht mal mehr, was, und nach zwei Minuten ist er eingeschlafen. Doch hier ist die Lage wesentlich anders geartet. Denn mein Sohn hat keinen Bart. Und keine Pistole. Denn mein Sohn hat um die Geschichte hübsch gebeten, während dieser Mann einfach versucht, sie mir zu rauben.
Ich versuche dem Bärtigen zu erklären, dass es sich, wenn er die Pistole in die Tasche zurücksteckte, nur zu seinen Gunsten auswirken würde. Zu unseren Gunsten. Es ist schwierig, eine Geschichte zu erfinden, wenn dir die Mündung einer geladenen Pistole auf den Kopf zielt. Aber der Kerl bleibt stur. In diesem Staat, erklärt er, musst du, wenn du was willst, es mit Gewalt einfordern. Er ist ein Neueinwanderer aus Schweden. In Schweden ist das völlig anders. Dort bittet man, wenn man was will, höflich darum, und meistens kriegt man es auch. Aber in dieser dampfenden und erstickenden Levante ist das nicht so. Eine Woche hier reicht dir aus, um zu verstehen, wie es funktioniert. Oder richtiger gesagt, um zu kapieren, wie es nicht funktioniert. Die Palästinenser haben hübsch um einen Staat gebeten. Haben sie was gekriegt? Einen Scheißdreck haben sie gekriegt. Haben sie sich darauf verlegt, Kinder in Bussen in die Luft zu jagen, und plötzlich fing man an, ihnen zuzuhören. Die Siedler wollten, dass man den Dialog mit ihnen aufnimmt. Hat man? Einen feuchten Dreck hat man. Haben sie rumgeprügelt, ein bisschen kochendes Öl auf Grenzwächter gekippt, und auf einmal hat man angefangen, ihnen entgegenzukommen. Dieser Staat ist ein Staat, der nur Gewalt versteht, egal, ob von Politik, Wirtschaft oder einem Parkplatz die Rede ist. Bloß Gewalt verstehen wir hier.
Schweden, von wo aus der Bärtige die Einwanderung nach Israel gemacht hat, ist ein fortschrittlicher Ort, erfolgreich auf nicht gerade wenigen Gebieten. Schweden ist nicht bloß Abba und Ikea und Nobelpreis. Schweden, das ist eine volle Welt, und alles, was sie erreicht haben, haben sie ausschließlich auf sanften Wegen erreicht. In Schweden, wenn er zum Haus der Solistin von Ace of Base gehen, an die Tür klopfen und darum bitten würde, dass sie ihm ein Lied vorsingt, würde sie ihm ein Glas Tee machen, eine Akustikgitarre unterm Bett rausziehen und für ihn spielen. Und das alles mit einem Lächeln. Aber hier? Wenn er keine Pistole in der Hand hätte, würde ich ihn doch bloß sämtliche Treppen hinunterwerfen.
»Schauen Sie«, versuche ich einzuwenden.
»Nichts da mit schauen Sie«, knurrt der Bärtige und spannt den Abzug, »entweder eine Geschichte oder eine Kugel in den Kopf.« Ich begreife, dass mir keine Wahl bleibt. Dem Kerl ist es absolut ernst.
»Zwei Menschen sitzen in einem Raum«, fange ich an, »und plötzlich hört man ein Klopfen an der Tür.« Der Bärtige richtet sich gespannt auf. Für einen Moment kommt mir vor, die Geschichte habe ihn gepackt, aber nein, die ist es nicht. Er horcht auf etwas anderes. Jemand klopft wirklich an die Tür.
»Mach auf«, sagt er zu mir, »und probier ja nichts. Bring ihn so schnell wie möglich weiter, sonst wird das böse enden.« Der junge Mann an der Tür ist von einer Meinungsumfrage. Er hat ein paar Fragen. Kurze. Zur hohen Feuchtigkeit hier im Sommer und dazu, wie sie sich auf meine Nerven auswirkt. Ich sage ihm, dass ich nicht interessiert bin, an der Umfrage teilzunehmen, aber er drängt sich trotzdem in die Wohnung.
»Wer ist das?«, fragt er mich und deutet auf den Bärtigen.
»Das ist mein Neffe aus Schweden«, lüge ich. »Er ist hergekommen, um seinen Vater zu beerdigen, der durch eine Schneelawine getötet wurde. Wir gehen gerade das Testament durch. Wären Sie bitte bereit, unsere Privatsphäre zu respektieren und zu gehen?«
»Is ja schon gut«, klopft mir der Meinungsforscher auf die Schulter, »doch bloß ein paar Fragen, gib deinem Bruder eine Chance, sich zu ernähren. Sie zahlen mir pro Kopf.« Er lümmelt sich mit seinem Ordner auf das Sofa. Der Schwede setzt sich neben ihn. Ich stehe noch, versuche entschieden zu klingen.
»Ich bitte Sie zu gehen«, sage ich zu ihm, »Sie sind zu einer ungünstigen Zeit gekommen.«
»Ungünstig, eh?« Der Meinungsforscher zieht einen Trommelrevolver aus dem Ordner. »Warum denn ungünstig, weil dein Bruder Orientale ist? Für Schweden, wie ich sehe, hast du ein Meer von Zeit. Aber für einen Marokkaner, einen entlassenen Soldaten, der ein Stück von seiner Milz im Libanon gelassen hat, für einen Kameraden hat man nicht mal ne Minute übrig.« Ich versuche ihm zu erklären, dass dem so nicht ist. Dass er mich einfach in einem delikaten Augenblick mit diesem Schweden erwischt hat. Aber der Meinungsforscher nähert den Revolverlauf seinen Lippen, signalisiert mir, den Mund zu halten. »Marschmarsch, allez-hopp«, sagt er, »nix mit Ausreden. Setz dich hier in den Sessel, und fang an auszuspucken.«
»Was ausspucken?«, frage ich. Die Wahrheit ist, dass ich jetzt langsam echt in Stress komme. Auch der Schwede hat eine Schusswaffe, es könnte hier eine Spannung entstehen, Ost-West und solches Zeug, Mentalitätsunterschiede. Oder er könnte einfach bloß so explodieren, weil er die Geschichte nur für sich selber, solomäßig, wollte.
»Leg dich nicht mit mir an«, droht der Meinungsforscher, »ich hab ne kurze Lunte. Nu, spuck schon aus, irgendeine Geschichte, ticketacke.«
»Ja«, schließt sich ihm der Schwede in überraschender Harmonie an, und auch er richtet seine Waffe auf mich. Ich räuspere mich und fange wieder an:
»Drei Menschen sitzen in einem Raum …«
»Und ohne ›plötzlich klopft es an der Tür‹«, fährt der Schwede warnend dazwischen. Der Meinungsforscher versteht nicht genau, was er damit meint, aber er springt auf die gleiche Welle mit auf.
»Wallah«, sagt er, »ohne Türklopfen. Erzähl was anderes. Was Überraschendes.« Ich schweige einen Moment, hole Luft. Beider Blick ist auf mich konzentriert. Wie kommt es nur, dass ich immer in solche Situationen gerate? Einem Amos Oz oder Grossman würde das nie im Leben passieren. Plötzlich ist ein Klopfen an der Tür zu hören. Ihr Blick wird konzentriert drohend. Ich zucke mit den Achseln. Das bin schließlich absolut nicht ich. Es gibt überhaupt nichts in meiner Geschichte, das mit diesem Klopfen in Zusammenhang steht.
»Werd ihn los«, befiehlt mir der Meinungsforscher, »werd ihn los, wer immer das auch ist.« Ich öffne die Tür nur einen Spalt. Ein Pizzabote steht dort.
»Bist du Keret?«, fragt er.
»Ja«, sage ich, »aber ich habe keine Pizza bestellt.«
»Bei mir steht hier, Zamenhoff vierzehn«, er wedelt mir mit einem Zettel vor der Nase herum und drängelt sich hinein.
»Das mag ja da stehen«, sage ich, »aber ich habe überhaupt keine Pizza bestellt.«
»Familienausgabe«, beharrt er. »Halb Ananas, halb Sardellen. Ist schon bezahlt. Mit Karte. Gib mir bloß ein Trinkgeld, und weg bin ich.«
»Bist du auch wegen der Geschichte hier?«, forscht der Schwede.
»Was für eine Geschichte?«, fragt der Bote. Man sieht, dass er schwindelt, er ist nicht besonders gut darin.
»Hol ihn raus«, wirft ihm der Meinungsforscher zu, »nu, hol schon den Revolver raus.«
»Ich hab keinen Revolver«, gesteht der Bote und deckt unter seinem Pizzapappkarton ein langes Schlachtermesser auf. »Aber ich schneid ihn in Scheibchen wie eine Pastrami, wenn er mir hier jetzt nicht gleich irgendein Geschichtchen vorsingt.«
Die drei sitzen auf dem Sofa. Der Schwede rechts, neben ihm der Bote, links der Meinungsforscher.
»Ich kann so nicht«, sage ich zu ihnen, »da kommt einfach keine Geschichte raus, wenn ihr drei mit der Waffe und dem Ganzen hier seid. Geht raus, dreht mal eine kleine Runde, und bis ihr zurückkommt, werde ich schon irgendwas fertig haben.«
»Der Scheißkerl wird die Polizei rufen«, sagt der Meinungsforscher zum Schweden, »was meint der denn, dass wir von gestern sind?«
»Nu, jetzt rück schon eine raus, und dann gehen wir«, fleht der Bote, »eine, eine kurze. Sei kein Knauser. Es sind schwere Zeiten. Arbeitslosigkeit, Anschläge, Iraner. Die Leute sind gierig nach was anderem. Was, meinst du denn, hat uns, korrekte Normalbürger, so weit gebracht, bis hierher zu dir? Die Verzweiflung, Mann, die Verzweiflung.«
Ich nicke und fange wieder an.
»Vier Menschen sitzen in einem Raum. Es ist heiß. Langweilig. Die Klimaanlage läuft nicht. Einer von ihnen verlangt eine Geschichte. Der zweite und der dritte schließen sich ihm an …«
»Das ist keine Geschichte«, platzt der Meinungsforscher wütend dazwischen, »das ist ein Bericht. Das ist genau das, was hier jetzt passiert. Genau das, vor dem wir zu fliehen versuchen. Kipp doch die Wirklichkeit nicht so über uns aus wie ein Mülllaster. Wirf deine Phantasie an, Bruderherz, erfind was, lass es strömen, geh damit so weit wie möglich.« Ich fange erneut an.
»Ein Mann sitzt allein in einem Zimmer. Er ist einsam. Er ist Schriftsteller. Er will eine Geschichte schreiben. Sehr viel Zeit ist vergangen, seit er seine letzte Geschichte geschrieben hat, und er hat Sehnsucht. Sehnsucht nach diesem Gefühl, etwas aus etwas zu erschaffen. Ja, etwas aus etwas. Denn etwas aus nichts, das ist, wenn man was komplett erfindet. Das hat keinen Wert, ist auch nicht wirklich eine Kunst. Aber dieses gewisse Etwas-aus-Etwas, das ist, wenn du etwas entdeckst, das die ganze Zeit über in dir vorhanden war, es in einem Ereignis entdeckst, das nie passiert ist. Der Mann entschließt sich, eine Geschichte über die Lage zu schreiben. Nicht über die politische und auch nicht über die gesellschaftliche Lage. Er beschließt, eine Geschichte über die menschliche Lage zu schreiben. Die menschliche Lage, wie er sie in diesem Moment erlebt. Doch es kommt keine Geschichte. Denn die menschliche Lage, wie er sie in diesem Moment erlebt, ist anscheinend keine Geschichte wert. Er stellt sich schon darauf ein aufzugeben, als es plötzlich …«
»Ich hab dich echt schon gewarnt«, schneidet mich der Schwede ab, »ohne Türklopfen.«
»Ich muss aber«, beharre ich, »ohne Türklopfen keine Geschichte.«
»Lass ihn«, sagt der Bote sanft, »lass mal locker. Er will ein Türklopfen? Dann eben Türklopfen. Wenn er uns bloß endlich eine Geschichte serviert.«
Lügenland
Seine erste Lüge erfand Rubi, als er sieben war. Seine Mutter gab ihm einen alten zerknitterten Geldschein und bat ihn, ihr beim Krämer eine Schachtel lange Kent zu kaufen. Rubi kaufte sich ein Eis von dem Geld. Die Münzen, die er als Wechselgeld herausbekam, versteckte er unter einem großen weißen Stein im Hinterhof des Hauses, in dem sie wohnten, und als er zurückkam, erzählte er seiner Mutter, dass ihn ein furchterregender rothaariger Junge mit einem fehlenden Schneidezahn auf der Straße angehalten, ihm eine Ohrfeige verpasst und ihm den Geldschein abgenommen habe. Sie glaubte es. Und ab da hörte Rubi nicht mehr auf zu lügen. In der Oberstufe fuhr er nach Eilat und räkelte sich dort fast eine Woche am Strand, nicht bevor er dem Schulsekretär die Geschichte von einer Tante aus Be’er-Scheva angedreht hatte, die an Krebs erkrankt war. In der Armee war diese illusionäre Tante dann schon blind und half Rubi aus einem Schlamassel wegen unerlaubter Abwesenheit heraus, ohne Haft und sogar ohne Stubenarrest. In der Arbeit rechtfertigte er einmal eine zweistündige Verspätung mit der Lüge von einem Schäferhund, den er angefahren am Straßenrand gefunden und zum Tierarzt gebracht hatte. In der Lüge blieb der Hund an zwei Beinen gelähmt, und die Verspätung ging völlig glatt durch. Eine Menge Lügen produzierte Rubi Algrabli in seinem Leben. Lahme und Kranke, Gewalttätige und Böse, Lügen mit Beinen und auf Rädern, Lügen mit Jackett und mit Schnurrbart. Lügen, die er in Sekundenschnelle erfand, ohne jeden Gedanken daran, dass er ihnen irgendwann einmal wieder begegnen müsste.
Alles begann mit einem Traum. Ein kurzer und nicht besonders klarer Traum von seiner toten Mutter. Im Traum saßen sie beide auf einer Matte inmitten einer weißen, gestaltlosen Fläche, die wirkte, als beginne oder ende sie im Nirgendwo. Neben ihnen auf der endlosen weißen Fläche stand ein Kaugummiautomat von der alten Sorte mit dem durchsichtigen oberen Teil und einem Schlitz, in den man eine Münze einwarf, dann an dem Griff drehte und einen runden Kaugummi erhielt. Und in dem Traum sagte Rubis Mutter zu ihm, dass diese jenseitige Welt sie langsam wahnsinnig machte, denn es seien zwar gute Menschen hier, aber es gebe keine Zigaretten. Nicht bloß keine Zigaretten, auch keinen Kaffee, keinen Kanal 2, rein gar nichts. »Du musst mir helfen, Rubi«, sagte sie, »du musst mir einen Kaugummi kaufen. Ich habe dich großgezogen, Sohn. Diese ganzen Jahre habe ich dir alles gegeben und nichts verlangt. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, deiner alten Mutter etwas zurückzugeben. Kauf mir einen runden Kaugummi. Rot, falls möglich. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ein blauer rauskommt.« Im Traum durchwühlte Rubi immer wieder seine Taschen, suchte nach Münzen und fand keine.
»Ich kann nicht, Mama«, sagte er unter Tränen, »ich habe keine Münzen. Ich habe in allen Taschen gesucht.« Für jemand, der im Wachzustand nie weinte, war es seltsam, im Traum zu weinen.
»Hast du auch unter dem Stein gesucht?«, fragte seine Mutter und legte ihre Hand über die seine. »Vielleicht sind sie noch da?«
Und da wachte er auf. Es war Schabbat, fünf Uhr morgens, noch dunkel draußen. Rubi ertappte sich dabei, wie er ins Auto stieg und zu dem Ort fuhr, wo er als Kind aufgewachsen war. Am Schabbatmorgen, ohne Verkehr auf den Straßen, brauchte er weniger als zwanzig Minuten dorthin. Im Erdgeschoss des Gebäudes, wo einmal der Krämerladen von Pliskin gewesen war, hatte ein »Alles für 1 Dollar« aufgemacht, und daneben, anstelle des Schuhgeschäfts, befand sich jetzt die Filiale einer Mobiltelefongesellschaft, die im Schaufenster ein Display an aufgerüsteten Geräten anbot, als gebe es kein Morgen. Doch das Gebäude war gleich geblieben. Über zwanzig Jahre waren vergangen, seit sie weggezogen waren, aber man hatte es nicht einmal angestrichen. Auch der Hof war noch der gleiche, mit ein paar Blumen, einem Wasserhahn, einer verrosteten Wasseruhr und einer Menge Unkraut. Und in der einen Ecke des Hofes, neben der Wäschespinne, die sie jedes Jahr zum Fest zur Laubhütte umfunktioniert hatten, ruhte der weiße Stein.
Da stand er, im Hinterhof des Hauses, in dem er aufgewachsen war, mit Anorak und einer großen Plastiklampe in der Hand, und fühlte sich komisch. Halb sechs in der Früh, Schabbat. Wenn nun, sagen wir mal, irgendein Nachbar herauskäme, was würde er zu ihm sagen? Meine tote Mutter ist mir im Traum erschienen und hat mich gebeten, ihr einen runden Kaugummi zu kaufen, also bin ich hergekommen, um nach Münzen zu suchen? Es war seltsam, dass der Stein nach so vielen Jahren immer noch da war. Obwohl, wenn man es recht bedenkt, es ist ja nicht so, dass Steine von selber irgendwohin gehen. Er hob den Stein hoch, halb furchtsam, als könnte es sein, dass sich irgendein Skorpion darunter verbarg. Aber es befanden sich weder ein Skorpion oder eine Schlange noch Liramünzen darunter, nur ein Loch vom Durchmesser einer Pampelmuse, aus dem Licht fiel. Rubi versuchte, in das Loch hineinzuspähen, doch das Licht blendete ihn. Er zögerte eine Sekunde, und dann steckte er seine Hand hinein, den ganzen Arm, bis zur Schulter. Er legte sich flach auf die Erde und bemühte sich, etwas zu berühren. Den Boden des Lochs. Doch das Loch hatte keinen Boden, und das Einzige, das er zu fassen bekam, fühlte sich an wie kaltes Metall. Wie ein Griff. Ein Griff von einem Kaugummiautomaten. Rubi drehte mit aller Kraft daran und spürte, wie der Mechanismus nachgab. Jetzt war der Augenblick gekommen, in dem ein runder Kaugummi herausrollen sollte, den ganzen Weg aus den metallischen Eingeweiden des Automaten bis in den Handteller des aufgeregten Jungen, der ungeduldig darauf wartete. Jetzt war der Augenblick, in dem all das passieren musste. Aber es geschah nicht. In der Sekunde, in der Rubi die Drehung des Automatengriffs vollendet hatte, tauchte er da auf.
Dieses »da« war ein andrer, aber auch bekannter Ort. Der Ort aus dem Traum von seiner Mutter. Ganz und gar weiß, ohne Wände, ohne Boden, ohne Decke, ohne Sonne. Nur Weiß, und ein Kaugummiautomat. Ein Kaugummiautomat, und ein kleiner gedrungener, hässlicher rothaariger Junge, den Rubi beim ersten Blick irgendwie zu übersehen geschafft hatte. Und bevor Rubi dazu kam, den Jungen anzulächeln oder etwas zu sagen, trat ihm der Rotschopf auch schon mit aller Gewalt ans Bein, und er brach in die Knie. Jetzt, als er stöhnend vor Schmerzen auf den Knien hockte, befanden sich Rubi und der Junge genau auf gleicher Höhe. Der Rotschopf blickte Rubi in die Augen, und obwohl Rubi wusste, dass sie sich nie begegnet waren, hatte dieser Junge irgendwas Bekanntes.
»Wer bist du?«, fragte er den rothaarigen Jungen, der schnaufend vor ihm stand.
»Ich?«, lächelte der Rotschopf bösartig, wobei er einen fehlenden Schneidezahn entblößte. »Ich bin deine erste Lüge.«
Rubi versuchte aufzustehen. Das Bein, gegen das der Rotschopf getreten hatte, tat irrsinnig weh. Der Rotschopf selbst war schon längst davongerannt. Rubi begutachtete den Kaugummiautomaten aus der Nähe. Zwischen den runden Kaugummis versteckten sich halbtransparente Plastikkugeln, die Überraschungen enthielten. Er durchwühlte seine Taschen auf der Suche nach einer Münze, doch da fiel ihm ein, dass es dem rothaarigen Jungen gelungen war, ihm die Geldbörse wegzuschnappen, bevor er geflüchtet war. Rubi begann in eine ungewisse Richtung zu hinken. Da es auf der weißen Fläche keinerlei Anhaltspunkt außer dem Kaugummiautomaten gab, konnte er als Einziges bloß versuchen, sich von ihm zu entfernen. Alle paar Schritte drehte er den Kopf nach hinten, um sich zu vergewissern, dass der Automat tatsächlich kleiner wurde, bis er bei einem der Male, als er sich umschaute, einen Schäferhund und daneben einen mageren alten Mann mit einem Glasauge und zwei Handstümpfen erblickte. Den Hund erkannte er gleich an der Art, wie er sich halb kriechend fortbewegte, wobei seine Vorderbeine mit enormer Anstrengung sein gelähmtes Becken nachzogen. Es war der angefahrene Hund aus der Lüge. Der Hund, der vor Anstrengung und Aufregung hechelte, freute sich, ihn zu sehen. Er leckte Rubis Hand und fixierte ihn aus glänzenden Augen. Den mageren alten Mann konnte Rubi nicht identifizieren. Der Alte streckte den Haken, der an seinem rechten Handstumpf befestigt war, zu einem improvisierten Händedruck aus.
»Rubi«, sagte Rubi und nickte.
»Igor«, stellte sich der Alte vor und klopfte mit einem der Haken auf Rubis Rücken.
»Kennen wir uns?«, fragte Rubi nach einigen Sekunden schweigenden Zögerns.
»Nein«, sagte Igor und angelte sich die Hundeleine mit Hilfe eines seiner Haken, »ich bin wegen ihm hier. Er hat dich kilometerweit gerochen und war ganz aufgeregt. Wollte, dass wir kommen.«
»Dann haben ich und du also überhaupt nichts miteinander zu tun«, meinte Rubi mit einem Gefühl der Erleichterung.
»Ich und du?«, gab Igor zurück. »Wirklich gar nichts. Ich bin die Lüge von jemand anderem.« Rubi hätte Igor nur allzu gern gefragt, wessen Lüge er denn sei, doch er war sich nicht sicher, ob diese Frage hier höflich war. Überhaupt wollte er ihn fragen, was dieser Ort eigentlich genau war und ob es hier noch viele Leute gab oder Lügen, oder wie immer sie sich auch nennen mochten, aber er fürchtete, auch das wäre eine zu heikle Frage. Also streichelte er, anstatt zu reden, den verkrüppelten Hund von Igor. Der Hund war ein lieber Kerl. Es sah so aus, als freute er sich tatsächlich riesig, Rubi zu treffen, und Rubi hatte Mitleid mit dem invaliden Tier und fühlte sich schuldig, dass er keine weniger leidvolle und schmerzhafte Lüge erfunden hatte.
»Der Kaugummiautomat«, fragte er Igor nach einigen Minuten, »mit was für Münzen funktioniert er?«
»Liras«, antwortete der Alte.
»Da war vorher irgend so ein Junge da«, sagte Rubi, »hat mir die Geldbörse weggenommen. Aber auch wenn er sie mir gelassen hätte, wären keine Liras drin gewesen.«
»Ein Junge mit Zahnlücke?«, fragte Igor. »Dieser Schurke klaut von allen. Sogar dem Hund frisst er das Bonzo weg. Bei uns in Russland würde man ein solches Kerlchen in Unterhemd und Unterhose in den Schnee rausstellen und ihn erst wieder nach Hause lassen, wenn sein ganzer Körper blau angelaufen ist.« Igor deutete mit einem Haken auf seine hintere Hosentasche. »Da drinnen sind ein paar Liras. Nimm sie, ein Geschenk von mir.« Der betretene Rubi holte sich eine Liramünze aus Igors Tasche, und nachdem er sich bedankt hatte, versuchte er ihm als Gegengabe seine Swatchuhr anzubieten.
»Danke«, lächelte Igor, »aber für was brauche ich eine Plastikuhr? Außerdem, ich hab’s nie irgendwohin eilig.« Und als er sah, dass Rubi nach etwas anderem suchte, das er ihm stattdessen geben könnte, beruhigte er ihn schnell: »Ich bin dir sowieso schon was schuldig. Wenn deine Lüge von dem Hund nicht gewesen wäre, wäre ich hier total allein. Jetzt sind wir also quitt.« Rubi hinkte rasch in Richtung des Kaugummiautomaten zurück. Der Tritt des rothaarigen Jungen schmerzte immer noch, allerdings weniger. Er steckte die Lira in den Automaten, tat einen tiefen Atemzug, schloss die Augen und drehte schnell am Griff.
Er fand sich ausgestreckt auf dem Boden im Hof des alten Hauses wieder. Erstes Licht begann schon den Himmel in dunklen Blautönen zu färben. Rubi zog seine zur Faust geballte Hand aus dem tiefen Loch, und als er sie öffnete, entdeckte er einen runden, roten Kaugummi darin.
Bevor er ging, schob er den Stein an seinen Platz zurück. Er fragte sich nicht, was in dem Loch dort eigentlich genau passiert war, sondern stieg bloß ins Auto ein, schaltete in den Rückwärtsgang und fuhr weg. Den roten Kaugummi legte er unters Kissen, für seine Mutter, falls sie im Traum zurückkommen sollte.
In den ersten Tagen dachte Rubi noch eine Menge daran, an diesen Ort, an den Hund, an Igor, an seine anderen Lügen, die er zum großen Glück nicht getroffen hatte. Da war diese sonderbare Lüge, die er einmal Ruthi, seiner früheren Freundin, erzählt hatte, als er nicht zum Freitagabendessen bei ihren Eltern erschienen war, eine Lüge von seiner Nichte, die in Natania wohnte und mit einem gewalttätigen Mann verheiratet war, wie dieser gedroht hätte, sie umzubringen, und Rubi dort hinmusste, um die Gemüter zu beruhigen. Bis heute wusste er nicht, warum er diese abartige Geschichte erfunden hatte. Vielleicht dachte er damals, je komplizierter und schräger er etwas erfände, desto mehr würde sie ihm glauben. Es gibt Menschen, die, wenn sie nicht zum Freitagabendessen erscheinen, einfach sagen, dass sie Kopfschmerzen haben, aber bei ihm, wegen diesen Geschichten, lebten jetzt nicht weit von hier in irgendeinem Loch in der Erde ein wahnsinniger Ehemann und eine verprügelte Frau.
Er kehrte nicht zu dem Loch zurück, aber etwas von diesem Ort blieb in ihm zurück. Am Anfang log er noch weiter, aber solche positiven Lügen, wo nicht geschlagen, gehinkt oder an Krebs gestorben wurde. Er kam zu spät zur Arbeit, weil er die Blumentöpfe in der Wohnung seiner Tante gießen musste, die ihren erfolgreichen Sohn in Japan besuchen gefahren war; zu irgendeiner Feier wegen der Geburt einer Tochter kam er nicht, weil eine Katze fast vor seiner Tür geworfen hatte und er sich um die Jungen kümmern musste. Solche Sachen. Doch das Problem mit diesen ganzen positiven Lügen war, dass sie viel komplizierter zu erfinden waren. Wenigstens solche, die sich überzeugend anhörten. Überhaupt, wenn du den Leuten was Schlimmes erzählst, nehmen sie dir das sofort ab, das klingt normal für sie. Wenn du aber gute Sachen erfindest, tendieren sie zu Misstrauen. Und so stellte Rubi langsam und allmählich fest, dass er immer weniger log. Aus Faulheit hauptsächlich. Und mit der Zeit dachte er auch weniger an diesen Ort. An das Loch. Bis zu dem Morgen, an dem er auf dem Korridor Natascha vom Budget mit dem Abteilungsleiter reden hörte. Sie bat ihn, ihr für ein paar Tage dringend Urlaub zu geben, da ihr Onkel Igor einen Herzinfarkt gehabt habe. Ein armer Tropf, glückloser Witwer, der bei einem Verkehrsunfall in Russland schon seine beiden Hände verloren habe und jetzt das noch, er sei so einsam und hilflos. Der Abteilungsleiter genehmigte den Urlaub, und Natascha ging in ihr Büro, nahm ihre Tasche und verließ das Gebäude. Rubi folgte ihr bis zu ihrem Auto. Als sie stehenblieb, um den Schlüssel aus der Tasche zu holen, blieb er auch stehen. Sie drehte sich zu ihm um.
»Du arbeitest im Einkauf«, sagte sie zu ihm, »der Assistent von Zagori, stimmt’s?«
»Ja«, nickte Rubi, »ich heiße Rubi.«
»Wallah, Rubi«, sagte Natascha mit einem nervösen russischen Lächeln, »also worum geht’s? Brauchst du was?«
»Es ist wegen deiner Lüge, von vorher, beim Abteilungsleiter«, stotterte Rubi, »ich kenne ihn.«
»Bist du mir den ganzen Weg zum Auto nachgegangen, nur um mich zu beschuldigen, dass ich eine Lügnerin bin?«, zischte Natascha.
»Nein«, verteidigte sich Rubi, »ich beschuldige dich gar nicht, echt nicht. Dass du eine Lügnerin bist, geschenkt, wenn’s dir Spaß macht. Ich bin auch ein Lügner. Aber dieser Igor, aus deiner Lüge, ich habe ihn getroffen. Er ist ein Goldmensch. Und du, entschuldige, wenn ich das sage, aber du hast schon genug Leiden für ihn erfunden. Ich wollte dir also nur sagen, dass …«
»Würdest du mal zur Seite rücken?«, schnitt ihn Natascha kühl ab. »Du behinderst mich dabei, die Autotür aufzumachen.«
»Ich weiß schon, dass das unsinnig klingt, aber ich kann’s dir beweisen«, sagte Rubi drängend. »Er hat kein Auge, der Igor. Das heißt, er hat eins, aber nur eines. Einmal hast du gelogen und gesagt, dass er ein Auge verloren hat, stimmt’s?« Natascha, die schon dabei war, ins Auto einzusteigen, hielt inne.
»Woher hast du das denn?«, fragte sie misstrauisch. »Bist du ein Freund von Slava?«
»Ich kenne keine Slava«, stammelte Rubi, »nur Igor. Wirklich wahr, wenn du willst, kann ich dich zu ihm mitnehmen.«
Sie standen im Hinterhof des Hauses. Rubi rückte den Stein weg. Legte sich auf den feuchten Boden und schob einen Arm in das Loch. Über ihm stand Natascha. Er streckte ihr die freie Hand hin und sagte: »Halt sie ganz fest.« Natascha betrachtete den Mann, der zu ihren Füßen ausgestreckt lag. Ein plus Dreißiger, ganz hübsch, der ein sauberes, gebügeltes weißes Hemd anhatte, das jetzt allerdings schon nicht mehr so sauber und viel weniger gebügelt war, dessen einer Arm in einem Loch steckte und dessen Wange an die Erde gedrückt war. »Halt sie ganz fest«, wiederholte er, und sie konnte nicht umhin sich zu fragen, während sie ihm ihre Hand reichte, wie sie bloß immer all diese Hirnkranken fand. Als er mit seinem ganzen Blödsinn am Auto angefangen hatte, hatte sie gedacht, das sei vielleicht so eine Art Humor, etwas dämlich einheimisch Israelisches, so wie diese »Versteckte Kamera« auf Kanal 2, doch jetzt begriff sie, dass der Typ mit den sanften Augen und dem verlegenen Lächeln wirklich durchgeknallt war. Seine Finger umklammerten fest die ihren. So verharrten sie erstarrt für eine kleine Weile, er auf der Erde ausgestreckt und sie leicht gebückt über ihm, mit verwirrtem Blick in den Augen.
»Okay«, flüsterte Natascha dann mit milder, fast therapeutischer Stimme, »jetzt halten wir also Händchen. Was nun?«
»Jetzt« sagte Rubi, »drehe ich am Griff.« Es kostete sie viel Zeit, Igor zu finden. Zuerst trafen sie irgendeine behaarte und bucklige Lüge, anscheinend von einem Argentinier, der kein Wort Hebräisch sprach, und danach eine andere Lüge Nataschas, so eine Nervensäge von religiösem Polizist, der darauf bestand, sie aufzuhalten und ihre Ausweise zu überprüfen, aber von Igor nie auch nur was gehört hatte. Wer ihnen am Ende half, war Rubis verprügelte Nichte aus Natania. Sie fanden sie dabei, wie sie die Katzenjungen aus seiner letzten Lüge fütterte. Diese Nichte war schon seit einigen Tagen nicht mehr auf Igor gestoßen, aber sie wusste, wo man seinen Hund finden konnte. Und der Hund, nachdem er damit fertig war, Rubis Hände und Gesicht abzulecken, führte sie gerne zum Bett seines Herrchens.
Igor war in keinem guten Zustand, seine Haut war völlig gelb, und er schwitzte die ganze Zeit. Doch als er Natascha sah, lächelte er strahlend breit. Er freute sich dermaßen, dass sie gekommen war, um ihn zu besuchen, dass er darauf bestand, aufzustehen und sie zu umarmen, obwohl er kaum fähig war, sich auf den Beinen zu halten. Als er sie umarmte, fing Natascha an zu weinen und bat um Verzeihung, denn dieser Igor war, nicht weniger als er eine Lüge war, auch ihr Onkel. Ein Onkel, den sie erfunden hatte, stimmt, aber trotzdem immerhin ein Onkel. Daraufhin sagte Igor zu ihr, sie brauche sich für nichts zu entschuldigen, und das Leben, das sie für ihn erfunden habe, sei vielleicht nicht immer gerade eins der leichtesten, aber er genieße jeden Augenblick, und sie müsse sich keine Sorgen machen, denn gegen das Zugunglück in Minsk, gegen den Blitzschlag in Wladiwostok und die Bisse des tollwütigen Wolfrudels in Sibirien sei dieser Herzinfarkt ein Pipifax. Und als sie zum Kaugummiautomaten zurückkamen, steckte Rubi eine Einliramünze in den Schlitz, nahm Nataschas Hand in die seine und bat sie, am Griff zu drehen.
Als sie wieder im Hof waren, entdeckte Natascha in ihrer Hand eine Plastikkugel mit einer Überraschung darin – ein hässlicher, goldfarbener Plastikanhänger in Form eines Herzen.
»Weißt du«, sagte sie zu Rubi, »ich hätte heute Abend für ein paar Tage mit einer Freundin in den Sinai fahren sollen, aber ich glaube, ich streich das und komm morgen hierher zurück, um Igor zu pflegen. Magst du auch kommen?« Rubi nickte. Er wusste, dass er, um morgen mit ihr mitzukommen, irgendeine Lüge fürs Büro erfinden müsste, aber obwohl er noch keinen genauen Plan hatte, was für eine, wusste er schon, dass es eine sonnige Lüge werden würde, in der viel Licht, Blumen, Himmel und wer weiß was vorkommen würden, vielleicht sogar ein paar lächelnde Babys.
Jesus Christ
Habt ihr euch einmal gefragt, was das häufigste letzte Wort im Munde derer ist, die dabei sind, eines gewaltsamen Todes zu sterben? Die MIT-Universität hat eine umfassende Fachstudie im Kreis heterogener Gemeinden im Norden Amerikas durchgeführt und entdeckt, dass es kein anderes Wort als »fuck« ist. Acht Prozent der Sterbekandidaten sagen »what the fuck«, sechs weitere Prozent sagen nur »fuck«, und dann gibt es noch 2,8 Prozent, die »fuck you« sagen, obgleich in ihrem Falle natürlich »you« das allerletzte Wort ist, auch wenn das »fuck« es unerschütterlich überstrahlt. Doch was sagt Jeremy Kleinman, einen Moment bevor er seiner Seele in der Quartiermeisterei droben enthoben wird? Er sagt: »Ohne Käse«. Jeremy sagte das, weil er gerade in einem Cheeseburgerlokal namens »Jesus Christ« etwas bestellte. Sie hatten keinen schlichten Hamburger auf der Karte, also verlangte Jeremy, der es mit dem koscher sehr genau nahm, einen Cheeseburger ohne Käse. Die Schichtverantwortliche in dem Lokal machte kein Aufhebens davon. Viele Kunden hatten das in der Vergangenheit schon von ihr verlangt. So viele, dass sie bereits das Bedürfnis verspürt hatte, in einer Reihe detaillierter E-Mails dem Generaldirektor der Jesus-Christ-Kette davon zu berichten, der in Atlanta saß. Sie hatte gebeten, in die Speisekarte auch die Variante eines einfachen Hamburgers aufzunehmen. »Viele Leute bitten mich darum, denn im Moment sind sie gezwungen, einen Cheeseburger ohne Käse zu bestellen. Das ist eine spitzfindige und etwas peinliche Möglichkeit. Sie ist peinlich sowohl für mich als auch, wenn Sie gestatten, für die gesamte Kette. Mich bringt das dazu, mich wie eine Technokratin zu fühlen, und den Kunden vermittelt es – dass die Kette ein komplizierter Apparat ist, den sie überlisten müssen, um das Gewünschte zu erhalten.« Der Generaldirektor antwortete nicht auf ihre E-Mails, und die Tatsache, dass er nicht antwortete, war aus ihrer Sicht sogar noch peinlicher und erniedrigender als alle die Male, bei denen ein käseloser Cheeseburger bei ihr bestellt wurde. Wenn sich ein treuer Angestellter an seinen Arbeitgeber wendet und ihn in ein Problem einweiht, noch dazu ein fachliches, das mit dem Arbeitsplatz zusammenhängt, ist das Minimum, zu dem der Arbeitgeber verpflichtet ist, dessen Existenz anzuerkennen. Der Generaldirektor hätte ihr schreiben können, es würde behandelt, oder dass er ihre Anregung zu schätzen wisse, zu seinem Bedauern jedoch die Speisekarte nicht zu ändern vermochte, oder noch eine Million mehr abgedroschener Antwortphrasen von dieser Sorte. Aber nein. Überhaupt nichts schrieb er. Und das brachte sie dazu, sich wie Luft zu fühlen. Genau wie an jenem Abend in New Haven, als ihr Freund Nick die Bedienung anbaggerte, während sie selber neben ihm an der Bar saß. Sie hatte damals geweint, und Nick hatte nicht einmal begriffen, warum. Noch in der gleichen Nacht hatte sie ihre Sachen gepackt und war gegangen. Gemeinsame Freunde riefen einige Wochen danach bei ihr an und erzählten ihr, dass Nick sich umgebracht hatte. Nach außen