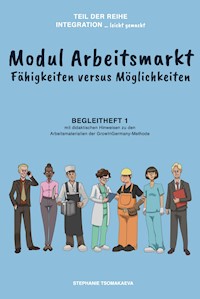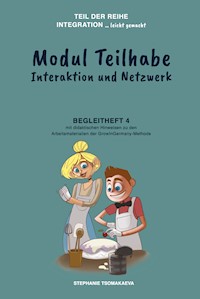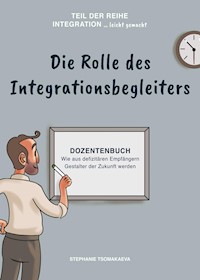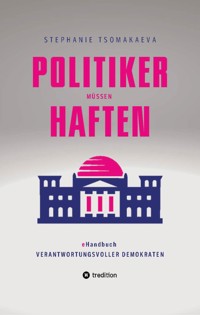
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn wir politisch einfach so weiter machen? Wie lässt sich Politik gleichzeitig verantwortungsvoller und dezentraler organisieren? Im Gegensatz zu anderen politischen Analysen bietet die Autorin eine reale und sofort umsetzbare Lösung für den Übergang in eine gerechtere und verantwortungsvollere, obwohl digitale Zukunft. Das vorgeschlagene Handlungskonzept ist ein universell, demokratisch und rechtsstaatlich anwendbares Verfahren für Politikerhaftung. Die Autorin illustriert es mit vielen Beispielen und bewegenden Geschichten aus dem eigenen politischen Leben. Wie zum Beweis führt sie uns mit Zitaten bekannter Politiker, Philosophen und Ökonomen durch die Regeln der heutigen Politik. Sie zeigt die Folgen dieser Politik und die Dringlichkeit einer politischen Weiterentwicklung auf, gibt aber gleichzeitig auch einen leicht nachvollziehbaren Ausblick auf eine gesellschaftliche Ordnung mit neuen demokratischen Spielregeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
POLITIKERHAFTUNG
ES IST DRINGEND. HEUTE ENTSCHEIDET SICH UNSERE GESELLSCHAFTLICHE ZUKUNFT. NICHT WENIGER ALS DEMOKRATIE UND FREIHEIT STEHEN AUF DEM SPIEL.
Dabei gibt es ein universelles Prinzip für inneren und äußeren Frieden. Einen Weg von politischem Aberglauben zu verantwortungsvoller Politik.
Das Handbuch für verantwortungsvolle Demokraten beantwortet dabei auch die großen gesellschaftlichen Fragen unserer Zukunft, wie:
• Wie stellen wir das Vertrauen in die Demokratie wieder her?
• Wie gestalten wir eine funktionierende Gewaltenteilung?
• Wie lässt sich das Vertretersystem gerechter organisieren?
• Wie bekommt der Einzelne ein Recht auf Mitbestimmung?
• Wie gelingt der Übergang in ein demokratisches Informationszeitalter?
• Wie verhindern wir künftig Inflation und Krieg?
• Welche neuen Spielregeln brauchen wir für einen fairen Interessenausgleich in einer multipolaren Welt?
Stephanie Tsomakaeva
POLITIKERMÜSSEN HAFTEN
HANDBUCH VERANTWORTUNGSVOLLER DEMOKRATEN
Stephanie Tsomakaeva (53) ist Autorin, Unternehmerin und politische Aktivistin. In Frankfurt/M. geboren hat sie sich 1991 in St. Petersburg selbstständig gemacht.
In den 22 Jahren, die sie in Russland war, hat sie Staatsauflösung, Hyperinflation, Verfassungsgebung, Währungszusammenbruch, Krieg und vorauseilenden Gehorsam gegen-über einer erneuten Diktatur kennengelernt. Sie vergleicht 2020–21 in Deutschland mit 2012–13 in Russland.
Seit 2014 ist sie aus politischen Gründen zurück in Deutschland und hat seitdem auf allen Ebenen Erfahrungen mit dem deutschen Parteiensystem gemacht. Heute parteilos beschreibt sie in diesem Buch einen Ausweg aus der Vertrauenskrise der Demokratie.
Das Buch ist allen Menschen gewidmet,
die Verantwortung für Frieden und Freiheit
in der Welt übernehmen.
Im Kleinen wie im Großen.
Vorwort
Viele davon habe ich auf dem gedanklichen Weg zu diesem Buch getroffen. Ihre Anregungen, Nachfragen, Vorschläge, Kritik, Lob und viele gemeinsame Emotionen waren für meine Seele die notwendige Grundlage, um die Ideen Freiheit und Verantwortung über mein eigenes Leben hinaus durchdringen zu können.
Die Anleitung zu einer verantwortlichen Demokratie, die Sie in den Händen halten, ist somit ein Gemeinschaftswerk, bei dem ich weise voraussehend, dass wir irgendwann eine Zusammenfassung und Handlungsanweisung brauchen, gedanklich als Protokollantin mitgeschrieben habe. Wie in Protokollen üblich, nutze ich im Buch für Dinge, die es in der Zukunft umzusetzen gilt, die grammatikalische Form der Gegenwart und verzichte zugunsten der Lesbarkeit auf die Doppelform männlicher und weiblicher Bezeichnungen.
Ganz besonders bedanke ich mich bei den Pionieren der Politikerhaftung Bernd Kölmel, Detlef de Raad, Arnd Frohne, Gabriele Reisch, Dr. Dirk Manske und Dr. Hansjörg Scheel.
Ein herzlicher Dank gilt auch Ralf Ludwig für seine gedankliche Vorarbeit zum Thema Veto-Recht. Wir hätten es allerdings nie diskutiert, wenn ich nicht Markus Backfisch, Dr. Swen Hüther, Matthias Peuschel, Olaf Lange, Lars Hünich, Paul Weiler und Matthias Garscha getroffen hätte. Ihre oft sehr konträren Blickwinkel haben mir den für das Thema notwendigen Blick über den politischen Tellerrand ermöglicht und Christine Born zusätzlich noch den Einblick in die Kunst des Schreibens.
Meine Hochachtung gilt auch denen, die den Mut haben, mit der Pinkweste das Thema auf die Straße zu tragen.
Oft sind es die ganz kleinen Gesten, die die Seele lange Zeit beflügeln. Eine solche war die eines Redners, dem ich 2019 auf einer Veranstaltung einen Button mit „Politiker müssen haften“ hinhielt. Sein beherztes Anstecken des Buttons mit der Aussage: „Genauso ist es!“, beflügelt mich noch heute.
Langen, den 1.4.2023
Inhalt
Cover
Politikerhaftung
Titelblatt
Vorwort
Prolog
I. Verantwortung wählbar machen
1.1. Gesinnung oder Dienst
1.2. Legitimation erzeugende Kraft
1.3. Demokratische Prinzipien
II. Was, wenn wir nichts tun?
2.1. Zentral oder dezentral
2.2. Sozialkredite: das Bonussystem der Ideologien
2.3. Analoges und digitales Geld
2.4. Geht Vertrauen ohne Wahrheit
2.5. Opposition in der Blase: Peng!
III. Politikerhaftung
3.1. Ende des Aberglaubens
3.2. Strafrechtliche Haftung
3.3. Zivilrechtliche Haftung
3.4. Schadensersatzansprüche
3.5. Politikersondergericht (PoSG)
IV. Veto-Recht
4.1. Das Ja zum Nein
4.2. In drei Stufen zum Veto-Recht
4.3. Amtszeitbegrenzung und Abwahl
V. Erhalt des Bargeldes
5.1. Tickendes Schuldenrisiko
5.2. Enteignung durch Inflation
VI. Geht nicht, gibts nicht
6.1. Dann machen wir es selbst
6.2. Legal und trotzdem kriminell
6.3. Keiner braucht Parteien, aber alle eine Vertretung
6.4. Hinterzimmerpolitik ade!
VII. Was, wenn wir es einfach machen?
7.1. Politik, die Zukunft kann
7.2. Berufung zur Verantwortung
7.3. Machtfrage klären
Anhang I – Vergleichstabellen111
Haftungsgrundlagen
Haftungsgrundlagen II
Haftungsgrundlagen III
Haftungsgrundlagen IV
Aberglaube in der Praxis
Aberglaube in der Praxis II
Aberglaube in der Praxis III
Prüfungsinstanzen (Schäferhunde)
Prüfungsinstanzen II
Politikerhaftung
Politikerhaftung II
Anhang II – Endnoten & Quellen
Urheberrechte
POLITIKER MÜSSEN HAFTEN
Cover
Titelblatt
Vorwort
Anhang II – Endnoten & Quellen
Urheberrechte
POLITIKER MÜSSEN HAFTEN
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
Prolog
Der neue ukrainische Präsident betrat sein Abgeordnetenhaus, einen prunkhaften Saal, in dem sich seine obersten Parlamentarier gerade wild tobend in den Haaren lagen. Der Versuch, sich mit einem höflichen „Sehr geehrte Abgeordnete!“ Gehör zu verschaffen, scheiterte kläglich. Erst als er laut anhob und in die Menge rief „Putin wurde gestürzt!“ war Stille.
„Das war ein Scherz. Sie waren einfach nicht anders zu stoppen.“ „Setzen Sie sich bitte, meine Damen und Herrn Volksvertreter“, rief nun auch der Ministerpräsident.
Der neue Präsident wünschte „Noch einmal, guten Tag!“ und begann seine erste Rede vor dem Parlament: „Schon lange wollte ich Sie alle einmal kennenlernen. Und die ganze Zeit habe ich darüber nachgedacht, wo ich anfangen soll. Darum, so denke ich, sollte ich hier bei Ihnen ganz von vorn anfangen: mit der Demokratie!
Sie alle sind Bedienstete des Volkes. Sie wissen, was Demokratie bedeutet. Ehrlich gesagt, übersetzt jeder den Begriff so, wie es ihm gerade passt. Aber in Wahrheit kommt das Wort ‚Demokratie‘ aus dem Griechischen. Es bedeutet ‚Volksmacht‘. Es heißt Demos – das Volk und Cratos – die Macht. Nicht KratoDemi. Verstehen Sie? Nicht ‚Macht über das Volk‘, sondern genau andersherum.
Wir haben doch eine Demokratie in unserem Land, nicht wahr? Zumindest nach dem zu beurteilen, wie viel wir im Fernsehen darüber bringen. Das sagt uns, die Macht in unserem Land gehört wirklich dem Volk. Und das Volk tut seinen Teil dafür und engagiert uns abwechselnd zum Regieren. Einmal Sie und diesmal eben mich.
Erklären Sie mir aber bitte, wieso kann sich ein einfacher Wähler wie ich, mit dem Gehalt eines Geschichtslehrers noch nicht mal eine kleine, schlichte Wohnung am Stadtrand von Kiew leisten. Während Sie selbst, meine Untergebenen, in riesigen Luxusvillen leben? Finden Sie das nicht seltsam? Oder habe nur ich den Eindruck, dass hier etwas nicht richtig ist? Für Sie ist das so in Ordnung?
Sie sind die Diener des Volkes! Wo in der Geschichte haben Sie schon einmal gesehen, dass Diener besser leben als ihre Herren? Haben sie da vielleicht etwas durcheinandergebracht? Dienen Sie vielleicht nicht dem richtigen Herrn? Anstatt ihrem Volk zu dienen, bedienen Sie die Oligarchen? Wollen Sie wirklich diesem Land nichts Gutes tun und glauben ernsthaft, dass auch unter der Erde ihre goldenen Kreditkarten noch akzeptiert werden?
Sehr geehrte Diener des Volkes, hiermit nutze ich mein Recht auf Gesetzesinitiative und beantrage eine Änderung im Gesetz zur Regulierung des Status der öffentlichen Angestellten. Erstens: Von Dienstwagen ist Abstand zu nehmen, ebenso von Residenzen und staatlichen Erholungseinrichtungen. Zweitens: Der riesige Mitarbeiterkorpus nicht benötigter Referenten und deren Anhängsel ist zu reduzieren. Drittens: Die gemeinsame Arbeitseffizienz ist zu steigern. Dem Parlament, dem Kabinett sowie dem Präsidialapparat lege ich nahe, ab sofort in ein gemeinsames Gebäude im Messezentrum umzuziehen. Ganz nebenbei wird uns das helfen, die Innenstadt von den endlosen Staatskarossen-Staus zu befreien.“
Leise fragte ein Abgeordneter nach: „Verzeihung? Was wird dann mit unseren Gebäuden passieren? Das sind die besten Bauwerke.“
Das Beste …, überlegte der Präsident noch, als eine Abgeordnete resolut dazwischenrief: „Den Kindern!“
„Wieso eigentlich nicht?“, fragte der Präsident. „Geben wir das Beste den Kindern. Oder ist hier irgendjemand dagegen?“
Die Abgeordneten schwiegen.
„Sehr gut. Dann können Sie sich jetzt weiterprügeln, wenn es sonst nichts zu tun gibt.“
Wolodymyr Selenskyi als Vasyl Petrovych Holoborodko bei seiner Antrittsrede als neuer ukrainischer Präsident in der erfolgreichen Fernsehserie „Die Volksdiener“.
I. Verantwortung wählbar machen
1.1. Gesinnung oder Dienst
Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie es passieren konnte, dass Politik heute so grundlegend am Willen der Bürger vorbei agiert? Warum sich berufliche Unfähigkeit, inkompetente Linientreue und Vetternwirtschaft in den Parteien breitmacht und einflussreiche Superreiche mithilfe ihrer Lobbyisten scheinbar beliebige Ziele durchsetzen können? Ziele, die einer Gesinnung folgen, die nicht Ihre ist und mit Folgen für uns alle, die zum Teil unverantwortlich sind. Dann geht es Ihnen wie mir.
Zum ersten Mal habe ich am Montag, dem 17. August 1998 voller Wut über unverantwortliche Politiker geschimpft. Ich stand gemeinsam mit anderen vor der geschlossenen Tür meiner Geschäftsbank und diskutierte über die Folgen des vor ein paar Stunden abgestürzten Rubels. Die knapp zwanzigtausend Dollar, die ich für einen großen Auftrag am Freitag in Rubeln aufs Konto eingezahlt hatte, waren unwiederbringlich verloren und Kunden würde ich so schnell keine neuen haben. Schuld daran war aber nicht meine falsche Wahl der Bank, sondern die von Politikern. 4,8 Mrd. US-Dollar verschwanden damals auf dem Weg vom Internationalen Währungsfonds zur russischen Zentralbank.1 Daraufhin konnte die russische Regierung ihre Rubelanleihen nicht bedienen und es kam zum Staatsbankrott. Wie konnte das passieren?
Dasselbe fragen sich heute nicht wenige Unternehmer in Deutschland. Sie stehen vor der gleichen Herausforderung wie ich damals: Mitarbeiter entlassen und selbst über die Runden kommen. Nicht, weil wir falsche unternehmerische Entscheidungen getroffen hätten, sondern wegen falscher politischer Entscheidungen. Ich habe mir damals geschworen, dass mir so etwas nicht noch einmal passieren würde. Seitdem gehört Politik zu meinem Leben.
Etwas Ähnliches muss auch dem Soziologen Max Weber nach dem fürchterlichen Ersten Weltkrieg durch den Kopf gegeistert sein. Mitten in der politischen Umbruchzeit der Weimarer Republik hielt er am 28. Februar 1919 vor dem Freistudentischen Bund in Erfurt einen sehr weitsichtigen Vortrag mit dem Titel „Politik als Beruf“. Er formulierte damals, was uns heute, in einer erneut politisch ungewissen Zeit, helfen kann, die Weichen richtigzustellen. Die Fehler, die in der Weimarer Republik gemacht worden sind, sollten wir heute nicht wiederholen.
Das Besondere an dem Vortrag war die universell formulierte Trennung zwischen Intention und Wirkung des politischen Handelns: „Wir müssen uns klarmachen, dass alles ethisch orientierte Handeln unter zwei voneinander grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen Maximen stehen kann: Es kann ‚gesinnungsethisch‘ oder ‚verantwortungsethisch‘ orientiert sein.“
Der Unterschied zwischen Absicht (Gesinnung) und Wirkung (Verantwortung) wurde mir in meinen vier Jahren im russischen Nordkaukasus bewusst. Ich habe dort während des zweiten Tschetschenienkrieges unter anderem mit Kollegen von „Memorial“, der größten und inzwischen zwangsgeschlossenen Menschenrechtsorganisation Russlands, zusammengelebt und -gearbeitet. Aus Sicherheitsgründen konnte ich abends nicht raus und so hatten wir Zeit uns in unserem „Trainingszentrum für Small Business“ die Köpfe über folgende Frage heißzureden:
Lohnt es sich, ein hohes eigens Risiko für die Rechte eines einzelnen Menschen einzugehen oder ist es besser, für den Einzelfall das eigene Leben nicht zu riskieren, weil wir dann mehr Menschen helfen können?
Die Gesinnungsethiker unter uns orientierten sich bei dieser Entscheidung an ihrer Gesinnung und nicht an der Wirkung. Für sie war die richtige Haltung eines Menschen der oberste Maßstab für jedes Handeln. Die Moral bestimmt, ob Handlungen allgemein und ohne Rücksicht auf die Folgen gut oder schlecht sind.
Was das bedeutet, musste ich schmerzhaft erleben, als eine Kollegin nach ihrem letzten Hilfeanruf mit dem Handy verschwand. Wir waren damals nur zwei Ausländerinnen ohne UN-Schutz, die in Nazran, Inguschetien lebten. Selbstverständlich hatte der russische Staat auf uns beide jeweils einen Zuständigen des Staatsschutzes abgestellt. Meiner besuchte mich regelmäßig. Auch wenn ich die Zusammenarbeit mit irgendwelchen Geheimdiensten aus Überzeugung ablehne und hier auf das absolute Minimum reduzierte, so sah ich mich doch in der Verantwortung für mein Projekt, die Mitarbeiter, die Teilnehmer und auch meine eigene Sicherheit. Mir blieb erspart, was meiner damaligen Kollegin passierte, weil sie „Haltung zeigte“. Sie folgte ihrer Gesinnung und verweigerte konsequent den Kontakt. Im Mai 2004 ist es dann passiert. Ich wurde gewarnt und sie gekidnappt. Sechs Monate lang saß sie in einem Betonraum ohne Fenster. Nur auf Drängen ihres Konsulats kam sie wieder frei. Wir konnten ihr nicht helfen. Für mich ein sehr lehrreiches Erlebnis.
Gesinnungsethiker bleiben bei ihrer Überzeugung, egal, was es kostet. Sie nehmen auch tödliche Folgen für sich und andere in Kauf. Der Zweck heiligt die Mittel.
Gewährenlassen
Was macht gesinnungsorientierte Politik, wenn es mal nicht so läuft, wie geplant? Max Weber brachte es so auf den Punkt: „Wenn die Folgen einer aus reiner Gesinnung fließenden Handlung üble sind, so gilt ihm nicht der Handelnde, sondern die Welt ist dafür verantwortlich, die Dummheit der anderen Menschen oder – der Wille des Gottes, der sie so schuf.“
Wir kennen den Spruch alle: Sollte der Wähler mal mit einer irrationalen Gesinnungspolitik unzufrieden sein, dann konnten die Gesinnungspolitiker die Wähler nur nicht „abholen“. Das hat sich wahrscheinlich auch der Wirtschafts- und Klimaminister Dr. Robert Habeck nach seiner Eröffnungsrede der Berlin Energy Transition Dialogue (BETD)2 im März 2022 anhören müssen. In der Rede entschuldigte er sich nämlich dafür, sich über den Krieg in der Ukraine zu freuen. Seine Klimawandelpolitik wäre mit diesem einfacher durchzusetzen. Es gab bestimmt Wähler, denen nicht einleuchtete, wie ein Krieg gut fürs Klima sein könnte.
Mit dem Abschieben der Verantwortung auf Dritte fängt die Verantwortungslosigkeit der Gesinnungsethiker aber erst an: Zur Erreichung „guter Zwecke“ nehmen sie wissentlich nicht nur bedenkliche und gefährliche Mittel, sondern auch die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit „übler“ Nebeneffekte in Kauf. „Dabei lässt sich nicht vorhersagen, wann und in welchem Umfang der ethisch ‚gute‘ Zweck die ethisch gefährlichen Mittel und Nebenerfolge ‚heiligt‘.“3 Um es mit Dr. Robert Habeck zu sagen: Es ist nicht klar, wann und wie der „üble“ Nebeneffekt, dass Menschen im Krieg sterben, helfen wird, das Klima zu retten.
Max Weber warnte 1919 die jungen Menschen vor den Folgen reiner Gesinnungspolitik und erklärte ihnen, warum Deutschland eine Verantwortungspolitik braucht.
„Ein Verantwortungsethiker dagegen, der um die Gebrechen der Welt weiß, bewertet sein Handeln hingegen nach den Folgen.“
Wie sich die Deutschen entschieden haben, wissen wir heute. Sie interessierten sich mehr für die kurzfristigen oder persönlichen Vorteile der brutalen Gesinnungspolitik, die nach der Weimarer Republik folgte, und ließen sie gewähren.
Die Verfasser des Grundgesetzes haben aus genau dieser Kurzsichtigkeit der Menschen die ersten 19 Artikel unseres Grundgesetzes mit einer Ewigkeitsklausel bedacht. Aber das entbindet uns alle nicht davon, unser eigenes Handeln nach seinen Folgen zu bewerten und Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Grundrechte weder abgeschafft noch ausgehöhlt oder ausgehebelt werden. Die Lehre aus der Vergangenheit heißt für mich: Wenn ich will, dass sich niemals wieder eine national-sozialistische oder eine sozialistisch-leninistische Diktatur wiederholt, dann muss ich persönlich bei jeder politischen Wahl immer die kurzfristigen Vorteile gegen die langfristigen Nachteile abwägen.
Max Weber formulierte damals auch, was gute Politik ausmacht: „… Gesinnungsethik und Verantwortungsethik sind nicht absolute Gegensätze, sondern Ergänzungen, die zusammen erst den echten Menschen ausmachen, den, der den ‚Beruf zur Politik‘ haben kann.“ Er formulierte einen universellen gesellschaftlichen Schutz gegen Übergriffe auf Freiheit und Demokratie und zitiert wird er heute, 100 Jahre und zwei Diktaturen später, leider nur mit dem Satz „Politik bedeutet dicke Bretter bohren“. Dabei ist sein wichtigster Gedanke:
Verantwortungsethik in der Politik ist der einzige Garant für inneren und äußeren Frieden.
Zwischen 2014 und 2021 war ich Mitglied in drei verschiedenen Parteien. Erst war ich Mitglied in der Gründungs-AfD. 2015 bin ich mit Prof. Dr. Bernd Lucke zur Partei Liberal-Konservative Reformer (LKR) gewechselt und habe schließlich 2021 ein Parteienbündnis für einen einmaligen Bundestagswahlantritt mit dem Namen BÜNDNIS21 gegründet. Meine persönlichen Erfahrungen teilen viele Kollegen aus anderen Parteien auch: Die Menschen, die das vereinen, was nach Max Weber einen guten Politiker ausmacht (politische Haltung und Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln), lassen sich in Parteien an einer Hand abzählen. Meine Amtszeit im Bundesvorstand 2017–2018 der LKR, die damals 1000 Mitglieder und Parteienfinanzierung hatte, hat mich von vielen Illusionen über Parteien befreit. Die meisten verantwortungsvollen Menschen mit starken Überzeugungen halten es auf Dauer gar nicht in einer Partei aus. Jedenfalls nicht aktiv in Ämtern.
1.2. Legitimation erzeugende Kraft
Wann sind unsere heutigen Regeln in Parteien, Parlamenten und der Politik eigentlich entstanden? Mitte des letzten Jahrhunderts. Vergegenwärtigen wir uns kurz gemeinsam die damaligen Rahmenbedingungen: Als die Bundesrepublik nach dem Krieg gegründet wurde, gab es weder Computer noch Internet. Viele Menschen in Deutschland hatten noch nicht einmal einen eigenen Telefonanschluss zu Hause. An Smartphones und soziale Medien dachte überhaupt noch niemand. Das beste Netzwerk war der Stammtisch. Autos und Fotoapparate waren Luxusgüter. Auch Kopierer in der heutigen Form gab es noch nicht.
Nur wenige Monate nach dem Putsch gegen Gorbatschow 1991 habe ich meine Firma in Russland gegründet. Die O-Buchstaben waren auf der ersten Kopie der Gründungsdokumente runde Löcher im Papier. Die „Maschinistin“, wie die Dame im Vorzimmer des Notars in St. Petersburg damals genannt wurde, hatte mit aller Kraft in die Tasten der Schreibmaschine gehauen. Auf der letzten Kopie der Satzung waren die „Os“ dafür die einzigen Buchstaben, die man noch richtig lesen konnte.
Nach dem Krieg reisten die meisten Abgeordneten mit Zügen zu den Parlamentssitzungen. Während der Reise waren sie nicht erreichbar. Mir ging das damals genauso. Während meiner ersten Aufenthalte in der Sowjetunion ab 1988 haben meine Eltern und ich uns Telegramme geschickt, um über den Eisernen Vorhang hinweg Lebenszeichen abzusetzen. Als ich damals von Frankfurt am Main, wo ich aufgewachsen bin, in das noch Leningrad heißende St. Petersburg gezogen bin, war das wie eine Reise in die Vergangenheit. Ähnliches wiederholte sich für mich 1999 im Nordkaukasus.
Um in den 1950ern mehreren Hundert Abgeordneten einen Gesetzesvorschlag zukommen zu lassen, war ein wochenlanger Vorlauf nötig. Im Gegensatz zu heute war es damals unmöglich, einen hundertseitigen Gesetzestext am Abend vor der Abstimmung an alle Abgeordneten zu versenden. Jedenfalls nicht so, dass diese ihn noch hätten erhalten können. Heute geht das problemlos mit einem Knopfdruck per E-Mail. Die ständige Erreichbarkeit über das Handy ermöglicht es uns, heute etwas zu versenden und morgen darüber abzustimmen.
Ähnliches gilt für die Berichterstattung. Kameras und Tonaufzeichnungen waren wenigen Spezialisten vorbehalten. Die Erstellung von Medienberichten war schwierig und teuer, eine Fälschung sehr aufwendig und zeitintensiv. Bis einschließlich 2004 hat mein Büro immer mal wieder Reisen für ausländische Kamerateams in Russland organisiert. Damals wurden die Filme noch auf Videokassetten aufgenommen. Der Aufwand war enorm und das Schneiden etwas für Profis. Es war einfacher, Filmaufnahmen ganz verschwinden zu lassen, als sie zu faken. Jegliche Informationen musste man mühsam zusammentragen und der Druck von Büchern und Zeitschriften war ebenso aufwendig. Davon abgesehen, dass diese oft auch nur an ausgewählten Stellen, wie beispielsweise Bibliotheken, zu bekommen waren.
Dank Internet und Computer lassen sich heute Informationen genauso schnell ändern, wie sie erstellt worden sind. Mit dem Handy und ein paar Klicks lassen sich selbst Videos in Sekundenschnelle bearbeiten – ganzjährig, vierundzwanzig Stunden, sieben Tage in der Woche, für jeden und überall.
Die Informationshoheit ist zu einem Wettlauf gegen die Zeit geworden. Während sich die Regeln im Informationsgeschäft völlig verändert haben, scheint diese Entwicklung an politische Regeln und Abläufen relativ spurlos vorübergezogen zu sein.
Die Wahl politischer Ämter, die zwingend physisch vor Ort durchzuführen ist, hat selbst den Digitalisierungsschub während der Coronamaßnahmen überlebt. Notwendige Fristen, Ämter, Mindestanzahl haben sich kaum verändert. Es werden höchstens immer mehr: mehr Abgeordnete, mehr Sitzungen, mehr Gesetzestexte.
Legitimität politischen Handels
Was geblieben ist, ist der Mensch mit seinem Suchen nach dem eigenen Vorteil. Wir mögen es gut oder schlecht finden, aber es ist menschlich, dass diejenigen, die Geld und Macht haben, versuchen beides zu vermehren oder zumindest zu erhalten.
Wenn wir den Menschen so akzeptieren, wie er ist und nicht den Anspruch haben, ihn umzuerziehen oder einen neuen Menschen zu erschaffen, dann können wir dieses menschliche Verhalten nicht ändern. Aber wir wissen um ein „Gebrechen der Welt“, wie es Max Weber ausdrückte, und können die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Regeln ändern.
Diese können das Streben des Menschen nach Macht und Reichtum erleichtern oder erschweren. Sie können Anreize für bestimmte Handlungen schaffen, indem sie Resultate des Handelns belohnen oder bestrafen.
Das können moralische Anreize sein, wie Ehre und Glaube, deren Verletzung eine Ächtung, zum Beispiel durch eine religiöse oder politische Gemeinschaft, nach sich zieht. Oder praktische Möglichkeiten, die etwas technisch fälschungssicher machen oder automatisch offenlegen. Es können aber auch strukturelle wie Haftung, Gewaltenteilung und Amtszeitbegrenzung sein.
Die heutigen Regeln der Politik entstanden nach einem gewalttätigen Krieg und mit frischer Erinnerung an die Nürnberger Prozesse. Es ging darum, Vergangenes nicht zu wiederholen und trotzdem vergessen zu machen. Zur Verhinderung einer Diktatur wurde in Deutschland ein föderales System mit viel Eigenständigkeit der politischen Ebenen geschaffen. Die Kontrolle wurde in die gleiche Ebene gelegt, damit keiner „von oben durchregieren“ konnte. Gedacht, um eine zentralistische Machtergreifung von oben oder unten zu verhindern, schuf diese Autonomie der Abgeordneten die praktischen und strukturellen Anreize in der heutigen Politik.
Einer meiner Professoren an der Frankfurter Philosophischen Fakultät, an der ich Anfang der 90er studiert habe, hat 2022 (im Alter von 92!) ein neues Buch mit dem Titel „Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik“ geschrieben. Das Buch wäre bahnbrechend, wenn nicht jeder Satz in diesem Buch die Länge eines ganzen Absatzes hätte und noch dazu mindestens zwei Worte enthält, die die meisten erst nachschlagen müssen. Auch ich kam ohne einen Bleistift beim Lesen nicht aus. Aber Prof. Dr. Jürgen Habermas bringt es auf den Punkt, wenn er uns an unsere Geschichte erinnert. Unsere heutige Demokratie ist entstanden, nachdem Monarchie und Diktatur geschichtlich überholte Staatsformen wurden. „Weil in modernen Gesellschaften die legitimierende Kraft des Glaubens an die göttliche Berufung der herrschenden Dynastien nicht mehr ausreichte, musste sich das demokratische System gewissermaßen aus sich selber legitimieren, und zwar durch die Legitimität erzeugende Kraft des rechtlich institutionalisierten Verfahrens der demokratischen Willensbildung.“4
Moderner Aberglaube
Politik machen bedeutet für mich, mit Menschen diskutieren. Wo immer ich unterwegs bin, freue ich mich, mit Menschen auf der Straße ins Gespräch zu kommen und spontan politische Willensbildung zu betreiben. Als geborene Frankfurterin bin ich mit Jazz-Frühschoppen und den lauten, offenen Diskussionen über mehrere Tische hinweg in hessischen Äppelwoi-Kneipen groß geworden.
Wenn ich die Frage stelle „Was muss sich ihrer Meinung nach in der Politik ändern?“ drücken die meisten Menschen mit unterschiedlichen Worten das gleiche Gefühl der Ohnmacht aus. Die Furcht vor immer skrupelloserer und verantwortungsloser Politik, die ohne Rücksicht auf Verluste über alle Bedürfnisse und Wünsche der Bürger hinweggeht, ja sogar die eigenen Wähler verrät. Wer kennt nicht solche Antworten: „Die machen eh, was sie wollen“, „Das Volk ist denen egal“ und „Kannste eh nix ändern“. Resignation und Misstrauen hat sich breitgemacht.
Dabei sind Mandatsträger wirklich nur temporär angestellte Diener des Volkes, wie der im Prolog zitierte Film es treffend auf den Punkt bringt. Ihre Aufgabe ist es, sich dem Auftrag des Wählers nachkommend, anständig und verantwortungsvoll um die gemeinschaftlichen Belange zu kümmern. Einen guten Job zu machen, wie der Handwerker im Ort, der Reiseveranstalter im Urlaub oder der Chirurg im Krankenhaus. Für gute Arbeit ist jeder auch gern bereit gut zu bezahlen. Erledigt der Handwerker seinen Job aber nicht gut, hat er recht schnell eine Schadensersatzklage am Hals.
Wieso ist das bei Politikern anders? Weil es leider immer noch den weitverbreiteten Aberglauben gibt, dass die Politik über uns herrschen dürfe und wir nichts dagegen machen können, Politiker alles entscheiden können, ohne dafür haften zu müssen. Ein veraltetes Überbleibsel aus Zeiten vor den heutigen Demokratien.
Nur diese falsche Annahme macht es möglich, dass wir immer noch regiert werden, anstatt selbst zu regieren. Im Grundgesetz steht: Alle Macht geht vom Volke aus. Aber was ist, wenn das Volk gar nicht glaubt mächtig zu sein?
Es ist ein fast kindlicher Aberglaube an einen fiktiven allmächtigen Thron, der sich ausdrückt in Sprüchen, wie „Mutti-Merkel“ oder „Papa-Staat“. Er gibt Politikern die Macht, die sie heute haben: den politischen Willen der Bürger zu ignorieren, die Vorteile der Macht zu privatisieren und die negativen Folgen auf die Allgemeinheit abzuwälzen.
Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten, ohne irgendwelche Bedingungen zu erfüllen, alle andere zwingen, Ihnen Geld zu bezahlen und – mehr oder weniger – beliebige Vorschriften einzuhalten. Sie bräuchten dafür nicht mit persönlichen Folgen zu rechnen. Auch später nicht, wenn zum Beispiel ein Gericht die Vorschriften für unzulässig erklärt. Sie dürften nur den Kollegen die Vorteilsnahme nicht wegnehmen. Gut, Sie selbst würden natürlich nur das Beste für alle wollen. Aber ob alle so selbstlos sind wie Sie?