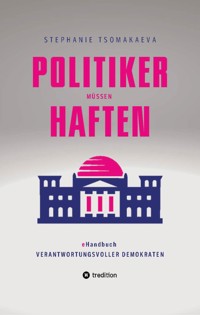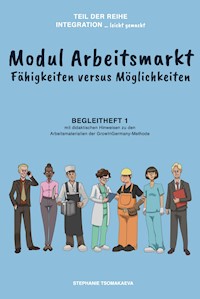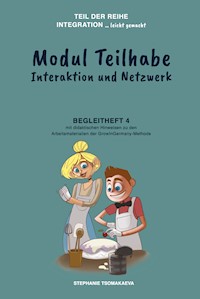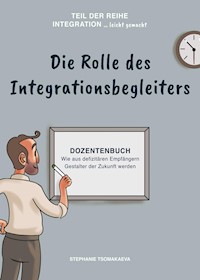
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Integration ... leicht gemacht
- Sprache: Deutsch
Das Buch beschreibt eine im Ausland erprobte Methode für erfolgreiche Integrationsarbeit. Eine Methode, mit der man Integration genauso einfach vermitteln kann wie Lesen und Schreiben. Es bereitet jeden Dozenten gut auf jegliche Kurse vor, deren Ziel es ist Menschen in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren oder beim Einstieg in den Arbeitsmarkt zu helfen. Das Buch liefert dafür nicht nur einen fachlich nötigen Überblick über gesellschaftliche und psychologische Hintergründe, es spricht auch persönliche und institutionelle Integrationsprobleme offen an. Im Gegensatz zu anderen Fachbüchern bleibt es aber nicht ein theoretischer Ansatz, sondern bietet auch etablierten Strukturen praktische methodische Lösungsansätze, pädagogische Ziele und Arbeitstechniken für einen umsetzbaren Paradigmenwechsel in der sozialen Arbeit. Argumentativ eingebettet in die aktuellen Chancen und Herausforderungen des deutschen Arbeitsmarkts liefert das Dozentenbuch "Die Rolle des Integrationsbegleiters" zusammen mit dem dazugehörigen Arbeitsbuch für Kursteilnehmer "Easy in die Arbeitswelt" und seinen modularen Begleitheften aus der Reihe "Integration … leicht gemacht" eine fertige Gebrauchsanleitung für alle Arten von Integrations- und berufsorientierenden Kursen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
TEIL DER REIHE
INTEGRATION … leicht gemacht
Die Rolle des Integrationsbegleiters
DOZENTENBUCH
Wie aus defizitären EmpfängernGestalter der Zukunft werden
STEPHANIE TSOMAKAEVA
© 2019 Stephanie Tsomakaeva
Illustration: Manuel Figueiredo
Design: Jerome Berg
Lektor: Dr. Matthias Feldbaum
Weitere Mitwirkende: Simon Roger (GrowInGermany gUG)
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback 978-3-7482-7455-1
Hardcover 978-3-7497-0749-2
E-Book 978-3-7482-7457-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Dieses Buch ist all den Menschen gewidmet, die in der Fremde ein neues Zuhause und in einem Fremden einen neuen Freund gefunden haben.
Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Eltern und Freunden. Ohne ihren Glauben an mich hätte ich die vielen Abenteuer nicht gewagt, die notwendig waren, um dieses Buch zu schreiben.
INHALT
KAPITEL 1
INTEGRATION
Begriffsreflexionen
Begriffsreflexion 1 – Assimilierung
Begriffsreflexion 2 – Integration
Begriffsreflexion 3 – Segregation
Begriffsreflexion 4 – Marginalisierung
Das Integrationsproblem
Grundpfeiler gelungener Integration
Zeit für Paradigmenwechsel
Abundanz-Mentalität statt Defizitorientierung
Interaktive Kommunikation statt Wissensvermittlung
KAPITEL 2
DER INTEGRATIONSBEGLEITER
Rolle des Integrationsbegleiters
Glaubenssätze
Kompetenzen
Kompetenz 1 – Veränderungskompetenz
Kompetenz 2 – Fachkompetenz
Kompetenz 3 – Sozialkompetenz
Kompetenz 4 – Methodenkompetenz
Kompetenz 5 – Vermittlungskompetenz
Kompetenz 6 – Prozesskompetenz
KAPITEL 3
AUFGABEN
Aufgaben 1 – Vorbereitung
Aufgaben 2 – Direkte Kommunikation
Aufgaben 3 – Qualitätssicherung
Aufgaben 4 – Zielorientierung
Aufgaben 5 – Transferorientierung
Fähigkeiten
Fähigkeiten 1 – Beobachtungsgabe
Fähigkeiten 2 – Empathie
Fähigkeiten 3 – Authentizität
KAPITEL 4
GELEBTE INTEGRATIONSLEISTUNG
Die Idee der multikulturellen Gesellschaft
Der Supermarkt der Massnahmen
Parallelgesellschaften
Die GIG-Community – horizontale Mini-Netzwerke
Religion
KAPITEL 5
ARBEIT
Begriffsreflexion
Geld ist nicht die Folge von Arbeit
Arbeit ist nicht nur das, wofür man Geld bekommt
Geld bekommt man nur für Lösungen
Der technische Fortschritt
KAPITEL 6
AUS DER VERGANGENHEIT LERNEN
Einwanderungswelle 1 – Anwerbeabkommen
Einwanderungswelle 2 – Maueröffnung und EU
Einwanderungswelle 3 – Flüchtlingskrise
Arbeitslosigkeit und Chancengleichheit
Fazit
KAPITEL 7
DIE ARBEITSMATERIALIEN
Der Kurs „Easy in die Arbeitswelt“
Zu Inhouse-Kursen gehören Offsite-Übungen
Sprachförderung 1
Sprachförderung 2 – Vokabelfelder
Module anders kombinieren
Feedback-Loop
Raumkonzept
KAPITEL 8
GESCHICHTE DER METHODE
NOTIZEN
ANLAGEN
* ausschließlich zugunsten der Übersichtlicheit und einfachen Lesbarkeit wird auf Doppelbezeichnungen in weiblicher und männlicher Form verzichtet. So auch im weiteren Buch.
KAPITEL 1
INTEGRATION
Bevor wir in die Frage nach gelungener Integration einsteigen und auf die Frage antworten, warum diese in Deutschland seit 30 Jahren ein ungelöstes Problem ist, erst ein paar Gedanken zum Buch selbst.
In Deutschland ist die spezifische Ausbildung von sogenannten Integrationsmanagern, in der Methoden und Techniken gelehrt werden, wie man den Aufgaben in der Integrationsarbeit professionell gerecht wird, noch in den Kinderschuhen; genauer genommen in den ersten Semestern einiger weniger Hochschulen. Der Name verrät, dass es um die Ausbildung derjenigen geht, die Integrationsarbeit organisieren und finanzieren. Weniger, um die, die täglich in Integrationskursen, Vermittlungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen, Schulen, Kitas oder als Paten heute schon aktive Integrationsarbeit leisten.
Das Buch möchte diese Lücke schließen und genau den Menschen, die in dieser Branche in Kursen arbeiten (oder arbeiten wollen), Anregungen geben über ihr eigenes Selbstverständnis nachzudenken, über die Ziele, die sie mit ihrer Integrationsarbeit erreichen wollen, und ihnen eine erprobte Methode mit praktischen Vorschlägen an die Hand geben. Deshalb ist im Buch immer von „Ihnen“ und „den Teilnehmern“ die Rede.
Sollte Ihnen der vorgeschlagene Paradigmenwechsel gefallen, können Sie ihn direkt in Ihrer täglichen Integrationsarbeit anwenden. Dafür gibt es die Arbeitsbücher. Ganz nach dem Motto der GrowInGermany-Methode: Keine Theorie ohne praktische Umsetzung.
Die Methode ist entwickelt worden, um inner-russischen Vertriebenen eine Starthilfe bei der Eingliederung in die Gesellschaft zu geben. Vertriebene, die aufgrund von aktuellen Kriegshandlungen innerhalb der Russischen Föderation an einen neuen Ort umziehen mussten oder solche, die nach der Vertreibung in ihre alte Heimat zurückkehrten. Die Gegenden sind ausnahmslos solche, die keinen strukturellen Arbeitsmarkt vorweisen können, weshalb die Methode ausschließlich auf die Entfaltung persönlicher Fähigkeiten setzt. Das macht sie so universell anwendbar.
Probieren Sie sie aus, jeder kann sie selbst testen und wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren ([email protected]).
Begriffsreflexionen
Der auf den ersten Blick kaum erkennbare Unterschied zwischen Integration und Assimilation und die ständige Verwechslung in den Medien und in der täglichen Diskussion macht es besonders schwierig die Begrifflichkeiten auseinanderzuhalten. Der Unterschied wird in der Integrationsbegleitung aber in dem Moment wichtig, wenn es um die Frage geht, wie geht man mit der Kultur des Heimatlandes oder der Subkultur um, aus der man selbst kommt und aus der die anderen Teilnehmer (oder deren Eltern) stammen.
In Folge eines intensiven Austausches zweier Kulturen (oder Subkulturen) erlebt ein Mensch Lern- und Veränderungsprozesse, die in der Sozialpsychologie auch als Akkulturation bezeichnet werden. Das Model mit den vier Formen Akkulturation des Migrationsforscher John Berry ist wahrscheinlich das bekannteste, weshalb seine vier Kategorien in der öffentlichen Diskussion im Zusammenhang mit Migration am häufigsten verwendet werden:
Begriffsreflexion 1 – Assimilierung
Anpassung: Aufgabe der eigenen Kultur mit Kontakt zur Mehrheitskultur.
Einwanderer, die sich mit Deutschland identifizieren, aber nicht mehr mit dem Heimatland, wie z. B. ein Migrantenkind, das als Erwachsener weder die Sprache seiner Eltern kann noch öfter oder länger im Heimatland der Eltern war als ein durchschnittlicher Deutscher.
Begriffsreflexion 2 – Integration
Erneuerung: Beibehaltung der eigenen Kultur mit Kontakt zur Mehrheitskultur.
Einwanderer, die sich sowohl positiv mit Deutschland identifizieren als auch mit ihrem Heimatland, wie z. B. ein Zuwanderer, der stolz ist sein eigenes Geschäft wie ein deutscher Geschäftsmann zu führen und sich gleichzeitig gut um die Familie im Heimatland zu kümmern.
Begriffsreflexion 3 – Segregation
Abtrennung: Beibehaltung der eigenen Kultur ohne Kontakt zur Mehrheitskultur.
Einwanderer, die sich mit dem Heimatland identifizieren, aber nur wenig oder gar nicht mit Deutschland, wie z. B. ein geduldeter Flüchtling, der sich nur aus Furcht vor Ab-Schiebung an die wichtigsten Gesetze hält und ansonsten weitgehend unter seinesgleichen so wie zuhause lebt.
Begriffsreflexion 4 – Marginalisierung
Ausschluss: Aufgabe der eigenen Kultur ohne Kontakt zur Mehrheitskultur.
Menschen, die sich weder mit Deutschland noch einem anderen Land identifizieren, wie z. B. ein Jugendlicher, der sich aufgrund seines Aussehens in Deutschland nicht dazugehörig fühlt, und aufgrund seiner Unkenntnis der Sprache und Heimat seiner Eltern das Land auch nicht seine Heimat nennen kann.
Wenn das Ziel ist, Menschen beim Assimilierungsprozess zu unterstützen, dann stehen Lernen und Training von Verhaltensweisen der Mehrheitsgesellschaft im Vordergrund. Wenn Sie aber Integration erreichen möchten, dann muss der Fokus auf den Prozess der Teilhabe verschoben werden. Die hier in diesem Buch vorgestellte Methode ist ein Verfahren um den Integrationsprozess zu initiieren und zum Erfolg zu begleiten. Ziel ist nicht Assimilation, sondern Integration.
Das Integrationsproblem
Wie kommt es eigentlich, dass Menschen den Kontakt zu einer Kultur verlieren? Oder vielleicht noch schlimmer, zu allen Kulturen, sogar zu ihrer eigenen und der ihrer Eltern?
Die erste These dieses Buches lautet: Auslöser ist ein Verlusttrauma. Gerade bei Geflüchteten, aber auch bei allen anderen, die ein Problem damit haben, sich positiv in die Mehrheitsgesellschaft einzubringen. Verlieren kann man Eltern, Kinder, Verwandte, die Arbeit, die Heimat, das Zuhause, Gesundheit, Ansehen, Geld und vor allem auch Vertrauen, in eine bessere Zukunft oder eben auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. So etwas passiert auch ohne Flucht, z. B. durch Unfälle, den Tod eines geliebten Menschen, schwere Krankheiten, Naturkatastrophen, Gewalt oder Mobbing. Alles, was Menschen ohne ihre eigene Entscheidung aus der gewohnten Lebenssituation herausreißt oder diese so unerträglich macht, dass sie sie aufgeben, um ihr zu entkommen.
Die zweite These ist: Eine Folge von Verlusttrauma ist der Verlust der persönlichen Orientierung im Leben und dadurch der Verlust der sozialen Einbindung. Im Kleinen kennt das jeder. Der Verlust eines geliebten Spielzeugs kann bei einem Kind (bei Erwachsenen z. B. ein Handy oder etwas anderes Wichtiges) für Tage alle Aufmerksamkeit absorbieren. Das geht solange, bis sich das Kind umorientiert und einen Ersatz für das Spielzeug gefunden hat. Bei dem Verlust eines geliebten Menschen oder einer lebenserfüllenden Arbeitsstelle ist das schon wesentlich schwieriger. Die Orientierungsphase geht bei den meisten Menschen mit einem zeitweisen Zurückziehen aus dem aktiven sozialen Leben einher. Bei manchen Menschen bis hin zu tiefen Depressionen und einem völligen Rückzug. Diese Phase dauert, je nach Situation, so lange bis eine neue Perspektive im Leben erkennbar wird. Wer sozial gut eingebunden war, dem hilft in der Regel der Halt der Gemeinschaft schneller eine neue Perspektive zu formulieren als das einsame Menschen können.
Für Migranten kommen allerdings zwei zusätzliche Probleme hinzu: zusätzlich zu ihrer persönlichen Orientierungslosigkeit verlieren sie durch die räumliche Veränderung den sozialen Halt der gewohnten Umgebung, und sie kennen weder die Möglichkeiten, noch die Anforderungen der Aufnahmegesellschaft, womit es für sie doppelt so schwer ist neue Perspektiven zu entwickeln.
Um das besser zu verstehen, versuchen Sie sich einmal folgende Situation vorzustellen: Sie leben Ihr ganz normales Leben, Familie, Haus, Arbeit, so wie alle anderen auch. Dann passiert plötzlich etwas, auf das Sie keinen Einfluss hatten und Sie müssen zusammen mit den anderen Menschen aus ihrem Heimatort flüchten. Am neuen Ort sind Sie natürlich froh, in Sicherheit zu sein. Klar …
Aber dann kommen die täglichen Probleme und mit ihnen die Fragen: zurückgehen? Hierbleiben? Weiterziehen? Zweifel, ob die Entscheidung richtig war. Sie vermissen Ihre Familie, Freunde, das Haus, die vielen lieben kleinen Dinge. Jeder das seine und jeder individuell.
Sie denken nach, wo Sie welche Perspektiven hätten, die über das nackte Überleben hinausgehen. Lernen, arbeiten, Familie, Anerkennung und Selbstverwirklichung. Das ist menschlich. Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer Stadt gestrandet, in der Sie weder die Sprache können, noch die Möglichkeit hätten etwas zu lernen, noch legal zu arbeiten und selbst die lokale Bevölkerung hätte die größten Probleme ihre rudimentärsten Bedürfnisse zu befriedigen, Sie dann noch weniger. Keiner hat dort auf Sie gewartet und es will Sie hier auch keiner in der Zukunft. Keine Frage, Sie sind in Sicherheit, aber eine Perspektive auf Dauer ist das sicher nicht.
Dann wagen Sie persönlich die nächste Flucht, diesmal vor der Perspektivlosigkeit des sicheren Ortes, und hoffen, dass sich Ihre Erwartungen an eine neue Zukunft an einem anderen Ort erfüllen. Viele Menschen sind so jahrelang auf der Flucht. Sie fliehen vor den täglichen Problemen, immer im Gedanken irgendwann an einen Ort zu kommen, wo sie den Ausweg aus der als ausweglos und ohnmächtig erlebten Situation finden. So ziehen auch Sie von einem Ort zum anderen in der Hoffnung wieder eine normale, legale Arbeit zu finden, Ihre Familie zu vereinen oder eine neue zu gründen. Zumindest eine neue Perspektive zu finden, an die Sie glauben können.
In dieser Hoffnung fällen Sie die Entscheidung und versuchen am neuen Ort Ihrer Wahl angekommen, mit Ihren gewohnten Kommunikationsmustern die eigenen Erwartungen einer besseren Zukunft zu realisieren. Schnell merken Sie, dass aber nicht nur Sprachprobleme, sondern auch Unterschiede, Intransparenz, Vorurteile, teilweise Unwille und Ausgrenzung, und nicht zuletzt die eigene Angst vor dem erneuten Scheitern die Umsetzung ihrer Pläne in immer weitere Ferne rücken lässt.
Schnell gesellt sich zur Einsamkeit in der Ferne auch die Einsicht, dass es keinen weiteren Platz auf der Welt gibt, wo man noch hingehen könnte. Denn das Ziel, das Sie ausgewählt hatten, war ja das Beste unter den möglichen. So, wie für viele Migranten Deutschland. Außer, natürlich, die gute, alte, vermisste Heimat. Wenn doch nur alles wieder so wäre wie früher …
Das ist der Moment, in dem das Integrationsproblem beginnt: Die persönliche Perspektive geht verloren, warum man alles, was man besitzt und kann – seine ganze Kraft – für eine Teilhabe an einer sozialen Gemeinschaft mit ihrer spezifischen Kultur einsetzen sollte. Die endgültige Perspektivlosigkeit stellt sich ein.
So entwickelt sich eine als ungewollt und zwangsläufig erlebte, unbewusst rückwärtsgerichtete Perspektive, die sich aus der Nostalgie der alten Tage und der Hoffnung speist, irgendwann wieder in die Heimat zurückzukehren. Rückbesinnung auf Freund- und Feindbilder der Heimat, sowie Zugehörigkeit zu Religion bieten am neuen Ort den anderweitig nicht gefundenen Halt.
Die ehemals als Perspektive wahrgenommenen Möglichkeiten des neuen Ortes werden nun zu einer beängstigenden Freiheit der anderen gegen einen selbst empfunden. Soziale Kontakte beschränken sich deshalb auf den Erhalt der alten Verhaltensmuster unter seinesgleichen. Der Weg in die Parallelgesellschaft nimmt seinen Lauf …
Grundpfeiler einer gelungenen Integration
Folgend finden Sie einen Definitionsvorschlag für gelungene Integration. In der Begriffsdefinition sehen wir, dass Integration Erneuerung bedeutet. Man könnte auch sagen die Schaffung von etwas Neuem, das durch den Kontakt der alten Kultur mit der neuen Mehrheitskultur entsteht. Wenn hier im Buch von Integration die Rede ist, dann gilt das in erster Linie für den Einzelnen, der sich durch die Kombination zweier Kulturen erneuert, ein anderer wird. Eine Gesellschaft, die global interagiert erneuert und verändert sich zwangsläufig ständig weiter. Unabhängig davon, ob sich der Einzelne assimiliert, integriert oder segregiert.
Für den einzelnen Menschen eröffnet sich bei erfolgreicher Integration folgende individuelle Perspektive:
• Ich weiß wie ich mich in „der Mitte der Gesellschaft“ bewegen muss.
• Ich kenne Menschen verschiedener Kulturen und Bildung.
• Ich weiß, ich habe eine reale Chance meine eigene Zukunft zu gestalten.
• Diverse Gruppen geben mir Halt und Motivation.
Wie gefällt Ihnen diese Perspektive? Sie teilen sie gar? Herzlichen Glückwunsch, das heißt, Sie sind gut integriert! Sie haben aber sicher bemerkt, dass es auch Abkömmlinge der Mehrheitsgesellschaft gibt, die nicht alle vier Fragen mit „ja“ beantworten können. Integrationsbedarf oder Integrationsprobleme sind kein Migranten-Privileg, sondern betreffen jeden, der aus der Mehrheitsgesellschaft gefallen ist oder aus einer Subkultur heraus will. Durch ein starkes persönliches Verlusttrauma können auch Menschen herausfallen, die vorher stark in der Mehrheitsgesellschaft verankert schienen.
Die drei formulierten Leitlinien gelungener Integration, die der GrowInGermany-Methode zugrunde liegen, gelten universell für alle Menschen. Die Prämisse dieser Leitlinien wird im Kapitel „Glaubenssätze“ noch ausführlicher besprochen, aber zumindest zwei sollten hier erwähnt werden: Der Mensch ist ein soziales Wesen und Arbeit ist alles, was er für andere tut.
Friede steht für einen dauerhaften und nachhaltigen Diskurs verschiedener Milieus, Kulturen, Altersgruppen, Traditionen und Religionen. Der Weg zu einem friedlichen Miteinander verläuft über Kommunikation und Interaktion, da beide Voraussetzung für Frieden sind.
Freude steht für ein Menschenbild, das nach der Befriedigung der Grundbedürfnisse den Wunsch nach Persönlichkeitsentwicklung anerkennt und auf ihm aufbaut. Im Mittelpunkt der Kurse steht die Begleitung der Teilnehmer bei der Realisierung ihrer individuellen Entwicklungswünsche.
Eigentum steht für eine persönlich positiv erlebte Teilhabe an produktiven gesellschaftlichen Prozessen, die den Menschen vom Bittsteller und Empfänger zu einem Macher und Gestalter des eigenen Lebens befähigen. Ziel ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit, da nur sie die Grundlage eines mündigen Bürgers ist, der seine Rechte und Pflichten kennt.
Zeit für Paradigmenwechsel
Viele Probleme der Integrationspolitik, die in den Kapiteln „Supermarkt der Angebote“, „Idee der multikulturellen Gesellschaft“, Parallelgesellschaften“ ausführlicher beschrieben werden, entstammen einer alten Vorstellung von Arbeit und Migration (s. Kapitel „Arbeit“). Ihr entspringt die aus der Entwicklungshilfe stammende Idee, das Wichtigste wäre Sachhilfe und Wissensvermittlung für Bedürftige. Eine Idee, die aus der Zeit der Industrialisierung stammt. Wie gleich zu sehen sein wird, passt das heute aber nur noch zur Katastrophenhilfe. Die in diesem Buch vorgestellte Methode unterscheidet sich deshalb auch in diesem Bereich durch zwei Paradigmenwechsel.
Abundanz-Mentalität statt Defizitorientierung
Der erste Paradigmenwechsel heißt: weg von der defizitorientierten Wahrnehmung des Menschen hin zu einer Abundanz-Mentalität. Defizitorientiert würde bedeuten, dass ein Mensch, der keine oder nur schlechte Kenntnisse einer Sprache hat, z. B. Deutsch, ein efizit hat. Auch die Fixierung auf das Defizit keine deutsche Ausbildung zu haben, schließt oft den Blick für Erfahrungen und Fähigkeiten, die Deutsche nicht oder nur sehr selten haben. Das gilt für die Dozenten, die Kurse koordinieren und organisieren, genauso, wie für die Teilnehmer dieser.
Außer gehörlosen Menschen kann jeder eine Sprache lernen, wenn er sie braucht. Auch hat jeder Mensch Ressourcen, um in jeglicher Gesellschaft erfolgreich zu sein; unabhängig davon, ob er gerade dabei ist sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren oder nach langer Pause wieder in diesen zu integrieren. Aber je länger sich der Einstieg in produktive Prozesse verzögert, desto mehr werden diese Ressourcen deaktiviert und desto schwieriger ist es sie zu reaktivieren. Die GrowInGermany-Methode verlagert deshalb den Fokus auf die individuellen Stärken und Fähigkeiten eines jeden Menschen. In der praktischen Umsetzung bedeutet das: raus aus der Empfängerrolle und aus Kursen, in denen Menschen „geparkt werden, bis sie die richtige Qualifizierung haben“, und rein in die Rolle des Gestalters und Machers des eigenen Alltags.
Aus dem gleichen Selbstverständnis heraus sind Dozenten mit einem ganz anderen professionellen Werdegang und Hintergrund, als den klassischen sozialen Berufen eine Bereicherung mit Vorbildfunktion. Ihr Wunsch nach Veränderung, die Umsetzung dieses Vorhabens durch eine Weiterbildung zu professionellen Integrationsbegleitern sowie die kontinuierliche Selbstreflexion und Zielformulierung während der Arbeit gehören zu den Grundlagen des Erfolgs der Methode.
Die GrowInGermany-Methode geht außerdem von einem ganzheitlichen und ressourcenorientierten Menschenbild aus. Dieses sieht nicht nur die äußeren Umstände der Menschen, die in die Rolle als Transferleistungsempfänger geraten sind, sondern auch den starken psychischen Druck, dem sie ausgesetzt sind. Oft entsteht ein Kreislauf, der durch milieuspezifische Stressoren und Verlust des eigenen Wertgefühls geprägt ist, wenn man Monate oder Jahre mit Einschränkungen durch Arbeitslosigkeit, bürokratische Wartezeiten, Umzüge oder Flucht erlebt hat. Dieser Druck kann auch den gesundheitlichen Zustand nachhaltig beeinträchtigen. Dabei gelingt es den Betroffenen meist nur schwer aus diesem Kreislauf herauszukommen. Das Gefühl des Kontrollverlustes, weil Krankheiten die Arbeitsaufnahme immer weiter verzögern, führen zu immer neuem Stress. Die Abundanzmentalität bietet einen Ausweg aus diesem Kreislauf, wie wir später noch im Kapitel „Glaubenssätze“ genauer sehen werden.
Interaktive Kommunikation statt Wissenvermittlung