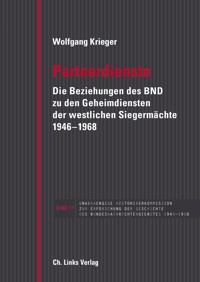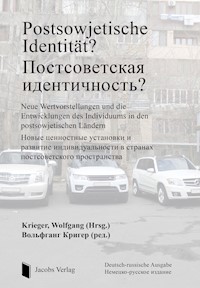
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lippe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Dreißig Jahre nach dem Ende der Sowjetunion scheint es berechtigt, eine Zwischenbilanz zu ziehen und die Frage zu beleuchten, welchen Wandel die Gesellschaften der ehemals sowjetischen Länder inzwischen vollzogen haben und welche politischen Leitbilder und Lebenssinn vermittelnden Werte die Geschichte der Transformation hervorgebracht hat. Gibt es eine „postsowjetische Identität“, ein gemeinsames Selbstverständnis der Menschen in diesen Ländern, das sich zugleich als Bewältigung der sowjetischen Vergangenheit und als ein Aufbruch zu neuen Orientierungen verstehen lässt? Gibt es – jenseits von Nationalismus, Romantisierung oder Abrechnung – eine postsowjetische Vision der künftigen Gesellschaften, die sich vom Blick auf die Vergangenheit lösen kann? Welcher Menschentypus folgt dem „homo sovieticus“ und wieviel vom Sowjetmenschen besteht noch fort in diesem? Wie schlagen sich die wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Umbrüche der postsowjetischen Gesellschaften nieder in der Sicht der Bürger*innen auf ihre Lage, in ihren Erwartungen, Hoffnungen und Idealen, in ihrem Lebenssinn und ihren Wertorientierungen? Finden die jüngeren Generationen die Freiheit und den Mut für neue Utopien und woher nehmen sie das Fundament für diese? Zu diesen Fragen versammelt das vorliegende Buch – jeweils in russischer und in deutscher oder englischer Sprache – sozialwissenschaftliche Beiträge aus Russland, Armenien, Kirgisistan, Litauen, dem Balkan und Deutschland. Спустя тридцать лет после распада Советского Союза кажется оправданным подвести итоги и изучить вопрос о том, какие изменения претерпели в настоящее время бывшие советские республики и какие политические модели и ценности, передающие смысл жизни, принесла история преобразований. Есть ли «постсоветская идентичность», у людей этих стран общее представление о себе, которое можно трактовать как примирение с советским прошлым, так и как путь к новым ориентациям? Есть ли – помимо национализма, романтизации или расправы с прошлым – постсоветское видение будущего общества, которое может отвлечься от взгляда на прошлое? Какой тип человека следует за «homo sovieticus» и сколько в нем еще осталось от советского человека? Как экономические, политические, социальные и культурные потрясения в постсоветских обществах отражаются на взглядах граждан на свое положение, на их ожидания, надежды и идеалы, на их смысл жизни и их ценностные ориентации? Найдёт ли молодое поколение свободу и смелость для новых утопий и что они возьмут за основу при их формировании?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 886
Ähnliche
Postsowjetische Identität?
Постсоветская идентичность?
Neue Wertvorstellungen und die Entwicklungen des Individuums in den postsowjetischen Ländern
Новые ценностные установки и развитие индивидуальности в странах постсоветского пространства
Krieger, Wolfgang (Hrsg.)
Вольфганг Кригер (ред.)
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Библиографическая информация Немецкой библиотеки
Немецкая библиотека включает данную публикацию в состав Немецкой национальной библиографии; подробная информация доступна в интернете на сайте: http://dnb.ddb.de
Copyright 2021 by Jacobs-Verlag
Am Prinzengarten1, 32756 Detmold
ISBN 978-3-89918-826-4
Inhalt – Содержание
Wolfgang Krieger – Вольфганг Кригер
Vorbemerkung und Ausblick auf die Beiträge des Buches …………,……..9
Предисловие и предварительный просмотр представленных в книге научных работ ……………………………………………………………..27
Zur Einführung – Введение
Wolfgang Krieger – Вольфганг Кригер
„Postsowjetische Identität“ – Eine Einführung zur Logik des Identitätsbegriffes ………………………………………………………..47
«Постсоветская идентичность» – Введение в тему логики
концепции идентичности ……………………………………………...65
Artur Mkrtchyan – Артур E. Мкртчян
Postsowjetische Identität im Prisma der Freiheit ………………….……….83
Постсоветская идентичность в призме проблемы свободы ….………..97
Bakitbek A. Maltabarov – Бакытбек А. Малтабаров
Die paradoxe Natur des postsowjetischen Menschen als soziologischer Untersuchungsgegenstand ………………………....................................111
Парадоксальный постсоветский человек как объект изучения социологии …………………………………………………………….123
Wertvorstellungen, Identität und Identifikationen Ценностные установки, идентичность и идентификации
Wolfgang Krieger – Вольфганг Кригер
Wertorientierungen und Wertewandel in postsowjetischen Ländern – ein internationaler Vergleich …………………………………………….….137
Ценности и их изменение в постсоветских странах
– международное сравнение …………………………………………….165
Elena I. Elisowa – Е. И. Елизова
Die Bildung von Wertorientierungen der russischen Jugend
im postsowjetischen Raum ………………………………………..........193
Формирование ценностных установок российской молодежи
в условиях постсоветского пространства ……………………………..203
Nomeda Sindaravičienė – Номеда Синдаравичене
Postsowjetische Identität – neue Wertvorstellungen und die Entwicklung des Individuums in den postsowjetischen Ländern
am Beispiel Litauens ……………………………………………………..213
Постсоветская идентичность – новые ценности и развитие личности в постсоветских странах на примере Литвы ……………………………223
Sona Manusyan – Сона Манусян
Die Verjüngung einer alten Identität? Der Aufbau bürgerlicher
Identität und der Entwicklungskontext staatsbürgerlicher
Beziehungen in Armenien ………………………………………............233
Омолаживане старой идентичности? Гражданское самосознание
и развивающийся контекст отношений между государством
и гражданами в Армении ……………………………………………...247
Edina Vejo / Elma Begagić – Эдина Вехо / Эльма Бегагич
Konstituierende Wertorientierungen in der bosnisch-herzegowinischen Nachkriegsgesellschaft am Beispiel der bosnisch-herzegowinischen Muslime ………………………………………………………………...261
Установочные ценности ориентации в послевоенном боснийско-герцеговинском обществе на примере боснийско-герцеговинских мусульман ……………………………………………………………..267
Arlinda Ymeraj – Арлинда Ймерай
Social Values in transition – the case of Albania …………………………273
Социальные ценности в переходный период – пример Албании ........287
Identität in ausgewählten Lebensbereichen – Идентичность в избранных сферах жизни
Wolfgang Krieger – Вольфганг Кригер
Identität und mediale Selbstdarstellung junger Menschen im postsowjetischen Raum ………………………………………………..303
Идентичность и самопрезентация молодых людей в социальных
сетях на постсоветском пространстве .………………………………321
Igor B. Ardashkin, Marina A. Makienko, Alexander J. Chmykhalo –
И.Б. Ардашкин, М.А. Макиенко, А.Ю. Чмыхало
Berufliche Identität am Beispiel der universitären Ingenieursausbildung
in Tomsk (Russland) ……………………………………………………339
Профессиональная идентичность на примере университетской инженерной подготовки г. Томска (Россия) …………………………351
Yana Chaplinskaya – Яна Чаплинская
Die berufliche Tätigkeit des „Patchwork-Menschen“ in der modernen russischen Gesellschaft ………………………………………………….363
Профессиональная деятельность «лоскутного» человека
современного российского общества ………………………………...367
Bilanz – Заключение
Wolfgang Krieger – Вольфганг Кригер
Postsowjetische Identität und (neue) Wertorientierungen?
Eine historische Bilanz …………………………………………………373
Постсоветская идентичность и (новые) ценностные ориентации? Исторический обзор ………………………………………………….431
Autor*innen – Авторы ……………………………………………………491
Vorbemerkung und Ausblick auf die Beiträge
des Buches
Wolfgang Krieger
Die kulturanthropologische Auseinandersetzung um das Bild des „Sowjetmenschen” hat sowohl in den ehemals sowjetischen Ländern als auch in einigen westlichen Ländern seit den Siebzigerjahren eine gewisse Tradition und sie ist nun, rund dreißig Jahre nach dem Ende der Sowjetzeit, noch immer keine abgeschlossene Diskussion. Sie bildet den Ausgangspunkt für die heutige Frage, ob und in welchem Umfang auch nach dem Ende der Sowjetrepubliken in den Mentalitäten der Bürger*innen ihrer Nachfolgestaaten der „Sowjetmensch” noch fortbestehe beziehungsweise welcher neue „Menschentypus” in den letzten Jahrzehnten nach dem Zerfall der Sowjetunion sich infolge der neuen wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen herausgebildet habe. Beide Fragen vereinen sich in der aktuellen Frage nach der Konstitution einer „postsowjetischen Identität”, der in diesem Buch teils auf grundsätzliche Weise, teils in analytischer und beschreibender Weise nachgegangen wird. Mit dieser Thematik eng verbunden ist die Frage nach der Entstehung neuer Wertorientierungen beziehungsweise auch nach dem Fortbestehen sozialistischer Werte in den auch im kulturellen Wandel sich befindenden Gesellschaften des ehemals sowjetischen Ostens. Die Bedeutung von Wertorientierungen für die Entstehung einer neuen „postsowjetischen Identität” stellt in diesem Buch eine herausgehobene Thematik dar und ist zugleich in gewissem Umfang auch eine programmatische Ausrichtung der Analyse.
Die Veröffentlichung dieses Buches schließt an eine Internationale Konferenz zum Thema „Postsowjetische Identität“ an, die vom 17. bis 21 September 2018 in Deutschland an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein am Fachbereich für Sozial- und Gesundheitswesen stattfand. An ihr nahmen Dozent*Innen aus Partner-hochschulen der Hochschule Ludwigshafen aus der russischen Föderation, aus Armenien, Albanien, Bosnien-Herzegowina und Deutschland teil. Sie beteiligten sich an Arbeitsgruppen und Workshops und hielten Vorträge zum Thema, die größtenteils in diesem Buch wiedergegeben und übersetzt werden. In der Folge schlossen sich weitere interessierte Autor*innen aus ehemals sowjetischen Ländern der Bearbeitung des Themas an, so dass im vorliegenden Buch nun Beiträge von russischen, albanischen, armenischen, bosnisch-herzegowinischen, deutschen, kirgisischen und litauischen Sozialwissenschaftler*innen veröffentlicht werden können.
Die besagte Konferenz trug den Titel „Postsowjetische Identität – neue Wertvorstellungen und die Entwicklungen des Individuums in den postsowjetischen Ländern” und setzte somit einen Akzent auf einen bestimmten sozialanthropologisch, soziologisch, kulturologisch und psychologisch gleichermaßen anerkannten Faktor in der Entwicklung von Identität, nämlich auf die identitätsbildende Bedeutung von Wertorientierungen in der Kultur von Gesellschaften. Dieser Faktor steht neben anderen Faktoren der Selbstidentifikation wie dem leiblichen Selbstbewusstsein, den Zuschreibungen von Identität durch die sozialen Beziehungen eines Menschen, der Selbstverortung des Menschen in sozialen Zugehörigkeiten und vertrauten ökologischen Räumen etc. und er findet sein Fundament vor allem in traditionellen, politischen und religiösen Weltbildern, aus welchen heraus leitende Wertorientierungen und lebenssinnschaffende Einstellungen entstehen. Damit hatte sich die Konferenz einer gewissen Engführung des Identitätsthemas verschrieben, die freilich nicht gegenüber andersartigen Faktoren der Identitätsentwicklung in ausschließender Weise verbindlich werden sollte, aber doch vor allem die Betrachtung von Identität als Selbstidentifikation mit Wertorientierungen und Haltungen in den Vordergrund stellen wollte.
Diesem Selbstverständnis des thematischen Auftrages entsprechend wurde der Konferenz eine Reihe von Leitfragen an die Teilnehmer*innen vorangestellt, die hier kurz aufgeführt seien:
Sind nach dem Ende der Sowjetzeit neue Werte entstanden oder sind die Wertvorstellungen dieser Zeit noch immer am wichtigsten? Welche Werte aus dieser Zeit existieren weiter, welche neuen Werte etablieren sich?
Woher kommen diese neuen Werte, wodurch werden sie begründet?
Gibt es neue Ideale?
Welche Visionen haben die Menschen heute vom guten Leben und von einem sinnvollen Leben?
Wodurch glauben die Menschen, etwas Wertvolles für andere Menschen, für die Gesellschaft tun zu können?
Welche Symbole kennzeichnen eine erfolgreiche Lebensführung und ein „gutes Image“ für den postsowjetischen Menschen?
Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Entsteht ein Wertepluralismus in dieser Gesellschaft oder zeichnet sich eine neue gesellschaftliche Homogenität im Wertbewusstsein der Individuen ab?
Gibt es Konflikte zwischen den Wertvorstellungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, gibt es Konflikte zwischen den Generationen?
Wie wünschen sich junge Menschen in der Zukunft zu werden? Gibt es Idole, mit denen sich junge Menschen identifizieren?
Welche Unterschiede können erkannt werden zwischen den Werten dieser Gesellschaft und denen im Westen zurzeit?
Wohin wird sich voraussichtlich die Gesellschaft in diesem Land in den nächsten Jahren entwickeln?
(Dimensionen: soziale Gerechtigkeit, Ungleichheit, Eliten, interkulturelle Öffnung)
Wo können die größten Konfliktpotenziale in der Gesellschaft gesehen werden?
Was eint und was spaltet die Gesellschaft?
Was sind die wichtigsten Veränderungen im Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Staat?
Die Artikel in diesem Buch nehmen zu ausgewählten Fragen aus dieser Liste Stellung und verbinden nicht selten Fragestellungen auch untereinander. Sie argumentieren sehr häufig stellungnehmend zur historischen Vergangenheit, sei es, um durch die Kontrastierung der Gegenwart zur Vergangenheit die Situation besondern prägnant zu profilieren, sei es, weil sich die Probleme der Gegenwart teilweise aus den Bedingungen der Vergangenheit herleiten lassen, sei es, um aus der vorsowjetischen Vergangenheit Wertsysteme wieder aufzugreifen, von deren Wiederbelebung man sich einen Gewinn für die Gegenwart und Zukunft erhofft. Der historische Vergleich ist daher ein fast durchgängiges Mittel zur Präzisierung der Identitätsproblematik und der Wertbildungsproblematik in der Gegenwart. An seiner Seite steht ein weiterer Vergleich, nämlich der zwischen dem Wertebewusstsein der westeuropäischen Kulturen und jenem der östlichen postsowjetischen Länder heute.
In diesem Buch wird die Suche nach einer Identität in Kulturen, die ihre sowjetischen Merkmale – so die implizte Vorannahme der Rede von einer “postsowjeti-schen Identität” – mehr oder minder verloren haben und auf dem Wege sind, neue Strukturen auszubilden und sich so selbst neu zu formieren, aus sehr unterschiedlichen Sichtweisen heraus betrieben. Das Buch versammelt Beiträge aus dem postsowjetischen und postkommunistischen Raum, konkret aus der russischen Föderation, aus Zentralasien, dem Kaukasus und dem Baltikum, ferner Autor*innen aus dem postkommunistischen Balkan, und schließlich aus dem europäischen Westen. Die Autor*innen aus diesen verschiedenen Ländern blicken auf das Alte wie das Neue teils als Insider mit den Augen der direkt Konfrontierten, die die Veränderungen in unmittelbarer Erfahrung verfolgt haben und bis in ihren Alltag hinein vielfältig von ihren Auswirkungen betroffen waren und die zugleich auch als Zeitzeugen der Vergangenheit mehr als alle anderen kompetent sind einen Vergleich zu ziehen; teils schauen sie – von westlichen Erwartungen und Sichtweisen geprägt – von außen auf eine wenig vertraute Welt und versuchen mit ihnen geläufigen Erklärungen die ihnen auffällig erscheinenden Phänomene des Fremden nach eigener Logik zu ordnen; teils verfügen sie über ähnliche Erfahrungen mit dem gelebten Sozialismus und mit der post-kommunistischen Ära wie die Autor*innen aus den ehemals sowjetischen Ländern (so hier die Autor*innen aus dem Balkan) und erleben die postkommunistische Zeit danach in gewissem Maße als ähnlich zur postsowjetischen Lage im Osten, auch wenn ihr Blick durch das eigene Kulturbewusstsein Differenzen wahrnimmt, die einerseits von alternativen Perspektiven zeugen, andererseits aber auch das Vertraute im Fremden dem Fremdem im Vertrauten gegenüberzustellen erlauben. So wird – den unterschiedlichen Vorausset-zungen entsprechend – eine Vielzahl von Sichtweisen artikuliert und das Thema dieses Buches aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Zugleich geraten auch infolge der Herkunft der Autor*innen aus verschiedenen Regionen landesspezifische Phänomene und Entwicklungen in den Blick, aus welchen sich Erklärungen für kulturelle Besonderheiten im Umgang mit den identitätsbildenden Faktoren finden lassen.
Das Buch versteht sich zugleich als ein Kompendium der Positionierungen in der Frage nach den Konstitutiva einer „postsowjetischen Identität” und als Kaleidsokop vielfältiger Schlaglichter auf die Entwicklungsgeschichte einer nun etwa dreißigjährigen Phase postsowjetischer Kultur- und Gesellschaftshistorie. Es ist nicht beabsichtigt, bestimmte Dimensionen dieser Geschichte systematisch nachzuzeichnen, diesen Dimensionen eine breite empirische Fundierung zu schaffen oder nationale und regionale Vergleiche zu ziehen. Diese Aufgaben sind in der Fachliteratur schon umfassend wahrgenommen worden und werden auch zukünftigen Studien überlassen bleiben. Vielmehr bescheiden wir uns im Großen und Ganzen mit dem Ziel, die Leser*innen dieses Buches an Erfahrungen und summarischen Interpretationen von Sozialwissenschaftler*innen teilhaben zu lassen, die vor dem Hintergrund der Geschichte ihres Landes die Krisen des Zerfalls des sowjetischen Sozialismus einerseits, die Bewältigung der anstehenden Aufgaben dieser Phase andererseits untersuchen und ihre Auswirkungen auf die Entstehung neuer Wertorientierungen und im Blick auf die Entwicklung sozialer und kultureller Identität darstellen. Dabei setzen die Autor*innen unterschiedliche thematische Schwerpunkte, indem sie bestimmte Wertentwicklungen und identitätsbildende Orientierungen in den Vordergrund rücken und zum Gegenstand ihrer Analyse machen. In diesen ausgewählten Sichtweisen steht nicht zu erwarten, dass der je zugrunde liegende Begriff der Identität in allen Beiträgen als einheitlich zu erkennen ist. Schon deshalb verbietet sich hinsichtlich vieler Dimensionen der Vergleich zwischen den Beiträgen. Nichtsdestoweniger aber hoffen wir, dass die zahlreichen Phänomene, die zur Darstellung kommen, und die unterschiedlichen Facetten der Wahrnehmungen, die sich aus der Differenz der Perspektiven ableiten, den Leser*innen einen verwertbaren Fundus an Kenntnissen und nicht minder an neuen Fragen vermitteln, die sich hinsichtlich des Konstruktes der „postsowjetischen Identität” stellen lassen.
Die veröffentlichungsreife Fertigstellung der Texte und insbesondere die Übersetzungen aller Texte haben viel Zeit in Anspruch genommen; daher konnte eine zunächst für das Jahr 2019 geplante Herausgabe des Buches nicht eingehalten werden und wir mussten einige Autor*Innen um Verständnis bitten dafür, dass wir die Bearbeitungszeit der Buchvorlage doch erheblich verlängern mussten. Dadurch haben sich allerdings auch neue Chancen ergeben, weitere Beiträge in das Buch aufzunehmen. Wir danken allen Autor*innen heute für ihre Geduld.
Der Herausgeber dankt insbesondere den Übersetzerinnen Anna Zasuhin, Elena Elisowa, Larissa Bogacheva und Lubov Korn für ihr unermüdliches kooperatives Engagement, ihr nicht nachlassendes Durchhaltevermögen und ihre eifrigen Bemühungen um sinngemäß treffende Übersetzungen für beide Sprachen. Ohne ihr zuverlässiges Engagement und ihre zielführende kommunikative Kompetenz im Dialog mit den Autor*innen wäre dieses Buch nicht zustande gekommen.
Wir danken für unterstützende Leistungen bei der Übersetzung der Artikel ins Russische bzw. ins Deutsche Daria Filipenko, Nino Kapanadze, Laima Lukočiūtė, Natalie Rybnikov und Lusine Zakaryan, die einige Vorträge wie auch Diskussionen im Rahmen der Konferenz übersetzt haben und auch in vielerlei anderer Hinsicht bei der Durchführung der Konferenz hilfreiche Beiträge geleistet haben.
Ausblick auf die Beiträge des Buches
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste und einführende Teil widmet sich der Einführung in einige allgemeine Grundlagen des Identitätsbegriffes und der Frage, welche Bedeutung der Rede von einer „postsowjetischen Identität“ überhaupt zukommen kann. Die Beiträge zweier Autoren aus Armenien und Kirgisistan skizzieren vorwiegend aus einer soziologischen und kulturpsychologischen Sichtweise die Bedingungen einer postsowjetischen Identität in ihren Ländern und vermitteln einen Einblick in die fundamentalen Schwierigkeiten der postsowjetischen Selbstfindung in den Zeiten der Transformation.
Der zweite Teil des Buches beleuchtet die Bedeutung von Wertorientierungen für die Ausbildung einer postsowjetischen Identität aus der Sicht von Autor*innen verschiedener postkommunistischer Länder. Sie untersuchen den historischen und aktuellen Fundus der kulturspezifischen Identitätssymbolik, die gesellschaften Identifikationstendenzen, den gegenwärtigen Stand und die treibenden Kräfte des Wertewandels, aber beschreiben auch die Spannungen zwischen verschiedenen Typen kollektiver Identität und die bestehenden generationalen Konflikte.
Spezielle Teilidentäten des postsowjetischen Menschen heute stellt der dritte Teil des Buches vor. Hier geht es zum einen um einige Auffälligkeiten in der sogenannten „Medien-Identität“ junger Menschen, in welchen die soziale Identität und die dominanten Wertorientierungen zum Ausdruck kommen, zum anderen um die Bedeutung der beruflichen Identität in Russland aus der Sicht von Studierenden und die Prioritäten bei der Berufswahl und schließlich um die Notwendigkeit einer balancierten Patchwork-Identität unter den aktuellen Bedingungen des Arbeitslebens.
Im Folgenden sollen nun die einzelnen Beiträge zusammenfassend vorgestellt werden.
Mit der Kernfrage des Buchtitels, in welchem Sinne der Begriff der „postsowjetischen Identität“ gedeutet werden kann und mit welchen Inhalten er zu füllen ist, befasst sich der einführende Artikel von Wolfgang Krieger. Diese Frage enthält eine Reihe von verführerischen Anreizen sowohl hinsichtlich des Identitätsbegriffes, der nun lange schon in der Kritik steht, als auch hinsichtlich der Formel des „Postsowjetischen“, dessen phänomenale Einheit zweifelhaft ist und von dem möglicherweise allenfalls im Plural gesprochen werden dürfte. Zu dieser Problematisierung gehört auch die skeptische Vermutung, dass in der Rede von postsowjetischer Identität Vorannahmen suggeriert werden, die angesichts der heutigen gesellschaftlichen Realtitäten nach drei Jahrzehnten Transformations-geschichte, aber auch angesichts der so unterschiedlichen kulturellen und sozialen Vorgeschichte der verschiedenen ehemals sowjetischen bzw. kommunistischen Länder des Ostens nicht (mehr) haltbar sind.
Die implizite Logik beider Begriffe zu problematisieren, ist daher das erste Anliegen des Artikels von Krieger. Worin, inwieweit und weshalb Menschen mit sich identisch bleiben – die Antworten auf diese Fragen sind vielfältig und führen zu divergenten Begriffen und wissenschaftlichen Theorien zur Identität. Daher werden im Folgenden von Krieger Identitätsbegriffe aus verschiedenen humanwissenschaftlichen Disziplinen aufgegriffen und der Wandel der Identitätstheorien hin zu einem dynamischen Identitätsbegriff nachgezeichnet. Ihr Ertrag für ein mögliches Konzept der „postsowjetischen Identität“ ist sehr wohl reichhaltig, doch bleibt eine erkenntnistheoretische wie semantische Relativierung der Rede von „postsowjetischer Identität“ maßgeblich: „Identität“ wie auch „das Postsowjetische“ sind reduktive Konstruktionen im Sinne des Weberschen Idealtypus; sie bezeichnen keine natürlichen Entitäten oder empirisch verfügbaren Verhältnisse, sondern ein Instrument der Analyse, dass das Besondere ausgewählter sozialer Phänomene in Erscheinung treten lässt und eine sinnhafte Ordnung in der Komplexität der sozialen Ereignisse und Strukturen postuliert.
Artur Mkrtchyan widmet seinen Artikel der Frage nach den postsowjetischen Bedingungen möglicher Freiheit und spannt die Analyse dieser Bedingungen ein zwischen den Polen der Haftung am Vergangenen und dem Streben nach dem Zukünftigen, aber auch zwischen den Polen einer negativen Freiheit der Überwindung von Abhängigkeit und einer positiven Freiheit, sich an neue Ideale und Werte zu binden. Auch wenn diese Pole nicht nur für die Einschätzung der Freiheit in postsowjetischen Ländern maßgeblich sein mögen, so haben sie hier doch eine besondere Bedeutung, zum einen, weil in postsowjetischen Ländern mit eben jenem Vergangenen größtenteils gebrochen worden ist, zum anderen, weil vom Zukünftigen kaum eine Vision besteht und ein verbreiteter Pessimismus und Fatalismus ein anomisches Chaos schafft und jegliche Initiative erstickt. Mkrtchyan betrachtet nun die postsowjetische Situation im Besonderen für das kleine Land Armenien, dessen Befindlichkeit zwischen Krieg und Frieden die Entwicklung von Perspektiven schwächt und viele Menschen zur Emigration bewegt. Die gewünschte Europäisierung des Landes (im Aufbau einer Zivilgesellschaft und demokratischer und rechtsstaatlicher Institutionen) behindern aber auch innere Faktoren, die noch als das Erbe der Sowjetzeit und als die Wunden der Neunzigerjahre identifiziert werden können, von welchen sich einige ehemals sowjetischen Länder außerhalb Russlands bis heute nicht erholt haben.
Es ist offenbar, dass viele postsowjetischen Gesellschaften für die Anforderungen eines gesellschaftlichen Neuaufbaus schlecht gerüstet scheinen, es fehlt als sozialen Strukturen, die über die Familien- und Clangemeinschaften hinaus hoffnungsvolle Ressourcen der Solidarität schaffen und Keimzellen der bürgerlichen Gesellschaft bilden könnten. Zwischen dem Ganzen der Nation und dem Partikularen der familialen Einheiten liegt ein Vakuum sozialen Engagements, welches auch in den Sinn- und Wertbindungen der Identität der Bürger*innen als ein fehlendes Orientierungspotenzial zu Tage tritt. Es fehlt an einem Bewusstsein sozialer Verantwortung und sozialer Rücksichtnahme, an sozialen Regeln und Prinzipien, an sozialer Engagiertheit aus eigenen Wertbindungen heraus. Es fehlt an rechtlichen Regelungen und mehr noch an der Anerkennung gesetzlicher Vorschriften und am Interesse für den Sinn gesellschaftlicher Normen überhaupt. Der eröffnete „individuelle“ Freiraum verführt zu einer anything goes Haltung, die nicht von Bewusstsein der Verantwortung für das eigene Handeln begrenzt wird. Woher kommt dieser Mangel? Die Gründe hierfür liegen in der Vergangenheit. Sie sind teils schon der sich in der spätsowjetischen Zeit und vollends dann in den Neunzigerjahren sich ausbreitenden Anomie geschuldet, die offenbar nicht nur den wirtschaftlichen und kulturellen Verfall der Sowjetstaaten, sondern auch einen Verfall der Solidarität und sozialen Aufmerksamkeit hervorgebracht hat, dem bis heute nichts entgegengesetzt werden kann. Sie sind aber auch eine Folge der erlebten Armut in den Neunzigerjahren, der Stagnation der Lohnentwicklung, der anhaltenden Abwertung akademischer Berufe und der mangelnden Perspektivität von gebildeten Menschen. Mkrtchyan bezieht seine Analyse hier auf die Anomietheorie von Merton und erklärt die Desorganisation und Regellosigkeit der armenischen Sozialkultur als einen kollektiven Zustand der Ziel-Mittel-Dissonanz, also als eine Folge der Unerreichbarkeit der Wertsymbole mittels der legalen Ressourcen. Zu diesem Zustand gehört die zunehmende Konzentration des Kapitals auf die Oligarchen ebenso wie das Anwachsen der Wirtschaftskriminalität und das Konkurrenzdenken und die Missgunst zwischen den Bürger*innen. Wenn diese Entwicklungen korrigiert werden sollen, so braucht es nicht nur eine Abkehr von Pessimismus und ein neues Bewusstsein des „moralischen Individualismus“ und des Verhältnisses zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Mkrtchyan setzt seine Hoffnung auf das Bildungssystem; denn dies ist der wichtigste gesellschaftliche Ort, an welchem neues Wissen vermittelt und neue Werte erworben werden können. Allerdings setzt dies voraus, dass sich das System von seinen bisherigen autoritären Strukturen und seinem ethnisierenden Propagandaauftrag verabschiedet und die jungen Menschen in bürgerschaftlicher Verantwortung und globalem Denken fördert.
Bakitbek Maltabarov beschreibt den Zustand des kollektiven Bewusstseins in den ehemaligen Sowjetstaaten als von Spaltungen, Fragmentierung und Widersprüchen geprägt. Paradoxien prägen nicht nur die Gesellschaft und einzelne Gruppen, sondern den Menschen selbst in seiner Persönlichkeit. Sie sind das Erbe einer in sich selbst widersprüchlichen Wirklichkeit der Sowjetgesellschaft und der sukzessiven Unterminierung und letztlich des Zusammenbruchs einer Weltanschauung, die für Generationen den Zusammenhalt von Staat, Gesellschaft und Individuum garantiert hatte, und des Verlustes von Werten und Einstellungen, die offenbar immer weniger in der Lage waren, Perspektiven für die Zukunft zu begründen. Maltabarov zeigt auf, dass die Abkehr von den sozialistischen Werten nicht erst mit der Perestroika erfolgte; vielmehr erodierte schon seit den 80erjahren das sozialistische Fundament der Werte und Einstellungen angesichts der gesellschaftlichen und politischen Praxis, bis schließlich die Widersprüche zwischen den hochgehaltenen Ansprüchen und der gelebten Wirklichkeit so offenkundig wurden, dass der Zusammenbruch des Systems nicht mehr aufzuhalten war. Auf der Suche nach neuen Formen der Zugehörigkeit spielt seit mehr als dreißig Jahren (wie schon einmal zur Jahrhundert-wende) nicht mehr die politische Ideologie, sondern der ethnisch-nationale Faktor nahezu auf der ganzen Welt eine dominierende Rolle. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war der Griff nach dem Konstrukt der nationalen oder ethnischen Identität der erste und am einfachsten zu etablierende Rettungsakt gegenüber der Gefahr des endgültigen Zerfalls der staatlichen Einheit. Maltabarov spricht von einem „Prozess der Materialisierung von nationaler Eigenart, Nationalwürde und Nationalkultur”, der sich des Rückgriffs auf die Traditionen und Bräuche der Vorfahren bediente, der aber auch Separatismus und Intoleranz beförderte. Die nicht enden wollende schmerzhafte Geschichte des Zerfalls der Sowjetunion ist auch eine Geschichte der Beschwörungen nationaler Identitäten, die im Kern ethnozentrisch bis rassistisch motiviert sind. Maltabarov zeigt eine ganze Reihe von politischen Paradoxien nationaler Identitäten auf, in deren Folge internationale Beziehungen erschwert, wenn nicht zerstört werden, die eigene Wirtschaft ruiniert und Chauvinismus und Rassismus kultiviert werden. Hierzu gehört auch die Paradoxie des neuerlichen religiösen Bewusstseins in Kirgisistan, welches in der Sowjetzeit zwar nicht erloschen, aber doch kaum mehr bemerkbar gewesen war, nun aber – für manche auch aus opportunen Gründen zugunsten politischer oder ökonomischer Vorteile überraschend wiedererweckt – zu einem Symbol der nationalen Geschlossenheit aufblüht. Einer von Maltabarov u. a. durchgeführten Studie ist zu entnehmen, dass eine Mehrheit der kirgisischen Bevölkerung behauptet, durch ihre Eltern im sunnitischen Islam religiös erzogen worden zu sein, während ein Viertel seine ethnische Herkunft für die neue Religiosität verantwortlich macht. Andererseits besuchen dennoch mehr als 70 Prozent der Befragten Moscheen oder andere Orte der Religionsausübung gar nicht oder nur einmal im Monat. Zwischen der behaupteten Religiosität und der praktizierten Religionsausübung besteht also ein gravierender Unterschied. Zugleich sind dieselben Befragten besorgt über die zunehmende Religiosität der Jugend, über die Aktivitäten von Sekten und extremistische Tendenzen im Land. Die Ergebnisse machen deutlich, dass nicht nur ein erheblicher Druck auf identitäre Festlegungen besteht, sondern bei der Suche nach Identität viele Menschen auf eine Einheit aus Religion und Ethnie setzen, die allerdings weder mit der persönlichen Sozialisation noch mit neu gewonnenen Überzeugungen glaubhaft begründet werden kann.
Mit der Bedeutung von Wertorientierungen für den kulturellen Wandel in postsowjetischen Ländern befasst sich Wolfgang Krieger in gleich zwei Artikeln in diesem Buch. In seinem ersten Beitrag über Wertorientierungen und Wertewandel stellt er auf der Grundlage des World Value Survey von Inglehart und anderen (von 2014 und vorherigen Jahren) Ergebnisse zu verschiedenen postsowjetischen Ländern zusammen und ordnet verschiedene Indikatoren zentralen Parametern des Wertebewusstseins zu. Dem Inglehartschen Konzept von Moderne als eine Sicherheit ausgerichtete und Postmoderne als ein auf individuelle Freiheit hin orientierte Kulturformation folgend werden die untersuchten Werte größtenteils den Rubriken „materialistische“ oder „postmaterialistische Werte“ zugeordnet. In ihrer Kumulation drücken die so systematisierten Wertvariablen auch die Nähe/Ferne zu autokratischen versus demokratischen Gesellschaftsidealen aus. Im Blick sind dabei in erster Linie Werte zu den Bereichen Arbeit, Individualität und soziale Werte, Wirtschaft und Wohlstand, Konformität und Autonomie, Politisches Engagement und Engagement in sozialen Vereinen und Organisationen und Vertrauen und Kommunikationsklima. Die Analyse berücksichtigt nicht nur die auffälligsten Phänomene und Trends, sondern auch einige Differenzen zwischen den Ländern, den Generationen und den Untersuchungszeitpunkten. Auf Basis der Leithypothesen von Inglehart zur Erklärung des gesellschaftlichen Wertewandels (Knappheitshypothese und Sozialisationshypothese) kann die Abhängigkeit des Wertebewusstseins von der ökonomischen Lage des Landes in der jeweils vorigen Generation ermessen werden. Die Differenzen zwischen den Ländern zeigen aber auch – so die Kritik –, dass diese beiden Hypothesen für die (post)sowjetischen Verhältnisse keine ausreichende Erklärungsbasis darstellen, sondern weitere Hypothesen, etwa zur Bedeu-tung der aktuellen wirtschaftlichen Lage, zum Bildungsstand der Personen, zum Einfluss von Politik und Religion und zur Wirkung von militärischer Bedrohung durch Nachbarstaaten, eine Rolle spielen. Für die Mehrzahl der postsowjetischen Länder ist ferner zu beobachten, dass Politik und Gesellschaft auf der Suche nach einer neuen Identität auf vorsowjetische Traditionen zurückgreifen und daher Werte beschwören, die noch vor der Moderne etabliert waren. Diese mischen sich dann sehr unterschiedlich in die materialistischen oder postmaterialistischen Werte hinein und geben ihnen einen Kontext, der mit den Begriffen von Moderne und Postmoderne nicht angemessen repräsentiert ist. Dies gilt insbesondere für Wertbegriffe einer traditionalistischen muslimischen Großfamilienkultur (die erstaunlich postmodern erscheinen, aber auch kollektivistisch sind). Missverständnisse sind ferner zu erwarten durch die noch der Sowjetideologie entstammenden Interpretationen von Begriffen wie „Solidarität“ oder „Individualismus“ und einigen mehr. In der Summe lässt sich konstatieren, dass alle postsowjetischen Länder sich – wenn auch in unterschiedlichen Entwicklungsständen – in einer unsicheren Dynamik des Wertewandels befinden, in der sich materialistische, postmaterialistische und traditionalistische Wertsysteme widerspruchsvoll vermischen. Dabei bilden materialistische Orientierungen offenkundig das dominante Wertsystem, befeuert von dem anhaltenden Kampf um ökonomischen Fortschritt und gesellschaftliche Stabilität.
Sehr deutlich macht Elena Elisowas Beitrag die intergenerationale Spaltung der russischen Gesellschaft hinsichtlich des Weltbildes und der Moral. Der Beitrag von Elisowa richtet sein Augenmerk auf die Wertorientierungen der russischen Jugend heute, auf ihre Entstehungsbedingungen vor dem Hintergrund des Zerfalls der Sowjetunion und der Anomie der Gesellschaft wie auch als Folge der 1991 neu eröffneten Möglichkeiten in der transformativen Gesellschaft. Die neue Freiheit bot zum einen ungewohnte Möglichkeiten, sich selbst für das zu engagieren, was den Jugendlichen interessant und wertvoll erschien, sie brachte aber auch Anomie, Perspektivlosigkeit, den Verlust von Lebenssinn und den Zerfall einer Vision für die russische Gesellschaft hervor und nicht zuletzt auch die berufliche Überlastung der Eltern beförderte unter Jugendlichen die Verbreitung von Drogenkonsum, Kriminalität und moralischer Indifferenz. Das Schwinden der nationalen Wertschätzung der Bildungsgüter hatte auch zur Folge, dass die Bildungsmotivation der Jugendlichen sich verringerte, ihr Sprachvermögen und ihre Ausdrucksfähigkeit geschwächt und überhaupt die Verbindlichkeit kultureller Normen geschmälert wurde. Diese Phänomene können gedeutet werden als ein Verlust an kultureller, gesellschaftlicher und moralischer Kompetenz, dem, wie Elisowa es nennt, eine „Pragmatisierung der Lebenswerte“ (процесспрагматизациижизненныхценностей) gegenübersteht. Sie drückt sich aus im Erstarken materieller Werte, insbesondere im Gewinnstreben, im Wohlstand und Konsum, in der Sicherheit der eigenen Familie und der Gesundheit. Diese Werte bilden sich auch in den Einstellungen ab, die die junge Generation den verschiedenen Berufen gegenüber zeigen; die Berufe des Business-Bereiches (Unternehmertum, Managment, Unternehmensberatung, Handel, Marketing, Werbung, PR und Bankenwesen) rangieren hier an oberster Stelle in der Wertschätzung. Andererseits engagieren sich nicht wenige Jugendliche auch ehrenamtlich in der Unterstützung sozial schwacher Gruppen und streben sichtlich danach, durch ein moralisch wertvolles Handeln ihrem Leben einen Sinn zu verleihen, den sie im Wertevakuum des Zynismus der 90erjahre nicht finden konnten. Elena Elisowa berichtet von einer soziologischen Studie mit dem Titel «Das Labor von Kryschtanovskaja» 2012-2013 und von Untersuchungen des Zentrums von Sulakschin 2015-2016, die zum einen das Fehlen einer sozialen Verortung der Jugend hinsichtlich ihrer Identität aufzeigen, in dem sich der Mangel an gesellschaftlichen Visionen und an der Entwicklung eines neuen postsowjetischen Weltbildes durch Politik, Wissenschaft und Medien in Russland widerspiegelt, zum anderen die gravierende Differenz zwischen Wertbegriffen der Jugend und jenen ihrer Eltern und Großeltern von immateriellen zu materiellen Werten hin, vom kulturellen Wissen hin zum technischen Wissen, von der Liebe zur Heimat hin zum egozentrischen Vorteilsdenken, in welches zwar noch die Familie, nicht mehr aber die eigene Gesellschaft einbezogen wird. Daher erreichen auch die nationalistischen Propagandabemühungen der Politik letztlich nicht mehr das Selbstbild der russischen Jugendlichen, auch wenn sie bei offiziellen Gelegenheiten dem Scheine nach noch nationalen Konformismus demonstrieren. Ihr Blick auf die politische Vergangenheit und auf den erlebten Legitimationsschwund von Staat und Politik überwindet zuweilen auch den Zynismus und etablierten Pragmatismus ihrer Eltern und ruft Werte der Freiheit, der sozialen Gerechtigkeit, der Chancengleichheit und des kulturellen Dialogs auf den Plan, die den Werten des westlichen Demokratiedenkens doch sehr ähnlich geworden sind.
Nomeda Sindaravičienė befasst sich in ihrem Artikel mit den Unterschieden zwischen den Generationen hinsichtlich der Wertorientierung und der Identifikationen mit der Sowjetzeit. Mit Beginn der Transformation existierten in Litauen (und wohl nicht nur dort) drei verschiedene Orientierungen nebeneinander, ein sowjetische, eine national und eine westlich ausgerichtete. Diese Orientierungen korrespondierten in gewissem Umfang mit den Generationen; quer zu den Generationen spielte aber das persönliche Schicksal und die eigene Rolle im sowjetischen System eine mindestens ebenso maßgebliche Rolle. Sindaravičienė unterscheidet zwischen der „alten Generation“ der noch vor dem Ende des zweiten Weltkrieges Geborenen, die zwischen ihren vorigen, oft westlich oder religiös geprägten Wertvorstellungen und den sozialistischen Werten einen Konflikt erlebte, der „jüngeren Generation“, die während des Krieges und bald danach geboren wurde und entweder im Aufbau der Sowjetgesellschaft wesentlich engagiert und ideologisch von ihr geprägt waren oder auch alles verloren hatten, sich immer bedroht fühlten und unaufällig bleiben mussten, der „verlorenen Generation“, die nach den Sechzigerjahren geborgen wurde, die große Rezession erlebte und mit ihr den Glauben an den sozialistischen Lebenssinn und die bisherigen Wertorientierungen verlor, und die heutige „unabhängige Generation“ der nach den Neunzigerjahren Geborenen, die im Wertevakuum der verlorenen Generation aufgewachsen ist und, ausgestattet mir mehr Freiheit als irgendeine Generation vor ihnen, eher verlegen vor der Aufgabe steht, sich neu zu orientieren. So bilden sich neue Typen von Orientierungen heraus mit neuen Prioritäten in Hinsicht auf Bildungsideale, soziales Engagement, Prestiges und sozialen Status und andere materialistische Werte. Auch eine Rückbesinnung auf vorsowjetische Traditionen, Religiosität, Familienkultur und nationale Größen auf der einen Seite und westliche politische, soziale, ökologische und demokratische Werte, Individualismus und eine ausgeprägte Konsumhaltung auf der anderen Seite kennzeichnen die neuen Orientierungen der jungen Generation.
Mit der Entwicklung einer staatsbürgerlichen Identität und ihren Rahmenbedingungen im nachrevolutionären Armenien befasst sich Sona Manusyan. Sie erläutert zunächst vor dem Hintergrund der Historie des Landes den Dominanzanspruch der ethnisch ausgerichteten Selbstwahrnehmung innerhalb der nationalen Identität der Armenier, dem gegenüber das staatsbürgerliche Fundament vergleichsweise schwach ausgeprägt ist. Ob die ethnische Identifikation ein Garant für sozialen Zusammenhalt ist, wenn ein staatsbürgerliches Selbstverständlich kaum ausgeprägt ist, erscheint jedoch fraglich, zumal wenn zwischen den Generationen und sozialen Schichten doch erhebliche Differenzen hinsichtlich ihrer Wertvorstellungen und Lebensziele zu finden sind, die nun durch die Revolution noch verstärkt worden sind. Es war diese Erfahrung einer erfolgreichen Revolution gegen das alte, von Korruption, Vetternwirtschaft und Bürgerferne gekennzeichnete Regime, die nicht nur den Menschen, die die Revolution getragen haben, ein neues bürgerliches Selbstbewusstsein vermittelt hat, sondern allen Bürger*innen gezeigt hat, dass sie Regierungen selbst bestimmen und den Staat mitgestalten können. Dennoch müssen viele Dimensionen einen staatsbürgerlichen Selbstverständnisses, die in der armenischen Vergangenheit nie entstehen konnten, erst noch aus der Taufe gehoben werden – ein neues Verständnis bürgerlicher Verantwortung, von Solidarität und Teilhabe – und ein neues, von wechselseitigem Vertrauen getragenes Verhältnis zwischen Staat und Bürger*innen muss sich mit der Zeit etablieren.
Manusyan untersucht die konkurrierenden Selbstverständnisse verschiedener Gruppen entlang von sieben Gegensatzdimensionen, nämlich den Spannungsverhältnissen zwischen dem ethnischen und dem bürgerlichen Selbstverständnis, dem Traditionellen vs. Progressiven, dem Persönlichen vs. Öffentlichen, dem Institutionellen vs. dem Agenten, der Vergangenheit vs. der Zukunft, dem Diskurs vs. der Praxis und dem Selbstverständlichen vs. der Selbstreflexiven. Zum einen Seite führt die ethnische Fundierung des Nationalen immer wieder dazu, dass die Normen der nationalen Identität mit Intoleranz und hohem Konformitätsdruck verteidigt werden, auf der anderen Seite scheint das bürgerliche Selbstbewusstsein noch zu wenig ausgeprägt, um den nationalistischen Vereinfachungen die Ansprüche einer freiheitlichen, demokratischen und pluralen Solidarität entgegenzusetzen. Auch zwischen den Polen des Konservativen und des Progressiven wandeln – mit starken genera-tionellen Bindungen – die Identitätsentwürfe der Bürger*innen, eingespannt zwischen dem Wunsch nach einer freieren Lebensführung und einer diese einschränkenden traditionellen Familienorientierung. Solche Widersprüche spiegeln sich auch in der Doppelmoral zwischen der nach außen gezeigten und privatim tatsächlich gelebten Praxis. Das ehemals durch Tradition wie auch durch die sowjetische Gesellschaftsmoral kontrollierte Individuum hat sich seit geraumer Zeit als trotzigen Widersacher gegenüber der Gesellschaft entworfen, der der gesellschaftlichen Realität, insbesondere den Institutionen mit sozialem Zynismus entgegentritt und jenseits dieser Realität sein Glück sucht. Es rächt sich heute durch einen rücksichtlosen Egoismus, blinden Konsumismus und uneingeschränkten sozialen Wettbewerb, dem offenbar jegliche Wahrnehmung öffentlicher Interessen fremd ist. Dieser Entwicklung kann, wenn die Druckmittel der Tradition und des Kollektivismus nicht mehr ausreichen, nur ein bürgerliches Bewusstsein entgegenwirken, das die Individuen nicht nur als Träger von Freiheitsrechten, sondern auch von Pflichten und Rücksichten sieht und hierauf eine neue Solidarität gründet. Ihm steht der Staat als Garant der Rechte, aber auch als Forderer der Rücksichten gegenüber.
Edina Vejo und Elma Begagić beleuchten die Situation der postsozialistischen Länder des Balkans nach dem Zerfall Yugoslawiens am Beispiel der Entwicklungen in Bosnien-Herzegowina. Wie in den anderen Staaten auch war die Suche nach einem neuen Selbstverständnis der Menschen und ihrer Gesellschaft vor allem geprägt von Tendenzen der Kontrastierung zur sozialistischen Vergangenheit. Auch hier boten die vorsozialistischen Traditionen, das ethnisch profilierte Kulturverständnis und nicht zuletzt auch die Religionen die naheliegendsten Ansätze zur Gewinnung eines neuen Identitätsrahmens, der genug Eigenes versprach, um sich von den zahlreichen anderen Balkangesellschaften zu unterscheiden. Die Identifizierung einer nationalen Identität mit diesen Bezugsgrößen erhöhte einerseits den Druck auf die Gesellschaft, maximale Homogenität herzustellen – was vor allem auf die Verteilung der Religionsgemeinschaften zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina eine hoch selektive Dynamik hervorbrachte –, sie konnte allerdings in Bosnien-Herzegowina andererseits keine Einheitlichkeit hervorbringen, da die Gesellschaft zwischen westlicher Modernisierung und einer zunehmenden Islamisierung hin- und hergerissen ist. Ein Versuch, zwischen beiden Tendenzen eine Brücke zu schlagen, bildet das Bemühen um einen zwar traditonell begründeten, aber historisch angepassten Islam. Dieses Bemühen soll – so die „moderne” Auffassung – als dialogischer Prozess, insbesondere mit der Jugend, seine Erfüllung finden.
In diesen verschiedenen Bestrebungen besteht zurzeit in jedem Falle ein Primat des Kollektivismus, sei er auf der Seite der Religion oder auf der Seite der westlichen Modernisierung. Wie schon einmal zur Zeit des jugoslavischen Sozialismus wird der bosnisch-herzegowinischen Gesellschaft in den laufenden Diskursen zur nationalen Identität eine „uniforme Kollektivität” aufgedrängt – Vejo und Begagić sprechen gar von der „Erstickung von Individualität” –, die der Entwicklung verantwortungsvoller Identität und Religiosität keinen Raum lässt. Vor allem die Suche nach einer nationalen Identität verhindert die Entwicklung einer pluralistischen Gesellschaft. Künftige Lösungen müssen im Raum dreier Kontinuen entwickelt werden, in der Bestimmung der Relation zwischen der Religion und der kollektiven Identifikation überhaupt, in der Bestimmung der Relation zwischen einem fundamentalistischen oder dialogischen Islam insbesondere und in der Bestimmung der funktionalen Indienstnahme der Religion als nationalistisches Symbol oder als Instrument eines intellektuellen Fortschritts in der bosnisch-herzegowinischen Gesellschaft.
Der soziale Wandel der Wertvorstellungen kennzeichnet auch den postsozialistischen Weg Albaniens und beeinflusst auf unterschiedliche Weise die neue Identität der Landsleute, so erklärt Arlinda Ymeraj in ihrem Artikel über soziale Werte im Übergang – im Falle Albaniens – und ihre Bedeutung für die Ausbildung einer staatsbürgerlichen Identität. Sie sieht diesen Wandel als eine Folge der Abwendung von den Werten der sozialistischen Verfassungen „gesellschaftliche Solidarität” und „Gleichheit” – ein in heutiger Bilanz unerfülltes Versprechen – hin zu demokratischen Werten, zum Schutz der Menschenrechte, zum Wohlstand für alle und zu sozialer Gerechtigkeit. Dass in den Jahren des Sozialismus das anfangs so begeisterungserfüllte Wertesystem vollständig zusammenbrechen konnte, hat seine Gründe u. a. im politischen Dogmatismus in den verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen, in der politischen Kontrolle von Programmen und in den Einschränkungen individueller Spielräume bei ihrer Durchführung, aber auch in der Unterdrückung und in der Angst vor dem kontrollierenden System, die die persönliche Identifikation mit den Werten unterhöhlten. Hinzu kam die bevorzugende und somit keineswegs gleichheitsorientierte Belohnung jener Bürger*innen und Einrichtungen, die sich besonders konform mit der politischen Führung erwiesen – vice versa die Benachteiligung eigenständig gestaltender Personen.
Vor dem Hintergrund der wandlungsreichen Geschichte des Landes in den letzten dreißig Jahren und der höchst autoritären Staatsführung bis 1991 werden die komplexen Wertkonflikte der albanischen Gesellschaft verständlich. Die – trotz wirtschaftlichen Wachstums – noch immer steigende Armut und soziale Ungleichheit, das geringe durchschnittliche Bildungsniveau, die in sozialen Normen begründete Diskriminierung und Exklusion von Bevölkerungsgruppen, verbreitete Korruption und anhaltend hohe Arbeitslosigkeit beeinflussen den Wertediskurs in der Gesellschaft und das Wertebewusstsein der Bevölkerung. Falsche Erwartungen an die Einführung der freien Marktwirtschaft bezüglich einer schnellen Verbesserung der eigenen Lebenslage und die seit bald 30 Jahren nahezu stagnierende Entwicklung des Landes bewirken zudem eine von Frustration genährte Skepsis gegenüber dem liberalen und demokratischen Wertesystem und – erneut – ein wachsendes Misstrauen in die Rentabilität persönlichen Engagements für diese Gesellschaft.
Ymeraj glaubt, in der albanischen Gesellschaft derzeit hinsichtlich ihres dominierenden Selbstverständnisses drei soziale Gruppen zu erkennen, die „Heimatlosen”, welche ohne hoffnungsvolle Aussichten in schlecht bezahlten Jobs oder in der illegalen Arbeit kaum mehr als ein Existenzminimum erarbeiten, die „Regelbrecher”, welche die kapitalistischen Wohlstandziele mit illegalen oder kriminellen Mitteln zu erreichen trachten und in Albanien ein nicht geringen Teil der Staatsmacht tragen, und die „Träumer”, loyale Staatsbürger*innen, die nicht aufhören, an ein neues demokratisches Albanien zu glauben, ihren Pflichten nachkommen und die eigentlich tragenden Kräfte einer Transformation in spe darstellen. Es liegt auf der Hand, dass – wenn schon nicht alle Werte – so doch die Normen der Lebensführung zwischen diesen drei Typen stark differieren. Kontrovers wird in Albanien diskutiert, ob die im Wechsel von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft veränderten Wertorientierungen die alten Werte der “Solidarität” und “Gleichheit” ersetzen müssten oder es möglich sei, sie beizubehalten und mit den neuen Werten auf bessere Weise zu erfüllen. Damit soziale Werte tatsächlich die Politik und das gesellschaftliche Leben in Albanien bestimmen können, ist es zunächst einmal notwendig, auf breiter Basis die soziale und staatsbürgerliche Bildung der Bürger*innen zu entwickeln.
In seinem zweiten Beitrag zurBedeutung von Wertorientierungen für den kulturellen Wandel wendet sich Wolfgang Krieger der Frage zu, welche Werthaltungen in der medialen Selbstdarstellung junger Menschen in postsowjetischen Ländern in den social media zum Ausdruck kommen. In diesen Medien offenbaren junge Menschen heute mehr als anderer Stelle, wie sie sich selbst sehen, was ich ihnen wichtig ist, wie sie zu sich stehen und wer sie gerne sein möchten, womit sie sich identifizieren und welchen Kohorten und Kulturen sie sich zugehörig fühlen. Sie zeigen also in ihrer „Medien-Identität“ zum einen ihre individuelle Besonderheit, zum anderen plurale Formen einer kollektiven Identität und bieten diese Selbstdarstellungen an auf einem quasi-öffentlichen „Markt“ der sozialen Anerkennung, der über Akzeptanz oder Ablehnung der Identitätsformationen entscheidet. Sie unterwerfen sich in der Konstituierung ihrer Identität, zumindest sobald sie „ihre Leute“ gefunden haben, nicht nur hinsichtlich des Symbolrepertoires, sondern auch hinsichtlich ihrer Identifikation mit Rollen, Einstellungen und Werten einem mehr oder minder heteronom konditionierenden Sanktionsmechanismus. Dieser erklärt womöglich, warum in stark konformistisch geprägten Gesellschaften auch in den Medien-Identitäten vor allem kollektivistische Selbstinszenierungen wahrscheinlich werden.
Stärker als in der westlichen Medienkultur fällt zum Ersten auf, dass junge Menschen in postsowjetischen Ländern hochgradig stereotyp „in einen kulturell sanktionierten Raum“ von Konventionen eingebunden sind, dem ein je spezifischer Wertehorizont entspricht und der geteilt werden muss, wenn soziale Anerkennung erreicht werden soll, zugleich ein wenig überschritten, um aufzufallen. Der Autor stellt dar, dass der Umgang mit diesen Konventionen ein ambivalent riskantes Manövrieren zwischen konformer Erwartungserfüllung und individuellem Über-raschungsgebaren darstellt, auch wenn man in der postsowjetischen Medienkultur hinsichtlich des Überraschungsmomentes meist eher von einem „Thema mit Variationen“ sprechen muss. Zum Zweiten fällt auf, dass die Selbstdarstellung durch die eigene Repräsentation meist zusammen mit Statusymbolen erfolgt und damit eine Selbstüberhöhung verfolgt, die oft die Grenzen der Glaubwürdigkeit auch überschreitet und im Vagen lässt, ob die Inszenierung Reelles repräsentieren oder mit Fiktivem spielen soll. Dieses „Spiel“ geht im Feld der Statussymbolik sehr weit und riskiert auch den Übergang zum Lächerlichen, in welchem erneut offen bleibt, ob das Gezeigte ernsthafter Angeberei oder der Selbstironie zu verdanken ist. Am Beispiel einiger „Präsentationsformen der Selbstkategorisierung“ (Neue Körperlichkeit, Status-Identität, politische Identität und soziales Engagement, „Normalo“-Identitäten und Authentizität) illustriert Krieger, wie kollektive Normen Stil und Inhalt der Selbstdarstellungen prägen und welche Werthorizonte hinter der Selbstsymbolisierung zu vermuten sind. In der Wahl der Statussymbole bildet sich ein weiteres Mal die Dominanz materialistischer Wertorientierungen ab.
Am Beispiel der Ingenieursstudent*innen in Tomsk/Sibirien beschreiben Igor Ardashkin, Marina Makienko und Alexander Umykhalo die Veränderungen der beruflichen Identität von Ingenieuren der neuen Generation in Russland. Die Ergebnisse der zugrunde liegenden empirischen Studie lassen aber wohl auch Schlussfolgerungen zu, die allgemein zur Vision des neuen Berufslebens in Russland gehören. Die an drei Universitäten und 480 Personen durchgeführte Befragung befasst sich neben Fragen zur Berufswahl und zum Studium mit dem Bild des zukünftigen Ingenieurs und den Zukunftsvorstellungen zu diesem Beruf aus Sicht der Studierenden. Schon die Untersuchung der Motive zur Berufswahl lässt soziale Wertvorstellungen erkennen wie etwa das Hilfemotiv, die Gewährleistung der menschlichen Sicherheit oder die Lösung wirtschaftlicher Probleme. Geschätzt wird auch die berufliche Selbstbestimmung im Ingenieursberuf. Hauptmotive für die Berufswahl sind aber materielle Werte und das Prestige des Berufs. Die Erwartung, dass die Verantwortung des Ingenieurberufs gegenüber der Gesellschaft zunehmen wird und der künftige Ingenieur mehr Kreativität zeigen müsse, wird von vielen geteilt. In der prospektiven Sicht des Berufs treten Merkmale wie Verantwortungsbewusstsein, Fleiß, Zielgerichtetheit und lebenslange Lernbereitschaft in den Vordergrund. Dieses Bild eines durchaus anspruchsvollen Berufs tritt dann aber in Kontrast zu den Visionen der beruflichen Zukunft: Die Mehrheit der Studierenden sieht die Zukunft als negativ oder gar bedrohlich und erwartet niedrige Gehälter. Die Hälfte der Studierenden zweifelt daran, ob sie je in diesem Beruf arbeiten werden. Optimistische und pessimistische Erwartungen zeigen sich als hoch abhängig von der sozialen Herkunft der Studierenden. Das Maß an beruflicher Unsicherheit wird aus Sicht der Befragten auch begründet durch das mangelnde Vertrauen in die sozioökonomische Situation, das Fehlen von gesellschaftlichen Entwicklungsstrategien und den mangelnden Dialog zwischen Politik und Gesellschaft über neue Herausforderungen im Beruf.
Der Artikel von Yana Chaplinskya befasst sich mit den aktuellen Problemen des Arbeitslebens in Russland und der Zerrissenheit der Lebensführung unter den Bedingungen einer zugemuteten „Patchwork-Identität“. War es zuerst der Zerfall des Sowjetischen Kultur, des zugrunde liegenden Menschenbildes und der sie tragenden Wertvorstellungen, der die Menschen in Unsicherheit und Orientierungslosigkeit stürzte, so ist es heute die Dynamik der modernen russischen Gesellschaft, die perspektivischen Risiken der eigenen Lebensentscheidungen und die durch die Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Informationen überfordernde Globalisierung, die bei den Menschen nicht nur ein hohes Maß an Unsicherheit und Stressbelastung hinterlassen, sondern auch den individuellen Sinnverlust und die Ungewissheit der eigenen Personalität weiter fortsetzen. Die modernen beruflichen und soziokulturellen Anforderungen zwingen den postsowjetischen Menschen in eine Patchwork-Identität hinein, die zu bewältigen er schlecht gerüstet ist. Mehr denn je stellt die Arbeit für die postsowjetischen Menschen hohe und vor allem unüberschaubare Anforderungen, während zugleich die Wahl des Berufes auf einem sehr schwankenden Grund der Vorkenntnisse, der Kompetenzerwartungen und der Zukunfts-prognosen zu treffen ist. In der neuen Arbeitsgesellschaft ist jeder auf sich alleine gestellt und muss selbst die Wege finden, für sich und die Seinen eine Lebensbasis, ein Einkommen und eine gewissen existenzielle Sicherheit zu erwerben. Die Instabilität der Verhältnisse macht diese Bemühungen besonders anstrengend: Das Tempo der Veränderungen am Arbeitsmarkt, die Notwendigkeit, für das eigene Fortkommen zahlreiche und vor allem die richtigen Beziehungen zu pflegen und stets aufmerksam zu sein, um berufliche Chancen nicht zu verpassen, sich möglichst viele Qualifikationsnachweise zu erwerben, um für jede zu erwartende Situation des beruflichen Wandels gerüstet zu sein, stellen den Menschen fortlaufend unter Stress. Sie verlangen ihm ferner eine Rollenvielfalt ab, die es zu balancieren gilt – eine nicht minder schwierige Aufgabe.
Als eine „natürliche Art der Selbstverwirklichung“ ist Arbeit von hoher Bedeutung für die Zufriedenheit des Menschen, sie darf aber nicht seinen gesamten Alltag einnehmen und bestimmen. Burnout und seelische Erkrankungen sind in Russland neue Phänomene, die vor allem auf eine überfordernde Arbeitssituation zurückgehen. Daher gilt es zum einen, die Arbeitsbelastung zu begrenzen und die Arbeit mit den eigenen Interessen, Stärken und dem individuellen Lebenssinn zu verbinden, zum anderen die Menschen mit einem reflexiven Vermögen auszustatten, das ihm erlaubt, sich selbst in seinem körperlichen und seelischen Wohlbefinden wie auch in den Belastungen aufmerksam zu beobachten und zu lernen, in und außerhalb der Arbeit im Dienste seines Wohlergehens für sich selbst zu sorgen. Chaplinskayas Artikel zeigt nicht nur den Einfluss eines humanistisch-individualistischen Denkens auf die jungen Menschen in Russland, sondern auch ihre Hoffnung, dass es durch aufmerksame Selbstbeobachtung und eine gelingende Sinnsuche möglich wird, wieder seine Mitte zu finden, die neuen beruflichen und soziokulturellen Anforderungen der postsowjetischen Gesellschaft zu bewältigen und „im Chaos eine Ordnung zu finden“.
So schwierig es ist, am Ende eines Buches mit solch thematisch und perspektivisch unterschiedlichen Beiträgen eine Summe zu bilden, so versucht der Herausgeber doch die anfangs grundlegend gestellte Frage nach der Existenz und Fassbarkeit einer „postsowjetischen Identität“ bilanzierend aufzugreifen und wenn schon nicht einheitliche Merkmale einer solchen Identität, so doch gemeinsame Rahmenbedingungen für die Erfüllung jener Aufgabe zu benennen, die die Erarbeitung einer neuen Identität für die postsowjetischen Länder darstellt. In vielfacher Bezugnahme auf die Autoren und Autorinnen dieses Buches beschreitet Wolfgang Krieger dabei in Folge zwei getrennte Wege:
Er rekapituliert zunächst die für die Länder der Sowjetunion gemeinsame Geschichte, deren politische und soziale Bedingungen durch den universellen Anspruch der Ideologie die kollektive kulturelle Identität der „Sowjetmenschen“ , nicht nur im Gelingen des ideologischen Programms, sondern auch in seinen Zerwürfnissen und seinem Scheitern, geprägt haben. Im Dreischritt von der sowjetischen Identität über die „transformatorische Identität“ zur postsowjetischen Identität werden die zentralen sozialen und politischen Strukturen und kulturpsychologischen Wirkungen der verschiedenen Stadien in der sowjetisch-postsowje-tischen Entwicklung nachgezeichnet und setzen sich wie ein Puzzle allmählich zusammen zu einem Gesamtbild der Chancen und Lasten der Vergangenheit bei der Bewältigung der heute bestehenden Aufgaben der postsowjetischen Gesellschaften. Dabei zeigt sich: Der „neue Mensch“ als Entwurf einer allgleichen kollektiven Identität des Sowjetmenschen war Fakt und unhinterfragte Selbstverständlichkeit und ist bis heute ein wirksames Fundament auch in der postsowjetischen Identitätsbildung, auch wenn es nicht geliebt, oft bestritten und als überwunden bezeichnet wird. Derlei Befangenheit widersetzt sich der Transformation und nur in ihrer Aufarbeitung können neue Positionen evolvieren.
Der zweite Weg verfolgt den Versuch einer Beantwortung der Frage nach den Wurzeln und Problemen einer möglichen postsowjetischen Identität über die Belichtung einzelner identitätsbildender Sektoren wie der „ethnischen und nationalen Identität“, der „religiösen Identität“, der „Genderidentität“, der „beruflichen Identität“ und der Konstruktion sogenannter „einfacher kollektiver Identitäten“. Dies ist nicht möglich, ohne ein paar Aspekte gründlich zu vertiefen und sie so der Oberflächlichkeit purer Erwähnung zu entreißen. Krieger legt in allen Sektoren dar, dass vor allem die in Russland vorangetriebene Gegenreform, aber auch der in einigen Staaten erstarkende Totalitarismus die Öffnung zu neuen Identitätshorizonten vereitelt und ängstliche Tendenzen zur Selbstverschließung und damit Stagnation hingegen angetrieben werden. Die gleichen Kräfte verhindern das Wachstum von Toleranz und individueller Autonomie und die Etablierung demokratischer Strukturen in den Institutionen, ganz zu schweigen von der Entwicklung eines staatsbürger-schaftlichen Bewusstseins in der Bevölkerung. So bleiben die meisten Menschen auch dreißig Jahre nach dem Ende der Sowjetunion zurückgeworfen auf die bescheidenen Chancen, im Privaten, in der Familie, im Freundeskreis und allenfalls im Beruf ein erfülltes Leben führen zu können, während ihr Verhältnis zum Staat und zur Gesellschaft sich den Schäden der spätsowjetischen Ära noch immer kaum entziehen kann. Staatsbürgerlich vereint ist man nur in der „negativen Identität“ (Gudkov), im Wissen, wer man nicht sein will, zu wem man nicht gehören will, was man zu beschimpfen und wogegen man sich zu wehren hat; an positiven zukunftsgerichteten Visionen, die die Bürger*innen zur Mitgestaltung des Staates und der Gesellschaft motivieren könnten und sich nicht darin genügen, die Vergangenheit zu verherrlichen, fehlt es aber eklatant. Dass es an solchen Visionen mangelt, hat eine Vielzahl von Gründen, hinsichtlich derer wohl alle postsowjetischen Staaten weitgehend unterschiedslos vereint sind, insofern sich diese Gründe aus der gemeinsamen Geschichte der ideologischen Bevormundungen, der Unterwerfung und Entpersönlichung der Sowjetzeit und all der sich hieraus ergebenden Deprivationen in menschlicher, sozial-kommunikativer, moralischer und auch lebens-praktischer Hinsicht, ableiten. Diese verlorenen Terrains wieder zu erobern, stellt die eigentliche Aufgabe der postsowjetischen Identität dar, ungeachtet der Frage, zu welchem Ergebnis diese Prozesse kommen werden.
Ludwigshafen am Rhein, im September 2020
Prof. Dr. WolfgangKrieger
Предисловие и предварительный просмотр представленных в книгенаучных работ
Вольфганг Кригер
Культурно-антропологическая дискуссия об образе "советского человека" имеет определенную традицию как в бывших советских странах, так и в некоторых западных странах с 1970-х годов, и до сих пор не завершена, спустя около тридцати лет после окончания советской эпохи.
Она является отправной точкой для сегодняшнего вопроса о том, сохраняется ли и в какой степени "советский человек" в менталитете граждан* государств-преемников Советского Союза после распада советскихреспублик, или какой новый "тип человека" появился в последние десятилетия после распада Советского Союза в результате новых экономических, политических, социальных и культурных событий. Оба вопроса объединены в современном вопросе о формировании "постсоветской идентичности", который исследуется в этой книге частично фундаментально, частично аналитически и дескриптивно.
С этой темой тесно связан вопрос о появлении новых ценностных ориентаций и продолжающемся существовании социалистических ценностей в обществах бывшего Советского Востока, которые также претерпевают культурные изменения. Значимость ценностных ориентаций для формирования новой "постсоветской идентичности" является заметной темой этой книги, а также в определенной степени программной основой анализа.
Публикация этой книги является продолжением международной конференции по постсоветской идентичности, состоявшейся в Германии с 17 по 21 сентября 2018 года в Университете прикладных наук Людвигсхафена-на-Рейне на факультете социального обеспечения и здравоохранения. В мероприятии приняли участие лекторы* из партнерских университетов Университета прикладных наук Людвигсхафена из Российской Федерации, Армении, Албании, Боснии-Герцеговины и Германии. Они участвовали в рабочих группах и семинарах и читали лекции по этой теме, большинство из которых воспроизводятся и переводятся в этой книге. Впоследствии к работе над этой темой присоединились и другие заинтересованные авторы из стран бывшего СССР, так что теперь в этой книге могут быть опубликованы труды российских, албанских, армянских, боснийско-герцеговинских, немецких, киргизских и литовских социологов.
Конференция прошла под названием "Постсоветская идентичность – новые ценности и развитие личности в постсоветских странах" и, таким образом, подчеркнула определенный социально-антропологический, социологический, культурно-психологический фактор развития идентичности, а именно, формирующее идентичность значимость ценностных ориентаций в культуре обществ. Этот фактор стоит в одном ряду с другими факторами самоиденти-фикации, такими как физическая уверенность в себе, атрибуция идентичности через социальные отношения человека, самолокация человека в социальных связях и привычных экологических пространствах и т.д., и он находит свою основу, прежде всего, в традиционных, политических и религиозных мировоззрениях, из которых возникают направляющие ценностные ориентации и жизненно важные установки.
Таким образом, конференция как бы взяла на себя обязательство в определенной степени сузить тему идентичности, которая, по общему признанию, не претендует на то, чтобы стать обязательной по отношению к другим факторам развития личности, но, тем не менее, хотела бы сосредоточить внимание прежде всего на восприятии идентичности как самоидентификации с ценностными ориентациями и установками.
В соответствии с этой самостоятельной концепцией тематической задачи конференции предшествовал ряд руководящих вопросов для участников, которые кратко перечислены ниже.
появились ли новые ценности после окончания советской эпохи или же ценности того времени по-прежнему являются самыми важными? Какие ценности из этого периода продолжают существовать, какие новые ценности устанавливаются?
Откуда берутся эти новые ценности, на чем они основаны?
Есть ли новые идеалы?
Какие представления у людей сегодня о хорошей, наполненной смыслом жизни?
Как люди полагают, что они смогут сделать что-то ценное для других людей, для общества?
Какие символы характеризуют успешный образ жизни и "хороший имидж" постсоветского человека?
Есть ли различия между полами?
формируется ли в этом обществе плюрализм ценностей или появляется новая социальная однородность в ценностном сознании людей?
существуют ли конфликты между ценностями различных социальных групп, есть ли конфликты между поколениями?
какими молодые люди хотят стать в будущем? Есть ли идеалы, с которыми молодые люди идентифицируются?
Какие различия могут быть выявлены между ценностями этого общества и ценностями Запада в настоящее время?
каково ожидаемое направление развития общества в этой стране в ближайшие годы?
(Измерения: социальная справедливость, неравенство, элита, межкультурное развитие)
Где можно увидеть наибольший источник конфликта в обществе? Что объединяет и разделяет общество?
Каковы наиболее важные изменения во взаимоотношениях между индивидуумом, обществом и государством?
Авторы статей в этой книге комментируют выбранные вопросы из этого списка и часто комбинируют вопросы друг с другом. Очень часто они аргументи-рованно высказываются по поводу исторического прошлого, либо для того, чтобы особенно лаконично охарактеризовать ситуацию, противопоставив настоящее и прошлое, либо потому, что проблемы настоящего могут быть частично выведены из условий прошлого, либо для того, чтобы вновь взять системы ценностей из досоветского прошлого, возрождение которых, как надеются, пойдет на пользу настоящему и будущему. Поэтому историческое сравнение является практически универсальным средством конкретизации проблем формирования идентичности и ценности в настоящем. Его сопровождает еще одно сравнение, а именно то, что между ценностным сознанием западноевропейских культур и ценностным сознанием восточных постсоветских стран сегодня.
В этой книге поиск идентичности в культурах, которые – таково предположение о "постсоветской идентичности" – более или менее утратили свои советские характеристики идут по пути формирования новых структур и, таким образом формируют себя сами, рассматриваются с совершенно разных точек зрения. В книге собраны материалы из постсоветского и посткоммунистического пространства, в частности из Российской Федерации, Центральной Азии, Кавказа и стран Балтии, а также авторы с Балканских посткоммунистических стран и, наконец, с Европейского Запада. Авторы из этих разных стран смотрят и на старое, и на новое отчасти как инсайдеры глазами тех, кто непосредственно столкнулся с этим, кто следовал за изменениями на собственном опыте и был по-разному затронут их последствиями прямо в своей повседневной жизни, и кто, в то же время, как современные свидетели прошлого, более чем кто-либо другой компетентны проводить сравнения; отчасти они смотрят – под влиянием западных ожиданий и перспектив – извне на малознакомый мир и пытаются использовать знакомые объяснения, чтобы упорядочить феномены "чужого", который кажется им странным в соответствии с их собственной логикой. Некоторые из них имеют тот же опыт живого социализма и посткоммунистической эпохи, что и авторы из бывших советских стран (здесь авторы из балканских стран), и переживают посткоммунистический период в дальнейшем, как и в некоторой степени похожие на постсоветскую ситуацию на Востоке, даже если их собственное культурное сознание заставляет их воспринимать различия, которые, с одной стороны, свидетельствуют об альтернативных перспективах, но, с другой стороны, также позволяют им сопоставлять знакомое в инородном с знакомым в знакомом. Таким образом – в соответствии с различными предпосылками – форму-лируется множество перспектив, и тема этой книги рассматривается с самых разных точек зрения. В то же время тот факт, что авторы приезжают из разных регионов, выдвигает на первый план феномены и события, характерные для конкретных стран, из которых можно найти объяснение культурным особенностям в работе с факторами, формирующими идентичность.
Книга представляет собой одновременно сборник позиций по вопросу о составных элементах "постсоветской идентичности" и калейдоскоп разнообраз-ных бликов по истории развития нынешнего тридцатилетнего этапа постсоветской культурно-социальной истории. Она не предназначена для систематического прослеживания определенных измерений этой истории, обеспечения широкой эмпирической основы для этих измерений или проведения национальных и региональных сравнений. Эти задачи уже всесторонне выполнены в литературе и будут оставлены на дальнейшее изучение. Скорее, мы придерживаемся скромной цели – дать возможность читателям этой книги поделиться опытом и обобщенными интерпретациями социологов, которые на фоне истории своей страны изучают, с одной стороны, кризисы распада советского социализма, а с другой – управление задачами, стоящими перед этой фазой, и представляют их влияние на возникновение новых ценностных ориентаций и с точки зрения развития социальной и культурной идентичности. При этом авторы устанавливают различные тематические приоритеты, выдвигая на первый план определенные ценностные ориентиры и идентификацию и делая их предметом своего анализа. В этих избранных перспективах не следует ожидать, что основополагающая концепция самобытности будет признана единообразной во всех вкладах. Только по этой причине невозможно провести сравнение между взносами по многим аспектам. Тем не менее, мы надеемся, что многочисленные представленные явления и различные аспекты восприятия, вытекающие из разницы в перспективах, обеспечат читателю полезный фонд знаний и не менее новые вопросы, которые могут быть заданы о построении "постсоветской идентичности".
Завершение работы над текстами, готовыми к публикации, и особенно перевод всех текстов заняло много времени; поэтому публикация книги, первоначально запланированная на 2019 год, не могла быть удержана, и нам пришлось обратиться к некоторым авторам* с просьбой о понимании того, что нам пришлось значительно продлить время подготовки книги к изданию. Однако это также открыло новые возможности для включения в книгу дополнительных материалов. Сегодня мы хотели бы поблагодарить всех авторов за их терпение.
Редактор благодарит переводчиков Анну Засухину, Елену Елизову, Ларису Богачеву и Любовь Корн, в частности, за их неустанное сотрудничество, неустанную настойчивость и неустанные усилия по созданию точных переводов на оба языка. Без их надежной ангажированности и целеустремленной коммуникативной компетентности в диалоге с авторами эта книга была бы невозможна.
Мы хотели бы также поблагодарить Дарью Филипенко, Нино Капанадзе, Лайму Лукочюте, Натали Рыбников и Лусине Закарян за их поддержку в переводе статей на русский и немецкий языки, соответственно, они перевели некоторые презентации и дискуссии во время конференции, а также внесли свой вклад во многие другие способы организации конференции.
Перспективы в отношении содержания книги
Книга разделена на три части. Первая и вводная часть посвящена введению в некоторые общие основы понятия идентичности и вопросу о том, какое значение вообще может придаваться разговору о "постсоветской идентичности". В материалах двух авторов из Армении и Кыргызстана описываются условия постсоветской идентичности в их странах, главным образом, с социологической и культурно-психологической точек зрения, а также дается представ-ление о фундаментальных трудностях постсоветского самопознания в период трансформации.
Во второй части книги освещается значение ценностных ориентаций для формирования постсоветской идентичности с точки зрения авторов из различных посткоммунистических стран. Они исследуют исторический и современный запас культурно-специфической символики идентичности, тенденции социальной идентификации, текущее состояние и движущие силы изменения ценностей, а также описывают напряженность между различными типами коллективной идентичности и существующими конфликтами поколений.
В третьей части книги представлена особая частичная идентичность сегодняшнего постсоветского человека. С одной стороны, речь идет о некоторых заметных особенностях в так называемой "медийной идентичности" молодежи, в которой также выражены доминирующие ценностные ориентации. С другой стороны, обсуждается важность профессиональной идентичности в России с точки зрения студентов и приоритетов при выборе карьеры, а также необходимость сбалансированной лоскутной (пэчворк) идентичности в современных условиях трудовой жизни.
Ниже в резюмированном виде будут представлены индивидуальные материалы.
Во вступительной статье Вольфганга Кригера рассматривается основной вопрос названия книги, в каком смысле термин "постсоветская идентичность" может быть истолкован и с каким содержанием он должен быть наполнен. Этот вопрос содержит ряд соблазнительных стимулов как в отношении концепции идентичности, которая уже давно подвергается критике, так и в отношении формулы "постсоветского", феноменальное единство которого сомнительно и о котором, возможно, можно говорить максимум во множественном числе. Эта проблематизация включает в себя и скептическое предположение о том, что в разговорах о постсоветской идентичности высказываются презумпции, которые (перестали) быть обоснованными в свете сегодняшних социальных реалий после трех десятилетий трансформации, а также в свете столь разных культурно-социальных историй различных бывших советских или коммунистических стран Востока.
Поэтому проблематизация неявной логики обоих понятий является первой задачей статьи Кригера. В чем, в какой степени и почему люди остаются идентичными самим себе – ответы на эти вопросы многообразны и приводят к расхождениям в концепциях и научных теориях идентичности. Таким образом, Кригер берет концепции идентичности из различных гуманитарных дисциплин и прослеживает изменение теорий идентичности в сторону динамической концепции идентичности. Их уступчивость возможной концепции "постсоветской идентичности", безусловно, богата, однако эпистемологическая, равно как и семантическая релятивизация разговора о "постсоветской идентичности" остается решающей: "идентичность", как и "постсоветская", являются редуктивными конструкциями в смысле идеального типа Вебера; они обозначают не естественные сущности или эмпирически доступные условия, а скорее инструмент анализа, заставляющий проявиться специфику избранных социальных явлений и постулирующий осмысленный порядок в сложности социальных событий и структур.
Артур Мкртчян посвящает свою статью вопросу о постсоветских условиях возможной свободы и охватывает анализ этих условий между полюсами приверженности прошлому и стремления к будущему, а также между полюсами отрицательной свободы преодоления зависимости и положительной свободы приверженности новым идеалам и ценностям. Даже если эти полюса могут быть решающими не только для оценки свободы в постсоветских странах, они имеют здесь особое значение, с одной стороны, потому что в постсоветских странах прошлое в значительной степени разбито, а с другой – потому, что вряд ли существует какое-либо видение будущего, а широко распространенный пессимизм и фатализм порождают аномальный хаос и заглушают любую инициативу. Мкртчян сейчас смотрит на постсоветскую ситуацию, в частности, для маленькой страны Армении, чье душевное состояние между войной и миром ослабляет развитие перспектив и побуждает многих людей эмигрировать. Однако желаемой европеизации страны (в развитии гражданского общества и демократических и конституционных институтов) препятствуют и внутренние факторы, которые еще можно идентифицировать как наследие советской эпохи и как раны 1990-х годов, от которых некоторые бывшие советские страны за пределами России до сих пор не оправились.
Очевидно, что многие постсоветские общества кажутся плохо приспособленными к требованиям социальной реконструкции; чего не хватает социальным структурам, которые могли бы создать обнадеживающие ресурсы солидарности, выходящие за рамки семьи и клановых сообществ, и сформировать зародышевые клетки буржуазного общества. Между всей нацией и особенностями семейной ячейки существует вакуум социальных обязательств, который также проявляется как отсутствие ориентационного потенциала в смысле и ценностных связей идентичности граждан. Отмечается недостаточная осведомленность о социальной ответственности и социальном учете, о социальных правилах и принципах, о социальных обязательствах, основанных на собственных ценностных связях. Отсутствуют правовые нормы и, тем более, отсутствует признание правовых норм и интерес к значению социальных норм в целом. Индивидуальная" свобода, которая была открыта, соблазняет людей принять отношение ("вседозволенности"), "все идет", "всё что угодно“, которое не ограничивается чувством ответственности за свои собственные действия. Откуда этот недостаток? Причины этого лежат в прошлом.
Отчасти они уже обусловлены аномалией, которая распространилась в конце советского периода, а затем и полностью в 1990-е годы, что, по-видимому, привело не только к экономическому и культурному упадку советских государств, но и к падению солидарности и внимания общества, чему ничто не может противостоять и сегодня. Но они также являются следствием бедности, пережитой в 1990-х годах, стагнации тенденций в области заработной платы, продолжающейся девальвации академических профессий и отсутствия перспектив для образованных людей. Мкртчян ссылается здесь на теорию аномалии Мертона и объясняет дезорганизацию и нерегулярность армянской социальной культуры как коллективное состояние диссонанса мишеней, т.е. как следствие недоступности ценностных символов посредством правовых ресурсов. Такое положение дел включает в себя растущую концентрацию капитала у олигархов, а также рост преступности среди "белых воротничков", конкуренцию и недовольство граждан. Если эти изменения будут исправлены, то необходимо будет не только отказаться от пессимизма и нового осознания "нравственного индивидуализма" и отношений между государством и гражданским обществом. Мкртчян возлагает свои надежды на систему образо-вания, потому что это самое важное социальное место, где можно прививать новые знания и приобретать новые ценности. Однако это предполагает, что система попрощается со своими прежними авторитарными структурами и своей этнизирующей пропагандистской миссией, а также будет способствовать воспитанию у молодежи гражданской ответственности и глобального мышления.
Бакытбек Малтабаров описывает состояние коллективного сознания в бывших советских республиках, характеризующееся разобщением, раздробленностью и противоречиями. Парадоксы формируют не только общество и отдельные группы, но и личность самого человека. Они являются наследием реальности советского общества, которая сама по себе противоречива, а также последовательного подрыва и, в конечном счете, крушения мировоззрения, которое на протяжении поколений гарантировало единство