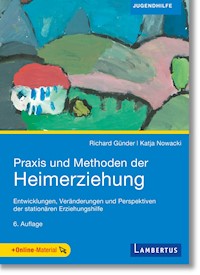
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lambertus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen verlangt heute mehr denn je eine hohe Professionalität. Die Einrichtungen haben sich in den letzten Jahrzehnten von Anstalten mit Aufbewahrungscharakter hin zu differenzierten pädagogischen Institutionen mit gut ausgebildeten Mitarbeitern entwickelt. Das Buch stellt die historische Entwicklung der Heimerziehung dar, berücksichtigt aktuelle Aspekte und Forschungsschwerpunkte stationärer Erziehungshilfe und skizziert fachliche Herausforderungen, wie etwa das Thema ''Sexualität in Heimen und Wohngruppen''. In die fünfte, völlig neu überarbeitete Neuauflage wurden neue Daten und Forschungsergebnisse eingearbeitet sowie veränderte gesetzliche Grundlagen. Das Buch ist als Lernmittel in Nordrhein-Westfalen zugelassen und in berufsbildenden Schulen in NRW als verbindliche Literatur zur Vorbereitung der Abiturprüfung in NRW 2016 vorgeschrieben. Zusatzmaterialien online auf www.lambertus.de. Übungsfragen zur Sicherung des Lernerfolgs für Lernfelder der Fachschule für Sozialpädagogik und Kontaktmöglichkeit mit dem Autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Günder | Katja Nowacki
Praxis und Methoden der Heimerziehung
Entwicklungen, Veränderungen und Perspektiven der stationären Erziehungshilfe
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.d-nb.de abrufbar.
6. überarbeitete und ergänzte Auflage 2020
Alle Rechte vorbehalten
© 2020, Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau
www.lambertus.de
Umschlaggestaltung: Nathalie Kupfermann, Bollschweil
Umschlagbild: Fabienne Sophie Brasch, Wolfegg
Druck: Elanders GmbH, Waiblingen
ISBN: 978-3-7841-3295-2
ebook ISBN: 978-3-7841-3296-9
Inhalt
Vorwort zur sechsten Auflage
Einleitung
1Entwicklungen und Veränderungen der Heimerziehung
Das Negativimage der Heimerziehung
Die Entwicklung der Heimerziehung in ihrem historischen Kontext
Heimerziehung in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR; 1949 – 1990)
Der Runde Tisch Heimerziehung
Reformen und ihre Auswirkungen
Quantitative Entwicklung der Heimerziehung seit 1991
Quantitative Veränderungen/Träger der Einrichtungen
Resümee
Indikationen für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
Aus welchen Familien kommen Heimkinder?
Wie war die Situation in der Herkunftsfamilie?
Wo hatten sich die jungen Menschen vor der stationären Hilfegewährung aufgehalten?
Wer hat den Heimaufenthalt angeregt?
Die Problemlagen der Kinder und Jugendlichen
Die besondere Situation unbegleiteter minderjähriger geflüchteter Kinder und Jugendliche (UMF) in der stationären Erziehungshilfe
Hilfen für junge Volljährige und „Care Leaver“
2Heimerziehung im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)
Die generelle Zielsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Erziehungshilfen im KJHG
Heimerziehung im Kinder- und Jugendhilfegesetz
Einbezug seelisch Behinderter
Sozialdatenschutz
Betroffenenbeteiligung bei der Hilfeauswahl
Partizipation von Kindern und Jugendlichen im gesamten Hilfeprozess
Hilfeplanung
Finanzierung
3Das differenzierte Leistungsangebot der stationären Erziehungshilfe
Heimerziehung hat sich verändert
Außenwohngruppen und Wohngruppen
Betreutes Wohnen
Erziehungsstellen
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Flexible Erziehungshilfen
4Heimerziehung aus der Sicht der Betroffenen
Die Einflussgröße von Standardsituationen auf die persönliche Entwicklung
Wie haben Betroffene ihre Heimerziehung erlebt?
5Folgerungen für die pädagogischen Mitarbeiter*innen
Woran kann sich Heimerziehung orientieren?
Rollenveränderungen und Identifikation der Heimerzieher*innen
Rollenveränderungen und Qualitätsanforderungen
6Folgerungen für pädagogische Beziehungsaspekte
Beziehungsaspekte bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Zwischen Selbstverwirklichung und Orientierungslosigkeit
Bindungsaspekte bei jüngeren Kindern in der Heimerziehung
Pädagogische Aspekte und Konzepte der Heimaufnahme
Die Heimaufnahme aus der Sicht der Mitarbeiter*innen
Die Heimaufnahme aus der Sicht der Gruppe
Pädagogische Methoden der Heimaufnahme
Die Gefahr der Festschreibung von Negativsymptomen
Das pädagogische Prinzip des Neubeginns und die Annahme des „guten Grundes“
Aufnahmerituale
Das Recht auf Schwierigkeiten
Resümee
Umgang mit Regeln und Strafen in der Heimerziehung
Umgang mit Regeln und Strafen unter Berücksichtigung motiv- und lerntheoretischer Perspektiven
Resümee
Räumliche Merkmale in ihrer Auswirkung auf pädagogische Prozesse
Die Frage der Angemessenheit
Räumliche Rahmenbedingungen und Ausstattungsmerkmale
Milieutherapeutische Heimerziehung
Folgerungen für die Heimerziehung
Bewertung
Resümee
7Ausbildungsprobleme und Grundhaltungen der Fachkräfte in der stationären Heimerziehung
Professionelles Handeln in der stationären Erziehungshilfe
Studie zu professionellem Handeln in der stationären Erziehungshilfe
Untersuchungsdesign
Praktika während der Ausbildung
Praxisnähe der Ausbildung
Fortbildungen
Supervision
Motivation und Zufriedenheit mit der beruflichen Situation
Ausrichtung/methodischer Schwerpunkt in den Einrichtungen
Literatur zur pädagogischen Ausrichtung bzw. zum methodischen Schwerpunkt
Resümee
Fachkräfte in der stationären Erziehungshilfe brauchen (pädagogische) Grundhaltungen
Pädagogische Grundvoraussetzungen
Nicht das Symptom, sondern die Person steht im Mittelpunkt
Übertragung auf den Heimbereich
8Methodisches Vorgehen in der Heimerziehung
Ausgangslage
Methoden in der Heimerziehung
Welche Methoden werden in der Heimerziehung praktiziert?
Ergebnisse einer Umfrage
Zur Methodik der Studie
Ergebnisse der Studie
Resümee
Die Umsetzung methodischer Vorgehensweisen
Zuständigkeiten abstimmen
Erziehungsziele und -aufgaben transparent machen
Den Alltag analysieren – das Chaos ordnen
Individuelle Pädagogik und Alltag miteinander verbinden
Die Gruppe einbeziehen
Konsequenz in der pädagogischen Realisierung
Bewusste Kontrollen einplanen
Methoden für den Umgang mit Gewalt und Aggressionen in der stationären Erziehungshilfe
Methodische Interventionen bei Gewalt und Aggressionen
Verhaltenstherapeutische Verfahren
Verbindung mit Entspannungsverfahren
Coolnesstraining
Weitere Maßnahmen im Umgang mit aggressivem Verhalten
Die Notwendigkeit von Teamarbeit als wichtigem methodischen Ansatz
Begründung der Teamarbeit
Die verschiedenen Aspekte der Teamarbeit
Kooperation zwischen Heim und Schule
9Partizipation von Eltern und Familienangehörigen
Zur Situation
Begründung der Elternarbeit
Rechtliche Grundlagen der Elternarbeit
Ressourcenorientierung
Der systemische und familientherapeutische Ansatz
Der psychoanalytische und der bindungstheoretische Ansatz
Die unterschiedlichen Zielsetzungen der Elternarbeit
Elternarbeit in der Form von Kontaktpflege
Grundsätzliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Elternarbeit
Einstellungen und Haltungen der Betreuer*innen zur Elternarbeit
Elternarbeit ohne Eltern
Elternarbeit als Trauerarbeit
Folgerungen für die Elternarbeit
Elternarbeit zur Unterstützung des Ablösevorgangs
Wer leistet Elternarbeit?
Professionelle Grundstandards in der Eltern- und Familienarbeit
Kontinuierlich hilfreiche Gespräche realisieren
Elterngruppenarbeit
Familientherapeutische Arbeit im Heim
Stationäre Familienarbeit im Heim
Resümee
10Sexualität in Heimen und Wohngruppen
Grundannahmen und Praxisbeispiele
Ausgangsüberlegungen
Zum Begriff der sexuellen Sozialisation
Ausgangslage der Sexualerziehung im Heim
Zum Begriff der Sexualität
Beispiele aus der Praxis der Heimerziehung
Inhaltsbereiche und Anforderungen einer Sexualerziehung in Heimen und Wohngruppen
Voraussetzungen der sexuellen Sozialisation
Einstellungen und Haltungen der Betreuer*innen innerhalb der Sexualerziehung
Förderung der sexuellen Sozialisation und Entwicklung unter dem Aspekt der Wohnbedingungen
Das eigene Zimmer
Die Frage der Schlüsselgewalt
Sexuelle Sozialisation als integrierter Bestandteil der Erziehung
Sexuelle Erziehung unter Berücksichtigung der besonderen Ausgangslage
Erzieherisches Vorbildverhalten
Enttabuisierung der Sexualität
Koordination partieller Erziehungseinflüsse
Einbezug der Eltern und Familien
Stellenwert der Sexualerziehung
Spezielle Fragestellungen der Sexualerziehung
Koedukative Erziehung, Mädchen- oder Jungenpädagogik
Homosexualität
Wann dürfen Jugendliche sexuelle Beziehungen aufnehmen?
Sexismus und Pornografie
Die pädagogische Situation sexuell missbrauchter Mädchen und Jungen in den Institutionen der Jugendhilfe
Ursachen und Auswirkungen sexueller Gewalt
Anforderungsbereiche der Heim- und Wohngruppenerziehung bei sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen
Sensibilität entwickeln, Projektionen und Überreaktionen vermeiden
Die Akzeptanz und Annahme der Persönlichkeit
Ein Vertrauensverhältnis aufbauen
Für ein therapeutisches Milieu sorgen
Neue Lebensperspektiven entwickeln
Die Sexualerziehung für Betroffene als Erziehung zur Liebesfähigkeit
11Maßnahmen stationärer Erziehungshilfe im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Kindern und Jugendlichen
Geschlossene Heimerziehung
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Adressat*innen der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung
Methoden und Organisation der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung
Ein intensivpädagogisches Projekt als Alternative zur geschlossenen Heimerziehung
Erlebnispädagogik und Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Alternative pädagogische Konzepte und Praxiserfahrungen
Zur Kritik an der Erlebnispädagogik
Literatur
Stichwortverzeichnis
Die Autoren
Zusatzmaterialien online auf
www.lambertus.de
•Übungsfragen zur Sicherung des Lernerfolgs für Lernfelder der Fachschule für Sozialpädagogik
•Kontaktmöglichkeit mit den Autor*innen
Vorwort zur sechsten Auflage
Zeit für Veränderungen
Die erste Auflage dieses Buches erschien im Jahr 2000 beim Lambertus-Verlag. Jede weitere Auflage berücksichtigte die aktuellen Veränderungen im Praxisfeld der Heimerziehung. Die statistischen Daten waren jeweils anzupassen und neu zu interpretieren, die neuen Ergebnisse der eigenen Forschung flossen in die Neuauflagen ein.
Nach 20 Jahren und insgesamt fünf überarbeiteten Auflagen stehen nun größere Veränderungen an:
Schon vor meiner Pensionierung als Professor für Erziehungswissenschaft musste überlegt werden, wie die weitere Überarbeitung und Aktualisierung dieses so gut angenommenen Lehrbuches bewerkstelligt werden könnte.
Ich konnte eine jüngere Kollegin meines Fachbereichs (Angewandte Sozialwissenschaften/FH Dortmund) dafür gewinnen, diese und auch die zukünftigen Neuauflagen zu gestalten. Frau Dr. Katja Nowacki ist Professorin für Psychologie und mit der Thematik stationäre Erziehungshilfen auch aus ihrer Praxis als Dipl. Sozialpädagogin bestens vertraut. Sie unterhält zahlreiche entsprechende Praxiskontakte und forscht zu unterschiedlichen Fragestellungen dieses Arbeitsfeldes.
Insofern bin ich sicher, dass das Buch „Praxis und Methoden der Heimerziehung“ sehr von der Professionalität der neuen Co-Autorin profitieren und so auch zukünftig den aktuellen Stand der Forschung widerspiegeln wird.
Für die Leser*innen und insbesondere für die Ausbildung dürfte diese Veränderung von großem Nutzen sein.
Hagen, im Frühjahr 2020
Prof. Dr. Richard Günder
Einleitung
Heimerziehung ist eine sehr kostenintensive Hilfe zur Erziehung. Die Kostenträger – also vor allem die Kommunen und Kreise – haben damit ihre Probleme. Bei vielen Kindern, Jugendlichen und Eltern ist Heimerziehung mit Ängsten besetzt, denn das mit ihr verbundene Image ist eher negativ und sie bedeutet eine zumindest vorübergehende Trennung von der Herkunftsfamilie. Ein Blick in die Geschichte der Heimerziehung zeigt sehr viel Leid. Die öffentliche Aufarbeitung der Heimerziehung in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu den 1970er-Jahren hat pädagogische Unfähigkeiten, Willkür sowie Missachtung der Menschenwürde offenbart. Dennoch ist die Anzahl der jungen Menschen, die in der stationären Erziehungshilfe leben, relativ gleich geblieben. In den letzten 30 Jahren lag der Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich jeweils am Jahresende in Heimerziehung befanden, in Bezug zur Bevölkerung im Alter von 0–20 Jahren, bei 0,37 bis 0,40 %. Dies bedeutet: Von 1.000 jungen Menschen sind durchschnittlich vier auf die Erziehungshilfe Heimerziehung angewiesen, was sich 2016 auf 0,6 % erhöht hat (also durchschnittlich sechs von 1.000 jungen Menschen).
Heimerziehung war also kontinuierlich notwendig und wird es voraussichtlich auch zukünftig sein. Daher geht es in diesem Buch vor allem um die Professionalität dieses Teilgebiets der Sozialen Arbeit. Denn der pädagogische und der finanzielle Aufwand sollten sich auch lohnen.
Die nun vorliegende sechste aktualisierte und ergänzte Auflage berücksichtigt neue Daten und Forschungsergebnisse sowie zusätzlich relevante Themen wie den Umgang mit Diversität im Kontext stationärer Erziehungshilfe, die Betreuung von Care Leavern, traumapädagogische Standards und auch internationale Perspektiven. Die Bedeutung der Beziehungsarbeit im Kontext von Fremdunterbringungen wird noch stärker herausgestellt.
Zunächst wird die Heimerziehung in ihrer historischen Dimension und Entwicklung, auch vor dem Hintergrund der deutschen Wiedervereinigung 1991, betrachtet und es wird aufgezeigt, welche strukturellen Veränderungen und inhaltlichen Reformen in den letzten Jahren vollzogen worden sind. Hierbei werden auch Aspekte der Qualitätsdebatte und der Finanzierung berücksichtigt.
Um das Aufgabengebiet der heutigen stationären Erziehungshilfe zu begreifen, müssen wir uns mit den Schwierigkeiten und Problemen von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen, die diese als Hilfeform benötigen. Es geht also darum zu klären, welche Indikationen die Maßnahme der stationären Erziehungshilfe legitimieren.
Weiterhin werden methodische Aspekte und Konzepte der Heimerziehung angesprochen, vor allem, wenn es um Orientierungen der pädagogischen und zielgerichteten Vorgehensweise in der konkreten Alltagspraxis oder in speziellen therapeutischen Situationen geht. Methodische Vorstellungen kommen aber auch bei der Zusammenarbeit zwischen Heim und Schule, bei der Elternarbeit, bei der Sexualerziehung in Heimen und in Wohngruppen sowie bei der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung und der geschlossenen Heimerziehung zur Sprache. Außerdem nehmen die Problemlagen der jungen Menschen und die Anforderungen an die pädagogischen Mitarbeiter*innen einen großen Stellenwert ein. Die Fachkräfte der stationären Erziehungshilfe haben häufig eine Ausbildung als Erzieher*in abgeschlossen, aber viele haben auch ein Studium der Sozialen Arbeit absolviert. Insofern wird häufig von den pädagogischen Fachkräften als Betreuer*innen der Kinder und Jugendlichen gesprochen, teilweise werden aber auch die spezifischen Berufsbezeichnungen verwendet, um den Fachhintergrund zu verdeutlichen.
Strukturelle und räumliche Rahmenbedingungen der Heimerziehung werden nicht nur exemplarisch behandelt; die architektonischen Bedingungen und Ausgestaltungsmerkmale von Heimen und Wohngruppen stellen wesentliche Faktoren des pädagogischen Alltags dar. Struktur, Gestaltung und Pädagogik beeinflussen sich ständig wechselseitig. Relativ breiten Raum nimmt auch das Kapitel „Sexualität in Heimen und Wohngruppen“ ein. An diesem so ungemein wichtigen Erziehungs-, Sozialisations- und Lebensbereich kann exemplarisch aufgezeigt werden, ob die institutionalisierte Erziehung elementare Sozialisationsprozesse eher behindert oder fördert. Da außerdem in Heimen und Wohngruppen häufig Kinder und Jugendliche leben, die in ihren Herkunftsfamilien sexuelle Gewalterfahrungen erleiden mussten, war der sich hieraus ableitende Aufgabenbereich für die Heimerziehung ausführlich zu behandeln. Hier werden auch Perspektiven von sexueller Orientierung und Identität in ihrer ganzen Breite berücksichtigt.
Das Buch will zu wesentlichen Entwicklungen, Aspekten und Perspektiven der stationären Erziehungshilfe Stellung nehmen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigten, dass diese Schrift vor allem im Bereich der Ausbildung und des Studiums sehr gut angenommen wurde. Sie wendet sich darüber hinaus sowohl an die Praktiker*innen, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind oder sich darüber informieren wollen, als auch an Leser*innen, die mehr ein wissenschaftliches Interesse an der Methodik und Struktur eines sozialpädagogischen Handlungsfeldes zum Lesen motiviert.
Kapitel 1
Entwicklungen und Veränderungen der Heimerziehung
Das Negativimage der Heimerziehung
Heimerziehung und die sozialpädagogische Betreuung in sonstigen Wohnformen haben die zentrale Aufgabe, positive Lebensorte für Kinder und Jugendliche zu bilden, wenn diese vorübergehend oder auf Dauer nicht in ihrer Familie leben können. Die sehr differenzierten Institutionen der stationären Erziehungshilfe sollen lebensweltorientiert ausgerichtet sein. Dies impliziert in der Regel eine ortsnahe oder zumindest regionale Unterbringung sowie die Unterstützung von Kontakten zum früheren sozialen Umfeld, vor allem aber zu der Herkunftsfamilie, wenn nicht im Einzelfall Gründe, die das Wohl des Kindes oder Jugendlichen gefährden könnten, dem gegenüberstehen. Das Heim als positiver Lebensort soll frühere oftmals negative oder traumatische Lebenserfahrungen verarbeiten helfen, für günstige Entwicklungsbedingungen sorgen, Ressourcen erkennen und auf ihnen aufbauen, den einzelnen jungen Menschen als Person annehmen und wertschätzen, eine vorübergehende oder auf einen längeren Zeitraum angelegte Beheimatung fördern und die Entwicklung neuer Lebensperspektiven unterstützen.
Die Entwicklung der Heimerziehung in ihrem historischen Kontext
Heimerziehung wird heute mitunter noch in Verbindung gebracht mit der anstaltsmäßigen Unterbringung von armen und verwaisten Kindern. Diese Vorstellung trifft für frühere Zeiten durchaus zu. Denken wir beispielsweise an die Situation elternloser Kinder in Findelhäusern, Klosterschulen, Hospitälern und Armenhäusern des Mittelalters, so fällt außerdem auf, dass erzieherische Gesichtspunkte damals kaum vorlagen, es ging vor allem darum, diese Kinder am Leben zu erhalten und sie zu Arbeitsamkeit, Gottesfurcht und Demut hinzuführen. In Deutschland entstanden die ersten Waisenanstalten im Jahrhundert in den Reichsstädten. Vorher war es üblich gewesen, verwaiste Kinder zu Familien zu geben. Die Lage solcher Kinder wurde jedoch vielfach als sehr schlecht beurteilt, häufig wurden sie als billige Arbeitskräfte für Haus und Hof eingesetzt, für ihre Erziehung oder gar Bildung wurde kaum etwas getan. Die ersten Waisenhäuser wurden 1546 in Lübeck, 1567 in Hamburg und 1572 in Augsburg eröffnet (Schips 1917, S. 702). Sehr bekannt wurden die im Jahre 1698 von August Herrmann Francke gegründeten Hallischen Anstalten. Durch eine strenge, pietistisch geprägte Erziehung sollten die Kinder in diesem Waisenhaus ihre innere Haltung ganz auf Gott hin ausrichten. Neben der übergeordneten religiösen Unterweisung fand erstmals auch ein auf lebenspraktische Inhalte orientierter Unterricht für die Waisenkinder statt. Anzustrebende Tugenden waren auf Gott bezogene Wahrheit, Gehorsam und Fleiß. Die Kinder wurden ständig zu häuslichen Arbeiten angehalten, welches durch genaue Dienstanweisungen und Reglementierungen zu erreichen versucht wurde (Sauer 1979, S. 18 ff.). Einengende Strenge und Disziplin waren alltäglich. Die Gruppen im Waisenhaus in Halle sollten ursprünglich möglichst klein sein, um eine individuelle pädagogische Vorgehensweise zu garantieren. Diese Absicht konnte jedoch nicht realisiert werden, denn wegen der jahrzehntelang andauernden Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges (Verwüstung von Städten und Ländereien, Verarmung der Bevölkerung, Zwangsabgaben zur Beseitigung der Kriegsschäden etc.) wurden die Anstalten von Kindern geradezu überflutet.
„Die berechtigte Kritik an dem Werk Franckes wird vermerken müssen, dass die Kasernierung so vieler Kinder in einer Anstalt letztlich eine formale Reglementierung des Lebens in ihr notwendig machte, die ihrerseits die pädagogischen Bemühungen zu einer pausenlosen Führung und Überwachung werden ließ, die dem kindlichen Wesen keine Freiheit zu eigener Entfaltung einräumte“ (Hegel 1968, S. 21).
Die weitverbreitete Massenunterbringung von Kindern, ihre hohe Sterblichkeit sowie der Vorwurf, sie würden in den damaligen Waisenhäusern nur zur Arbeit angetrieben, führte zu einem erbitterten und lang andauernden Streit.
„… die Unzufriedenheit mit den Waisenhäusern stieg. Immer wieder zeigte es sich, dass die in den oft engen und dürftigen Räumen zusammengedrängten Kinder von Hautkrankheiten geplagt wurden; immer wieder traten auch in der Verwaltung arge Missbräuche hervor, welche die verfügbaren Mittel zersplitterten und die Wohlgesinnten abgeneigt machten, neue Unterstützungen zu gewähren. Da gewann die Frage, ob es nicht besser sei, die Waisenhäuser als geschlossene Institute ganz aufzuheben und die Waisen in Familienpflege zu geben, mehr und mehr an Bedeutung. … Die Waisenhäuser wurden als Mördergruben, als Lazarethe bezeichnet, in denen die armen Kinder elendiglich verdürben oder doch den Keim der Krankheit für das ganze Leben in sich aufnähmen; man nannte ihre Zöglinge Geschöpfe, die unter liebloser und sorgloser Verwaltung durch Schmutz und Krätze, durch schlechte Kost und geheime Sünden, bleiche, abschreckende Gespenster würden, während sie doch zu Christen, zu brauchbaren Bürgern, zu tüchtigen Menschen gebildet werden sollten. Dagegen schwärmte man für die Erziehung auf dem Lande und in wackeren Familien und sah hier überall Bilder der Unschuld, der Einfalt, der Herzensgüte, des stillen Gedeihens“ (Pädagogisches Handbuch 1885, S. 1209).
Aber es waren nicht nur die schlimmen Zustände in den Anstalten, die zur Sorge Anlass gaben, sondern auch solche ökonomischen Gründe wurden angeführt, die uns an die gegenwärtige Diskussion über die hohen Kosten der Heimerziehung erinnern. Der Aufenthalt in einem Waisenhaus war beispielsweise im Jahre 1862 in Berlin dreimal so teuer wie in der Familienpflege.
Die „hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe“ schrieb im Jahre 1779 eine Preisaufgabe aus, in welcher geklärt werden sollte, ob die Erziehung der Waisenkinder vorteilhafter in Familienpflege oder in Waisenhäusern durchzuführen sei.
„Die Resultate, welche aus den Untersuchungen über jene Preisfrage hervorgehen, sind übereinstimmend ungünstig für die Waisenhäuser ausgefallen. Durch sehr ins Einzelne gehende Berechnungen ist dargethan worden, dass es für den Staat oder die Anstalten selbst weit vorteilhafter sey, die Kinder in auswärtige Verpflegung zu geben“ (Conversations-Lexikon 1819, S. 422).
Es wurde gleichzeitig gefordert, die Pflegeeltern „gehörig auszuwählen“ und diese „immer unter eine genaue Aufsicht“ zu stellen. In mehreren Orten wurden „die Waisenhäuser abgeschafft, und dagegen die Waisenvertheilung eingeführt. Der offenbare Erfolg davon ist eine bedeutende Ersparnis der Ausgaben, und eine sehr verminderte Mortalität unter den Kindern gewesen“ (Conversations-Lexikon 1819, S. 423).
Dennoch konnte dieser „Waisenhausstreit“, in dem es neben pädagogischen auch immer um finanzielle Gesichtspunkte ging, keineswegs eindeutig gelöst werden.
„Gehen wir nun von der Geschichte der Waisenerziehung zu der Waisenfrage über, so müssen wir zu Voraus bemerken, dass dieselbe seit hundert Jahren wie keine andere ventiliert wurde, ohne dass von den aufgestellten Prinzipien eines das andere verdrängt und entschieden die Oberhand gewonnen hätte. Der Grund liegt hauptsächlich darin, dass einerseits die Waisenfrage zugleich eine Geldfrage ist, und andererseits die Erziehungsfrage selbst, statt klarer und eine den Erziehern bewußte, nur immer noch mehr verwirrt wird“ (Real-Encyclopädie 1874, S. 765).
Doch obwohl die „Segnungen des Familienlebens“ in den Waisenhäusern ohnehin als „verloren“ galten, eine „individuelle Behandlung“ als „erschwert, wenn nicht unmöglich“ angesehen wurde, konnte der Streit nicht einfach zugunsten der Familienpflege entschieden werden. Auch die damals vorgetragenen Gründe lassen Parallelen zur heutigen Situation erkennen, denn man hätte sich wohl für die Familienpflege entschieden, „wenn nur die entsprechende Anzahl tauglicher Familien gefunden würde, denen die Kinder anvertraut werden könnten“ (Real-Encyclopädie 1874, S. 766). Nach der im Jahre 1840 vorgetragenen Auffassung des Vorstehers des Waisenhauses in Hamburg könnten jedoch „gut organisierte Waisenhäuser die besten Erziehungsanstalten für Waisen“ sein, wenn unter anderem die folgenden Voraussetzungen erfüllt wären: „Unterordnung der Oeconomie und des Rechnungswesens unter den höheren Erziehungszweck, statt jene als erste und letzte Rücksicht zu betrachten und sich dadurch leiten zu lassen“ und außerdem, „dass die Anstalt mit ihren Zöglingen auch nach der Entlassung wenigstens bis zur Mündigkeit in ununterbrochener Beziehung stehen müsse. Endlich, dass Waisenhäuser, da sie mehr kosten, auch mehr leisten und sich unablässig vervollkommnen müssen“ (Pädagogische Real-Encyclopädie 1852, S. 907).
Diese schon im Jahre 1840 erhobene Forderung ist für die stationäre Erziehungshilfe gültig und wird in neuen Forschungs- und Anwendungsbereichen, wie z. B. bei Care Leaver Projekten (s. z. B. Strahl/Thomas 2013), explizit aufgegriffen.
Erst mit dem Beginn der Aufklärung und mit allgemeinen Veränderungen in der Betrachtung des Wertes der Kindheit und einer kindorientierten Erziehung hielten in der Beeinflussung durch Rousseau und Pestalozzi pädagogische Ideen in größerem Umfang in die damaligen Institutionen für elternlose Kinder Einzug. Pestalozzi wurde im Jahre 1798 in Stanz die Gründung eines Armen-Erziehungshauses übertragen. Erstmals waren in einer solchen Anstalt nicht mehr Strenge, Zucht und Ordnung die herausgehobenen Attribute, sondern es überwog ein anderes Element, nämlich das der Liebe zu den Kindern.
„Der Waisenvater musste seinen Kindern alles sein: Vater, Diener, Aufseher, Krankenwärter und Lehrer. Bei der Kärglichkeit der Hilfsmittel musste sich die Erziehung der Kinder auf das Wichtigste beschränken; die Erziehungsmethode war diejenige der Liebe“ (Rattner 1968, S. 100).
Pestalozzi teilte gemeinsam mit seiner Familie sein Leben mit den Waisenkindern. Der „Wohnstubencharakter“ seines Erziehungsideals ließen ihn zum Begründer des Familienprinzips in der Heimerziehung werden (Sauer 1979, S. 36).
„Ich wollte eigentlich durch meinen Versuch beweisen, dass die Vorzüge, die die häusliche Erziehung hat, von der öffentlichen müssen nachgeahmt werden und dass die letztere nur durch die Nachahmung der erstern für das Menschengeschlecht einen Wert hat“ (Pestalozzi o. J., S. 93).
Die immense Bedeutung einer Pädagogik durch Beziehungsarbeit wird durch folgende Aussage deutlich:
„Vor allem wollte und musste ich also das Zutrauen der Kinder und ihre Anhänglichkeit zu gewinnen versuchen. Gelang mir dieses, so erwartete ich zuversichtlich alles übrige von selbst“ (Pestalozzi, o. J., S. 94).
Die von Pestalozzi ausgehenden Impulse sollten die Waisenpflege nachhaltig beeinflussen. Denn es wurde „immer entschiedener die dabei zu lösende Aufgabe als eine pädagogische“ (Pädagogisches Handbuch 1885, S. 1209) aufgefasst. Die sich anschließende „Rettungshausbewegung“ verfolgte zwei Zielsetzungen. Einmal sollte das Seelenheil der verwaisten Kinder durch religiöse Bildung und Hinführung zu Gott gerettet werden. Andererseits ging es darum, elternlose Kinder für das weltliche Leben bzw. das Überleben zu retten und sie zu brauchbaren Mitgliedern der Gesellschaft heranzubilden. Einer der bedeutendsten Vertreter der Rettungshausbewegung war Johann Hinrich Wichern, welcher im Jahre 1833 das „Rauhe Haus“ in Hamburg gründete. Mit der Errichtung dieses Waisenhauses reagierte der Theologe Wichern auf die unvorstellbare Verarmung großer Bevölkerungsteile und auf den sozialen Zerfall der Gesellschaft. Dem einzelnen jungen Menschen, welcher zu ihm geführt wurde, begegnet Wichern – von seinem christlichen Lebensprinzip geleitet – mit Liebe und Vergebung. Eine kleine Abhandlung in der „Schulzeitung“ von 1847 schildert das Rauhe Haus folgendermaßen: „Das Ganze ist ebensowenig eine Waisen-, als eine Schul-, Zucht- oder Armenanstalt, sondern ist nach und nach zu einer kleinen Colonie herangewachsen, in welcher die rettende Liebe sehr mannigfaltige Zwecke pflegt und nach außenhin verwirklicht. Diese Anstalten beherbergen gegenwärtig in zwölf kleineren und größeren Gebäuden zwischen 140 bis 150 Hausgenossen verschiedener Art. … Fragen wir nach den Mitteln, deren sich die rettende Liebe des Rauhen Hauses bedient, um die Verirrten mit neuen Lebenskräften zu durchdringen, so stellen sich namentlich folgende heraus: Zunächst ist es eine selbstbestimmte Ordnung, woran man die Aufgenommenen gewöhnt, um sie aus dem ungeordneten, wilden und wüsten Treiben herauszureißen, in welchem sie die Ihrigen leben sahen und in welchem sie mitlebten. Das zweite Mittel ist eine nützliche Beschäftigung, von der die Zöglinge vor ihrer Aufnahme noch nichts wußten. Das dritte Mittel besteht in dem fleißigen Gebrauche des göttlichen Wortes, um sie nun auch in das rechte Verhältnis mit Gott zu setzen, wovon bei ihnen sonst kaum eine Spur zu finden war. Ein viertes Mittel besteht in dem Bemühen, Liebe in den Herzen der Kinder zu erwecken und hierin namentlich offenbart das Rauhe Haus am Deutlichsten seine besondere Eigentümlichkeit – das Familienleben, ein gemütliches Beisammenwohnen, welches es allen anderen Einrichtungen vorgezogen hat; denn es ist der naturgemäßigste Boden für das Gedeihen des kindlichen Lebens, und das Förderlichste einer gegenseitigen Erziehung“ (Pädagogische Real-Encyclopädie 1852, S. 909 f.).
Die Verdienste Wicherns sind in der konsequenten Praxis des Familienprinzips zu sehen, damit stellte er die ansonsten übliche Vermassung der Kinder in Anstalten deutlich ins Abseits. Die Erziehung in und durch kleine Gemeinschaften wurde begleitet von einer christlich geprägten individuellen Zuneigung. Die Waisenhauserziehung hätte bei Anwendung solcher Grundsätze von diesem Zeitpunkt an ihre Schrecken verlieren können. Dies war aber nicht so. Sehr deutlich wird die Nichtbeachtung bereits vorhandener pädagogischer Einsichten beispielsweise, wenn man die Anstaltssatzung des Münchner Waisenhauses aus dem Jahre 1908 liest und feststellen muss, dass die autoritäre und aus heutiger Sicht menschenverachtende Anstaltsordnung kaum Raum für pädagogische Prozesse zuließ. Von den Kindern wurde eine ehrerbietige Haltung gegenüber den Vorgesetzten erwartet, Widerspruch wurde nicht geduldet. In der Hausordnung dominierten Begriffe wie Strenge, Strafen, Schweigen und Ruhe. Eine Briefzensur war selbstverständlich. Die durch Rousseau, Pestalozzi und Wichern vorgebrachten Erkenntnisse des Wertes einer vom Erwachsenen ausgehenden Beziehungsarbeit, welche durch Liebe und Zuneigung geleitet wird, pervertieren in der Anstaltssatzung in ihr Gegenteil:
„Die Zöglinge haben allen ihren Vorgesetzten einschließlich allen Ordensmitgliedern Ehre, Liebe und Gehorsam zu erweisen“ (Mehringer 1994, S. 34).
Positive emotionale Beziehungen zwischen Kindern und Erzieher*innen wurden so von vornherein ausgeschlossen. Jahrhundertelang wurde – bis auf wenige Ausnahmen – Kindern durch Institutionen kein Zuhause geboten, sie wurden in Anstalten kaserniert und zu Zucht und Ordnung angetrieben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erfahren, dass der Begriff „Heim“ erst Anfang des 20. Jahrhunderts üblich wurde und vorher und auch danach Beschreibungen wie
•Besserungs- und Corrigendenanstalt
•Rettungshaus und Rettungsanstalt
•Zwangserziehungsanstalt
•Fürsorgeerziehungsanstalt
•Erziehungsanstalt
•Jugendschutzlager/Konzentrationslager für Jugendliche/Arbeitslager für Fürsorgezöglinge“ (Schrapper/Heckes 1986, S. 1 f.)
üblich waren.
Die Erziehungssituation im Nationalsozialismus war dadurch gekennzeichnet, dass alle Kinder und Jugendlichen während dieser Zeit ganz massiven ideologisch ausgerichteten Erziehungsgewalten außerhalb der eigenen Familie ausgesetzt waren. Dies stand im Widerspruch zur eigentlich vorherrschenden Familienideologie, denn die Zielsetzung der diktatorischen Staatsgewalt, nationalsozialistisch wertvolle junge Menschen heranzubilden, führte faktisch zu einer Schwächung der Erziehung innerhalb der Familie (Sauer 1979, S. 73).
„Die öffentliche Erziehung blieb nicht mehr Ersatzerziehung für den Notfall eines elterlichen Versagens, sie wurde zu einer staatspolitischen Pflichtaufgabe. Elterliches Vorbildverhalten wurde faktisch um das umschriebene Tatbestandsmerkmal der politischen Unzuverlässigkeit der Sorgeberechtigten erweitert“ (Wolff 1999, S. 155).
Bei der Aufgabenstellung der Fremdunterbringung blieben die pädagogischen Erkenntnisse und Errungenschaften vorangegangener Zeiten außer Betracht. Richtlinie wurde die Fragestellung, was die Hilfeleistung für den Einzelnen dem NS-Staat voraussichtlich nützen würde; es fand eine Aufteilung der Hilfebedürftigen nach rassistischen Merkmalen und ihrem Wert für die „Volksgemeinschaft“ statt. Für Kinder und Jugendliche, die außerhalb ihrer eigenen Familie in Institutionen aufwachsen mussten, wurde eine Unterteilung vorgenommen in „‚gute‘ Elemente, die als ‚erbgesund‘, normal begabt und eingliederungsfähig galten und in NSV1 Jugendheimstätten untergebracht und erzogen wurden, in ‚halbgute‘ Elemente – sie erhielten auf der Grundlage des RJWG2 aus dem Jahre 1922 Fürsorgeerziehung – und die ‚bösen’ Elemente, die als schwersterziehbar ab 1940 in polizeilichen Jugendschutzlagern untergebracht und mit Erreichung der Volljährigkeit in ein Arbeitshaus oder in ein Konzentrationslager übergeführt wurden“ (Lampert 1983, S. 198).
Diese Klassifizierung führte dazu, dass in den NSV Jugendheimstätten nur als rassisch „wertvolle“, erbgesund sowie erziehungsfähig und erziehungswürdig angesehene junge Menschen aufgenommen wurden. Alle anderen kamen in die sogenannte Bewahrung, eine Aufgabe, welche den Wohlfahrtsverbänden überlassen wurde.
Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges war es zunächst sehr schwierig, der großen Anzahl an heimatlosen und elternlosen Kindern mit sinnvoll organisierten Hilfeangeboten entgegenzutreten. Nur noch wenige Heime waren vorhanden, die in der Regel von unausgebildetem Personal (so z. B. von ehemaligen Soldaten) geführt wurden. Großgruppen von bis zu 30 und mehr Kindern waren an der Tagesordnung. Um mit solchen „Massen“ von Kindern einigermaßen fertig zu werden, blieben dem nicht qualifizierten Personal nur wenige Methoden übrig, die auf Strenge, Disziplin, Ruhe, Ordnung und Unterordnung basierten. Einige der wenigen Ausnahmen hiervon konnten im zuvor schon erwähnten Münchener Waisenhaus beobachtet werden. Der wegen seiner Aktivitäten während der NS-Zeit nicht unumstrittene Pädagoge Andreas Mehringer (1911–2004) übernahm nach dem Zweiten Weltkrieg die Leitung des Waisenhauses in München. Er setzte sich erfolgreich für Reformen der Heimerziehung insgesamt ein. Ihm gelang es in der frühen Nachkriegszeit, das Familienprinzip innerhalb der Heimerziehung mit dem Wiederaufbau des Hauses „realitäts- und hilfebezogen“ zu realisieren.
Auf diese Zeit zurückblickend, schrieb Mehringer später:
„Muss man … die Kinder wie in der alten Anstalt kasernieren? Muss der Unterschied zwischen einem Familienkind und einem Anstaltskind so riesengroß sein? Wir sagten: Nein. Es gibt einige wesentliche Elemente der Familie, welche auf die Ersatzunterbringung übertragbar sind. Es sind vor allem diese drei: die überschaubare kleine Zahl; dann: nicht lauter gleiche, sondern verschiedene Kinder in der Gruppe, große und kleine, Knaben und Mädchen; und schließlich die abgeschlossene Wohnweise dieser kleinen gemischten Gruppe. Anders gesagt: Die eigenen vier Wände, die jeder Mensch für sich haben möchte; die er liebt, weil er sie braucht. Auch Kinder brauchen sie“ (Mehringer 1994, S. 60).
Es sollte allerdings noch Jahrzehnte dauern, bis die von Mehringer ausgehenden pädagogischen Impulse die Heimerziehung insgesamt erreichten und veränderten.
Von einer anderen Seite ausgehend wurde die Idee, elternlosen Kindern ein wirkliches Zuhause zu geben, nach dem Zweiten Weltkrieg auch durch die SOS-Kinderdorfbewegung praktiziert. Der allgemeine Weg zur Veränderung weg von der Anstaltserziehung in der Großinstitution Heim hin zu überschaubaren familienähnlichen Formen, setzte auf breiter Ebene erst mit Beginn der 1970er-Jahre ein und fand seinen Ausdruck in der Auflösung großer Institutionen, im Auftauchen von Kinderhäusern, Außenwohngruppen und Wohngruppen.
Die Beheimatung von Kindern, z. B. in den Kinderdörfern innerhalb eines familienähnlichen Rahmens, war zweifellos eine Abwendung von der Anstaltspädagogik und sie war notwendig, da es sich in der Regel um elternlose Kinder handelte. Hier trat dann auch der in der ansonsten praktizierten Heimerziehung existierende Änderungs- und Verbesserungscharakter der Pädagogik zurück, zugunsten der „normalen“ Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb einer fördernden familiären Atmosphäre. Das sich mehr und mehr durchsetzende Familienprinzip innerhalb der Heimerziehung blieb jedoch nicht unumstritten (Sauer 1979), denn es erschien fraglich, ob familienähnliche Lebens- und Erziehungsformen wirklich für alle Kinder die günstigsten Entwicklungsmöglichkeiten bieten könnten.
Spätestens dann, wenn eine Bezugsperson austritt, merken die Kinder, dass „ihre Familie“ eine organisierte Täuschung war (Bühler-Niederberger 1999, S. 337). Durchsetzen konnte sich allenthalben jedoch die Tendenz, Heimerziehung in Gruppen zu praktizieren, die zumindest von der äußeren Form und Struktur her der Familie ähneln. Bis auf wenige andere Ausnahmen gebührt zweifellos der SOS-Kinderdorfbewegung der Verdienst, Heimkindern einen Rahmen geschaffen zu haben, in dem neben einer beständigen Bezugsperson eine wirkliche Atmosphäre der Geborgenheit und des Sich-Zuhause-Fühlens vorhanden war. Die übrigen Institutionen der Heimerziehung verfügten zwar im Laufe der Jahre auch über bessere Gebäude und nach und nach über zumindest einzelne pädagogisch ausgebildete Mitarbeiter*innen, es waren aber trotzdem immer noch Anstalten mit ihren typischen Negativmerkmalen.
Erst gegen Ende der 1960er-Jahre wurde der Heimerziehung insgesamt mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Initiatoren der sogenannten Heimkampagne oder anders ausgedrückt: der Skandalisierung der Heimerziehung, waren linke Student*innengruppen, die das vorherrschende kapitalistische Gesellschaftssystem anprangerten und sich für Randgruppen, welche durch eben dieses System erzeugt seien, einsetzten. Heimkinder und vor allem Jugendliche in geschlossenen Fürsorgeheimen waren eine solche Randgruppe, mit der Student*innengruppen sich solidarisierten. Die Öffentlichkeit wurde – teilweise in spektakulären Formen – auf die Not der in Heimen lebenden jungen Menschen aufmerksam gemacht, die Rahmenbedingungen und Erziehungspraktiken wurden angeprangert. Heimzöglinge wurden „befreit“, es entstanden die ersten alternativen Wohngemeinschaften. Auch die allgemeine Einstellung zur Erziehung unterlag in diesem Zeitraum Veränderungstendenzen, die im Zusammenhang mit den politischen und gesellschaftlichen Reformen gesehen werden können. Vor allem die Veröffentlichungen von Neill (1970/2014) über die Theorie und Praxis der antiautoritären Internatschule Summerhill gaben sowohl der Fachwelt als auch der breiten Öffentlichkeit wesentlichen Anstoß zu einer lebhaften und lang anhaltenden Diskussion über diese revolutionär anmutenden Erziehungsansichten. Sowohl die Skandalberichte über die Heimerziehung als auch die Auswirkungen der antiautoritären Erziehungsbewegung leiteten erneut Reformforderungen für die Heimerziehung ein, wie
•die Abschaffung repressiver, autoritärer Erziehungsmethoden,
•die Verringerung der Gruppengröße,
•tarifgerechte Entlohnung sowie Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten für Erzieher(innen),
•die Abschaffung von Stigmatisierungsmerkmalen, etwa Anstaltskleidung, Heime in abgelegener Lage etc. (Almstedt/Munkwitz 1982, S. 21–33).
Heimerziehung in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR; 1949 – 1990)
Heimerziehung in der DDR hatte die Aufgabe, sich mit Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen, „für die gesellschaftliche Regelsysteme nicht greifen, also mit Ausnahmefällen“ (Mannschatz 1994, S. 15).
Während in Westdeutschland die 1968er-Bewegung, die Skandalberichte über die Zustände in Heimen sowie liberaler gewordene politische und pädagogische Auffassungen und Realitäten zu andauernden Reformen der stationären Erziehungshilfe führten, gab es in den Heimeinrichtungen der ehemaligen DDR weniger solche Impulse und Veränderungen.
Dagegen bestanden in der Zeit vor 1968 bezüglich der Heimerziehung viele Übereinstimmungen. Kappeler (2008, S. 69 ff.) resümiert, dass in den stationären Jugendhilfesystemen beider deutscher Staaten Merkmale „totaler Institutionen“ vorhanden waren, so wie sie von Goffman (1974) beschrieben wurden. Sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR waren abweichende Verhaltensweisen, die Beobachtung bzw. Zuschreibung von Verwahrlosungstendenzen und sogenannte Schwererziehbarkeit wesentliche Einweisungsgründe. In der DDR wurden – im Gegensatz zu Westdeutschland – die aus den Normabweichungen resultierenden „Erziehungsnotwendigkeiten“ ganz offen dargelegt und ideologisch mit der „Erziehung zu einem neuen Menschen“ und zum Sozialismus begründet. In Ost und West „stand die Einhaltung der ‚Heimordnung‘ durch die Kinder und Jugendlichen gleichermaßen im Mittelpunkt des pädagogischen Geschehens“ (Kappeler 2008, S. 73). Um Disziplin und Veränderungen zu erreichen wurde mit Härte und unnachgiebiger Konsequenz (um)erzogen. Größere Gruppen oft verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher führten nahezu zwangsläufig zu „kasernierten Strukturen und Ordnungen“ (Krause 2004, S. 139).
In der ehemaligen DDR lebten durchschnittlich ca. 30.000 Kinder und Jugendliche in Heimen (Krause 2004, S. 11). In Westdeutschland befanden sich in den 1980er Jahren im Durchschnitt ca. 52.000 junge Menschen in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe. Vergleicht man diese Zahlen mit der jeweiligen Bevölkerungsanzahl im Jahr 1989 (DDR 16,4 Millionen – Westdeutschland 62,6 Millionen), dann fällt auf, dass in der DDR im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mehr als doppelt so viele Kinder und Jugendliche in Heimerziehung untergebracht waren als in der Bundesrepublik.
Mannschatz bewertet das inhaltliche Konzept der Jugendhilfe in der DDR als ein von Anfang an pädagogisch orientiertes Konzept. Es ging um die Beeinflussung der Lebens- und Erziehungssituation junger Menschen. Begünstigt wurde dies durch den Aspekt, dass Jugendhilfe der Volksbildung zugerechnet wurde (Mannschatz 1994, S. 40). Die inhaltliche Ausrichtung der Heimerziehung in der DDR orientierte sich wesentlich an den Erziehungsvorstellungen des Pädagogen Makarenko, welcher als Hauptform der Erziehung das Kollektiv betrachtet (Makarenko 1978, S. 125). Die Kollektiverziehung solle zur Heranbildungen des neuen (sozialistischen) Menschen verhelfen (Hafeneger, 2017, S. 14). Entscheidend sei hierbei die Disziplin. Diese „darf nicht nur als Erziehungsmittel angesehen werden. Sie ist das Ergebnis des Erziehungsprozesses, in erster Linie das Ergebnis des Kollektivs der Zöglinge selbst …“ (S. 39). Während im Westen die individuelle Förderung immer wichtiger wurde, stand im Osten nicht die einzelne Person, sondern die Gemeinschaft im Zentrum der Erziehung.
Die Differenzierung der Heime reichte von Normalkinderheimen für Kinder von 3 – 14 Jahren, Spezialkinderheimen für sogenannte „schwererziehbare“ und auch bildungsschwache Kinder, Aufnahme- und Beobachtungsheimen (auch in Verbindung mit Strafvollzug oder Fürsorgeerziehung) über Jugendwerkhöfe für erziehungsschwierige und straffällige Jugendliche bis hin zu Jugendwohnheimen, Heimen für schwererziehbare, sogenannte bildungsunfähige schwachsinnige Jugendliche und Durchgangsstationen, wohl vergleichbar mit Institutionen der Inobhutnahme (Krause 2004, S. 81 ff.)
Heimerziehung „wurde im Wesentlichen erst dann realisiert, wenn andere Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg gezeigt hatten. Einzigartig und letztes Mittel zu sein, charakterisierte entscheidend das Selbstverständnis von Heimerziehung in der DDR“ (Krause, 2004, S. 89). Die Aufgabe waren vor allem der „Ausgleich und die Korrektur von Fehlverhaltensweisen“ (S. 90).
Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau war die einzige Institution dieser Art in der DDR. „Sie war gedacht als Disziplinar-Einrichtung. Aufgenommen wurden Jugendliche, die in den Jugendwerkhöfen die Heimordnung ‚vorsätzlich schwerwiegend und wiederholt verletzten‘. (…) Der Aufenthalt durfte 6 Monate nicht überschreiten. Der Jugendwerkhof hatte eine Kapazität von 60 Plätzen“ (Mannschatz 1994, S. 59). Der Jugendwerkhof Torgau wurde zwischenzeitlich zum Inbegriff einer willkürlichen und das einzelne Individuum verachtenden Heimerziehung in der DDR. Ein Vergleich der Kapazitäten geschlossener Heimerziehung relativiert allerdings das Ausmaß dieser Erziehungsform: 60 geschlossenen Heimplätzen in der DDR standen im Jahr 1989 insgesamt 372 geschlossene Heimplätze in der Bundesrepublik gegenüber (v. Wolfersberger/Sprau-Kuhlen 1990, S. 61 ff.). Orientiert an den jeweiligen Bevölkerungszahlen hätte es nach DDR-Maßstäben nur 229 geschlossene Heimplätze in der Bundesrepublik geben müssen. Wir wollen nun jedoch die inhaltlichen Aspekte der geschlossenen Heimerziehung in Torgau betrachten.
Der Prozess der Umerziehung begann bereits mit der Einweisung in die Heimeinrichtung. Hier „wurde der Jugendliche mit unabdingbaren Forderungen konfrontiert, die die Macht der Erzieher demonstrierten“ (Beyer/Strobl/Müller 2016, S. 67). Unglaublich schockierend müssen die betroffenen Jugendlichen bereits die Aufnahme erlebt haben. Sie mussten sich in der Kleiderkammer vollständig ausziehen, sie wurden desinfiziert, alle Körperöffnungen wurden überprüft, die Haare kurz geschoren. Die ersten Tage mussten in Arrestzellen verbracht werden. In dieser Isolationshaft standen nur eine Pritsche sowie ein Toiletteneimer zur Verfügung (S. 64 f.). Es ging darum, die Persönlichkeit zu demütigen und zu brechen. Auch der weitere Aufenthalt im Jugendwerkhof Torgau war von Zwangsmaßnahmen und unerbittlicher Disziplinanforderung geprägt. Der Tagesablauf war minutiös strukturiert, viele – teilweise kleinkariert wirkende – Einzelheiten wurden in einer 86 Seiten umfassenden Arbeitsordnung präzise geregelt (S. 71).
Mannschatz stellt im Rückblick fest, „dass die Errichtung des geschlossenen Jugendwerkhofes Ausdruck der Hilfslosigkeit gegenüber extremen sozialpädagogischen Problemlagen war“ (1994, S. 59). Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau ist zu einem Synonym für Erziehungsrepression und Unrechtspädagogik in der DDR geworden.
Wie sind die Unterschiede der Heimerziehung in West und Ost zu bewerten? Die 1968er-Ereignisse hatten in der westdeutschen Heimerziehung zu deutlichen Reformen Anlass gegeben. Ansonsten aber gilt: „Im Ergebnis haben offenbar das christliche Menschenbild und das sozialistische Menschenbild die gleichen Erziehungsmethoden vorgebracht“ (Kappeler 2013, S. 28).
Der Runde Tisch Heimerziehung
In den letzten Jahren wurde in den Medien verstärkt über einzelne Erfahrungen ehemaliger „Heimkinder“ in den 1950er- und 1960er-Jahren berichtet. Die Betroffenen hatten während ihrer Heimaufenthalte massive Eingriffe in ihre Persönlichkeitsrechte erleiden müssen, sie wurden wie selbstverständlich zu unentgeltlichen Arbeiten angehalten, sie mussten drakonische Strafen über sich ergehen lassen und sie leiden noch heute unter den (sexuellen) Gewaltübergriffen ihrer ehemaligen Betreuer*innen. Die Verhältnisse, unter denen diese ehemaligen Heimkinder aufwuchsen, waren durch Lieblosigkeit und Machtherrlichkeit bzw. Machtmissbrauch gekennzeichnet. Gerade auch in christlichen Einrichtungen der damaligen Heimerziehung waren solche Zustände anzutreffen (Wensierski 2006), die keinesfalls nur mit Verweis auf die seinerzeit üblichen Erziehungsvorstellungen und Rahmenbedingungen zu erklären sind.
Kappeler (2010) spricht in diesem Zusammenhang von unverantwortlichem Verhalten der Personen, die für und innerhalb der Heimerziehung Verantwortung tragen sollten.
„Das geltende Jugendrecht und die in der Kinder- und Jugendhilfe auch damals schon entwickelten Standards wurden in der Praxis der Heimerziehung und der ‚Wege ins Heim‘ – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht verwirklicht. An den entscheidenden Stellen des Jugendhilfesystems, bei öffentlichen und privaten Trägern fehlten die Einsicht und der politische Wille, die Kritik anzunehmen und fachlich qualifizierte Vorschläge zu realisieren“ (Kappeler 2010, S. 138).
Berichte und Hinweise ehemaliger Heimkinder veranlassten den Leiter eines Kinderheims in evangelischer Trägerschaft in Nordrhein-Westfalen dazu, die Vergangenheit seiner Institution in den 1950er- und 1960er-Jahren durch den Erstautor wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Man war sehr daran interessiert, mit betroffenen ehemaligen Heimkindern und mit früheren Betreuungspersonen in einen Dialog zu treten. Von der Heimleitung wurde die persönliche Begegnung mit den Betroffenen als sehr wichtig erachtet.
Sowohl aus Interviews mit ehemaligen Betreuer*innen als auch mit ehemaligen Jugendlichen geht hervor, dass der Tagesablauf in der Heimeinrichtung sehr stark durchstrukturiert war. Diese Struktur wurde jedoch nicht als äußerer Halt, sondern eher als Einschränkung und als Unfreiheit verstanden und aufgefasst. Die Kinder und Jugendlichen mussten in Reih und Glied in Zweierreihen in den Speisesaal gehen. Gegessen wurde von Blechtellern, da Porzellan ohnehin nur kaputt gemacht worden wäre. Das Essen wurde als sehr eintönig, einfach und schlecht beurteilt. „Es gab jeden Tag einen Kessel Mehlsuppe“ (Aussage einer ehemaligen Mitarbeiterin). Beim Essen herrschte Schweigegebot. Die Minderjährigen besuchten die Heimschule auf dem Gelände. Die Möglichkeit zum Duschen und zum Kleiderwechsel wurde nur an Freitagen eingeräumt. Die Toiletten hatten keine Türen, einige der Interviewten empfanden dies als demütigend. An Samstagen mussten die Hände und Schuhe gezeigt werden, die Schlafsäle wurden kontrolliert. Insgesamt herrschten ausgeprägte Kontrollen vor. An Geburtstagen konnte zwar im kleinen Rahmen gefeiert werden, es gab aber keine Geschenke. Unter den Kindern und Jugendlichen entwickelten sich hierarchische Strukturen, gegenseitige Erpressungen waren an der Tagesordnung.
Die Mitarbeiter*innen berichten übereinstimmend von einer „völligen Überforderung“. Dies wird z. B. begründet mit der großen Kinderanzahl und mit nicht vorhandenen Möglichkeiten einer Aussprache unter den Betreuer*innen. Es herrschte ein „Kasernenton“ vor, Emotionen waren nicht vorhanden, die Kinder wurden einfach nur „verwahrt“. Emotionale Zuwendungen unterblieben und die ehemaligen Heimkinder berichten, dass sie es vermisst haben „einfach einmal in den Arm genommen zu werden“ oder sonstige Streicheleinheiten zu erhalten.
Ein ehemaliges Heimkind erinnert sich folgendermaßen: „Wenn kein Gehorsam im Schlafsaal herrschte, mussten alle unter die ‚kalte Dusche’, diese Prozedur dauerte manchmal bis 2 Uhr nachts.“ Die Gewalt aufseiten der Erzieher*innen und unter den Kindern sei sehr hoch gewesen. Es hätten definitiv Demütigungen und sexuelle Misshandlungen stattgefunden. Es habe auch Räumlichkeiten gegeben, in denen die Jungen eingeschlossen wurden, wenn sie nicht gehorchten. Diese Isolation dauerte zwischen einem Tag und einer Woche. Auch Spalierläufe mit nassen Bettlaken habe es gegeben. Der ehemalige Hausvater habe von morgens bis abends nur geschrien.
„Man musste im Büro des Anstaltsleiters ‚antanzen’, seine Hosen runter ziehen und es gab drei Schläge mit dem Rohrstock.“ Auch ein anderes ehemaliges Heimkind erinnert sich daran, mehrfach geschlagen worden zu sein. Einmal wurde er mit dem Schlauch geschlagen.
„Der Hausvater bestrafte die Kinder in seinem Büro durch Schläge mit dem Rohrstock auf das Gesäß und Schläge mit der Hand ins Gesicht. Schläge standen an der Tagesordnung. Im Speisesaal wurden Kinder von den Betreuern vor allen anderen geschlagen.“
Von den sechs befragten ehemaligen Heimkindern geht nur bei einem aus den Aussagen hervor, dass er den Aufenthalt unbeschadet überstanden habe. Ein weiterer Betroffener beurteilte die Zeit im Heim als belastend, er habe aber etwas gelernt. Ein anderer erlebte den Heimaufenthalt offensichtlich als sehr belastend. „Es ging damals nicht um Kindererziehung, sondern um Geld und Politik.“
Aufgrund der Äußerungen von drei weiteren Befragten kann man von lang andauernden Traumatisierungen ausgehen. Einer von ihnen hat nach seiner Heimerfahrung nie wieder Weihnachten gefeiert und hätte über seine Kindheit nicht sprechen können, wenn er nicht eine Therapie gemacht hätte. Ein anderer spricht von Angstzuständen, wenn er durch bestimmte äußere Situationen an das Heim erinnert wird. Er vermeidet z. B. Restaurants wegen der großen Räume mit vielen Menschen und wegen des Geschirrklapperns. Auch er unterzog sich einer Therapie. Ein weiterer Ehemaliger äußerte sich folgendermaßen: „Man fing an, das Leid zu ertragen, weil der Wille gebrochen wurde. Man wurde verwahrt und nicht mit Liebe erzogen.“ Er hätte gerne eine Therapie gemacht, weil er die Erinnerungen nicht alleine verarbeiten konnte. Aus finanziellen Gründen sei dies aber nicht möglich gewesen. Es habe bei ihm lange gedauert, sich im Leben nach dem Heim auf Menschen einzulassen. Selbstwertgefühl und Urvertrauen seien verloren gegangen und nicht wieder zu erlangen. Insbesondere sind die betroffenen Personen deshalb verbittert, weil es nur in geringen Einzelfällen zu Entschuldigungen kam und sie ansonsten auf eine Mauer des Verschweigens, Verdrängens und Leugnens stießen. Nur wenige Institutionen hatten bislang ihre jüngere „Geschichte“ aufgearbeitet.
Eine der ersten positiven Ausnahmen stellte die Resolution des Landeswohlfahrtsverbands Hessen dar:
„Der Landeswohlfahrtsverband Hessen erkennt an, dass bis in die 70er Jahre auch in seinen Kinder- und Jugendheimen eine Erziehungspraxis stattgefunden hat, die aber aus heutiger Sicht erschütternd ist. Der LWV bedauert, dass vornehmlich in den 50er und 60er Jahren Kinder und Jugendliche in seinen Heimen alltäglicher physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt waren“ (Landeswohlfahrtsverband Hessen 2006).
Nach anfänglichem Zögern reagierten auch die kirchlichen Spitzenverbände. Der Bundesverband Evangelischer Einrichtungen und Dienste e. V. erklärte in einem Positionspapier:
„Das erlittene Unrecht der Opfer in der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre ist anzuerkennen, und das Leid ist nicht zu relativieren“ (EREV-Positionspapier 2008, S. 160).
Die Caritas und ihr Erziehungshilfe-Fachverband BVkE nahmen wie folgt Stellung:
„Was die Vergangenheit und ganz konkret die Vorwürfe aus der Zeit der 50er und 60er Jahre betrifft, können die heute Verantwortlichen nur mit aller Aufrichtigkeit bedauern, was Kindern und Jugendlichen an Leid und Schaden zugefügt worden ist“ (Breul 2009, S. 21).
Im Jahre 2004 gründeten Betroffene den „Verein ehemaliger Heimkinder“. Zielsetzungen des Vereins sind z. B.:
•Mitglieder bei der Suche nach Therapieplätzen und der Förderung von Selbsthilfegruppen zu unterstützen,
•die Anerkennung von Rentenanwartschaftszeiten für die Zeit der erzwungenen Arbeit ohne Lohn ehemaliger Heiminsassen zu erreichen,
•die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte der Heimerziehung der 50er, 60er und 70er Jahre (Der Verein ehemaliger Heimkinder e. V. 2008, S. 78).
Dieser Verein wandte sich, um Unterstützung für diese Zielsetzungen zu erhalten, an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Nach mehreren Anhörungen empfahl der Petitionsausschuss am 26. November 2008 dem Bundestag die Einrichtung eines „Runden Tisches“.
„Der Petitionsausschuss sieht und erkennt erlittenes Unrecht und Leid, das Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Kinder- und Erziehungsheimen in der alten Bundesrepublik in der Zeit zwischen 1945 und 1970 widerfahren ist und bedauert das zutiefst“ (Deutscher Bundestag – Petitionsausschuss – 2008, S. 12).
Dieser Runde Tisch solle vor allem die Heimerziehung unter den damals rechtlichen, pädagogischen und sozialen Bedingungen und deren negativen Folgen aufarbeiten, zugefügtes Unrecht prüfen sowie Lösungen entwickeln und aufzeigen (S. 13 f.). Der Runde Tisch „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“ konstituierte sich im Februar 2009 unter dem Vorsitz der ehemaligen Bundestagsvizepräsidentin Anke Vollmer.
Im Zwischenbericht des Runden Tisches wurde u. a. resümiert:
„Häufig waren Heime keine Schutzräume, sondern Orte, in denen körperliche und psychische Misshandlungen und in manchen Fällen offenbar auch sexuelle Gewalt möglich waren und nicht oder nur unzureichend unterbunden oder geahndet wurden. Es war möglich, dass sich in Heimen repressive und rigide Erziehung etablierte, die in geschlossenen Systemen jedes Maß verlor. Aufsichts- und Kontrollinstanzen, sowohl einrichtungs- und trägerintern als auch extern und staatlich, waren offenbar nicht in der Lage oder gewillt, diese Missstände – selbst wenn sie bekannt waren – abzustellen“ (Zwischenbericht des Runden Tisches 2010, S. 46).
Im Januar 2011 legte der Runde Tisch seinen Abschlussbericht vor. Darin wird anerkannt, „dass es in der Heimerziehung vielfaches Unrecht und Leid gab. Dabei wird deutlich, dass es in der Heimerziehung der frühen Bundesrepublik zu zahlreichen Rechtsverstößen gekommen ist, die auch nach damaliger Rechtslage und deren Auslegung nicht mit dem Gesetz und auch nicht mit pädagogischen Überzeugungen vereinbar waren. Elementare Grundsätze der Verfassung wie das Rechtsstaatsprinzip, die Unantastbarkeit der Menschenwürde und das Recht auf persönliche Freiheit und körperliche Integrität fanden bei weitem zu wenig Beachtung und Anwendung“ (Abschlussbericht des Runden Tisches 2010, S. 29).
Neben der Anerkennung des erlittenen Unrechts und der Bitte um Verzeihung, empfahl der Runde Tisch eine materielle Unterstützung, damit Betroffene traumatische Erfahrungen oder andere Folgeschäden der Heimerziehung mit fachlicher Hilfe aufarbeiten können sowie einen finanziellen Ausgleich, wenn im Einzelfall Rentenansprüche vermindert sind, weil während der Heimunterbringung eigentliche vorgesehene Sozialversicherungsbeiträge nicht gezahlt wurden. Der Deutsche Bundestag beschloss im Juli 2011 eine weitgehende Übernahme der Empfehlungen des Rundes Tisches. In der Folge gründeten der Bund, westdeutsche Länder sowie die Kirchen einen Fond, aus dem berechtigte Ansprüche von Betroffenen in Form von Sachleistungen gezahlt werden können. Im Jahr 2012 gründeten Bund sowie ostdeutsche Länder einen weiteren Fond „Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949–1990“. Ehemalige Heimkinder der früheren DDR können hier einen Ausgleich für nicht angerechnete Sozialversicherungszeiten beantragen.
„Die Vertreter der Heimkinder halten diese Regelungen jedoch für völlig unzureichend. Sie fordern Entschädigungen für alle früheren Heimkinder. Nach ihren Vorstellungen soll den Opfern eine Pauschalzahlung von 54.000 Euro oder eine Monatsrente von 300 Euro zustehen. Diese Forderung hatten Vollmer und die Vertreter von Bund, Ländern und Heimträgern aber als unrealistisch und unbezahlbar zurückgewiesen“ (IGFH 2011).
Auch bei der Beteiligung am Runden Tisch Heimerziehung bzw. bei der Umsetzung von Entschädigungszahlungen gibt es Kritik von Betroffenen. Sie äußerten sich, sich nicht ausreichend gehört gefühlt zu haben und Unverständnis über langwierige Prozesse bei der Beantragung von Entschädigungen (Struck 2011; Munsch et al. 2011).
In einer neueren Forschungsarbeit hat sich Sylvia Wagner mit weiterem Unrecht beschäftigt, das den Menschen, die in Heimen zwischen 1950 und 1975 in der Bundesrepublik Deutschland aufwuchsen, widerfahren ist. So hat sie in ihren Recherchen herausgefunden, dass es mindestens 50 Medikamentenversuche ohne Einwilligung von Betroffenen oder Sorgeberechtigen in den großen Institutionen gab, unter deren Auswirkungen Betroffene heute noch leiden (Wagner 2016).
Der Verein ehemaliger Heimkinder (2019) fordert entsprechend weitergehende Opferentschädigungen und Opfergleichstellung.
Reformen und ihre Auswirkungen
Nach und nach konnten die politisch und auch gesellschaftlich anerkannten Forderungen nach Reformen in der Praxis der Heimerziehung realisiert werden. Vor allem wurde dafür gesorgt, dass pädagogisch gut ausgebildetes Personal in den Heimen arbeitet und entsprechende Richtlinien der Heimaufsichtsbehörden wurden erlassen. Im Laufe der Jahre verringerte sich die Gruppengröße immer mehr, sodass heute durchschnittlich acht bis zehn Kinder/Jugendliche von vier pädagogischen Mitarbeiter*innen betreut werden. In Intensivwohngruppen kann der Betreuungsschlüssel teilweise noch besser sein, sodass fast auf jedes Kind oder Jugendlichen eine Betreuungskraft kommt. Diese aus pädagogischen Gründen zu begrüßende Strukturveränderung und Qualifizierung hatte allerdings ganz erhebliche Kostensteigerungen zur Folge. Ungefähr 70 bis 80 % der Heimkosten resultierten aus Personalkosten.
Nicht nur unter pädagogischen, sondern auch unter finanziellen Gesichtspunkten wurde und wird daher versucht, Heimerziehung zu vermeiden. In den letzten 40 Jahren wurden vorbeugende oder alternative Maßnahmen, die Schwierigkeiten bei Kindern in ihrer Entstehung verhindern oder ambulant abbauen können, verstärkt. Als solche ambulante oder teilstationäre Erziehungshilfen, die einem Kind den Heimaufenthalt unter Umständen ersparen können, wären zu nennen:
•Erziehungsberatung,
•Soziale Gruppenarbeit,
•Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer,
•Sozialpädagogische Familienhilfe,
•Erziehung in einer Tagesgruppe.
Diese Hilfen stehen im Kinder- und Jugendhilfegesetz auch explizit in den Paragraphen 27 ff. SGB VIII.
Der außerdem zu Beginn der 1970er-Jahre gewaltige Ausbau des Pflegekinderwesens hat Heimerziehung in sehr vielen Fällen ersetzen können. Aus pädagogischen Gründen werden vor allem Kleinstkinder und Kinder im Vorschulalter nur noch selten in einem Heim untergebracht und Pflegefamilien vorgezogen.
Die begrüßenswerte Tatsache, dass in vielen Fällen die vorbeugenden und alternativen Maßnahmen erfolgreich waren und ein Heimaufenthalt nicht mehr notwendig wurde, hat aus der Sicht der Heimerziehung zu einer gewaltigen Erschwerung der täglichen Praxis geführt; denn in den Heimen verblieben vor allem die Kinder und Jugendlichen, die nicht in Pflegestellen vermittelt werden konnte und erst mit massiven Problemen und nach längerer Zeit ungünstiger Bedingungen in familiären Strukturen aufgenommen wurden.
Bisweilen konnten regelrechte Kampagnen beobachtet werden; Heimerziehung wurde verteufelt, die Jugendämter beschuldigt, weil sie pädagogisch verantwortungslos viel zu wenige Heimkinder in Pflegefamilien vermittelt hätten. Zwar melden sich viel mehr Bewerber*innen bei den Jugendämtern als Pflegeverhältnisse vereinbart werden, hierbei gilt es jedoch, die Erfahrung der Pflegevermittlungen in den Jugendämtern zu beachten. Von 100 Anfragen nach Pflegekindern bleiben durchschnittlich nur zwei bis drei Eltern übrig, denen ein Pflegekind verantwortungsvoll vermittelt werden kann. Bei den anderen waren die Anfrage und die zugrundeliegende Motivation oft nur von kurzer Dauer – bisweilen aus spontanen sentimentalen Anlässen heraus geschehen – in anderen Fällen war die Motivation der Pflegeelternbewerber*innen oder deren häusliche Situation völlig ungeeignet, um dem Wohl von Pflegekindern zu entsprechen.
Erfahrungsgemäß ist es auch äußerst schwierig, Kinder, die älter als sechs Jahre alt sind, in Pflegefamilien zu vermitteln, weil diese in der Regel jüngere bevorzugen. Noch schwieriger wird diese Situation, wenn es sich um Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten handelt. Es ist auch richtig, dass es mehr Adoptivbewerber*innen als adoptivfähige Kinder gibt; doch bei vielen Heimkindern sind die rechtlichen Voraussetzungen zur Adoption nicht gegeben, und viele sind wiederum zu alt, um dem Wunschalter von zukünftigen Adoptiveltern zu entsprechen.
Zwar hat vor allem das Pflegekinderwesen zu einem stetigen Abbau der Heimkinderzahlen beigetragen, es ist aber zu berücksichtigen, dass dieser Abbau aus den vorgenannten Gründen begrenzt bleiben wird, und es muss auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass nicht wenige Kinder und Jugendliche nach gescheiterten Pflegeverhältnissen (wieder) ins Heim kommen. Im Jahre 2016 wurden 2.214 Minderjährige aus Heimen und Wohngruppen in Pflegefamilien vermittelt. Im gleichen Zeitraum kamen allerdings auch 2.263 Kinder und Jugendliche aus Pflegefamilien in Heimerziehung (Statistisches Bundesamt 2018 b). Im Jahr 2016 führte die hohe Anzahl von geflüchteten Menschen, die nach Deutschland eingereist sind, zu einem massiven Anstieg der stationären Hilfen zur Erziehung, insbesondere in den Heimgruppen. So stieg hier die Zahl im Jahr 2016 im Vergleich zu 2014 um fast 50 % an (Statistisches Bundesamt 2017).
Unbestreitbar sind unter dem stärker gewordenen Kostendruck der öffentlichen Haushalte auch fiskalische Gesichtspunkte für den Versuch einer weiteren Vermeidung von Heimerziehung verantwortlich.
Allerdings lohnen sich die Gelder, die für den stationären Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Erziehungshilfe investiert werden auch aus volkswirtschaftlicher Sicht. Eine Evaluationsstudie, in der die Hilfeverläufe von 471 jungen Menschen in acht Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe evaluiert wurden, kommt zu dem Ergebnis, dass durch Heimerziehung erhebliche volkswirtschaftliche Nutzeffekte zu erzielen sind: „Die Kosten-Nutzen-Relation ist in hohem Maße von der Hilfedauer abhängig:
1.Hilfen unter einem Jahr erreichen einen kritischen Wert von 1:0,74. 1 Euro steht nur 74 Cent Nutzeneffekte gegenüber.
2.Heimerziehung mit einer Dauer zwischen einem und zwei Jahren erreicht hingegen eine Nutzen-Kosten-Relation von 1:3,35.
3.Hilfen über zwei Jahren erreichen trotz linear mit der Hilfedauer steigenden Kosten sogar eine Nutzen-Kosten-Relation von 1:3,85“ (Macsenaere/Keller, Arnold 2011, S. 154).
Quantitative Entwicklung der Heimerziehung seit 1991
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im Jahre 1970 in den alten Bundesländern 88.810 Minderjährige in Heimen der Jugendhilfe untergebracht. 10.126, dies sind 11,4 % der betroffenen Kinder und Jugendlichen, lebten dort im Rahmen der Fürsorgeerziehung, also in der Regel unfreiwillig, überwiegend in sogenannten Erziehungsheimen und auch in geschlossener Heimerziehung. Die Zahlen haben sich zunächst verringert. So waren im Jahre 1982 noch 52.699 Kinder und Jugendliche in Heimerziehung, davon 2,9 % in Fürsorgeerziehung. Gegen Ende des Jahres 1993 lebten – bezogen auf die alten Bundesländer – 57.538 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Heimen, Wohngruppen oder in sonstigen betreuten Wohnformen. In den neuen Bundesländern waren es zum gleichen Zeitpunkt 18.639 (Statistisches Bundesamt 1994).
Trotz des stetigen Ausbaus der unterschiedlichen ambulanten Erziehungshilfen hat sich über Jahrzehnte hinweg die Inanspruchnahme von Heimerziehung als sehr stabil erwiesen (Bundesministerium für Familie 2013, S. 342). Durch die hohe Anzahl geflüchteter junger Menschen ist die Zahl zusätzlich nochmals deutlich angestiegen.
Damit ist der prozentuale Anteil der jungen Menschen in Heimerziehung im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung im Alter von 0 bis 20 Jahren von 0,37 % in 1991 auf 0,59 % in 2016 angestiegen.
Prozentanteil zur Bevölkerung im Alter von 0–20 Jahre
(Statistisches Bundesamt 2010a/2014/2018/2019)
Im Jahr 2005 hatte für insgesamt 25.307 junge Menschen die Hilfe zur Erziehung in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform (wieder) neu begonnen und war im Jahr 2012 bereits um 42 % auf 36.048 junge Menschen angestiegen. Im Jahr 2016 gab es einen erneuten Anstieg um 30 % auf 95.582 Kinder und Jugendliche in stationärer Erziehungshilfe. Dieser Anstieg ist wohl primär mit dem Schutzauftrag der Jugendhilfe zur Prävention und Abwehr von Kindeswohlgefährdung zu erklären. Auch die geflüchteten Kinder und Jugendlichen bedürfen der Unterstützung durch die Jugendhilfe. Die absolute Zahl der in Heimen oder sonstigen Wohnformen lebenden Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen war dagegen im Vergleichszeitraum relativ gleich. Betrug im Jahr 2005 die durchschnittliche Aufenthaltsdauer noch 27 Monate, waren es im Jahr 2012 nur noch 20 Monate und im Jahr 2016 sogar nur noch 17 Monate (Statistisches Bundesamt 2014, 2018b). Unterschiedliche Evaluationsstudien zeigten auf, dass Hilfen zur Erziehung im Durchschnitt erst ab dem zweiten Jahr der Hilfe nachweisbare Erfolge aufweisen, die im dritten Jahr noch weiter ansteigen. Dem würde die oftmals vorgefundene Praxis widersprechen, aus Kostengründen von Beginn an festzulegen, Erziehungshilfen schon nach kürzerer Zeit zu beenden (Macsenaere/Herrmann 2004, S. 39). Die Realität bietet gegenwärtig folgendes Bild: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer war bei den im Jahre 2016 aus der Heimerziehung Entlassenen mit 17 Monaten deutlich kürzer als die für erforderlich gehaltene Mindestdauer von zwei Jahren. Rechnet man die 23 % Kinder und Jugendlichen heraus, welche nur bis zu drei Monaten im Heim verblieben (vermutlich zur Klärung ihrer Lebenssituation und/oder zur Überbrückung einer akuten Notlage), so wurden weitere 35 % bereits nach einer Aufenthaltsdauer von drei bis zwölf Monaten und insgesamt 47 % nach einer Dauer von bis zu eineinhalb Jahren entlassen. Als Gründe lassen sich jedoch keineswegs nur fiskalische Überlegungen der Kostenträger anführen. Denn in 32 % aller Fälle wurde die Hilfe abweichend vom Hilfeplan bzw. den Beratungszielen vorzeitig abgebrochen, davon zu 51 % auf Veranlassung der Sorgeberechtigten und/oder den jungen Volljährigen und zu 24 % durch Minderjährige (Statistisches Bundesamt 2018b). Rumpf (2009, S. 28) beklagt, „dass die betroffenen Personensorgeberechtigten nur halbherzig die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Hilfemaßnahme mittragen und sie wie auch das der Hilfe bedürftige Kind das Prinzip der Freiwilligkeit überbewerten. Es ist wohl nicht immer gelungen, ihnen zu vermitteln, dass die gleichberechtigte Beteiligung am Kommunikationsprozess über geeignete Hilfen nicht bedeutet, gemeinsam geplante Ziele kurzfristig eigenmächtig zu verändern.“
54 % der jungen Menschen erhielten nach ihrer Entlassung aus der Heimerziehung weitere Hilfe(n) zur Erziehung bzw. Eingliederungshilfe, 5 % wurden durch den Allgemeinen Sozialdienst des Jugendamtes oder weitere Beratungsstellen unterstützt, in 41 % wurden allerdings keine weiteren Hilfen mehr gewährt (Statistisches Bundesamt 2018b).
Quantitative Veränderungen/Träger der Einrichtungen
Die Struktur der Trägerschaft der Heime und sonstigen betreuten Wohnformen bietet folgendes Bild: Von den insgesamt 36.754 Institutionen der stationären Erziehungshilfe sind 77,5 % in freier Trägerschaft und 22,5 % in öffentlicher Trägerschaft. Bei den freien Trägern sind die beiden konfessionellen Verbände, das Diakonische Werk (22 %) und der Caritasverband (15 %), besonders stark vertreten, nämlich mit 37 % aller freien Träger. Es folgen Institutionen des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes mit 17 % und der Arbeiterwohlfahrt mit 5 %. Etwa 6 % der Einrichtungen werden von Wirtschaftsunternehmen vorgehalten, 20 % von sonstigen juristischen Personen und anderen Vereinigungen. Die restlichen 15 % verteilen sich auf verschiedene Träger wie z. B. das Deutsche Rote Kreuz, die Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und andere religiöse Gemeinschaften des öffentlichen Rechts (Statistisches Bundesamt 2018a).
Am 31. Dezember 2016 waren insgesamt 93.551 pädagogisch/therapeutische Fachkräfte in Einrichtungen der Heimerziehung und in sonstigen betreuten Wohnformen incl. Internaten, die nach §34 KJHG aufnehmen, tätig. Den Hauptanteil der Mitarbeiter*innen nehmen mit 40 % Erzieher*innen ein. Danach kommen mit 24 % Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen (Diplom Fachhochschule oder Bachelorabschluss, beides mit staatlicher Anerkennung). Die Berufsgruppe der Pädagog*innen und Erziehungswissenschaftler*innen hat einen Anteil von 7 %. Annähernd 1 % sind Heilpädagog*innen. Kinderpfleger*innen findet man nur noch mit einem Anteil von weniger als 1 %. Heilerzieher*innen und Psycholog*innen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen sind jeweils zu etwa 3 % vertreten. Darüber hinaus finden sich verschiedene Berufsgruppen wie z. B. Familienpfleger*innen, Lehrer*innen, aber auch Krankenpfleger*innen (Statistisches Bundesamt 2018a).
Resümee
Die Geschichte der Heimerziehung ist durch sehr viel Leid, Missachtung und durch das Fehlen einer Befriedigung elementarster Grundbedürfnisse wie liebevolle Zuneigung, Geborgenheit, Anerkennung und Lob gekennzeichnet. Unzulängliche Rahmenbedingungen und der Mangel oder das Außerachtlassen pädagogisch begründeter Vorgehensweisen innerhalb der Praxis haben zu einer Abseitsstellung und einem Negativimage der Heimerziehung geführt. Wie wir gesehen haben, hat sich das Praxisfeld Heimerziehung innerhalb der letzten 70 Jahre sehr stark verändert. Die Einrichtungen wurden von Anstalten mit Aufbewahrungscharakter zu differenzierten pädagogischen Institutionen mit qualitativ gut ausgebildeten pädagogischen Mitarbeiter*innen. Diese verbesserte pädagogische Ausgangslage wird in der Gesellschaft aber weiterhin zu wenig gesehen und anerkannt. Heimerziehung gilt oftmals immer noch als letztes (pädagogisches) Mittel.
Der Ende der 1960er-Jahre während der Heimkampagne laut gewordene Ruf: „Holt die Kinder aus den Heimen!“ ist aus heutiger Sicht, wenn man die Forderungen auf alle Kinder und Jugendlichen bezieht, pädagogisch weder notwendig noch verantwortbar, vor allem aber in der Praxis nicht realisierbar. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn wir die Indikationsstellung, d. h. die Problemlagen der Kinder und Jugendlichen, die auf Heimerziehung angewiesen sind, näher analysieren. Die heutige Heimerziehung hat die notwendigen Reformen weitgehend realisiert. Die sehr differenzierten Institutionen der stationären Erziehungshilfe bieten ein großes Spektrum von Leistungsangeboten für junge Menschen mit schwierigen Ausgangs- und Lebenslagen und für deren Familien. Die breite Öffentlichkeit hat diese Reformen zumeist nicht erkannt, zu oft wird Heimerziehung noch mit einer unfreiwilligen Fürsorgeerziehung gleichgesetzt, die aber weder im Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII) noch in der Praxis existent ist. Auch aktuell ist die Heimerziehung noch immer eine der häufigsten Formen von Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen.
Indikationen für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
Aus welchen Familien kommen Heimkinder?
Aus welchen Gründen kommen heute Kinder und Jugendliche in Heime und sonstige Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe? Wir wissen aus der Geschichte der Heimerziehung, dass es sich früher fast ausschließlich um elternlose oder um ausgesetzte Kinder handelte. Dies ist aber, nachdem zunächst noch zahlreiche Kriegswaisen nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges beheimatet werden mussten, längst nicht mehr der Fall. Waisenkinder sind in der gegenwärtigen Heimerziehung eine seltene Ausnahme.
Kinder und Jugendliche leben heute in Heimen oder in sonstigen betreuten Wohnformen (Außenwohngruppen, Wohngruppen, Betreutes Wohnen), wenn sie aus sehr unterschiedlichen Gründen in ihrer Herkunftsfamilie vorübergehend oder auf längere Sicht nicht leben können, wollen oder dürfen. Es handelt sich in der Regel um junge Menschen, die aus schwierigen oder aus schwierigsten Verhältnissen stammen. Sie bringen bei der Aufnahme ihre eigene individuelle Lebensgeschichte mit, die manchmal schon auf den ersten Blick sehr erschütternd sein kann. Bisweilen werden traumatische Lebenserfahrungen, langandauernde Frustrationen und Erziehungssowie Erfahrungsdefizite jedoch erst im Laufe des Heimlebens erkennbar.
Die Kinder stammen in der Regel aus unterprivilegierten Bevölkerungsschichten, der Ausbildungsgrad und der berufliche Status ihrer Eltern sind überwiegend gering. Kinder mit einem Stiefelternteil sind besonders häufig. Alkoholoder andere Suchtprobleme spielen in vielen der Familien eine Rolle und zeigen in der Regel negative Auswirkungen auf die dort lebenden Kinder.
Sogenannte Scheidungskinder oder auch Scheidungswaisen sind in der Heimerziehung überrepräsentiert. Kinder und Jugendliche aus gescheiterten Pflegeverhältnissen kommen in den vergangenen Jahren immer häufiger in stationäre Institutionen der Jugendhilfe, insbesondere mit Beginn der Pubertät,




























