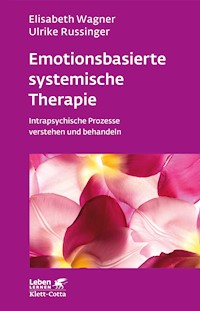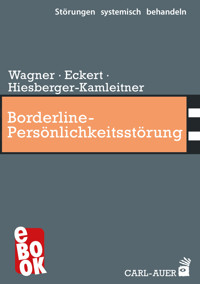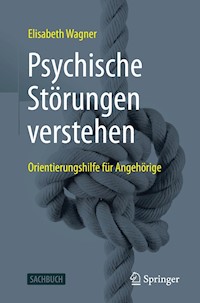34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Leben Lernen
- Sprache: Deutsch
Was unterscheidet die Systemische Therapie von anderen anerkannten psychotherapeutischen Verfahren wie Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse? Mit welcher Haltung, welchen Interventionen und Techniken nähert sie sich den PatientInnen? Anschaulich und mit vielen Beispielen aus der Praxis zeigt die Autorin, worauf es bei der Anwendung in klinischen Kontexten ankommt. Mit der nun endlich auch in Deutschland vollzogenen Anerkennung der Systemischen Therapie als abrechenbares psychotherapeutisches Verfahren stellen sich in der klinischen Praxis viele Fragen: - Wie gehen systemische TherapeutInnen mit der Diagnosestellung um? - Wie lassen sich typisch systemische Herangehensweisen wie die Einbeziehung der Lebensumwelt eines Klienten oder Ziel- und Ressourcenorientierung im klinischen Kontext umsetzen? - Wie verstehen SystemikerInnen innerpsychische Prozesse? Das Buch widmet sich diesen grundsätzlichen Fragen in anschaulicher Weise und stellt in einem zweiten Teil die wichtigsten Interventionen vor, vom »systemischen Fragen« bis hin zu narrativen, visualisierenden und hypnosystemischen Techniken. Auch hier wird das therapeutische Vorgehen anhand von Fallvignetten aus der Praxis erläutert. Die Autorin zeigt, wie Systemische Therapie wirkt und wie sie konkret angewandt wird. Dieses Buch richtet sich an: - Diplom-PsychologInnen - ÄrztInnen - PsychiaterInnen, die die Approbation zum »Systemischen Therapeuten« erwerben wollen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Elisabeth Wagner
Praxisbuch Systemische Therapie
Vom Fallverständnis zum wirksamen psychotherapeutischen Handeln in klinischen Kontexten
Klett-Cotta
Zu diesem Buch
Mit der nun auch in Deutschland vollzogenen Anerkennung der Systemischen Therapie als abrechenbares psychotherapeutisches Verfahren stellen sich für die klinische Praxis viele Fragen, z. B.:
Wie lassen sich typisch systemische Herangehensweisen wie z. B. Ziel- und Ressourcenorientierung im klinischen Kontext umsetzen?
Wie verstehen SystemikerInnen psychische Prozesse und wie gehen sie mit Diagnosestellungen um?
Das Buch widmet sich diesen grundsätzlichen Fragen in anschaulicher Weise und stellt in einem zweiten Teil die wichtigsten Interventionen vor, vom »systemischen Fragen« bis hin zu narrativen, visualisierenden und hypnosystemischen Techniken. Auch hier wird das Vorgehen anhand zahlreicher Fallvignetten erläutert.
Die Reihe »Leben Lernen« stellt auf wissenschaftlicher Grundlage Ansätze und Erfahrungen moderner Psychotherapien und Beratungsformen vor; sie wendet sich an die Fachleute aus den helfenden Berufen, an psychologisch Interessierte und an alle nach Lösung ihrer Probleme Suchenden.
Alle Bücher aus der Reihe ›Leben Lernen‹ finden Sie unter:
www.klett-cotta.de/lebenlernen
Impressum
Leben Lernen 313
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Jutta Herden, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von © istock/xefstock
Gesetzt aus der Documenta von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Printausgabe: ISBN 978-3-608-89259-8
E-Book: ISBN 978-3-608-11610-6
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20452-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhalt
Einführung: Warum ein Praxisbuch Systemische Therapie?
Kapitel 1
Wie lernt man Psychotherapie?
Kapitel 2
Ist Psychotherapie Krankenbehandlung?
2.1 Die Klassifikation psychischer Störungen
Kapitel 3
Wie wirkt Psychotherapie? Welchen Stellenwert haben die theoretischen Grundannahmen einer Psychotherapieschule?
3.1 Unspezifische und allgemeine Wirkfaktoren
Kapitel 4
Was macht Systemische Therapie aus?
4.1 Erkenntniskritische Haltung und Multiperspektivität
4.2 Fokus Veränderung – Zukunft – Ressourcen – Lösungen und Veränderungsoptimismus: »Sie können sich jederzeit ändern, aber Sie sind nicht dazu verpflichtet«
4.3 Selbstorganisation und Wechselwirkungsrealität
4.4 Skepsis gegenüber kausalen Erklärungen
Kapitel 5
Welche Konzeptualisierung des Mentalen passt zu Systemischer Therapie?
5.1 Eine systemtheoretische Konzeptualisierung psychischer Prozesse
5.2 Die hypnosystemische Konzeptualisierung psychischer Prozesse
5.3 Die synergetische Perspektive
5.4 »Persönlichkeit« unter neurobiologischer Perspektive
5.5 Die Konzeptualisierung des Unbewussten
Kapitel 6
Wie erklären sich Systemische TherapeutInnen die Entstehung psychischer Störungen?
6.1 Krankheit ohne Grund
6.2 »Belastungsabhängige psychische Störungen«
6.3 Die Bedeutung früher Erfahrungen
6.3.1 Bindungstheorie
6.3.2 Entwicklungspsychologische Überlegungen
6.3.3 Wie lässt sich die Auswirkung früher Erfahrungen systemtheoretisch konzeptualisieren?
6.4 Traumatisierung
6.5 Der gesellschaftliche Kontext psychischer Störungen
Kapitel 7
Das Wirkverständnis Systemischer Therapie bei klinisch relevanten psychischen Störungen
Kapitel 8
Systemische Konzepte in der stationären Psychiatrie
Kapitel 9
Systemische Therapie im Kontext psychiatrischer Störungen – Diagnostische Kompetenz und Auftragsorientierung – das Erstgespräch
Kapitel 10
Prozesssteuerung zwischen ärztlicher und therapeutischer Identität (5 Fallvignetten)
10.1 Psychotherapie ohne Medikation
10.2 Initiale psychiatrische Behandlung mit nachfolgender Einzeltherapie
10.3 Fortführung einer etablierten psychopharmakologischen Behandlung in Kombination mit Einzel- und Paartherapie
10.4 Fachärztliche Diagnostik und kombinierte Einzel- und Familientherapie
10.5 Stützende psychopharmakologisch-psychotherapeutische Behandlung einer Borderline-Patientin
Kapitel 11
»Systemisches Gesprächsverhalten« in klinischen Kontexten: Ressourcenorientierung
Kapitel 12
»Systemisches Gesprächsverhalten«: Fragen als Intervention
12.1 Zirkuläre Fragen zur Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktion
12.2 Lineale Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion
12.2.1 Fragen nach Ressourcen und Ausnahmen
12.2.2 Fragen zum Überweisungskontext und zur Auftragsklärung
12.2.3 Fragen zur interaktionellen und biografischen Problemkontextualisierung
12.2.4 Fragen zur Klärung von Affekten, Bedürfnissen und Motivationen
12.2.5 Fragen zur Erfassung dysfunktionaler psychischer Verarbeitung
12.3 Fragen zur Möglichkeitskonstruktion
12.3.1 Zielorientierte Fragen, Wunderfrage
12.3.2 Verschlimmerungsfragen, Fragen zur Nicht-Veränderung
12.3.3 Fragen zum Nutzen des Problems, Als-ob-Fragen
12.3.4 Hypothetische Fragen
12.3.5 Fragen zur Dekonstruktion problemaufrechterhaltender Überzeugungen
12.4 Reflexive Fragen zur therapeutischen Beziehung
12.5 Abschließende Überlegungen
Kapitel 13
Visualisierende Verfahren
13.1 Genogramm
13.2 Familienbrett
13.3 Zeitstrahl
13.4 Idiografische Systemmodellierung
Kapitel 14
Aufgaben und Rituale
14.1 Beobachtungsaufgaben
14.2 Vorhersageaufgaben
14.3 Reflexionsaufgaben
14.4 Verhaltensaufgaben
14.5 Rituale
14.6 Abschließende Überlegungen
Kapitel 15
Narrative Techniken, Externalisierung
15.1 Re-Authoring
15.2 Externalisierung
15.3 Briefe, Urkunden und Deklarationen
Kapitel 16
Teilearbeit
Kapitel 17
Einsatz von Bodenankern
Kapitel 18
Hypnosystemische Perspektive
18.1 Hypnosystemische Teilearbeit und positive Externalisierung
18.2 Hypnosystemische Zielarbeit – Induktion des Zielerlebens
18.3 Problemlösungsgymnastik
18.4 Geleitete Imaginationen und Nutzung von Trancephänomenen
18.5 Hypnosystemische Nutzung von Metaphern und Utilisieren
Kapitel 19
Emotionsbasierte systemische Interventionen
19.1 Förderung der Emotionswahrnehmung
19.2 Affektklärung
19.3 Förderung der Emotionsregulation
19.4 Emotionen transformieren
Kapitel 20
Fallverständnis
20.1 Der Stellenwert störungsspezifischen Vorgehens
20.2 Das typische diagnostische Selbstverständnis Systemischer Therapie
20.3 Erweiterungen des »Diagnostizierens« in der Systemischen Therapie
20.4 Dimensionen der Fallkonzeption
Kapitel 21
Wirkverständnis und Prozesssteuerung
21.1 Settingentscheidungen
21.2 Inhaltlicher Fokus und »Problemformatierung«
21.3 Einsatz spezifischer Interventionen
Kapitel 22
Die therapeutische Beziehung
22.1 Die therapeutische Beziehung zwischen Verstörung und Empathie
22.2 Warum die Systemische Therapie auf die Begriffe Übertragung und Gegenübertragung verzichtet
22.3 Warum die Systemische Therapie auf die Konzeptualisierung von Widerstand verzichtet
22.4 Ein systemischer Umgang mit Schwierigkeiten in der therapeutischen Beziehung
22.5 Der Umgang mit »verleugneten« problematischen Erlebnis- und Verhaltensweisen
Kapitel 23
Abschließende Überlegungen und Dank
Literatur
Einführung: Warum ein Praxisbuch Systemische Therapie?
Systemische Konzepte haben sich in den letzten Jahrzehnten sowohl in therapeutischen wie auch in beraterischen Kontexten rasant verbreitet. Wo immer Menschen mit Menschen umgehen – von der Erziehungsberatung über die Jugendhilfe bis zur Organisationsentwicklung –, können sich systemische Ausbildungen über höchste Wachstumsraten erfreuen. Dass die Systemische Therapie in Deutschland erst 2008 als Richtlinienverfahren anerkannt wurde und erst im November 2018 die sozialrechtliche Anerkennung erlangte, tat der Attraktivität systemischer Weiterbildungen keinen Abbruch. Viele BeraterInnen und TherapeutInnen erkannten den Nutzen der systemischen Prinzipien von Ziel-, Ressourcen- und Auftragsorientierung. Das Denken in Wechselwirkungen, der Einbezug des sozialen Bezugssystems und ein breites Interventionsspektrum taten ein Übriges, um systemische Weiterbildungen für viele Professionen unverzichtbar zu machen.
Im Vergleich zu dieser dominanten Stellung im Bereich der Beratung konnten sich systemische Konzepte in Deutschland in der Psychiatrie bislang kaum durchsetzen. Nur wenige prominente VertreterInnen der Systemischen Therapie sind im psychiatrischen Kontext tätig. Vergleichsweise wenige FachärztInnen für Psychiatrie und psychologische PsychotherapeutInnen haben in Deutschland eine systemische Qualifikation. Dies könnte sich durch die nun erreichte sozialrechtliche Anerkennung der Systemischen Therapie ändern.
In Österreich erfolgte im Unterschied dazu die wissenschaftliche und sozialrechtliche Anerkennung der Systemischen Therapie bereits in den frühen Neunzigerjahren bald nach Inkrafttreten des Psychotherapiegesetzes. Systemische Therapieausbildungen mussten daher in Österreich von Anfang an zur Behandlung psychischer Störungen befähigen. Die Systemische Therapie ist zwar nur eine von 21 anerkannten Psychotherapiemethoden, ist jedoch unter den AbsolventInnen deutlich überrepräsentiert. Unter den aktuell in Ausbildung befindlichen PsychotherapeutInnen ist die Systemische Therapie sogar die am meisten nachgefragte Methode: Fast 15 % aller AusbildungskandidatInnen Österreichs befinden sich in einer systemischen Ausbildung, gefolgt von knapp 14% in personzentrierter Therapie und knapp 11 % in Verhaltenstherapie. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Systemische TherapeutInnen in Österreich seit Langem in diversen Gesundheitseinrichtungen tätig sind und auch in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung einen wesentlichen Beitrag leisten.
Als Lehrtherapeutin für Systemische Familientherapie bin ich in zwei Ausbildungskontexten tätig: Neben der Lehranstalt für Systemische Familientherapie in Wien, in der alle entsprechend dem österreichischen Psychotherapiegesetz zugelassenen Berufsgruppen, v. a. PsychologInnen, PädagogInnen und SozialarbeiterInnen, ihre Psychotherapieausbildung absolvieren können, leite ich seit 2008 auch systemische Lehrgänge im Rahmen der Akademie für Psychotherapeutische Medizin, in der ausschließlich ÄrztInnen psychosomatisch und psychotherapeutisch weitergebildet werden. Diese Kurse werden überwiegend von AssistenzärztInnen und FachärztInnen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie absolviert, sodass in den letzten zehn Jahren ca. 40 % aller in Wien tätigen AssistenzärztInnen für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin ihre psychotherapeutische Ausbildung in einem systemischen Curriculum absolvierten. Zumindest für Wien, in geringerem Ausmaß gilt das für ganz Österreich, ist damit systemisches Denken in der Psychiatrie mittelfristig gut verankert. Allerdings schien es mir speziell in diesem Ausbildungskontext nötig, bestimmte Positionen der Systemischen Therapie zu relativieren, um sie für klinische Kontexte anschlussfähig zu machen. Wenn im Rahmen des Gesundheitssystems krankheitswertige Störungen behandelt und abgerechnet werden – egal ob von ÄrztInnen, Klinischen PsychologInnen oder anderen PsychotherapeutInnen –, sind eine radikale Infragestellung des Krankheitsbegriffes, eine strikte Auftragsorientierung und eine enge Auslegung der Position des Nicht-Wissens (vgl. Goolishian et al. 1988), wie sie in vielen systemischen Lehrbüchern vertreten werden, wenig hilfreich.
Das Ziel meiner Ausbildungstätigkeit besteht darin, ein Verständnis von Systemischer Therapie zu vermitteln, das für die Nachbardisziplinen Psychiatrie und Klinische Psychologie anschlussfähig ist. Statt radikalem Konstruktivismus geht es mir um die Vermittlung einer »angemessen erkenntniskritischen Haltung«, statt radikalem Verzicht auf Konzepte, die psychische Prozesse erklären, versuche ich eine Konzeptualisierung derselben unter synergetischer Perspektive. Als wesentliches Kriterium für professionelles psychotherapeutisches Handeln betrachte ich die Fähigkeit, die psychischen und die sozialen Aspekte, die zur Aufrechterhaltung von Problemzuständen führen, angemessen erfassen und beschreiben und auf der Basis dieses »Fallverständnisses« das konkrete therapeutische Tun erklären zu können. Neben den interventionellen Kompetenzen ist dieses »professionelle Denken«, die Anwendung theoretischen psychotherapeutischen Wissens auf den konkreten Einzelfall, das wichtigste Ziel jeder systemischen Therapieausbildung.
Die Grundlagen dieses »professionellen Denkens« sollen durch das vorliegende Buch vermittelt werden: Die zentralen Prinzipien systemischen Denkens und Handelns werden zunächst theoretisch erklärt und dann fallbezogen erläutert. Das konkrete therapeutische Vorgehen wird anhand von Fallvignetten nachvollziehbar dargestellt. Zielgruppe sind alle Systemischen TherapeutInnen, die im Rahmen des Gesundheitswesens mit behandlungsbedürftigen psychischen Störungen konfrontiert sind.
Auch wenn der Fokus des »Praxisbuches Systemische Therapie« die Behandlung psychischer Störungen ist, bleibt das Verhältnis von Systemischer Therapie und Krankenbehandlung grundsätzlich reflexionsbedürftig: In den drei einführenden Kapiteln werden daher einige grundlegende Überlegungen zu Psychotherapie und psychotherapeutischer Medizin angestellt werden: Wie lernt man Psychotherapie? Ist Psychotherapie Krankenbehandlung? Wie wirkt Psychotherapie?
Darauf folgt eine ausführliche Darstellung dessen, was Systemische Therapie ausmacht. Aufgrund der hohen Binnendifferenzierung aller Therapiemethoden sind solche Festlegungen immer problematisch und nie ganz zutreffend – dennoch sollten sie »gewagt« werden, um gedanklich auf den Interventionsteil einzustimmen. Damit eine interventionsreiche Therapiemethode wie die Systemische Therapie nicht zur trivialisierenden Anwendung verführt, sollte das professionelle Denken – die Anwendung theoretischer Konzepte auf den konkreten Fall – gefördert werden. In den Kapiteln 5 und 6 wird daher ein weiterer Bogen gespannt: Welche Konzeptualisierung des Mentalen passt zur Systemischen Therapie und wie erklären sich Systemische TherapeutInnen psychische Störungen?
Auf der Basis dieser Überlegungen werden dann das Wirkverständnis Systemischer Therapie im psychiatrischen Kontext sowie systemische Konzepte in der stationären Psychiatrie überblicksmäßig dargestellt, bevor wir uns im Kapitel 9 einem zentralen Spannungsfeld zuwenden: Die im medizinischen Kontext selbstverständliche Expertenhaltung steht in einem deutlichen Gegensatz zu der für Systemische Therapie typischen Auftragsorientierung. Daher wird die für klinische Kontexte adäquate Auslegung von Auftragsorientierung und Expertenschaft zunächst ausführlich reflektiert, bevor in fünf Fallverlaufsdarstellungen die Prozesssteuerung zwischen ärztlicher und therapeutischer Identität konkret dargestellt wird.
In den nachfolgenden neun Kapiteln wird das typisch systemische Vorgehen praxisnah dargestellt: Es geht zunächst um die Realisierung der Ressourcenorientierung, die bei besonders ressourcenarmen Personen, die uns in klinischen Kontexten häufig begegnen, nicht so einfach zu realisieren ist. Besonders ausführlich wird die Hauptintervention der Systemischen Therapie, das Fragen, erläutert. Weitere Kapitel widmen sich den visualisierenden Verfahren, Aufgaben und Ritualen, narrativen Techniken, der Teilearbeit, der Nutzung von Bodenankern, hypnosystemischen und emotionsbasierten Interventionen. All diese Vorgehensweisen werden in ihren Grundzügen erklärt, bevor die Anwendung mit konkreten Fallvignetten dargestellt wird. Dies soll dazu beitragen, nicht nur die »Bauanleitung« der Interventionen, sondern auch das konkrete Wirkverständnis besser erfassen zu können. Die Angemessenheit einer Intervention, oder weiter gefasst, des konkreten TherapeutInnenverhaltens lässt sich nur beurteilen, wenn wir uns über den Zweck im Klaren sind. Was will ich mit meinem konkreten therapeutischen Handeln bewirken, was ist die therapeutische Absicht, inwiefern ist das konkrete Vorgehen geeignet, dies zu bewirken?
Wie der Untertitel des Buches nahelegt, muss das Wirkverständnis psychotherapeutischer Interventionen am konkreten Fallverständnis anschließen. Welche Merkmale des Falles gilt es zu berücksichtigen, um im Sinne des Patienten/der Patientin wirksam zu werden? In den letzten Kapiteln des Buches wird daher auf Fallverständnis, Wirkverständnis und die therapeutische Beziehung noch einmal ausführlich eingegangen.
Durch die fallorientierte Darstellung systemischer Praxis bei der Behandlung psychiatrischer Störungen soll die Integration systemischen Denkens in klinische Kontexte, vor allem ins psychiatrische Versorgungssystem gefördert werden. Dafür können die Erfahrungen, die bei der systemischen Ausbildung von fast 100 (Kinder- und Jugend-)PsychiaterInnen in den letzten Jahren gesammelt wurden, hilfreich sein.
Jedenfalls fließt hier auch eine persönliche Erfahrung ein: Als ich in den Neunzigerjahren zusätzlich zur Facharztausbildung an der Universitätsklinik für Psychiatrie in Wien meine Ausbildung in Systemischer Familientherapie in einem Ausbildungsinstitut nach dem Psychotherapiegesetz absolvierte, erlebte ich ein starkes Spannungsfeld: In der Abteilung für Biologische Psychiatrie lernte ich von erfahrenen PsychiaterInnen, wie psychiatrisch Erkrankte zu diagnostizieren und zu behandeln sind. Ich bewunderte ihre psychopharmakologischen Kenntnisse und die Unaufgeregtheit, mit der sie heikelste klinische Situationen managten. Obwohl viele dieser Oberärzte einer Generation geisteswissenschaftlich gebildeter Psychiater mit differenzierten psychopathologischen Kenntnissen angehörten, setzte sich in dieser Zeit durch die Pseudoobjektivierung von ICD-10 und DSM-IV-R zunehmend ein naiver Realismus durch. Eine erkenntniskritische Haltung gegenüber diagnostischen Klassifikationssystemen, die bei Jaspers noch selbstverständlich formuliert wurde, war nicht mehr Teil des offiziellen Fachdiskurses, sondern wurde nur mehr als Liebhaberei von einzelnen kritischen Geistern kultiviert.
Auf der anderen Seite erlebte ich in meiner systemischen Ausbildungseinrichtung erfahrene LehrtherapeutInnen, deren therapeutische Fähigkeiten ich hinter dem Einwegspiegel kennen und schätzen lernte, allesamt aber überzeugte Konstruktivisten, die psychologische Konzeptualisierungen und psychiatrische Krankheitsbegriffe ablehnten, als wären sie für die Behandlung völlig irrelevant, ja sogar störend, weil vom subjektiven Selbstverständnis des Betroffenen ablenkend. Naiver Realismus auf der einen Seite, Konstruktivismus mit dogmatischer Ablehnung jeglichen klinischen Expertenwissens auf der anderen Seite führten dazu, dass ich mich in beiden Welten fachlich ein bisschen fremd fühlte. In der Psychiatrie fehlte mir die erkenntniskritische Position, in der Systemischen Therapie diagnostische und klinische Kompetenz. Es dauerte viele Jahre, bis die Psychiaterin und die Systemische Therapeutin in mir eine integrierte professionelle Identität gebildet haben.
Diesen langwierigen Integrationsprozess möchte ich jungen KollegInnen erleichtern, was auch durch die Entwicklung der Systemischen Therapie in den letzten fünfzehn Jahren nahegelegt wird: Die radikalkonstruktivistische empirie- und diagnosekritische Haltung ist auch bei den bekannten deutschsprachigen VertreterInnen Systemischer Therapie nicht mehr unwidersprochen. Einen wesentlichen Beitrag dazu lieferte Kirsten von Sydow, die gemeinsam mit Beher, Retzlaff und Schweitzer jene Expertise zur Wirksamkeit der Systemischen Therapie verfasste, die 2008 zur Anerkennung als wissenschaftlich fundiertes Verfahren durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie in Deutschland führte. In dem von ihr herausgegebenen Lehrbuch (von Sydow 2015), das stark an empirischer Forschung orientiert ist, bekennt sie sich trotz positivistischer Grundhaltung zu einem »gemäßigten Konstruktivismus« (von Sydow 2015, S. 28 f.) und kritisiert die »konzeptuelle Vernachlässigung innerpsychischer Variablen« in der systemischen Literatur. Ihre Forderung nach einer stärkeren Berücksichtigung affektiver Prozesse und verinnerlichter Beziehungs- und Bindungsmuster in der systemischen Fachliteratur stimme ich vollinhaltlich zu.
Daher wurden in dem Buch »Emotionsbasierte Systemische Therapie. Intrapsychische Prozesse verstehen und behandeln« (Wagner/Russinger 2016) psychologische Konzepte vorgestellt, die für ein differenziertes Fall- und Wirkverständnis hilfreich sind – und dies ohne unzulässige Trivialisierungen und Ontologisierungen. Psychische Vorgänge werden hier konsequent als Prozesse verstanden, als selbstorganisierte Muster in komplexen dynamischen Systemen. Wie der Titel vermuten lässt, fokussierten wir dabei die affektive Seite des Erlebens, die bislang in der systemischen Fachliteratur kaum explizit thematisiert worden ist. Das Buch sollte das Verständnis für Prozesse der Emotionsverarbeitung und Störungen derselben vermitteln und bietet darüber hinaus eine systematische Darstellung von Interventionen, die Affektwahrnehmung, -klärung und -bearbeitung fördern.
Auch Hans Lieb, der prominenteste Vertreter störungsspezifischer Systemtherapie, kritisiert das Dogma der Dekonstruktion psychischer Störungen, das in manchen systemischen Ausbildungseinrichtungen gültig scheint. Er fordert dazu auf, dass SystemikerInnen störungsbezogene Perspektiven einnehmen, ohne ihre systemische Identität zu verlieren, was vor allem heißt, dass der Störungsbegriff nicht ontologisierend verwendet, sondern die der Unterscheidung krank/gesund zugrunde liegende Beobachtungsleistung berücksichtigt wird (Lieb 2014, S. 11 f.). Ich hoffe, mit diesem Buch auch diesem Anspruch zu genügen, selbst wenn die systemtheoretische Fundierung meiner Ausführungen mehr auf der Synergetik als der soziologischen Systemtheorie Luhmanns beruht.
Wie lassen sich typisch systemische Herangehensweisen wie z. B. Ziel- und Ressourcenorientierung im klinischen Kontext umsetzen?
Wie verstehen SystemikerInnen psychische Prozesse und wie gehen sie mit Diagnosestellungen um?
Kapitel 1
Wie lernt man Psychotherapie?
Eine erste grobe Differenzierung von Lernprozessen betrifft die Unterscheidung von Wissen und Können. Wissensinhalte wie Latein-Vokabeln, chemische Formeln, die Anatomie des Menschen oder philosophische Theorien erwirbt man anders als Kompetenzen wie Radfahren, Schwimmen oder Klavierspiel. Im einen Fall realisiert sich der Aneignungsprozess im Wesentlichen über das explizite Denken und Erinnern, im anderen Fall im Wesentlichen über das wiederholte Tun (Üben).
Für die Psychotherapie halte ich es allerdings für sinnvoll, vier Dimensionen zu unterscheiden: Neben dem theoretischen Wissen und den interventionellen Kompetenzen (»professionell handeln«) ist die Fähigkeit, Fachwissen fallbezogen adäquat anzuwenden (»fachlich denken«), zentral bedeutsam. Diese drei Dimensionen sind in vielen Professionen zu unterscheiden. In der Psychotherapie gibt es jedoch eine weitere Anforderung, nämlich die Fähigkeit, verlässlich – also unabhängig von evtl. dysfunktionalen Beziehungsmustern der KlientInnen – eine hilfreiche professionelle Beziehung anzubieten. Die Förderung dieser Beziehungskompetenz ist damit eine weitere Zieldimension jeder Psychotherapieausbildung. Auf jede dieser Dimensionen soll im Folgenden kurz eingegangen werden.
Das theoretische Wissen umfasst Konzepte zur »Gegenstandsmodellierung« sowie die Wirkprinzipien des therapeutischen Vorgehens (»Wirkverständnis«). Beide Begriffe sollen kurz erklärt werden:
Was versteht man unter »Gegenstandsmodellierung« oder »Konzeptualisierung psychosozialer Prozesse«: Die Seele können wir nicht sehen. Die Funktionsweise der Psyche kann man sich ganz unterschiedlich erklären: Ist sie durch Triebkonflikte geprägt, wie Freud es annahm, oder durch das Streben nach Selbstentfaltung, wie es die humanistischen Therapiemethoden beschreiben? Welche Rolle spielt das Unbewusste? Welche Rolle spielen frühkindliche Erfahrungen? Die verschiedenen Therapiemethoden entwerfen ganz unterschiedliche Bilder vom Mentalen, ihre theoretischen Grundannahmen »modellieren den Gegenstand« und legen damit auch fest, was als wirksames therapeutisches Tun betrachtet werden kann (»Wirkverständnis«). Hält man unbewusste seelische Konflikte für die Ursache psychischer Störungen, kann ein kognitiv-behaviorales Vorgehen, das vorwiegend die bewussten Kognitionen modifiziert, nur für ein oberflächliches Manöver gehalten werden. Stellt man die kausale Bedeutung unbewusster seelischer Konflikte infrage, erscheint die jahrelange hochfrequente Psychoanalyse als eine unnötig aufwendige Suche nach selbst versteckten Ostereiern.
Die theoretischen Grundlagen einer Therapiemethode vermitteln somit ein jeweils spezifisches Verständnis psychosozialer Prozesse und ihrer Beeinflussbarkeit im Kontext von Psychotherapie. Die Darstellung dieser »Wirkprinzipien« wird den Hauptteil dieses Buches ausmachen. Im Unterschied zu anderen Lehrbüchern soll dies aber konsequent fallbezogen erfolgen. Die theoretischen Konzepte sollen damit nicht nur beschrieben, sondern auch »exemplifiziert« werden, um das fachliche Denken zu fördern.
Unter »fachlich denken« verstehe ich die Anwendung von theoretischem Wissen auf einen konkreten Fall. Fachlich denken kann man dementsprechend nur fallbezogen lernen. Die adäquate Unterrichtsform ist die Supervision: Hier wird anhand konkreter Fallanliegen fachliches Denken entwickelt. Häufig ist in diesem Kontext aufgrund der Zahl und der Dringlichkeit der Supervisionsanliegen der Fokus allerdings eingeengt auf die Frage »Wie mache ich am besten weiter?«, sodass eine umfassende Reflexion des Fallverständnisses ausbleibt. In diesen Fällen wird fachliches Denken wieder nur implizit gelernt. Dieses Buch soll dazu beitragen, fachliches Denken zu fördern, indem Fall- und Wirkverständnis Systemischer Therapie anhand von ausgewählten Fallvignetten dargestellt wird. Anders als in der Supervision geht es nicht darum, mittels fachlichen Denkens in einem gegebenen Fall bestmöglich handlungsfähig zu werden, sondern darum, die der Systemischen Therapie zugrunde liegenden Konzepte anhand von Fallbeispielen nachvollziehbar verständlich zu machen.
Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen und der Förderung der Fähigkeit, dieses auf Basis einer sensiblen Wahrnehmung fallbezogen adäquat anzuwenden, geht es bei einer Psychotherapieausbildung immer auch um die Entwicklung von Handlungskompetenz. Psychotherapeutische Interventionen müssen »getan« werden, es genügt nicht, sie theoretisch beschreiben zu können. Verglichen mit dem Erlernen einer neuen Sprache geht es hier um den »Sprechakt« bzw. die Handlung. Das »Gewusste« muss nicht nur fallbezogen genutzt, sondern auch in konkretes therapeutisches Tun umgesetzt werden. Dieser Kompetenzerwerb bedarf interaktiver Unterrichtssequenzen: Eine konkrete Intervention wird erklärt, demonstriert, in Kleingruppen geübt. Im Rollenspiel oder noch besser anhand eigener »kleiner« Themen erfahren die Teilnehmenden die Wirkung der Intervention an sich selbst und können sich »im geschützten Terrain« in der Therapeutenrolle erproben.
Unter »Beziehungskompetenz« wird die Fähigkeit verstanden, auch bei dysfunktionalen (»pathologischen«) Beziehungsangeboten von KlientInnen verlässlich eine konstruktive, hilfreiche Beziehung anbieten zu können. Die Verantwortung für die Qualität der therapeutischen Beziehung liegt bei der Therapeutin. Manche KlientInnen machen es uns leicht, indem sie uns von Anfang an vertrauen, Kompetenz zuschreiben und die Kooperation für den Veränderungsprozess nützen. Aber das ist keine Bedingung, die zu Behandlungsbeginn eingefordert werden kann. Professionelle Beziehungskompetenz ist vor allem dann gefragt, wenn KlientInnen von dieser Idealnorm abweichen, was sie öfter tun, als uns lieb ist. Die daraus resultierenden Schwierigkeiten werden typischerweise in der Supervision und evtl. in der Eigentherapie thematisiert. In diesem Buch wird sich ein eigenes Kapitel mit den Anforderungen an »Beziehungskompetenz« aus systemischer Perspektive beschäftigen, darüber hinaus wird in vielen Fallvignetten ein professioneller Umgang mit typischen Beziehungsschwierigkeiten dargestellt.
Nach nunmehr bald zwanzigjähriger Ausbildungstätigkeit sehe ich die größte Herausforderung im Rahmen einer Psychotherapieausbildung darin, in differenzierter Art »fachliches Denken« zu fördern. Theorievermittlung ist relativ einfach – Theorien kann man referieren, vorbereitende oder vertiefende Leseaufgaben und Reflexionsrunden sichern das Verständnis ab. Auch die Vermittlung von Handlungskompetenz wirft didaktisch keine großen Fragen auf (auch wenn sie nicht immer gleich gut gelingt). Schwieriger ist es, explizit »angemessenes fachliches Denken« zu lehren. Dazu soll dieses Buch einen Beitrag leisten.
Zuvor müssen aber einige grundsätzliche Gedanken zum Wesen (Systemischer) Psychotherapie formuliert werden.
Kapitel 2
Ist Psychotherapie Krankenbehandlung?
Psychotherapie ist keine Krankenbehandlung. PsychotherapeutInnen muss man das in der Regel nicht erklären. PsychiaterInnen häufig schon, da sich ÄrztInnen traditionell für Krankheiten zuständig fühlen. In Zusammenhang mit Krankheiten und ihrer Behandlung verfügen sie über ein empirisch abgesichertes Expertenwissen. Aus medizinkritischer Perspektive kann die Überlegenheit ärztlichen Expertenwissens infrage gestellt werden, im Selbstverständnis von ÄrztInnen und der überwiegenden Mehrzahl ihrer PatientInnen ist die Zuschreibung einer Expertenrolle aber konstitutiv.
Das beste Beispiel dafür ist der Unfallchirurg. Meine damals 13-jährige Tochter stürzte mit dem Fahrrad und konnte ihren rechten Arm nicht mehr heben. Der Assistenzart veranlasst ein CT und beruhigt – er sieht nichts. Alle atmen auf. Der Oberarzt schaut sich die Bilder noch einmal an, äußert einen Verdacht, veranlasst eine weitere Bildgebung, diesmal in einer anderen Achse, und zeigt uns die Fraktur. Ungünstige Stelle, muss sofort operiert werden, sonst droht eine dauerhafte Bewegungseinschränkung. Der Expertise des Arztes wird getraut – was hätte man seinen Erklärungen entgegenzuhalten?
Nicht überall in der Medizin ist die Expertenschaft des Arztes so unumstritten, nicht immer sind die Befunde so eindeutig. Der Unfallchirurg markiert das eine Ende des Spektrums: unstrittige Expertenschaft, er weiß, was zu tun ist, kann das dem Patienten anhand eindeutiger Befunde erklären. Das Privileg des Unfallchirurgen: Er kann sehr häufig nicht nur eine eindeutige Diagnose liefern, sondern auch eine kurative Prozedur anbieten. Er operiert, der Patient muss es nur zulassen. Zumindest in der Akutsituation reduziert sich die Compliance auf die Einverständniserklärung – »lassen Sie mich nur machen«.
Natürlich ist dieser Idealfall nicht immer gegeben. Es gibt auch in der Unfallchirurgie unklare Befunde (Experten einigen sich nicht über das zugrunde liegende Problem) oder widersprüchliche Ansichten über die geeignete Behandlung (Experten einigen sich nicht über die bestmögliche Lösung), und natürlich bedarf es in der postoperativen Phase der Kooperation des Betroffenen: Schonung, gezieltes Training, alles zur richtigen Zeit und im richtigen Ausmaß. Aber auch dazu können die ExpertInnen eindeutige Empfehlungen geben. Das heißt: medizinisches Fachwissen bezieht sich auf die Diagnose und Behandlung von Krankheiten. Die Expertenrolle des Arztes verpflichtet zur Patientenaufklärung (diese Prozedur ist, wie jeder weiß, der sich schon einmal einer einfachen chirurgischen Intervention unterzogen hat, formal über eine schriftliche Einverständniserklärung abgesichert), begründet die durchzuführende Behandlung und legitimiert darüber hinausgehende Beratung (z. B. betr. Ernährung, Bewegung, Gewichtsreduktion) bzw. Schulung des Patienten.
Wie stellt sich die Situation nun bei psychischen Störungen dar?
Wenn wir an eine typische paranoide Schizophrenie, eine bipolare Störung, eine schwere Zwangsstörung oder Anorexie denken: auf den ersten Blick ganz ähnlich. Auch hier verfügt die Medizin – in diesem Fall die Psychiatrie – über gesichertes Expertenwissen und kann adäquate Behandlung anbieten. Die Krankheitsbilder sind gut definiert und lassen sich vom Zustand des Gesunden sicher unterscheiden. Ein klassisch ärztliches Selbstverständnis ist zulässig und sinnvoll, sofern der Patient bereit ist, diese Expertenrolle dem Arzt zuzuschreiben und sich der psychiatrischen Definition seines Erlebens anzuschließen. Aus »Ich bin so unglücklich und weiß nicht warum« wird dann im besten Fall eine behandelbare depressive Episode, aus »Stimmen befehlen mir, dass ich mich umbringe, weil ich für alles Unglück in der Welt verantwortlich bin« eine psychotische Episode, die psychopharmakologisch gut zu behandeln ist.
Aber wie groß ist der Anteil dieser eindeutig definierbaren und nach einem medizinischen Rational gut zu behandelnden Patientengruppe? Allen Frances, der 1994 den Vorsitz der Arbeitsgruppe für die Revision des DSM-IV innehatte und sich in den letzten Jahren zum prominentesten Kritiker des DSM-5 entwickelt hat, gibt folgende Einschätzung ab: »Wir können Patientinnen und Patienten, die an schweren psychischen Störungen leiden und etwa 5 % der Bevölkerung ausmachen, präzise diagnostizieren, und wir wissen auch ziemlich gut, wie sie zu behandeln sind. An den Grenzen zur ›Normalität‹ haben wir dagegen eine enorme Unschärfe. Gerade diese Grenzbereiche umfassen allerdings eine sehr große Anzahl von Menschen …« (Frances 2017, S. 104) Wenn man von einer 10-Jahres-Prävalenz von 30 % psychischer Störungen ausgeht, ist das knapp ein Viertel der Bevölkerung. Und mehr noch als für die schwerst psychisch Kranken ist für diese große Zahl an Menschen an der »Grenze zur Normalität« Psychotherapie oder psychotherapeutische Medizin indiziert. Die Frage ist daher, welche Art von Diagnostik und Behandlungsverständnis (jenseits der Krankenbehandlung) hier angemessen ist und wie sich hier psychotherapeutische Professionalität oder Expertenwissen realisiert.
Das Wissen und die Kompetenzen, die im Rahmen der Facharztausbildung für Psychiatrie im Krankenhaus erworben werden, sind für diese große Population meist jedenfalls nicht ausreichend, da nur ein kleiner Anteil aller Personen mit einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung je stationär aufgenommen wird. Solange die Facharztausbildung Psychiatrie vorwiegend in stationären Einrichtungen absolviert wird, müssen wir davon ausgehen, dass viele AssistenzärztInnen ihr gesamtes Störungs- und Behandlungsverständnis an einem sehr kleinen, nämlich dem schwerst kranken, Segment der Population sammeln, während sie den Großteil der v. a. psychotherapeutisch zu Behandelnden nicht oder kaum kennenlernen.
Im Rahmen ihrer Facharztausbildung sammeln AssistenzärztInnen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin zweifellos unzählige Erfahrungen im Umgang mit mittel- bis schwer erkrankten PatientInnen aller Diagnosegruppen. Aufnahme- und Entlassungsmanagement, Zuweisungen, Visiten und Patientenaufklärung füllen aufgrund kürzer werdender Verweildauern den Arbeitstag des Facharztes zunehmend aus, sodass zeitaufwändigere Prozeduren wie ausführliche biografische Anamnesen, das Erfragen des subjektiven Krankheitsverständnisses oder psychotherapeutische Gespräche erschwert werden. Diese »Engführung« psychiatrischer Behandlung verhindert oftmals, dass unter den gegebenen Bedingungen psychiatrische Erfahrung mit Kompetenzerwerb im Bereich der psychotherapeutischen Medizin einhergeht und kann in manchen Fällen regelrecht zu einer »deformation professionelle« führen, die das Individuum mit seinen jeweils subjektiven Wünschen, Zielen und Ängsten hinter der ICD-Diagnose und dem psychopharmakologischen Behandlungsbedarf vergessen lässt.
Die Ausbildung in psychotherapeutischer Medizin ist damit ein wesentlicher Beitrag dazu, dass die heute ausgebildeten PsychiaterInnen auch die große Gruppe von Menschen »an den Grenzen zur Normalität« adäquat behandeln können. Voraussetzung dafür sind aber psychotherapeutische Konzepte, die für die Psychiatrie anschlussfähig sind.
Die für die frühe Systemische Therapie typische vehemente Ablehnung des psychiatrischen Krankheitsbegriffes ist vor diesem Hintergrund keine glückliche Lösung. Für PsychiaterInnen würde es bedeuten, in zwei unvereinbaren Fachwelten leben bzw. arbeiten zu müssen, aber auch für nicht ärztliche PsychotherapeutInnen erschwert es die Kooperation mit dem klinischen Kontext. Wenn Systemische TherapeutInnen psychische Störungen ausschließlich als soziale Konstrukte, nicht als Krankheiten verstehen, sind sie für andere klinische Disziplinen nicht anschlussfähig. Nicht zuletzt durch die Anerkennung der Systemischen Therapie als Richtlinienverfahren kam es allerdings in den letzten 10 Jahren zu einer Annäherung an das Gesundheitssystem. Statt vehementer Ablehnung wird nun vermehrt die pragmatische Nutzung des Störungsbegriffes empfohlen, der berühmte Carl Auer Verlag hat sich gar zur Herausgabe einer Reihe zur »Störungsspezifischen systemischen Therapie« entschieden.
Kehren wir zur ersten Aussage zurück: Wenn Psychotherapie keine Krankenbehandlung im herkömmlichen Sinn ist – was ist sie dann? Eine gängige Definition von Psychotherapie (vgl. Strotzka 1982) beschreibt diese als bewussten und geplanten interaktionellen Prozess zur Verbesserung von psychosozialen Leidenszuständen oder Verhaltensstörungen auf der Basis einer definierten Theorie normalen und pathologischen Erlebens und Verhaltens. Im Unterschied zur Medizin, deren Gegenstand zwar komplexe, aber im Wesentlichen objektivierbare und messbare biologische, chemische Vorgänge darstellen, geht es in der Psychotherapie ganz wesentlich um subjektive Sinnzusammenhänge. Halten wir fest: Der »Gegenstand«, auf den sich Psychotherapie bezieht, ist nicht »Krankheit« wie in der Medizin, sondern der subjektiv leidende Mensch. Dieses subjektive Leid kann die Form einer »Krankheit« annehmen (wenn Lisa z. B. in dem Gefühl, nicht attraktiv genug zu sein, anorektisch wird), muss es aber nicht. Wenn Lisa freudlos und hadernd weiter isst, aber ihren Körper nicht akzeptiert und deshalb nicht mit Freunden schwimmen geht und jegliche sexuelle Annäherung aus Scham, sich nackt zeigen zu müssen, verweigert, ist dieses »Nicht-Bewältigen einer Entwicklungsaufgabe« eine ebenso zulässige Indikation für Psychotherapie.
Nicht die objektivierbare Krankheit, sondern das subjektive Leid ist damit der »Gegenstand« von Psychotherapie.
Wer diese Subjektivität als zu behebendes Defizit betrachtet, hat Psychotherapie oder psychotherapeutische Medizin grundlegend missverstanden. Die Auseinandersetzung mit subjektiven Sinnzusammenhängen und Bedeutungskonstruktionen, mit individuellen Erlebnisweisen und Motivationsdynamiken ist für die therapeutische Praxis konstitutiv. Professionalität besteht daher nicht primär darin, ein eigengesetzlich ablaufendes Krankheitsgeschehen zu erfassen, sondern die Person in ihrer Auseinandersetzung mit ihrem Gewordensein, ihren Ängsten, Schwierigkeiten, Sehnsüchten und Zielen zu unterstützen. Allerdings – bei Vorliegen einer im engeren Sinne psychiatrischen Störung – beinhaltet professionelles Handeln natürlich auch die Berücksichtigung derselben. Nicht ärztliche PsychotherapeutInnen müssen zu einem Facharzt für Psychiatrie überweisen, PsychiaterInnen müssen gegebenenfalls pharmakologische und psychotherapeutische Maßnahmen kombinieren.
Im Kontext von Psychotherapie und Psychotherapeutischer Medizin braucht es häufig spezialisiertes »Störungswissen« (z. B. in Form von psychiatrischem Fachwissen), in jedem Fall braucht es aber eine angemessene Konzeptualisierung psychischer Prozesse sowie ein ausreichendes »Steuerungswissen«. Mit welcher therapeutischen Haltung, mit welchen Interventionen kann ich in welcher Praxissituation hilfreich agieren? Dazu gehören neben dem konkreten interventionellen Wissen (der Kenntnis einzelner Interventionen und ihrer sinnvollen Anwendung) auch »Metakompetenzen« wie die Wahrnehmung von Veränderungsmotivation (Wie schnell und wie grundlegend kann und will sich ein Klientensystem verändern?), Fähigkeiten zur differenzierten Beziehungsgestaltung (Wie viel Zustimmung und Bestärkung braucht ein Klient, wie viel Anregung oder Verstörung verträgt er?) und vieles mehr.
2.1 Die Klassifikation psychischer Störungen
Die Klassifikation psychischer Störungen, wie sie von den modernen Diagnoseschemata vorgegeben werden, ist hingegen für psychotherapeutische Behandlungsprozesse nur bedingt hilfreich. Im Gegensatz zu weiten Bereichen der medizinischen Wissenschaft, die vorwiegend von ätiopathogenetischen Denkansätzen geleitet ist, beruht die Klassifikation psychischer Störungen weitgehend auf einer deskriptiven Beschreibung. Das heißt, die psychiatrischen Störungen werden anhand der beschreibbaren Symptome zu Syndromen geordnet und klassifiziert. Durch die Selbstbescheidung auf die beobachtbare Symptomebene und den Verzicht auf ätiologische Annahmen, die in der Diagnose enthalten sind (z. B. endogene versus neurotische Depression), wurde selbstverständlich die Reliabilität psychiatrischer Diagnosen verbessert. Es ist, als würde man die Tierwelt nach Größe und Farbe und Zahl der Beine etc. ordnen – hinsichtlich dieser Kriterien wird eine reliable Beschreibung kein Problem sein. Die damit verbundene Hoffnung war aber eine andere: »Das DSM-III sollte damit einen vergleichbaren Rang einnehmen wie das Ordnungssystem von Carl Linné, der das Pflanzen- und Tierreich beschrieben und akkurat kategorisiert hat, was zu Darwins Evolutionstheorie führte, oder wie das von Mendelejew entwickelte Periodensystem der Elemente. Die Fachleute erhofften sich, dass eine klare Beschreibung eine schlüssige Erklärung ermöglichen würde.« (Frances 2017)
Frances lässt keinen Zweifel daran, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt hat: »Wir sollten das DSM-System oder das ICD-10-System als provisorisches heuristisches Instrument verstehen, wonach die aufgelisteten Störungen KlinikerInnen, die eine Bewertung vornehmen, Hilfestellung geben. Sie helfen bei der Prognose und bieten Leitlinien für die Behandlung. Aber sie beschreiben mit Sicherheit keine homogenen Krankheiten, die eine eindeutige Ursache haben, und sie werden am Ende auch mit Sicherheit nicht zu den einfachen Behandlungen führen, wie wir sie heute durchführen.«
Bei der Klassifikation von Krankheiten ist ein wesentlicher Unterschied zu den Klassifikationssystemen in den Naturwissenschaften zu beachten: Es werden keine Dinge der materiellen Welt geordnet, sodass keine Ordnung abgebildet werden kann, die die Natur hervorgebracht hat. Psychische Störungen sind modifizierbare Konstrukte, jedes Klassifikationssystem das vorläufige Ergebnis eines Expertenabstimmungsprozesses, was immer dann besonders deutlich wird, wenn die Diagnosekriterien bei der Neuauflage der Manuale verändert werden: Durch die willkürliche Festlegung der Zahl der notwendigen Kriterien kann die Grenze zwischen gesund und krank massiv verschoben werden.
Kritik an der deskriptiven Diagnostik ist weit verbreitet: Von neurowissenschaftlicher Seite wird argumentiert, dass eine rein syndromorientierte Klassifikation zwangsläufig zu einer fehlerhaften Nosologie psychischer Krankheiten führt, da sie verschiedene Ursachen, die in ähnlichen Syndromen resultieren, gleich klassifiziere. Dementsprechend fordert auch das National Institute of Mental Health (NIMH) mit seiner Research Domain Criteria Initiative (RDoC), »die Klassifikation psychischer Störungen dem in der Medizin dominierenden kausalen Krankheitsbegriff stärker anzupassen und die zugrunde liegenden neurobiologischen Eigenschaften zu berücksichtigen. Nicht die Ähnlichkeit in den offensichtlichen oberflächlichen Eigenschaften (hier: den Symptomen einer Krankheit) sei entscheidend für eine Nosologie, sondern die Gleichheit oder Ähnlichkeit der zugrunde liegenden kausalen Mechanismen, die zu den offensichtlichen Eigenschaften führen.« (Walter und Müller 2015) Auch in anderen Bereichen der Medizin – so wird argumentiert – bestimmt nicht das Symptom (z. B. Fieber oder Ausschlag) die Diagnose, sondern der zugrunde liegende pathophysiologische Mechanismus.
Während das rein symptombasierte DSM- und ICD-System agnostisch bezüglich der Pathogenese psychischer Erkrankungen ist, hat die RDoC-Initiative das erklärte Ziel, biologisches Wissen über Risikofaktoren und Ursachen psychischer Krankheiten zu systematisieren. Die RDoC-Initiative wurde nicht als praktisch verwendbares, alternatives Diagnosemanual zum DSM-5 oder zum ICD-10/11 entwickelt, sondern soll der multidisziplinären Erforschung psychischer Störungen und der Entwicklung neuer, auf spezifischen Krankheitsmechanismen basierenden sowie individualisierten Therapiestrategien dienen (vgl. Walter 2017).
Viele psychiatrische Experten kritisieren den RDoC-Ansatz aufgrund begrifflicher Verwirrungen und seiner reduktionistischen Sicht auf das Mentale: So habe er keine konzeptuelle Validität, sei nicht in der Lage, aus sich heraus valide Krankheitsschwellen zu bestimmen, verwechsele Risikofaktoren für psychische Krankheiten mit den Krankheiten selbst und vernachlässige den Kontext psychischer Störungen sowie die Rolle von Bedeutung und Bewusstsein (zitiert nach Walter & Müller 2015). Diese Fokussierung auf die zugrunde liegenden neurobiologischen Mechanismen psychischer Störungen lässt auch keinen unmittelbaren Nutzen für die psychotherapeutische Behandlungsplanung erwarten.
Interessanter ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung »transdiagnostischer« Behandlungsansätze in der Psychotherapie. Dieser Trend wird derzeit vor allem in der Verhaltenstherapie im Rahmen der Dritte-Welle-Ansätze aufgegriffen und stellt wohl eine Gegenbewegung zu der in den letzten Jahrzehnten auf die Spitze getriebenen Störungsorientierung dar. Grundlage dieser Entwicklung ist die Einsicht, dass verschiedenen psychischen Störungen ähnliche dysfunktionale psychische Prozesse zugrunde liegen können. Für die psychotherapeutische Behandlung liegt es daher nahe, auf diesen Phänomenbereich und nicht auf die Symptomebene »scharf zu stellen«. Behandelt wird dann nicht die Depression oder die Angststörung, sondern z. B. die Vermeidung unangenehmer Affekte, die übermäßige oder mangelnde Emotionsregulation, dysfunktionale Überzeugungen oder Verhaltensmuster. Diese Vorgehensweise deckt sich mit meinen Überlegungen, die im Kapitel Fallverständnis und emotionsbasierte Techniken weiter ausgeführt werden.
Die Nutzung der aktuellen Klassifikationssysteme psychischer Störungen ist nicht grundsätzlich problematisch, wenn wir uns ihrer Limitierungen bewusst sind. Wir müssen im Auge behalten, dass es komplexe biopsychosoziale Phänomene sind, die wir klassifizieren, dass es sich um jeweils vorläufige Ordnungen handelt, um modifizierbare Konstrukte, die jeweils das Ergebnis eines Expertenabstimmungsprozesses darstellen. Und wir müssen uns damit abfinden, dass die Störungsdiagnose nicht zwingend erhellend oder gar handlungsleitend für das Fallverständnis ist.
Psychologische bzw. psychopathologische Kompetenz realisiert sich im Kontext psychotherapeutischer Behandlungen als die Fähigkeit, problematische Muster psychischer Selbstorganisation differenziert zu erfassen und in ihrer Relevanz für die aktuellen Störungen einzuschätzen. Darauf bereiten weder eine typische systemische Therapieausbildung noch eine Facharztausbildung in Psychiatrie optimal vor. Durch die zunehmende Ausrichtung auf die moderne psychiatrische Diagnostik basiert das Störungsverständnis junger PsychiaterInnen, aber auch vieler klinischer PsychologInnen immer mehr auf »Symptomchecklisten«, eine differenzierte psychopathologische Beschreibung wird oft nicht mehr geleistet. Diese Pseudoobjektivierung psychischer Störungen ist auch mit einer reduzierten Aufmerksamkeit für psychische Verarbeitungsprozesse verbunden, es werden Symptome aufgezählt, statt sich für die spezifische Funktionsweise der Psyche im Austausch mit der äußeren Welt zu interessieren. Hier gilt es gegenzusteuern.
Kapitel 3
Wie wirkt Psychotherapie? Welchen Stellenwert haben die theoretischen Grundannahmen einer Psychotherapieschule?
Kehren wir zur Definition von Psychotherapie zurück und wenden wir uns nun dem letzten Satzteil zu: Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter interaktioneller Prozess zur Verbesserung von psychosozialen Leidenszuständen oder Verhaltensstörungen auf der Basis einer definierten Theorie normalen und pathologischen Erlebens und Verhaltens. Diese »definierte Theorie normalen und pathologischen Verhaltens« ist eine genuine Leistung jeder Therapiemethode. Nur wenn eine konsistente Theorie normalen und pathologischen Verhaltens und Erlebens entwickelt und die Wirkprinzipien plausibel erklärt werden sowie die Wirksamkeit der Methode empirisch nachgewiesen werden kann, erfolgt die Anerkennung als Psychotherapiemethode.
Da psychische Prozesse unterschiedlich konzeptualisiert werden können und verschiedene Konzeptualisierungen (z. B. eine psychodynamische, kognitiv-behaviorale, humanistische oder systemische Perspektive) wirkungsvolles therapeutisches Handeln ermöglichen, ist offensichtlich, dass es nicht eine »einzig richtige« Erklärung psychischer Phänomene gibt. Jede der genannten psychotherapeutischen Theorien bietet einen Verstehenszusammenhang, eine »Interpretationsfolie« für psychische Phänomene und ermöglicht damit konsistentes therapeutisches Handeln, das zu nachweisbaren Erfolgen führt. Dass Methoden, die auf unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Konzeptualisierungen beruhen, dennoch annähernd gleich wirksam sind, ist natürlich irritierend. Was wirkt dann in der Psychotherapie, wenn es nicht die auf den spezifischen Wirkannahmen beruhenden Wirkprinzipien sind (z. B. Deutung von Übertragung und Widerstand, sokratischer Dialog etc.)? Im Wesentlichen sind zwei Antworten möglich: Zum einen gibt es unspezifische Wirkfaktoren, die von allen Therapiemethoden gleichermaßen erfüllt werden (z. B. Aufbau einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung etc.), zum anderen »allgemeine Wirkfaktoren«, die von unterschiedlichen Therapiemethoden in unterschiedlicher Weise realisiert werden, aber damit zu vergleichbaren »Netto-Effekten« führen. Da diese Überlegungen für ein differenziertes Verständnis der Wirkung von Psychotherapie hoch relevant sind, soll darauf später noch ausführlicher eingegangen werden.
Die einer Psychotherapiemethode zugrunde liegende Theorie vermittelt ein Verständnis für normale und pathologische psychosoziale Prozesse und für deren absichtsvolle Beeinflussung durch konkretes Therapeutenverhalten (Wirkverständnis). Ein kognitiver Verhaltenstherapeut erklärt sich die Probleme eines Patienten nicht nur anders als ein Psychoanalytiker oder ein humanistischer Therapeut, er verhält sich demzufolge auch in der Therapie anders. Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie lange Sie eine Therapiesequenz beobachten müssten, bis Sie erkennen, um welche Therapiemethode es sich handelt? Nach einer Minute, nach drei Minuten, nach zehn Minuten? Manchmal ist es leicht – wenn der Patient auf einer Couch liegt, handelt es sich wohl um Psychoanalyse, wenn eine Familie zirkulär befragt wird, ist es wohl Familientherapie. Aber wie sicher und wie schnell können Sie einen tiefenpsychologisch und einen systemischen Therapeuten unterscheiden, wenn Sie beide eine Einzeltherapie im Sitzen durchführen?
In diesem Zusammenhang sind zwei Entwicklungen zu bedenken: zum einen die Integration methodenfremder Vorgehensweisen und damit die Abschwächung schulenspezifischer Merkmale, wie sie bei erfahrenen PsychotherapeutInnen zu beobachten ist. Es ist ein häufig replizierter Befund, dass sich erfahrene PsychotherapeutInnen verschiedener Schulen weniger unterscheiden als BerufsanfängerInnen. Neben diesen individuellen Integrationsprozessen kam es über die Jahrzehnte aber auch zu einer Annäherung der Therapiemethoden durch eine »zentripetale Entwicklung«. Während sich beispielsweise die frühe, triebtheoretisch begründete Psychoanalyse, die frühe lerntheoretisch begründete Verhaltenstherapie und die frühe interaktionell orientierte Familientherapie radikal voneinander unterschieden, kam es im Zuge der »Binnendifferenzierung« der Therapiemethoden zu einer deutlichen Annäherung. Moderne tiefenpsychologische Methoden wie die strukturbezogene Therapie nach Rudolf oder die mentalisierungsbasierte Therapie nach Fonagy unterscheiden sich deutlich weniger von Schematherapie (einer Weiterentwicklung der Verhaltenstherapie) oder emotionsbasierter systemischer Therapie. Diese Annäherung erfolgt nicht durch individuelle Integrationsprozesse, die fallweise ja eher eklektischen Charakter haben, sondern durch Ausweitung der theoretischen Grundlagen. Auch diese Überlegung wird uns noch einmal begegnen.
Wenden wir uns zunächst aber der Frage zu, wie Psychotherapie wirkt. Was wissen wir darüber aus der Evaluationsforschung?
Über 500 Metaanalysen belegen, dass Psychotherapie bei den meisten psychischen Störungen schneller, stärker und nachhaltiger wirkt als der natürliche Heilungsprozess oder ein stützendes Umfeld (vgl. Lambert & Ogles 2004, Lambert 2011, Wampold 2001). Während die grundsätzliche Wirksamkeit von Psychotherapie daher außer Frage steht, wird eine andere Frage von Psychotherapieforschern aber kontroversiell diskutiert: Sind Psychotherapiemethoden alle ungefähr gleich wirksam, wie es die Verfechter des Dodo-Verdict behaupten, oder lassen sich doch stabile Unterschiede in der Wirksamkeit der verschiedenen Therapiemethoden nachweisen?
3.1 Unspezifische und allgemeine Wirkfaktoren
Da diese hochinteressante Diskussion, die viele forschungsmethodische Fragen umfasst, hier nicht umfassend abgebildet werden kann, möchte ich folgende konsensfähige Formulierung vorschlagen: Außer Zweifel steht, dass sich die spezifischen Theorien der psychotherapeutischen Verfahren – die Annahmen über Störungsursachen und die daraus abgeleitete Behandlungstheorie – deutlich mehr unterscheiden als die durch die Behandlung erzielten Effekte. Daher muss es neben den Faktoren, die von den einzelnen Verfahren als spezifisch wirksam gehalten werden, auch »allgemeine« oder »unspezifische« Wirksamkeitsfaktoren geben. Reisner (2005) schreibt dazu: »Science has established psychotherapy as generally effective … All therapies are basically equal in effectiveness … Factors common among all therapies are what account for patient improvement rather than the specific techniques used by a given school of therapy.« Dieser Gedanke ist keineswegs neu. Bereits 1936 formulierte Rosenzweig »… besides the intentionally utilized methods and their consciously held theoretical foundations, there are inevitably certain unrecognized factors in any therapeutic situation – factors that may be even more important than those purposely employed«.
Was könnten nun diese in jeder therapeutischen Situation wirksamen Faktoren sein und was können wir für unser »systemisches Wirkverständnis« daraus lernen?
Unspezifische Wirkfaktoren sind jene Therapievariablen, die implizit im Kontext jeder Psychotherapie realisiert werden – unabhängig von Therapiemethode und zu behandelndem Störungsbild. Ganz basal können wir hier die therapeutische Beziehung, das professionelle Erklärungsangebot bezüglich der beschriebenen Probleme und ein Rational für die Verbesserung beschreiben. Diese Sichtweise wurde zu Beginn der 1960er-Jahre von Jerome D. Frank zum »Common-Component-Model« (Frank 1971) weiterentwickelt. Frank führt aus, dass der Aufbau einer positiven Behandlungserwartung der zentrale allgemeine Wirkfaktor von Psychotherapie ist. Nicht nur der sozial legitimierte Kontext lässt die Erwartung entstehen, nun qualifizierte Hilfe zu erhalten, auch die emotional unterstützende Beziehung und das Angebot eines plausiblen Erklärungszusammenhanges fördern den Glauben an Veränderungsmöglichkeit. Die aus dem Erklärungsmodell abgeleiteten Vorgehensweisen des Therapeuten fördern die konstruktive bewältigungsorientierte Auseinandersetzung mit den Problemen, sodass neue Einsichten oder Einstellungs- und Verhaltensänderungen wahrscheinlich werden. In diesem Modell »ist die Wirksamkeit von Psychotherapie nicht im Inhalt der verschiedenen Theorien und Techniken begründet, sondern in deren Funktion: Die Psychotherapiekonzepte und die damit verbundenen Therapietechniken bilden lediglich den Rahmen für eine glaubwürdige Behandlung.« (Pfammatter et al. 2012)
Auf dieser Basis lassen sich weitere Dimensionen differenzieren. So führt z. B. Karasu (1986) aus, dass alle Therapiemethoden eine Kombination aus affektiven, kognitiven und behavioralen »change agents« bieten. Neben dem »affective experiencing« (also dem bewussten Erleben und Ausdruck von Gefühlen) tragen vor allem »cognitive mastery« (also motivationale Klärung, Abbau dysfunktionaler Überzeugungen, Aufbau und Integration neuer Einstellungen und Denkmuster) und »behavioral regulation« (Erlernen neuer Verhaltenskompetenzen) zur Veränderung bei.
Die von Weinberger (1995) postulierten fünf Wirkfaktoren könnten auch in »to-do-Sätzen« formuliert werden: Biete eine vertrauensvolle Beziehung und fördere positive Therapieerwartungen. Ermögliche dem Klienten im Schutz dieser Beziehung eine konstruktive Auseinandersetzung mit seinen Problemen und fördere damit die Wahrscheinlichkeit von Bewältigungserfahrungen und kognitiver Kontrolle über problematisches Erleben (»Providing an experience of mastery or cognitive control over the problematic issue«). Fördere die Selbstwirksamkeitserwartungen, indem du den Therapieerfolg des Patienten auf ihn selbst attribuierst.
Eine etwas andere Perspektive bringt Klaus Grawe (1998) ein, der argumentiert, dass die Wirkung von Psychotherapie durch folgende »allgemeine Wirkfaktoren« zustande kommt: Problemaktualisierung, Ressourcenaktivierung, motivationale Klärung oder Intentionsveränderung und Problembewältigung oder Intentionsrealisierung. Die verschiedenen Therapiemethoden unterscheiden sich nach Grawe nicht nur darin, wie – das heißt durch welche Techniken – sie die Wirkfaktoren realisieren, sondern auch in der spezifischen Gewichtung der einzelnen Faktoren. So ist z. B. die Psychoanalyse ein stark klärungsorientiertes Verfahren, die Verhaltenstherapie, v. a. wo sie übende Verfahren einsetzt, ein stark bewältigungsorientiertes Verfahren, während die Systemische Therapie ihre Wirkung vor allem über die Ressourcenaktivierung erzielen dürfte.
Wenn wir zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen zurückkehren, dass sich nämlich die spezifischen Theorien der psychotherapeutischen Verfahren – die Annahmen über Störungsursachen und die daraus abgeleitete Behandlungstheorie – deutlich mehr unterscheiden als die durch die Behandlung erzielten Effekte, könnten wir hier eine mögliche Erklärung finden. Neben den im engeren Sinn unspezifischen Wirkfaktoren, die von allen Therapiemethoden gleichermaßen erfüllt werden (z. B. Aufbau einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung, Aufbau positiver Behandlungserwartungen, Anbieten eines Erklärungsmodells etc.), gibt es auch jene »allgemeine Wirkfaktoren«, die von unterschiedlichen Therapiemethoden in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichem Ausmaß realisiert werden. Grawe postuliert nicht nur, dass sich die einzelnen Methoden in ihrem »Wirkfaktorenprofil« unterscheiden, sondern fordert auch die Entwicklung einer »allgemeinen Psychotherapie«, die ausgewogen alle vier Wirkfaktoren realisiert und damit allen etablierten Therapiemethoden überlegen wäre. »Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen« forderte Grawe dereinst bei einem Vortrag in Wien.
Während die »Abschaffung der Therapieschulen« aufgrund der vorhandenen Strukturen und Machtverhältnisse nicht zu erwarten ist, vollzieht sich doch eine andere Entwicklung, die in dieselbe Richtung weist. Wie schon erwähnt, lässt sich eine Annäherung der Therapiemethoden durch theoretische Integration und Assimilation ergänzender Perspektiven beschreiben: Die im Entstehungszusammenhang einer Therapiemethode sehr enge Auslegung des Psychischen (Triebtheorie, operantes Lernen, familiäre Interaktion) wird im Laufe der Entwicklung weiter und umfasst damit immer mehr Komponenten. Die Verhaltenstherapie nach Skinner wurde zuerst durch die kognitive Wende, später durch die Schematherapie in ihrem Wirkverständnis »ausgeweitet«. Während zunächst unwillkürliche Lernprozesse (operante Konditionierung) für die Problementstehung für konstitutiv gehalten wurden, waren es nach der kognitiven Wende dysfunktionale Gedanken und Überzeugungen, die durch kognitive Interventionen (sokratischer Dialog, kognitive Umstrukturierung etc.) abgebaut werden sollten. Mit der »Mindfulness based Cognitive Therapy« wurde ein auf Achtsamkeitsübungen basierendes Verfahren entwickelt. In der Schematherapie werden nun zentral affektive Prozesse, v. a. die Wirksamkeit dysfunktionaler affektiver Schemata, die als das Ergebnis früher leidvoller Erfahrungen verstanden werden, konzeptualisiert und erstmals erlebnisorientierte und »affektbearbeitende Methoden« als notwendig für Veränderung betrachtet.
Eine ähnliche Entwicklung lässt sich für die Systemische Therapie beschreiben: Während in ihren Anfängen als Familientherapie der interaktionelle Fokus im Mittelpunkt stand, kam es durch die konstruktivistische Wende zu einer Fokussierung individueller Bedeutungskonstruktionen. Was auf den ersten Blick ebenso als »kognitive Wende« verstanden werden kann, weist bei genauer Beobachtung doch auch deutliche Unterschiede zu jener in der Verhaltenstherapie auf, da unter dem Einfluss des Konstruktivismus Systemische Therapie im Unterschied zur Verhaltenstherapie den Anspruch aufgegeben hat, Verhalten und Denken von PatientInnen objektiv zu beschreiben und zu erklären (vgl. Lieb 2009, S. 18). In dieser Phase entwickelten sich der konstruktivistisch-konversationale Ansatz von Kurt Ludewig, Fritz Simon und Arnold Retzer (um nur einige Vertreter zu nennen), die lösungsorientierte Kurztherapie nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg sowie der narrative Ansatz von Michael White und David Epston. Im Zuge der weiteren Entwicklung wurde auch hier der sprachlich-kognitive Fokus erweitert: Die hypnosystemische Therapie von Gunther Schmidt bietet die Möglichkeit, auf unwillkürliche Prozesse Einfluss zu nehmen, im emotionsfokussierten systemischen Ansatz werden nicht nur erlebnisorientierte und affektbearbeitende Interventionen vorgestellt, sondern vor allem ein synergetisches Verständnis psychischer Prozesse vermittelt, das den reflektierten Einsatz dieser Methoden erlaubt.
Je vielfältiger die theoretischen Konzepte und damit die Handlungsmöglichkeiten der TherapeutInnen werden, desto wichtiger ist es, eine Metaperspektive einnehmen zu können, die Orientierung und Prozesssteuerung erleichtert. Die allgemeinen Wirkfaktoren von Klaus Grawe könnten so ein »Metakonzept« darstellen, indem in der konkreten therapeutischen Situation die Realisierung der einzelnen Wirkfaktoren überprüft wird.
In einem nächsten Schritt wollen wir uns der Frage zuwenden, was angesichts der beschriebenen Vielzahl von Konzepten und theoretischen Modellen als zentrale Merkmale systemischer Therapie angesehen werden kann. Dies ist kein einfaches Unterfangen, da es neben den gemeinsamen Grundorientierungen und -haltungen bei genauerer Betrachtung auch »handfeste Widersprüche« und »theoretische Unvereinbarkeiten« zwischen den einzelnen systemischen Ansätzen gibt (Levold 2014, S. 13). Aufgrund der hohen Binnendifferenzierung der Systemischen Therapie und der bereits beschriebenen Annäherung der Therapiemethoden durch Ausweitung deren Wirkverständnis ist eine klare Definition von Systemischer Therapie schwierig. Egal ob konstruktivistische Grundhaltung, interaktioneller Fokus (»Verstehe den Menschen und das Symptom in seinem aktuellen Bezugssystem«) oder Ressourcenperspektive – all diese Haltungen sind weder für Systemische Therapie spezifisch noch zwingend realisiert. Schiepek (2013) spricht daher von einer »im Fluss befindlichen Familienähnlichkeit von Merkmalen«, die die Systemische Therapie ausmachen, und weist darauf hin, dass dies auch für andere Therapiemethoden, wie z. B. die Verhaltenstherapie, gilt.
Kapitel 4
Was macht Systemische Therapie aus?
4.1 Erkenntniskritische Haltung und Multiperspektivität
Systemische TherapeutInnen können in der Regel einen konkreten Fall aus verschiedensten Perspektiven betrachten: lösungsorientiert, strukturell, strategisch, narrativ, hypnosystemisch, um nur die wichtigsten zu nennen. Gunther Schmidt (2017)