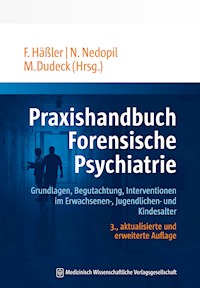
Praxishandbuch Forensische Psychiatrie E-Book
199,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Forensische Psychiatrie geht weit über gutachterliche Beurteilung und Behandlung von psychisch kranken Rechtsbrechern hinaus. Das forensische Gutachten erfordert zudem Wissen in sozial-, familien- und zivilrechtlichen Fragestellungen und nicht zuletzt auch in ethischen oder historischen Einordnungen. Dem Basiswissen zu Erstellung, Verfassen und Vortrag von Gutachten folgen praxisnahe Beiträge aus Recht und Medizin zu Begutachtung, Behandlung und Prognose. Dazu gehören auch die diagnostischen Standards wie die Interventions- und Behandlungskonzepte der Forensischen Psychiatrie. Einmalig ist die Herangehensweise der Betrachtung der strafrechtlichen Verantwortung bei speziellen Delikten einerseits und der forensischen Relevanz spezieller Störungen andererseits. Die einzigartige integrierte Darstellung der forensischen Psychiatrie des Erwachsenen- wie auch des Kindes- und Jugendalters, der Rechtsmedizin und Rechtspsychologie eröffnet den Blick auf die Besonderheiten der Nachbardisziplinen. Die Neuauflage des umfassenden Standardwerks wurde um zahlreiche neue Themen wie die Forensische Psychiatrie im internationalen Vergleich, die Grundlagen der Verkehrsmedizin, rechtsmedizinische und rechtspsychologische Erörterungen, Testierfähigkeit, neurobiologische Aspekte und vieles mehr ergänzt. Das Grundkonzept, sowohl der wissenschaftlich interessierten als auch der praxisorientierten Leserschaft ein ausgewogenes, fundiertes und trotz seines Umfangs handhabbares Nachschlagewerk an die Hand zu geben, wurde in dieser Neuauflage vervollkommnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1699
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. Häßler | N. Nedopil | M. Dudeck (Hrsg.)
Praxishandbuch Forensische Psychiatrie
Grundlagen, Begutachtung, Interventionen im Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kindesalter
3., aktualisierte und erweiterte Auflage
mit Beiträgen von
M. Allroggen | T. Auerbach | G. Badura-Lotter | K.M. Beier | A. Boysen | P. Briken | A. Brunnauer | C.-L. Cimpianu | R. Doberenz | M. Dudeck | H. Fangerau | J.M. Fegert | I. Franke | S. Franke | F. von Franqué | M. Fritz | D. Gaudernack | K. Haack | U. Hammer | F. Häßler | A. Herrmann | J. Kaspar | L. Kistler Fegert | M. Kölch | N. Konrad | M. Lammel | S. Langgartner | G. Laux | M. Liebrenz | M. Lutz | C. Maaß | N. Nedopil | A. Opitz-Welke | C. Prüter-Schwarte | M. Rassenhofer | O. Reis | H. Remschmidt | W. Retz | E. Richter | F. Riegg | P.H. Rothe | C. Sachser | N. Saimeh | R. Schepker | K. Schiltz | R. Schleifer | C. Schlögl | K. Schmeck | H. Schütt | F.M. Segmiller | H. Singer | C. Stadler | J. Thomas | J. Thome | L. Titze | D. Turner | N. Vasić | A. Voit | B. Völlm | A. Voulgaris | K. Wedler | W. Weissbeck | M. Wertz | T. Wetterling
mit einem Geleitwort von Henning Saß
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Die Herausgeber
Prof. Dr. med. habil. Frank Häßler
Tagesklinik für Kinder- & Jugendpsychiatrie
Dierkower Höhe 14
18146 Rostock
und
MVZ der GGP Gruppe
Goerdelerstr. 50
18069 Rostock
Prof. Dr. med. Norbert Nedopil
Ludwig Maximilians Universität München
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Klinikum Innenstadt der Universität München
Abteilung für Forensische Psychiatrie
Nußbaumstr. 7
80336 München
Univ.-Prof. Dr. med. Manuela Dudeck
Universität Ulm am BKH Günzburg
Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie
Lindenallee 2
89312 Günzburg
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstraße 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
ISBN 978-3-95466-723-9 (eBook: PDF)
ISBN 978-3-95466-724-6 (ePub)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2022
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. In vorliegendem Werk wird nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht anders angegeben.
Die Verfasser haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Der Verlag kann insbesondere bei medizinischen Beiträgen keine Gewähr übernehmen für Empfehlungen zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen oder für Dosierungsanweisungen, Applikationsformen oder ähnliches. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden.
Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website.
Produkt-/Projektmanagement: Susann Weber, Lisa Maria Pilhofer, Berlin
Copy-Editing: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Layout, Satz & Herstellung: zweiband.media Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH
Umschlagsbild: ©picture alliance /APA Picturedesk/Helmut Fohringer
E-Book: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstraße 4, 10117 Berlin, [email protected]
Vorwort zur 3. Auflage
Das Praxishandbuch Forensische Psychiatrie des Kindes-, Jugend-, und Erwachsenenalters liegt nunmehr mit veränderter Herausgeberschaft in der umfänglich erweiterten 3. Auflage vor. Nach dem Ausscheiden von Dr. Wolfgang Kinze komplettiert Frau Prof. Manuela Dudeck aus Ulm das Herausgebertrio.
Das Praxishandbuch wendet sich nach wie vor vorrangig an forensisch tätige Kinder- und Jugendpsychiater, Psychiater, Sexualmediziner, Psychologen, Mitarbeiter der Jugendhilfe sowie an Juristen. Durch das Beibehalten einer einheitlichen Struktur ist es wieder gelungen, trotz vieler Gemeinsamkeiten in Diagnostik, Therapie und forensischer Begutachtung, spezielle Aspekte bei Kindern und Jugendlichen von denen der Erwachsenen inhaltlich zu trennen und schärfer herauszuarbeiten.
Auch die 3. Auflage spiegelt dank einer gründlichen Überarbeitung der Kapitel anhand neuester Erkenntnisse den aktuellen praxis- und wissenschaftsorientierten Stand der Forensik nicht nur in Deutschland wider. Die Zahl der mitwirkenden namhaften kinder- und jugendpsychiatrischen sowie (erwachsenen)psychiatrischen Experten und auf dem Gebiet tätigen Juristen, Ethiker und Historiker ist größer geworden. Völlig neu wurden neben vielen anderen auch Kapitel von Rechtspsychologen und Rechtsmedizinern sowie zur Testierfähigkeit, zu Intensivtätern und zu verkehrsmedizinischen Aspekten aufgenommen. Im fächerübergreifenden Zusammenspiel, welches durch gesetzliche Vorgaben im forensischen Alltag geradezu gefordert wird, liegt der Schwerpunkt des Buches. Sowohl im Grundlagenteil als auch bei der delikt- und störungsspezifischen Betrachtung kriminellen Verhaltens, den diagnostischen Standards, den therapeutischen Optionen und insbesondere in den zivil- und öffentlich-rechtlichen Kapiteln liegt er auch in der 3. Auflage nicht mehr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Ein weiteres Anliegen der Herausgeber ist es, forensisch tätige Kollegen bzw. angehende Fachärzte, die laut Musterweiterbildungsordnung auch forensische Erfahrungen in Form von Gutachten aufweisen müssen, und Juristen mit den vielschichtigen Ursachen und Entstehungskomplexen delinquenten Verhaltens, dem diagnostischen und therapeutischen Know-How sowie der Entwicklungsperspektive der Kinder- und Jugendpsychiatrie vertraut zu machen. Psychische Erkrankungen und Delinquenz sind aber nicht an Altersgrenzen orientiert und die Evaluierung jugendpsychiatrischer Prognosen gelingt oft erst im Erwachsenenalter. Somit bedarf es einer engen Kooperation zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychiatrie auf Augenhöhe. Dies ist bei der Konzeptualisierung und Realisierung dieses forensischen Praxishandbuches bereits vorbildlich gelebt worden. In Anbetracht einer zunehmend globalisierten Welt geht es den Herausgebern auch um den Blick über den deutschen Tellerrand hinaus hin zu den unmittelbaren Nachbarn in Österreich und der Schweiz.
Zuletzt sei allen Autorinnen und Autoren für Ihre engagierte Mitwirkung ganz herzlich gedankt. Ihre Beiträge, die auf ihren jeweiligen reichhaltigen Praxiserfahrungen basieren, machen das Buch zu dem, was es in der vorliegenden Form ist – einem forensischen Praxishandbuch, welches nicht nur umfänglicher und aktueller, sondern auch in seiner Struktur einmalig ist. Dieses Praxishandbuch soll weiterhin als Leitfaden und Nachschlagewerk bei der Bearbeitung rechtlicher Fragestellungen sowie forensischer Probleme den oben genannten Professionen zuverlässig und kompetent zur Seite stehen.
Frank Häßler
Norbert Nedopil
Manuela Dudeck
im April 2022
Geleitwort zur 1. Auflage
Schon immer haben die forensischen Fragestellungen innerhalb der Theorie und Praxis des Faches Psychiatrie eine herausgehobene Funktion besessen. Gerade wegen der Nähe der forensischen Psychiatrie zu den Rechtswissenschaften sind konzeptionelle Klarheit, begriffliche Strenge und ein methodenbewusstes Vorgehen unabdingbar. Nicht zuletzt deshalb waren vor allem in früherer Zeit hervorragende Kliniker und Psychopathologen häufig auch sehr aktiv auf forensischem Gebiet. Beispiele in der französischen Psychiatrie sind Philippe Pinel, Jean Étienne Dominique Esquirol oder Bénédicte-Augustin Morel; in den angloamerikanischen Ländern waren es etwa Benjamin Rush, Henry Maudsley oder Aubrey Lewis. Besonders enge Beziehungen zwischen forensischer und allgemeiner Psychiatrie finden sich bei den großen Klinikern und Psychopathologen in den deutschsprachigen Ländern, so bei Wilhelm Griesinger, Emil Kraepelin, Karl Jaspers, Karl Wilmanns, Eugen Bleuler, Kurt Schneider, Walter Ritter von Baeyer. Erst in den letzten Jahrzehnten ist die Verbindung zwischen klinischer und forensischer Psychiatrie lockerer geworden, sodass sich eigenständige forensische Kliniken, Lehrstühle und Arbeitsbereiche gebildet haben, etwa in München mit Mikorey, Mende und ihren Nachfolgern, in Berlin mit Rasch, Cabanis und Nachfolgern, in Hamburg mit Giese, Schorsch und Nachfolgern.
Inzwischen erfordert es angesichts der Erfolge der neurobiologischen Arbeitsrichtungen ein gesondertes Bemühen, die Integration der forensischen Psychiatrie in die allgemeine Entwicklung des Faches aufrechtzuerhalten. Sie ist allerdings unbedingt erforderlich, um zum einen in der Forensik den Anschluss an die Fortschritte in den Neurowissenschaften zu halten und auf der anderen Seite, um die klinische Psychiatrie immer wieder in den Stand zu versetzen, sachverständig auf die forensisch-psychiatrischen Fragestellungen zu reagieren, einschließlich der Ausstrahlungen in sozialmedizinische, kriminologische und gesellschaftswissenschaftliche Randgebiete der Psychiatrie.
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind über die genannten Nachbardisziplinen hinaus weitere Arbeits- und Problemfelder zu berücksichtigen, etwa die Überschneidungen mit sozialpsychologischen, pädagogischen, pädiatrischen und vor allem den jugend- und familienrechtlichen Themenstellungen. Von daher überstreicht das Aufgabengebiet des vorliegenden Praxishandbuches ein ausgesprochen großes Feld, umfasst es doch, wie der Titel anzeigt, nicht nur die angeführten Fächer mit ihren Randzonen, sondern darüber hinaus auch eine sehr weite Altersspanne, die sich vom Kindes- und Jugendalter bis zum Erwachsenen erstreckt. Dies zeigt, wie ambitioniert das Vorhaben der drei Herausgeber dieses von seinem Anspruch her gänzlich neuen Handbuches ist.
Dabei ist die Herangehensweise insofern neuartig, als auf eine Schichtung der Thematik in forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie einerseits sowie forensische Erwachsenenpsychiatrie andererseits verzichtet wird. Dies ist zu begrüßen, weil die Trennung zwischen den beiden Fächern zumindest in forensischer Hinsicht etwas Artifizielles hat. Gerade das Heranwachsendenalter zwischen 18 und 21 Jahren ist wegen Ausmaß und Art delinquenter Verhaltensweisen in dieser besonders kritischen Entwicklungsperiode nicht isoliert nur aus der Perspektive der Kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. der Erwachsenenpsychiatrie zu bearbeiten. Interdisziplinärer Austausch und eine übergreifende Betrachtung der gesamten Spanne, die zwischen Jugend- und Heranwachsendenzeit sowie dem frühen Erwachsenenalter liegt, sind sachlich unabdingbar. Wie erforderlich dies ist, zeigt sich sehr deutlich an den aktuellen Debatten in diesem Feld, etwa um das Buch der Berliner Jugendrichterin Heisig über die Jugendkriminalität bei Migranten, um die Probleme der Sicherungsverwahrung gem. § 7 Abs. 2 Jugendgerichtsgesetz oder um diesbezügliche Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Straßburg.
Zur Bewältigung der weit gespannten Aufgabenstellung haben die Herausgeber eine große Zahl von Fachautoren mit jeweils zusammenhängenden Aspekten betraut. Die Experten stammen aus allen Gegenden der Bundesrepublik wie auch aus Nachbarländern, etwa der Schweiz und Polen. Auf diese Weise ist eine sehr facettenreiche Darstellung der unterschiedlichen Themenbereiche entstanden, die zwar manche Überlappungen birgt, andererseits aber auch interessante Vergleiche und Differenzierungen hinsichtlich unterschiedlicher Lösungsansätze in den verschiedenen Rechtskulturen erlaubt. Nicht bei allen forensischen Problemstellungen gibt es die Möglichkeit eindeutiger Entscheidungen zwischen richtig und falsch, vielmehr geht es häufig um Gewichtungen, Bewertungen und Einschätzungen, die trotz allen Bemühens um Objektivität nicht frei von subjektiven Auffassungen bleiben können. Die Vielzahl der Autoren und der von ihnen vertretenen Positionen erlaubt eine kritische Gegenüberstellung zur Entwicklung eines eigenen Standpunktes, den sich der werdende Sachverständige im Laufe seiner Ausbildung zu erarbeitet hat. Hierfür wie auch für den interdisziplinären Dialog unter den Fachleuten bietet das vorliegende Handbuch eine Fülle von Anregungen.
Prof. Dr. med. Henning Saß,
Universitätsklinikum Aachen
Inhalt
Teil I: Basiswissen
AForensische Psychiatrie im Kontext
1Zur Geschichte der forensischen PsychiatrieKathleen Haack
2Ethische Aspekte der Kinder-, Jugend- und ErwachsenenforensikHeiner Fangerau und Gisela Badura-Lotter
3Forensische Psychiatrie im europäischen Vergleich – Aktueller Stand und PerspektivenBirgit Völlm
EXKURS: Ökonomie und Ethik im Maßregelvollzug: Minimum vs. Goldstandard oder: Alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit?Dorothea Gaudernack
BGrundsätze für Gutachten und Gutachter
1Merkmale und Mindestanforderungen eines forensischen GutachtensManuela Dudeck, Larissa Titze und Maximilian Lutz
2Qualifikation und Zuständigkeit des GutachtersFelix M. Segmiller
3Beauftragung zur BegutachtungJohannes Kaspar
4Rechtliche Grundlagen der Begutachtung bei Kindern und JugendlichenMarc Allroggen
5Stellung des Gutachters im ProzessFelix M. Segmiller
6Stellung des Gutachters zum BegutachtetenIrina Franke
7Aufbau des schriftlichen GutachtensChristian Prüter-Schwarte
8Vergütung und Rechnungsstellung des GutachtersPhilipp H. Rothe
Teil II: Praxiswissen
ADie strafrechtliche Verantwortlichkeit: Grundlagen
1Reife und Entwicklungsstand – Grundlagen und Bewertung der ReifebeurteilungRenate Schepker
2Zahlen und Fakten zur Kinder- und JugendlichendelinquenzRenate Schepker
3Grundsätze des JugendstrafrechtsRenate Schepker
4Strafrechtliche Reife/strafrechtliche Verantwortlichkeit/Unrechtserkenntnis/HandlungsreifeRenate Schepker
5Juristische Terminologie zur SchuldfähigkeitElisabeth Richter
6Einsichts- und Steuerungsfähigkeit und ihre DifferenzierungAnnette Opitz-Welke
7Haft- und VerhandlungsfähigkeitElisabeth Richter
BRechtspsychologie
1Die Stellung des Rechtspsychologen in Zivil- und StrafrechtReinhard Doberenz und Jana Thomas
EXKURS: Besonderheiten bei Angeklagten mit MigrationshintergrundRenate Schepker
2Standards der Glaubhaftigkeitsbegutachtung – Ein RückblickReinhard Doberenz
CRechtsmedizin
1Grundlagen der VerkehrsmedizinGerd Laux und Alexander Brunnauer
2Schuldfähigkeitsbegutachtung bei Alkohol-, Drogen- und Substanzmissbrauch/-konsumUlrich Hammer
DDie strafrechtliche Verantwortlichkeit: Spezielle Delikte
1DiebstahlsdelikteFrank Häßler
2GewaltdelikteFrank Häßler
3TötungsdelikteFrank Häßler
4Kindesmisshandlung und KindstötungFrank Häßler
5Sexualstraftaten bei Jugendlichen und HeranwachsendenFrank Häßler
6Sexualdelinquenz im ErwachsenenalterFritjof von Franqué, Alexander Voulgaris und Peer Briken
7BrandstiftungFrank Häßler
8Kfz-DelikteMichael Kölch, Hanneke Singer, Liliane Kistler Fegert und Jörg M. Fegert
9Straftaten in Verbindung mit Alkohol, Drogen und MedikamentenWolfgang Retz und Daniel Turner
10Polytrope KriminalitätMichael Kölch, Anja Voit und Jörg M. Fegert
ESpezielle Störungen und ihre mögliche forensische Relevanz
1Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen und EpilepsieFrank Häßler
2Substanzmissbrauch und -abhängigkeit im Jugendalter und bei HeranwachsendenChristian Schlögl
3Substanzmissbrauch und -abhängigkeit im Erwachsenenalter – mit dem Fokus auf den Schweizer RechtsraumMichael Liebrenz und Roman Schleifer
4Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen im Kontext der forensischen Psychiatrie und PsychotherapieNenad Vasić
5Affektive StörungenKolja Schiltz, Camelia-Lucia Cimpianu und Florian Riegg
6Neurotische und BelastungsstörungenMatthias Lammel
7Störungen der SexualpräferenzKlaus M. Beier
8Persönlichkeits- und VerhaltensstörungenMatthias Lammel
9Intelligenzminderung mit VerhaltensstörungenFrank Häßler
10EntwicklungsstörungenHelmut Remschmidt
11Hyperkinetische Störungen (HKS) und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)Frank Häßler
12Störungen des SozialverhaltensChristina Stadler und Klaus Schmeck
FUrsachenkomplexe von Delinquenz/„Tätertypologien“
1Wer wird eigentlich delinquent? – Zum „intrapsychischen Nutzen“ von Radikalisierung und Fanatismus als Bedingungsgefüge für extremistisch motivierte GewaltNahlah Saimeh
2Die Neurobiologie der Delinquenz: Antisoziales Verhalten, Delinquenz, Antisoziale Persönlichkeitsstörung und Psychopathie aus Sicht moderner bildgebender Verfahren und GenetikMichael Fritz und Manuela Dudeck
3Intensiv- und SerientäterNorbert Nedopil
GSpezialisierte Behandlung von Straftätern
1Die Behandlung im ErwachsenenmaßregelvollzugManuela Dudeck, Maximilian Lutz und Larissa Titze
2Therapie mit sexualdelinquent gewordenen MenschenFritjof von Franqué und Peer Briken
3Psychotherapeutische Behandlung delinquenter Jugendlicher im MaßregelvollzugWolfgang Weissbeck und Arne Boysen
4Pflege in der Forensischen PsychiatrieThomas Auerbach
5Angehörige in der Forensik oder die Kunst des Scheiterns (Vortrag anlässlich einer Tagung)Angelika Herrmann
HKriminalprognostische Bewertung
1Forensisch-psychiatrische RisikoeinschätzungNorbert Nedopil
2Lockerungsentscheidungen im ErwachsenenmaßregelvollzugKristina Wedler und Christina Maaß
IFormen der Sicherung
1Strafrechtliche UnterbringungFrank Häßler
2Die SicherungsverwahrungKolja Schiltz, Simon Langgartner und Maximilian Wertz
3Überwachung mittels elektronischer FußfesselFrank Häßler und Holger Schütt
JPsychisch kranke Straftäter im Regelvollzug
1Psychisch kranke Jugendliche und Heranwachsende im RegelvollzugAnnette Opitz-Welke
2Psychisch kranke Erwachsene im RegelvollzugAnnette Opitz-Welke und Norbert Konrad
KSozialrechtliche Begutachtungen
1Anhaltspunkte für die ärztliche Begutachtung bei BehinderungMarc Allroggen, Michael Kölch, Stefanie Franke und Jörg M. Fegert
2Pflegebedürftigkeit und Pflegestufen gemäß SGB XIMarc Allroggen, Michael Kölch und Jörg M. Fegert
3FrühförderungMarc Allroggen, Michael Kölch und Jörg M. Fegert
4Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIIIMichael Kölch, Marc Allroggen und Jörg M. Fegert
5Gesetzliche Regelungen der Versorgung der Opfer von GewalttatenStefanie Franke, Miriam Rassenhofer, Cedric Sachser und Jörg M. Fegert
LZivilrechtliche Begutachtungen
1TestierfähigkeitTilman Wetterling
2SorgerechtOlaf Reis und Michael Kölch
3VormundschaftFrank Häßler
4UmgangsrechtOlaf Reis und Michael Kölch
5BetreuungFrank Häßler
6NamensänderungOlaf Reis und Frank Häßler
7Kindesrecht, Kindeswohl, KindeswilleFrank Häßler
8Zivilrechtliche und sozialrechtliche Unterbringung bei MinderjährigenFrank Häßler
9Das Sachverständigengutachten nach FGG-RGFrank Häßler
10Öffentlich-rechtliche Unterbringung – Landesgesetze für die Unterbringung psychisch KrankerJohannes Thome
11Zivilrechtliche Unterbringung VolljährigerJohannes Thome
Sachwortverzeichnis
I
Basiswissen
A
Forensische Psychiatrie im Kontext
1Zur Geschichte der forensischen PsychiatrieKathleen Haack
2Ethische Aspekte der Kinder-, Jugend- und ErwachsenenforensikHeiner Fangerau und Gisela Badura-Lotter
3Forensische Psychiatrie im europäischen Vergleich – Aktueller Stand und PerspektivenBirgit Völlm
EXKURS: Ökonomie und Ethik im Maßregelvollzug: Minimum vs. Goldstandard oder: Alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit?Dorothea Gaudernack
1Zur Geschichte der forensischen PsychiatrieKathleen Haack
1.1Vorbetrachtungen
Die Ansicht, dass psychisch kranke Menschen, die eine Straftat begangen haben, nicht in gleicher Weise beurteilt werden dürfen wie psychisch gesunde, durchzieht die Menschheitsgeschichte seit weit mehr als tausend Jahren. Gleiches gilt für Kinder und mit Einschränkungen auch für Jugendliche. Schon der babylonische Codex Hammurabi (um 1750 v. Chr.) sah Strafmilderung vor. Sowohl von germanischen Volksrechten als auch vom römischen Recht sind solche Regelungen überliefert. Das bedeutendste Rechtsbuch des Mittelalters, der aus dem 13. Jahrhundert stammende Sachsenspiegel, betonte, dass Geisteskranke sich nicht strafbar machen, Kinder durften nicht zum Tode verurteilt werden. Für Jugendliche hingegen galten keine gesonderten Straftatbestände. Die von Karl V. initiierte Constitutio Criminalis Carolina aus dem Jahre 1532 sah in Anwendung des Artikels 179 „jemandt, der jugent oder anderer gebrechlichkeyt halben, wissentlich seiner synn nit hett“ Strafmilderung vor. Auch Geisteskranke fielen hierunter. Hintergrund war die Auffassung, dass Straftäter, die die Mündigkeit noch nicht erreicht hatten, nicht vernunftbegabt und demgemäß gar nicht in der Lage waren – ebenso wie „Wahnsinnige“ – vernünftig zu handeln. Eine solche Ansicht ist nachvollziehbar und plausibel. Sie wirft jedoch zwei Problemkreise auf: Was heißt es, innerhalb eines historischen Kontextes erstens nicht volljährig und zweitens psychisch krank zu sein oder ganz und gar einer Kombination von beidem zu unterliegen? Die Antworten hierauf müssen zwangsläufig vielschichtig ausfallen, denn beide Phänomene waren im Laufe der Geschichte einem steten Wandel unterworfen. Sie sind es noch immer. Zudem ist es gar nicht möglich, ein Verständnis des Menschen, der das Recht verletzt, nur von einer Wissenschaft aus zu gewinnen. Dazu war und ist die Beschäftigung mit abweichendem Verhalten zu komplex. Neben medizinischen und juristischen Einflüssen bestimmten auch philosophische, anthropologische, theologische und im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie natürlich pädagogische Ideen den Diskurs über deviantes Verhalten. Ein Rückblick auf die Geschichte der Psychiatrie und ihrer Subdisziplinen kann somit kein rein wissenschaftshistorischer sein, sondern schließt notwendigerweise kultur- und sozialgeschichtliche Aspekte ein.
1.2Kindheit als Phänomen und Forschungsgegenstand
Obwohl unser Wissen über die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in der Geschichte noch immer sehr gering ist, lassen sich seit dem 16. Jahrhundert Tendenzen einer Abgrenzung dieser Lebensphase erkennen. Kindern und Jugendlichen wurde nun zunehmend eine eigene biografische Identität zuerkannt. Die Einstellung zum individuellen Körper – so auch zu dem des Kindes – änderte sich. Eine medizinisch-pädagogische Ratgeberliteratur entstand in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Spielzeug kam auf, in öffentlichen Schulen bildeten sich Jahrgangsklassen heraus. Kinder und Jugendliche wurden nun als Wesen begriffen, deren Reife in ihnen selbst angelegt war. Durch vernunftgeleitete Erziehung kam diese zum Tragen. Der erste Höhepunkt einer solchen Entwicklung lässt sich für das 18. Jahrhundert konstatieren. Erinnert sei an Jean-Jaques Rousseaus (1717–1778) im Jahr 1762 erschienen epochalen Roman „Emile oder Über die Erziehung“. In ihm plädierte der berühmte Philosoph dafür, Kindheit nicht mehr nur als notwendiges Durchgangsstadium zum Erwachsensein anzusehen. Dieser, von einer bürgerlichen Welt getragene „Schutzraum Kindheit“ schloss von vornherein jedoch viele von ihnen aus. Kinderarbeit, ein Leben auf der Straße und häufig damit einhergehende Kriminalität, gehörten durchaus zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Und auch heutzutage scheinen die scharfen Trennungslinien zwischen Kindern und Erwachsenen eher wieder zu verblassen. Neil Postmans (1931–2003) postuliertes „Verschwinden der Kindheit“ wird, wenn auch unter differenzierteren Vorzeichen, durchaus als Phänomen beobachtet und anerkannt.
Doch eines bleibt festzuhalten: Spätestens seit dem 17. Jahrhundert nahm das Interesse an den frühen Lebensphasen zu. Die Wissenschaft begann, sowohl den Menschen insgesamt als „erfahrbares“ geschichtliches Individuum (anthropologisch-psychologischer Empirismus) als auch das Subjekt Kind bzw. Jugendlicher im Besonderen als „Forschungsgegenstände“ zu begreifen.
Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts war es zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung der Wissenschaften gekommen. In diesem Kontext bildeten sich u.a. die Pädagogik sowie die Psychiatrie als eigenständiges Fachgebiet der Medizin heraus. Wichtigste Bezugswissenschaft beider war die Anthropologie, die im Grenzbereich zwischen Philosophie, Medizin und Naturkunde die komplexen Regulationen zwischen Körper und Seele untersuchte. Als eine der universellsten Wissenschaftsgattungen des 18. Jahrhunderts ging es der Anthropologie um die Ausarbeitung und Tradierung von Theorien über den Menschen. Es kam zu einer zunehmenden Fokussierung und Ausdifferenzierung des Subjekts. Sowohl dessen physische als auch psychisch-moralische Natur galt es zu erforschen; im Falle der Pädagogik die des Kindes, im Falle der Psychiatrie, die des seelisch kranken Menschen. Beide Disziplinen gingen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zunächst getrennte Wege, sodass das erste Jahrhundert der modernen Psychiatrie im Prinzip keine Spezialisierung für den Bereich der Kinder und Jugendlichen kannte (auch die Kinderheilkunde bildete sich erst ab Ende des 19. Jahrhunderts heraus). Speziell eingerichtete Anstalten, in denen Kinder zumeist unter dem unspezifischen Sammelbegriff der Idiotie betreut wurden, wurden zunächst von Pädagogen oder Theologen geleitet. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts gab es erste Bemühungen von psychiatrischer Seite. Adolf Albrecht Erlenmeyer (1822–1877) war der erste Psychiater in Deutschland, der eine Anstalt für geistig behinderte Kinder gründete und leitete. Dennoch blieb das Wissen über die Spezifik psychischer Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen in den folgenden Jahrzehnten ein beinahe weißer Fleck. Hermann Emminghaus (1845–1904), der 1887 die erste lehrbuchartige Darstellung der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorgelegt hatte, stellte resigniert fest: „dass ein vom Erwachsenen ausgehendes Denken es unmöglich mache, die spezifischen Charaktere der Kindheit wahrzunehmen. Im Gegensatz zum Erwachsenen, dessen Stärken im Bereich der Einsicht und Vernunft lägen, würden Kinder andere positive Eigenschaften haben, die er nicht einmal benennen könne.“ (zit. nach Fegert 1986: 135). Es sollte dem 20. Jahrhundert vorbehalten bleiben, den weißen Fleck (die terra incognita) Kinder- und Jugendpsychiatrie und erst recht ihre forensische Subdisziplin mit Farbe zu füllen. Aber immerhin hatten Psychiater zu diesem Zeitpunkt schon beinahe 100 Jahre Erfahrung mit psychisch kranken Straftätern.
1.3Auf dem Weg zur Herausbildung der forensischen Psychiatrie
Systematische Forschungen zum Umgang mit psychisch kranken Straftätern vor dem 19. Jahrhundert gibt es kaum. Bekannt ist, dass für unzurechnungsfähig erklärte Delinquenten meist in ihren Familien lebten. Und auch bei Kindern und Jugendlichen, die mit dem Gesetz in Konflikt kamen, muss man davon ausgehen, dass ihre Angehörigen die entsprechende Aufsicht übernahmen. Waren diese mit der Situation überfordert, konnten auffällig gewordene Geisteskranke in Zucht-, Arbeits- und Tollhäusern bzw. in Hospitälern untergebracht werden. Die dortige Klientel war eine bunt gemischte und reichte von „liederlichen Leuten“ über trotzige und ungehorsame Kinder bis hin zu Schwerverbrechern. Bei der Behandlung stand der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Durch Arbeit und Unterricht in geistlichen Angelegenheiten sollten die Insassen zu „anständigen Leuten“ erzogen werden. Obwohl es Belege über Exekutionen von Kindern und Jugendlichen noch bis ins 18. Jahrhundert hinein gibt, kann man davon ausgehen, dass in den meisten Fällen strafmildernd vorgegangen bzw. die Verfahren gänzlich eingestellt wurden. So ist beispielweise von einem zwölfjährigen Mädchen aus Zürich überliefert, dass sie auf Veranlassung des bösen Geistes, welcher ihr als schwarzer Hund erschienen war, ein Haus in Brand gesteckt hatte. Aufgrund ihres Alters und des zweifelhaften Gemütszustandes wurde sie für unzurechnungsfähig erklärt und 1659 ins Hospital eingeliefert. Dort wurde sie in der Kindbettstube versorgt und von Geistlichen unterrichtet (Zürcher 1960: 38).
Seit dem 17. Jahrhundert ist die Tendenz zu erkennen, neben klerikalen Einrichtungen auch landesherrschaftliche Hospitäler einzurichten. Sie besaßen stets einige Räume für Geisteskranke und können u.a. als Vorläufer spezifischer Heil- und Pflegeanstalten für psychisch Kranke angesehen werden. Diese waren seit Beginn des 19. Jahrhunderts in allen Ländern des Deutschen Reiches entstanden und gründeten auf der Idee, dass jeder Mensch dem Wahnsinn anheim fallen könne und es eine besondere Fürsorgepflicht, verbunden mit dem Versuch der Heilung, gegenüber diesen „Unglücklichen“ gebe (Vanja 2008). Erste psychiatrische Heilanstalten, wenig später um den Begriff der Pflegeanstalt ergänzt, entstanden in Bayreuth, Neuruppin, Sonnenstein/Pirna und Siegburg. Es erwuchs der „Erfahrungsraum Psychiatrie“, in denen der Arzt als Direktor „väterlicher Freund“ und „guter Psychologe“ sein sollte. Dieser „Erfahrungsraum“ ermöglichte das klinische Studium der Symptome und des Verlaufs von Geisteskrankheiten. Es kam zu einer Längsschnittbeobachtung psychisch Kranker und somit zu einem erweiterten Verständnis psychiatrischer Symptomatik. Dies wiederum brachte neue Erklärungsansätze abweichenden Verhaltens hervor. Kriminalität wurde medikalisiert und führte im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu einer engeren Koppelung von Justiz und Medizin, insbesondere ihrer sich gerade etablierenden Teildisziplin Psychiatrie. Dieser Prozess war von mehreren Faktoren getragen, die sich wie folgt beschreiben lassen und nachfolgend erörtert werden sollen:
1. Der Grundsatz der Willens- bzw. Handlungsfreiheit fand im ausgehenden 18. Jahrhundert Eingang in das bürgerliche Strafrecht und hatte eine Psychologisierung bzw. Medikalisierung kriminellen Verhaltens zur Folge. Die Willensfreiheit fungierte nun als neues Kriterium für die Zurechnungsfähigkeit und führte zur Berücksichtigung der individuellen, psychischen Verfassung des Täters.
2. Ein psychiatrisches Lehrgebäude war im Entstehen begriffen. Damit verbunden war die Erweiterung des Krankheitsbegriffs. Psychische Krankheit galt nicht mehr allein als eine Störung des Verstandes, sondern auch der Gefühle und des Willens. Dies führte zur Ausdifferenzierung neuer psychischer Krankheitsbilder. Die sogenannten zweifelhaften Gemüthszustände (u.a. amentia occulta, manie sans délire, Monomanien) waren von besonderer Bedeutung für die Herausbildung und Etablierung der forensischen Psychiatrie.
3. Trotz Zweifel an der Existenz solcher Krankheitsbilder war man sich im Prinzip einig, dass es einen Bereich von „Befindens- und Verhaltensstörungen“ gab, der auch ohne somatisch nachweisbar zu sein, der Medizin respektive der Psychiatrie zuzurechnen war.
4. Das Wissen der Psychiater ging durch ihre in den neu entstandenen Anstalten gesammelten Erfahrungen weit über das laienhafte der Philosophen, aber auch über das der Juristen hinaus. Psychiater waren um die Mitte des 19. Jahrhunderts als Experten in forensischen Fragen anerkannt. Sie waren prädestiniert, psychische Erkrankungen zu diagnostizieren sowie eine Prognose bezüglich der Heilbarkeit und der von dem Delinquenten ausgehenden möglichen weiteren Gefahr für die bürgerliche Gesellschaft zu erstellen. Dies galt nicht nur bei erkennbaren somatischen Auffälligkeiten, sondern eben auch bei den sogenannten „zweifelhaften Gemüthszuständen“.
1.4Die Etablierung der forensischen Psychiatrie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Das 19. Jahrhundert war die Epoche der großen Strafrechtskodifikationen. In vielen Staaten des Deutschen Reiches entstanden neue Partikular-Gesetze, die bedeutendsten in Preußen, Bayern und Baden. Nun wurden die Bestimmungen über die Behandlung jugendlicher Täter festgelegt und damit eine Behandlungswillkür weitgehend ausgeschlossen. Das erste Gesetzeswerk eines deutschen Staates war das 1794 in Kraft getretene „Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten“ (ALR). Die strafrechtlichen Bestimmungen sind in 1.577 Paragrafen niedergelegt, nur ein einziger, nämlich § 17 fokussiert auf die Behandlung junger Straftäter. Darin heißt es: „Unmündige und schwachsinnige Personen können zwar zur Verhütung fernerer Verbrechen gezüchtigt, niemals aber nach der Strenge des Gesetzes bestraft werden.“ (T. II, 20. T. § 17). Als unmündig galten diejenigen, die das 14. Lebensjahr noch nicht überschritten hatten. In der juristischen Praxis des Königsreichs Preußen unterteilte man diese Lebensspanne jedoch nochmals. Kinder unter 7 Jahren wurden milde behandelt. Sie waren im Allgemeinen auch von Züchtigungen ausgeschlossen und gingen in der Regel völlig straffrei aus. Straftäter, die älter als 14 Jahre waren, unterlagen hingegen der uneingeschränkten strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Diese war nur dann ausgeschlossen, wenn der Täter frei zu handeln unvermögend war. Der am Beginn des Strafrechtsteils des ALR stehende, bewusst unspezifisch formulierte Passus „Wer frey zu handeln unvermögend ist, bei dem findet kein Verbrechen, also auch keine Strafe statt“ (T. II, 20. T. § 16) fand auf Kinder und psychisch Kranke Anwendung. Die Handlungsfreiheit, bei unter 14-Jährigen infolge des Mangels an Vernunft generell ausgeschlossen, galt nun als elementare Voraussetzung der Zurechnungsfähigkeit. Sie implizierte, dass der Mensch und sein Handeln frei seien, sofern er willensfähig ist. Damit wurden die Handlungsbzw. Willensfreiheit zu einem neuen Kriterium der Zurechnungsfähigkeit, zum „Kernbestandteil bürgerlicher Identität“, wie es Doris Kaufmann formulierte (Kaufmann 1995: 78).
Der Gedanke der Freiheit des Willens als Ausgangspunkt für vernünftiges Handeln stammte aus dem Naturrecht. Er spielte im Strafrecht der Zeit und gekoppelt daran zunehmend bei der medizinisch-forensischen Beurteilung eine herausragende Bedeutung. Die im Zuge der Aufklärung sich verfestigende Idee des Rechts auf persönliche Freiheit beförderte den Blick auf den Menschen als Einzelwesen in seiner jeweiligen Besonderheit. Vordenker einer solchen Entwicklung war Samuel Pufendorf (1632–1694), der mit seiner Imputationslehre maßgeblichen Einfluss auf die deutsche und europäische Rechtsphilosophie des 18. und 19. Jahrhunderts hatte. Pufendorf hatte die imputatio (die Zurechnung) als terminus technicus eingeführt und verstand darunter auch die Betrachtung der subjektiven Voraussetzungen für eine begangene Straftat. Erstmals wurden in größerem Umfang Wesen und Natur menschlicher Handlungen untersucht, zum einen auf das Verhältnis der Handlungen zum Willen und Intellekt, zum anderen auf ihre Beziehungen zum Sittengesetz. Der Blick der Sachverständigen verlagerte sich. In der Folge begann man, deviantes Verhalten und damit möglicherweise einhergehende psychische Erkrankungen nicht länger göttlich oder dämonologisch, sondern rational zu deuten. Ebenso erwuchs die Kompetenz des Strafwesens nicht mehr aus einer göttlichen Direktive, sondern aus der Ermittlung einer inneren Ratio unterliegenden Handlung eines Individuums. Erschien diese Handlung wider die Vernunft, galt es, möglichst empirisch nachweisbare Ursachen ausfindig zu machen. Eine solche Suche trug zu einem neuen anthropologischen Wissen über die innere Natur des Menschen bei. So konnte es nicht ausbleiben, dass die Beschäftigung mit der menschlichen Psyche auch und gerade deren Abartigkeiten und Pathologien zu Tage förderte. Dahinter stand die von den Aufklärern vertretene Auffassung, man könne die innere Natur des Menschen am besten durch die Kenntnis jener erforschen, die die Grenzen des „Vernünftigen“ und „Moralischen“ überschritten: Menschen mit deviantem Verhalten. Zwangsläufig stellte sich auch die Frage nach den Beweggründen einer strafbaren Handlung. Es ging darum festzustellen, inwieweit menschliche Willensentscheidungen frei oder vorherbestimmt sind und welche Faktoren eine mögliche Wahlfreiheit einschränkten oder gar verhinderten. Der Fokus lag nun nicht mehr auf der strafbaren Handlung an sich, d.h. die Perspektive verlagerte sich von der Tat zum Täter und somit auf die psychologische Motivation für die begangene Straftat. Es kam zur Berücksichtigung der individuellen psychischen Verfassung des Täters. Bei jungen Delinquenten galt es zudem festzustellen, ob die Straftat mit oder ohne „malitia“, also besonderer Boshaftigkeit oder Heimtücke begangen worden war. Der Grundsatz malitia supplet aetatem implizierte, dass man von der Schwere des Delikts auf die Reife des Täters schließen könne. Auch hier war also auf psychische Besonderheiten und Auffälligkeiten zu achten, wobei in der forensischen Praxis Mediziner bei Kindern und Jugendlichen seltener zu Rate gezogen wurden als bei Erwachsenen. Ging man bei ihnen von vornherein davon aus, dass ihre Handlungsfreiheit eingeschränkt war – ein Grund, warum psychische Erkrankungen bei Kindern eher selten explizit untersucht wurden – so setzte der Gesetzgeber bei erwachsenen Straftätern vorerst den freien Willen des Einzelnen, d.h. die Fähigkeit des selbständigen, überlegten besonnenen Wollens und Handelns und demgemäß die Zurechnung für die begangene Tat voraus. Damit hielt man sich weitgehend an Immanuel Kants (1724–1804) Theorem, dass dem Menschen ein Vermögen beiwohnt, sich unabhängig von der Nötigung durch sinnliche Antriebe selbst zu bestimmen. Warum aber, so zeigte die Erfahrung, agierte der als frei handelnd angesehene Mensch nicht immer (moralisch) vernünftig? Offensichtlich deshalb nicht, weil er nicht immer in der Lage war, seine Leidenschaften, Triebe und Affekte zu zügeln. Der seit der Aufklärung als Vernunftwesen deklarierte Mensch erschien nicht selten als, wie es Heinrich Heine (1797–1856) formulierte, unberechenbare Größe voller Spitzbübereien. Dies hatten gerade die seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert so zahlreich gesammelten kriminalpsychologischen Fakten nahe gelegt; erst recht dann, wenn durch Krankheit das Gleichgewicht physischer und psychischer Komponenten außer Kraft gesetzt war. Besonders psychische Störungen konnten dazu führen, dass das Individuum die bewusste Herrschaft über sein Wollen und Handeln, seinen Willen, verloren hatte. Neben der Anerkennung somatischer Gründe, fand man seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert die Ursachen psychischer Erkrankungen zunehmend in der Abhängigkeit von Sinnesreizen, Leidenschaften, Affekten und Trieben. Die Beschreibungen psychischer Störungen ohne offensichtliche Beeinträchtigung der intellektuellen Fähigkeiten begannen, einen immer breiteren Raum einzunehmen. Ins Blickfeld der juristischen Praxis trat eine neue Gattung psychischer Erkrankungen: die „zweifelhaften Gemüthszustände“; zweifelhaft deshalb, weil weder vor noch nach der Tat Spuren für eine psychische Erkrankung erkennbar waren, die Täter zumeist mit wohlbedachter Überlegung zu Werke gingen und demzufolge ihren Verstand gebrauchten. Die „zweifelhaften Gemüthszustände“ firmierten unter zahlreichen Wortschöpfungen, so z.B. unter raptus melancholicus oder furibundus, furor melancholicus licet transitorio, mania transitoria, melancholia activa transitoria, incandescentia, excandescentia furibunda, furor transitorius, folie instantanée oder raisonnante, sowie unter den deutschen Bezeichnungen „Wuth ohne Verkehrtheit des Verstandes“ oder „Anreiz durch gebundenen Vorsatz“ u.a.m. In der forensischen Praxis waren drei von besonderer Bedeutung. Es waren die Krankheitsbilder der amentia occulta, manie sans délire und besonders das der Monomanien. So definierte sich die amentia occulta (versteckter Wahnsinn) als psychische Erkrankung, bei der der Verstand durch den Einfluss einer einzigen Idee (oder weniger Ideen) den Willen zu den vernunftwidrigsten Handlungen antrieb (Haack et al. 2008). Ganz ähnlich beschrieb der berühmte französische Psychiater Philippe Pinel (1745–1826) die manie sans délire, nämlich: Keine in die Augen fallende Veränderung der Verstandesverrichtungen, wohl aber Verkehrtheit in den Willensäußerungen, nämlich ein blinder Antrieb zu gewalttätigen Handlungen, oder gar zur blutdürstigen Wut. Und auch sein Schüler Jean Étienne Dominic Esquirol (1772–1840) beschrieb in Erweiterung des Pinelschen Konzepts einen partiellen Wahnsinn (Monomanie), der sich fröhlich oder traurig, ruhig oder tobend äußern könne. Entsprechend flexibel war ein solcher Begriff zu handhaben. Esquirols Lehre der Monomanien bestimmte seit spätestens den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts die psychiatrisch-forensische Diskussion in Deutschland. Seit der Antike war man davon ausgegangen, dass „Geisteskranke“ überhaupt keine Vernunft besaßen oder diese durch Krankheit so eingeschränkt war, dass sie von ihr keinen Gebrauch mehr machen konnten. Nun war eine psychische Erkrankung nicht mehr zwingend an das Fehlen der Vernunft bzw. des Verstandes gekoppelt und musste demzufolge auch nicht augenscheinlich sein. Dieser Umstand machte die Attraktivität der „zweifelhaften Gemüthszustände“ vor Gericht aus. Es kam in foro zu einer verstärkten Diagnosestellung solcher Krankheitsbilder. Geschuldet war dies der Tatsache, dass die meisten Partikular-Gesetzbücher nun vorschrieben, der Richter müsse beim Verdacht des Vorliegens einer psychischen Erkrankung eines Straftäters einen Arzt zu Rate ziehen. Noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hatte er, zumeist ohne Konsultation eines medizinischen Experten, die alleinige Entscheidung getroffen, ob ein Straftäter zurechnungsfähig war oder nicht. Mit den neuen gesetzlichen Vorschriften ergab sich auch eine neue Situation. So verfügte beispielsweise der Paragraf 280 der preußischen Kriminalordnung aus dem Jahr 1805: „Auf die Beschaffenheit des Gemüthszustandes eines Angeschuldigten muß der Richter fortwährend ein genaues Augenmerk richten [...] Finden sich Spuren einer Verwirrung oder Schwäche des Verstandes, so muß der Richter mit Zuziehung des Physikus oder eines approbirten Arztes den Gemüthszustand des Angeschuldigten zu erforschen bemühet seyn, [...] wobei der Sachverständige sein Guthachten über den vermutlichen Grund und die wahrscheinliche Entstehungszeit des entdeckten Mangels der Seelenkräfte abzugeben hat.“ Die Folge war eine zunehmende Koppelung von Justiz und Medizin. Viele Juristen sahen ihre Autorität und die des Staates untergraben. Sie witterten gar das Ende der Kriminaljustiz. Die Entscheidungshoheit in Fragen der Zurechnungsfähigkeit schien auf dem Prüfstand zu stehen. Letzten Endes kristallisierte sich jedoch der Weg in die bis heute praktizierte Richtung heraus, bei dem die Mediziner den Richtern ein möglichst objektives medizinisches und nachvollziehbares Fundament für deren Entscheidung liefern sollten. Die Schuldfähigkeitsproblematik wurde zunehmend an die Erkenntnisse der Medizin und besonders der Psychiatrie gekoppelt. Psychiater waren nun die Experten. Sie galten als Sachverständige der kranken Seele und waren doppelt prädestiniert, sowohl somatisch bedingte als auch rein psychische Störungen diagnostizieren zu können. Ihre in den Anstalten gesammelten Erfahrungen stützten die Existenz der neu beschriebenen psychischen Erkrankungen. Trotz bestehender Zweifel war man sich im Prinzip einig, dass es einen Bereich von „Befindens- und Verhaltensstörungen“ gab, der auch ohne somatisch nachweisbar zu sein, der Medizin, spezifisch der Psychiatrie zuzurechnen war. Um einen solchen Nachweis erbringen zu können, musste die psychologische Untersuchung (Lebenslauf, Auffälligkeiten, gesellschaftliches Umfeld, Motive und Umstände der Tat) in die Medizin eingebunden werden. Psychisch determinierte Kriminalität wurde aus der strafrechtlichen Beurteilung herausgelöst und einer anderen, der psychiatrisch-institutionellen Ordnung unterworfen. Deviantes Verhalten wurde medikalisiert. Die Psychiatrie erhielt Zutritt zum juristischen Praxisfeld und wurde somit selbst gerichtliche Disziplin, die, gekoppelt an ihr medizinisches Fundament, eine eigene Entwicklung nahm, eigenständige Konturen annahm und sich als medizinisch-forensische Subdisziplin während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts etablieren konnte. Als solche sekundierte sie Justiz und Staat. Ihr kam dabei eine besondere Aufgabe zu: das Herausfiltern derjenigen, die sich dem durch die Vernunft fundierten Gemeinwillen nicht freiwillig unterordnen konnten, diejenigen also, die krankheitsbedingt „unvernünftig“ waren. Zugute kam der Psychiatrie dabei der Umstand, dass sie sich als medizinische Disziplin verstand, und die, wenn auch fast ausschließlich somatisch orientierte, Gerichtsmedizin (auch die Chirurgie und Hebammenkunde) schon seit langem eine wichtige Säule im forensischen Prozess war. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts konnte sie sich sowohl durch die Erfahrungen der Psychiater bei der forensischen Begutachtung als auch im Umgang mit psychisch kranken Rechtsbrechern in den Anstalten von der Gerichtsmedizin emanzipieren.
1.5Der wachsende Einfluss der Medizin auf den Umgang mit Straftätern
Dass die Medizin im Verlauf des 19. Jahrhunderts ihren Einfluss auf die Behandlung von Straftätern, auch jungen Straftätern, ausbaute, zeigt sich u.a. in der Strafgesetzgebung des Norddeutschen Bundes, die die Grundlage für ein einheitliches deutsches Strafrecht bildete. Erstmals wurde der Zeitpunkt des Eintritts der Strafmündigkeit nicht nur aus juristischer, sondern auch medizinischer Sicht entschieden. Dazu wurde eigens ein Gutachten der wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen erstellt. Der „Entwurf eines Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund“ von 1869 orientierte sich an diesen medizinischen Vorgaben. Kinder unter 12 Jahren konnten strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden, zwischen 12 und 16 Jahren nur dann, wenn der Richter das Vorliegen des Unterscheidungsvermögens bei ihnen festgestellt hatte. Das 16. Lebensjahr galt zunächst als Grenze zur vollen Strafmündigkeit. Im Reichsstrafgesetzbuch (RStGB) von 1871 wurde diese Grenze noch einmal nach oben, auf Vollendung des 18. Lebensjahres verschoben, wobei junge Straftäter bis zum Alter von 20 Jahren in Besserungsanstalten untergebracht werden konnten (§§ 56 und 57, Abs. 1). Die alte Zersplitterung war mit den Regelungen des RStGB beseitigt. Ein eigenständiges Jugendstrafrecht gab es jedoch noch immer nicht.
Und noch eine Entwicklung zeichnete sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ab, die ohne den Einfluss der nun zunehmend naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin respektive Psychiatrie nicht möglich gewesen wäre. Der kriminologische Diskurs veränderte sich. Die Idee einer fortschreitenden Eigenständigkeit von Vernunft und Freiheit, wie sie sich in den Anschauungen der am forensisch-kriminologischen Diskurs Beteiligten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch gezeigt hatte, verlor nun ihre legitimierende Funktion. Durch Verbrechensstatistiken, die Problematisierung des Strafvollzugs durch die neu entstandene Gefängniswissenschaft sowie eine effizientere Strafverfolgung durch die Vervollkommnung polizeilicher Ermittlungsverfahren rückten Kriminalität und abweichendes Verhalten zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit. Die bürgerliche Gesellschaft schien der wachsenden Zahl pathologisierter Straftäter ohnmächtig gegenüberzustehen und entwickelte neue Deutungsmuster. Der veränderte kriminologische Diskurs war nun geprägt von Degenerationslehre und Evolutionstheorie. Er ermöglichte eine zunehmende Pathologisierung sozialer Devianz, wie sie sich etwa in der Lehre Bénédict Augustin Morels (1809–1873), den Ideen vom „delinquente nato“ des italienischen Psychiaters Cesare Lombroso (1836–1909) und bald auch in den Psychopathiekonzepten des 20. Jahrhunderts niederschlug. Es sei an Julius Ludwig August Kochs (1841–1908) Konzept der „Psychopathischen Minderwertigkeiten“, Emil Kraepelins (1856–1926) „Entartungsirresein“ oder Theodor Ziehens (1862–1950) „Psychopathische Konstitution“ erinnert. Psychisch kranke Straftäter, insbesondere Wiederholungstäter, galten nun als doppelt belastet und wurden als asozial und minderwertig stigmatisiert bzw. typisiert. Devianz wurde auf eine psychopathische Persönlichkeitsstruktur zurückgeführt, die erblich bedingt und weder therapeutisch noch pädagogisch zu heilen war. Das Konzept der „psychopathischen Persönlichkeit“ galt um die Jahrhundertwende als wichtigstes Deutungsmuster kriminellen Verhaltens in der deutschsprachigen Psychiatrie. Die Folge war die Ausgliederung solch „gefährlicher Individuen“ durch ein System sichernder Maßnahmen, so etwa in Form des „Festen Hauses“ ab Ende des 19. Jahrhunderts. In der Folge kam es zu einer breit angelegten Diskussion über den Schutz der Gesellschaft vor sogenannten gemeingefährlichen psychisch Kranken und der Forderung nach einer entsprechenden Gesetzgebung über sichernde Maßregeln im Falle der Unzurechnungsfähigkeit. Zahlreiche Reformentwürfe prägten die Debatten im Kaiserreich und der Weimarer Republik, ohne jedoch vom Gesetzgeber umgesetzt zu werden. Auf der Grundlage der Reichsvorlage von 1927 kam es mit dem „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung“ ab November 1933 zur Einführung des Maßregelvollzugs. Im Vordergrund stand der Sicherungs- weniger der Behandlungsgedanke. Waren solche Tendenzen auch in der sich nun langsam herausbildenden Kinder- und Jugendpsychiatrie wahrnehmbar?
1.6Die Anfänge der (forensischen) Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie wurzelt sowohl in der Psychiatrie, Kinderheilkunde und der Pädagogik. Nicht zuletzt waren aber auch forensische Aspekte mitbestimmend, die am Ausgang des 19. Jahrhunderts die von der sozialen Norm abweichenden Kinder und Jugendlichen zunehmend ins Blickfeld der Gesellschaft und Wissenschaft rücken ließen. Dahinter stand ein neues Verständnis von Jugend und deren spezifischen Lebensphasen. In Anlehnung an Evolutionstheorien sah man in der Entwicklung des Kindes zum Erwachsenen einen Parallelismus zur Genese der menschlichen „Rasse“. Die Beschäftigung mit dieser Lebensphase versprach neue Erkenntnisse. Die Pädiatrie wurde eigenständige medizinische Disziplin, die Psychologie entdeckte die Kindheit als Schlüssel zur späteren Persönlichkeitsentwicklung und etablierte die empirische Entwicklungspsychologie als ein Spezialgebiet.
Hinzu kam, dass die Auswüchse der modernen, durch Industrialisierung, Landflucht, Verstädterung, Herausbildung eines Proletariats sowie Auflösung althergebrachter sozialer Strukturen geprägten Gesellschaft nicht mehr zu übersehen waren. Sie gipfelten in der Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen und damit einhergehender Kriminalität. Die seit 1882 geführte Reichskriminalstatistik offenbarte das Problem der Jugendkriminalität und gab den Anstoß für die wissenschaftliche und kriminalpolitische Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Es galt, wirksame Konzepte zu entwickeln. Der Staat versuchte durch die Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen solchen Auswüchsen entgegenzuwirken. 1900 wurde das Gesetz für die Fürsorgeerziehung Minderjähriger verabschiedet. Es regelte die Vormundschaft für u.a. uneheliche und für gefährdete Kinder, die notfalls auch zwangserzogen werden konnten. Dieses Fürsorgegesetz bildete die Grundlage für das 1922 verabschiedete und 1924 in Kraft getretene Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG), welches „jedem deutschen Kind [...] das Recht auf Erziehung zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit“ (§ 1) zubilligte. In den folgenden Jahren bemühte man sich, die Fürsorgepflege zu etablieren und sie von der Armenpflege abzugrenzen. Es entstanden Jugendheime, Fürsorgestellen sowie in psychiatrischen Einrichtungen spezielle Abteilungen für Kinder und Jugendliche. Der Paragraf 65 des RJWG regelte die ärztliche Gutachtertätigkeit. Danach konnten jugendliche Psychopathen bis zu 6 Wochen in psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalten untergebracht werden. Die Institutionalisierung der Fürsorge, auch die der psychiatrischen, hatte begonnen. Die Herausbildung einer spezifischen Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters war eng an das Problem der Devianz junger Menschen gekoppelt, welches um die Wende zum 20. Jahrhundert besonders deutlich zum Vorschein gekommen war. Man ging davon aus, dass sich psychische Auffälligkeit und Erkrankung bereits in jungen Jahren zeigen würde, sich später manifestiere und möglicherweise in Kriminalität münde. Die beobachtete Zunahme der Störungen des Sozialverhaltens erschütterte die bürgerliche Gesellschaft in ihren Grundfesten. Die bevorzugte Diagnose innerhalb der deutschen Psychiatrie wurde vor allem bei Jugendlichen die Psychopathie. Dahinter verbarg sich ein Sammelsurium nicht normgerechter Verhaltensweisen. Psychopathen, so die Definition Kochs, wurden als abnorme Persönlichkeiten definiert, die selbst unter ihrer Abnormität litten oder an deren Abnormität die Gesellschaft litt. Am Beispiel der Psychopathie zeigt sich besonders deutlich, dass Krankheitsentitäten keine fest definierbaren Größen sind, die unabhängig vom historisch-kulturellen Kontext existieren. Krankheit und unsere Vorstellung von ihr werden durch kulturelle und soziale Wahrnehmungen, Körperbilder und Erklärungsmodelle geprägt. Das Konstrukt der Psychopathie wurde mit abweichendem Verhalten und Kriminalität gleichgesetzt und damit als Gefahr aufgefasst, der es zu begegnen galt. So resümierte etwa der Psychiater Karl Kleist (1879–1960), dass die Verwahrlosung während und nach dem Ersten Weltkrieg einen erschreckenden Umfang angenommen habe und erhob die Psychopathenfürsorge zu einer der dringendsten Friedenaufgaben: „Die rechtzeitige Erkennung und die Fürsorge der Psychopathen ist demnach eine ungemein wichtige soziale Aufgabe, die aber bisher noch wenig in Angriff genommen ist [...] Es ist [...] zu erstreben, dass die vorhandenen Anstalten für Psychisch-Abnorme den Zwecken der Erkennung der Psychopathen dienstbar gemacht werden [...]“ (LHAS. 5.12–7/1). Man überantwortete das Problem der Psychopathie der juristischen, fürsorgerischen (im weitesten Sinne pädagogischen) und psychiatrischen Ordnung. Die Tendenz, psychisch kranke Straftäter in eigenen Abteilungen unterzubringen – sei es in Gefängnissen oder auch in Heil- und Pflegeanstalten – nahm zu. Sie zeigt sich auch deutlich in der steigenden Anzahl sogenannter Beobachtungsabteilungen für Psychopathen in psychiatrischen Kliniken und Anstalten. So fungierte die Kinder- und Jugendpsychiatrie von Anfang an auch als forensische Disziplin zur Normierung des bürgerlichen Subjekts mit dem Ziel der Kriminalitätsbewältigung.
1.7Eigenständige Jugendgesetzgebung zwischen Liberalisierung und Radikalisierung
Während des Ersten Weltkrieges und der angespannten Situation in den ersten Jahren der Weimarer Republik verschärfte sich das Problem der Jugendverwahrlosung und -kriminalität noch weiter. Nun galt es, die schon seit Langem im Raum stehende Forderung nach einem eigenständigen Jugendstrafrecht endlich umzusetzen. Am 1. Juli 1923 trat das Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Kraft. Erstmals wurde dem Erziehungsgedanken Vorrang vor dem Rechtsgedanken eingeräumt. Die Strafmündigkeit wurde vom 12. auf das 14. Lebensjahr heraufgesetzt. Bestrafung, die eine gewisse sittliche Reife voraussetzte, sollte nur dann erfolgen, wenn Erziehungsmaßregeln (Verwarnung, Überweisung an Erziehungsberechtigte bzw. Schulen, Unterbringung in Heimen u.a.) nicht ausreichten. Die Höchststrafe wurde auf 10 Jahre festgesetzt. Kleinere Delikte konnten straffrei bleiben. Es kam zur systematischen Einrichtung reiner Jugendgerichte, die Jugendgerichtshilfe wurde eingeführt, der Ausschluss der Öffentlichkeit gängige Praxis. Auch wenn die Realität des Weimarer Staates, nicht zuletzt aufgrund der desolaten finanziellen Situation, hinter der Theorie zurückblieb, war das JGG ein fortschrittliches Gesetzeswerk. Es trug bereits die Grundzüge des heutigen Jugendgerichtsgesetzes.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden viele positive Errungenschaften wieder rückgängig gemacht. Wie nie zuvor in der Geschichte rückte die Jugend als Zukunft des gesunden „Volkskörpers“ in den Fokus der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Das Resultat war ein expandierendes System von Kontrollen und Strafmaßnahmen gegen Jugendliche, die von der Norm abwichen – eine Norm, die sowohl gesellschaftliche Außenseiter als auch körperlich und psychisch Kranke wie Behinderte ausschloss und aus der Verabsolutierung des vermeintlichen Nutzens für eine Gesellschaft resultierte, deren Grenzen immer enger gesteckt wurden. Recht war nicht mehr originär, sondern hatte sich dem Dienst an der Volksgemeinschaft unterzuordnen. Die Idee der Erziehung durch vergeltende Strafe rückte erneut in den Vordergrund. Es gab Überlegungen, die Eigenständigkeit des Jugendgerichtsgesetzes wieder aufzulösen; eine Position, die sich schließlich nicht durchzusetzen vermochte, jedoch die Debatte über die Erneuerung des Jugendstrafrechts im Sinne einer NS-adäquaten Behandlung jugendlicher Delinquenter zur Folge hatte. Konkret bedeutete dies eine verschärfte Vorgehensweise gegenüber „Abweichlern“. 1939 trat, auf persönliche Anordnung Hitlers, die Verordnung zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher in Kraft. Somit konnten auch unter 18-Jährige nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. 1940 wurde der Jugendarrest eingeführt, 1941 die Jugendgefängnisstrafe von unbestimmter Dauer. Das Reichsjugendgesetz (RJGG) von 1943 beseitigte die Strafaussetzung zur Bewährung, die Strafmündigkeit wurde bei schweren Delikten auf 12 Jahre herabgesetzt. Angehörige „nichtarischer“ Volksgruppen, wie Juden, Polen oder „Zigeuner“ waren nach den Richtlinien zu § 1, Abs. 2 praktisch rechtlos. Dies waren auch, wenn gesetzlich auch keineswegs verankert, psychisch kranke und/oder behinderte Kinder und Jugendliche bzw. „Unverbesserliche“ und „Unerziehbare“. Es ist zu bedenken, dass bereits diejenigen als verwahrlost und potenziell kriminell angesehen wurden, die sich den Zwängen der staatlichen Jugenderziehung verweigerten. Kinder und Jugendliche, die aus gesundheitlichen, sozialen, politischen oder „rassischen“ Gründen von den Normvorstellungen des nationalsozialistischen Staates abwichen, schwebten plötzlich in Lebensgefahr. Etikettiert als „Ballastexistenzen“, „Minderwertige“ oder „Asoziale“ fielen zahllose von ihnen Zwangssterilisationen, Zwangsinternierungen und nicht zuletzt dem unter dem euphemistischen Begriff „Euthanasie“ begangenen systematischen Mord zwischen 1939 und 1945 zum Opfer.
1.8Die Verbrechen an psychisch kranken, behinderten und „asozialen“ Kindern und Jugendlichen in der Zeit des Nationalsozialismus unter besonderer Berücksichtigung der Verbindung von Psychiatrie und Jugendfürsorge
Bereits in der Weimarer Republik hatten sich Radikalisierungstendenzen gegenüber kranken und behinderten Menschen abgezeichnet. Das Hungersterben in der Psychiatrie während und nach dem Ersten Weltkrieg war mit ökonomischen Zwängen gerechtfertigt, die, nun gekoppelt an sozialdarwinistische und völkische Überlegungen, als Notwendigkeit im Kampf des Überlebens der Starken gegen die Schwachen propagiert wurden. Diese zunehmend kompromisslose Gesinnungsverhärtung gipfelte in der 1920 erschienen Schrift „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ des Juristen Karl Binding (1841–1920) und des Psychiaters Alfred E. Hoche (1865–1943). Noch war eine solche „Freigabe zur Vernichtung“ Theorie. Unter dem Bedingungsrahmen des nationalsozialistischen „Doppelstaates“ (Ernst Fränkel) mündeten diese Überlegungen ab 1939 schließlich im systematischen Mord an psychisch kranken und/oder behinderten Menschen. Zuvor waren viele von ihnen bereits zwangssterilisiert worden. Man schätzt, dass im Rahmen des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ (GzVeN) mindestens 400.000 Menschen davon betroffen waren. Zirka 300.000 Psychiatriepatienten wurden unter dem Begriff der „Euthanasie“ – wörtlich: der leichte, gute Tod – zwischen 1939 und 1945 ermordet. Ihr Tod war alles andere als leicht. Sie wurden erschossen, vergast, mit Tabletten oder Injektionen getötet oder mussten verhungern. Die Darstellung des „Euthanasie“-Komplexes muss im Kontext der Planung, Organisation, Steuerung und Finanzierung des nationalsozialistischen Gesundheitssystems insgesamt betrachtet werden. Vor dem Hintergrund der Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung während des Zweiten Weltkrieges war die Tötung eine Folge des Verdrängungsprozesses, bei denen Psychiatriepatienten der geringste Stellenwert zugemessen wurde. „Verbrecherische Geisteskranke“, die nach § 42b untergebracht und von denen nicht wenige bereits im Rahmen der „Aktion T4“ selektiert und getötet worden waren, wurden ab 1943 auf Anweisung des Reichsinnenministeriums in Konzentrationslager deportiert. Damit wollte man die besonders Störenden, die zudem eine erhöhte Aufmerksamkeit erforderten, aus der Anstalt herausnehmen, zugleich jedoch ihre Arbeitskraft nutzen. Diese letzte Option entfiel bei Kindern, bei Jugendlichen war sie eingeschränkt. Da der Wert des Einzelnen sich ausschließlich an der Verabsolutierung des vermeintlichen Nutzens für die Gesellschaft orientierte, bei der die Idee der Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ längst kein Tabu mehr war, verwundert es kaum, dass gerade die Schwächsten Opfer der NS-Gesundheitspolitik wurden: Schätzungsweise 5.000 bis 10.000 kranke und behinderte Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen der „Euthanasie“-Maßnahmen getötet (vgl. Schmuhl 2011; Haack et al. 2013).
Ihr Weg in die Vernichtung konnte auf mehreren Ebenen stattfinden: in den sogenannten Kinderfachabteilungen, die im Zuge der „Kindereuthanasie“ entstanden waren, im Rahmen der „Aktion T4“, bei der auch Minderjährige der Vergasung in den „Euthanasie-Anstalten“ zum Opfer gefallen sind, bei der „wilden Euthanasie“ in Kliniken, Anstalten oder Heimen und schließlich auch in den sogenannten „Jugendschutzlagern“, die nichts anderes als Konzentrationslager für schwer erziehbare Jugendliche waren.
Neben der zweifelsohne noch vorhandenen helfend-heilenden Aufgabe kam der Psychiatrie immer mehr die des Selektierens und schließlich des Tötens zu. Selbst Kinder unter 10 Jahren wurden „in die Nervenklinik [...] für etwaige Schritte der Zwangssterilisation“ eingeliefert (Krankenblattarchiv Zentrum für Nervenheilkunde Universität Rostock [KbAR]). Unter spezifisch jugendpsychiatrisch-forensischem Aspekt standen kriminell „Schwachsinnige“ und vor allem Psychopathen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der Umgang mit den letztgenannten gestaltete sich im Allgemeinen schwieriger. Sogenannte „Asoziale und psychopathisch Kriminelle“, die als nicht erziehbar galten, sollten ausgesondert werden. Psychiater bereisten Fürsorge-, Kinder- und Beobachtungsheime in „Fragen der Zöglingsauslese“. Umgekehrt wurden Jugendliche zur Beobachtung in psychiatrische Klinken eingewiesen. Dem Sprachduktus der Zeit entsprechend, lesen sich die häufig identischen Einträge in den Krankenakten wie folgt: „Psychopathie, willensschwach, sexuell triebhaft. Primitive Persönlichkeit“, „intellektuell minderbegabt, verlogen, verführbar, kriminell“ oder „reizbare, asoziale, erethische Psychopathin“. Zumeist folgte der Hinweis auf die Nicht- bzw. Schwererziehbarkeit mit der Empfehlung zur Unterbringung in der geschlossenen Fürsorgeerziehung oder sogar im Jugendschutzlager (alle Angaben KbAR). Wie in der forensischen Praxis mit solchen Psychopathen verfahren werden sollte, wurde auf der 22. Tagung der Deutschen Gesellschaft für gerichtliche und soziale Medizin 1934 in Hannover erörtert: „es sei verfehlt, Psychopathen [...] milder zu behandeln als Gesunde. Auf die [...] Widerstandsfähigkeit des Psychopathen könne durch ernste Strafen vielfach nachhaltiger eingewirkt werden als durch allzu große Milde.“ (Mueller 1934).
Fürsorgeerziehung, Pädagogik und Jugendpsychiatrie arbeiteten zunehmend Hand in Hand, eine eigentlich positive Entwicklung, wäre sie nicht primär unter der Aufgabenstellung der Selektion zustande gekommen. Der Psychiatrie kam nun eine Schlüsselfunktion als selektierende Instanz zu. Hinsichtlich der Mitwirkung von Psychiatern fasste der AFET (Allgemeine Fürsorge-Erziehungs-Tag) im Juli 1933 zusammen: „1. [...] besonders durch das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, sowie durch das zu erwartende Bewahrungsgesetz ergibt sich eine vermehrte Tätigkeit des Psychiaters in der FE. (Fürsorgeerziehung, K.H.) 2. Im Rahmen der von der Regierung angestrebten Einschränkungen minderwertigen Nachwuchses ist die psychiatrische Erfassung und Betreuung der in der FE. befindlichen Mj. (Minderjährigen, K.H.) planmässig zu gestalten.“ (Schäfer 2010: 7–8). Die gemeinsamen Anstrengungen spiegeln sich auch in der Etablierung der ersten deutschen kinderpsychiatrischen Gesellschaft wider, die als „Deutsche Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik“ 1940 in Wien gegründet wurde. Dabei war die heilpädagogische Ausrichtung durchaus nicht im Sinne aller Beteiligten. Einer der führenden Rassehygieniker des Deutschen Reichs und Vorsitzender der „Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater“, Ernst Rüdin (1874–1952), insistierte: „Die Gesellschaft darf nicht bloß heilpädagogisch aufgezogen werden, sonst bekommen wir unsere Erbminderwertigen nie los.“ (zit. nach Castell 2003: 78). Die Janusköpfigkeit dieser offiziellen Geburtsstunde der deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrie hat Müller-Küppers treffend beschrieben: „Da entwickelt sich das eigene Fachgebiet, wie in anderen europäischen Ländern [...] im Konsens zu einer Gemeinschaft von Ärzten und Pädagogen [...] Die deutsche Kinder- und Jugendpsychiatrie ist wegweisend und auf dem Prüfstand kollegialer Zusammenarbeit fast untadelig [...] Und was passiert in Wirklichkeit? Kinder werden ihren Eltern entzogen und fremdbestimmt [...] Man misshandelt und quält Kinder [...] Man lässt sie verwahrlosen [...] vergiftet sie. Man experimentiert mit ihnen [...] lässt sie verhungern.“ (Müller-Küppers 1998: 125).
Spätestens 1943 mit dem „Erziehungsfürsorge-Erlass“, der Jugendstrafrechtsverordnung und dem RJGG wurde die Orientierung der „Jugendhilfe“ deutlich. An erster Stelle stand die Strafe. Förderung erfuhren nur noch erbgesunde und somit wertvolle Jugendliche, auch als noch erziehbar eingeschätzte Kinder und Jugendliche erhielten eine „normale“ Fürsorgeerziehung. „Minderwertige“ hingegen sollten selektiert und in „Jugendschutzlagern“ untergebracht werden. Das in der Gesetzgebung von Weimar verankerte Recht jedes einzelnen Kindes auf Erziehung war damit, nun juristisch verankert, aufgegeben. De facto war es das bereits zuvor.
1.9Kontinuitäten und Brüche
Sowohl in der Fürsorgeerziehung als auch der Kinder- und Jugendpsychiatrie stellte das Ende des Nationalsozialismus keineswegs einen einschneidenden Bruch dar. Kontinuitäten zeigten sich neben dem personellen Fortbestand auch in den Funktionen beider Bereiche. Die einseitig betonten biologistischen Konzepte waren nicht diskutiert worden und wirkten weiter. Besonders deutlich zeigt sich eine solche Kontinuität in der Person Werner Villingers (1887–1961). Villinger hatte, wie es Holtkamp beschreibt, „zögerlich“ an der T4-Aktion mitgearbeitet: „Mit der Freigabe seiner psychiatrischen Patienten für Menschenversuche und der Beteiligung an der ‚Euthanasie’-Mordaktion war der ethisch-moralische Tiefstand seiner psychiatrischen Karriere erreicht.“ (Holtkamp 2002: 110). Er wurde 1946 Direktor der Universitätsnervenklinik Marburg und beschäftigte sich weiterhin schwerpunktmäßig mit psychiatrischen Problemen des Kindes- und Jugendalters. Die 1940 gegründete kinderpsychiatrische Gesellschaft wurde von Villinger 1950 wieder begründet, zunächst als „Verein für Jugendpsychiatrie, Heilpädagogik und Jugendpsychologie“, später unter dem Namen „Deutsche Vereinigung für Kinderpsychiatrie“. In seiner Person zeigt sich der ungebrochene Einfluss derjenigen Entscheidungsträger, die sowohl in der NS-Zeit als auch danach auf die Entwicklung der Kinder- und Jugendpsychiatrie entscheidenden Einfluss hatten. Bis zu seinem Tod im Jahre 1961 war Villinger der Vorsitzende der „Deutschen Vereinigung für Kinderpsychiatrie“. Er war maßgeblich an der Errichtung des ersten deutschen Lehrstuhls für Kinder- und Jugendpsychiatrie beteiligt, eingerichtet 1954 in Marburg.
Das Jugendstrafrecht erfuhr erst Anfang der 1950er-Jahre eine Änderung. Zuvor hatten die Alliierten bereits Richtlinien herausgegeben, die es verboten, Jugendliche wegen ihrer Rasse, Staatsangehörigkeit, Religion u.a. Gründen unterschiedlich zu behandeln. 1952 wurde ein neues Jugendgerichtsgesetz in der DDR verabschiedet, ein Jahr später in der BRD. In beiden deutschen Staaten wurde die Ungültigkeit der nationalsozialistischen Vorschriften betont. Die Gesetze orientierten sich am „Stand von Weimar“. Erziehungsmaßnahmen rückten wieder in den Vordergrund. Zuchtmittel wurden ersatzlos gestrichen. Das JGG der DDR galt bis 1968. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Jugendstrafrecht in das allgemeine Strafrecht der DDR eingegliedert.
Neben der Wiederherstellung des Primats der Erziehung bestand die wichtigste Neuerung des bundesdeutschen JGG in der Möglichkeit, auch Heranwachsende, also Angeklagte zwischen 18 und 21 Jahren, nach Jugendstrafrecht zu verurteilen. Die wieder eingeführte Strafaussetzung zur Bewährung wurde durch strengere Bestimmungen, angelehnt an die Bewährungshilfe nach englischem Muster, geregelt. Zum „Organ der Persönlichkeitsforschung“ des Straftäters avancierte die Jugendgerichtshilfe. Die Ermittlungen sollten sich nicht nur auf die Tat beschränken, sondern neben den äußeren auch die inneren Verhältnisse des jugendlichen Täters betrachten. Dazu sollte nach Möglichkeit ein befähigter Sachverständiger hinzugezogen werden.
Eine wirkliche Neuorientierung und damit einhergehende Umstrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe erfolgte 1990/91. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), seit dem 3. Oktober 1990 im Westen Deutschlands und dem 1. Januar 1991 im Osten angewandt, führte zum Wandel von der Fürsorgeerziehung zur Erziehungshilfe. Ab 01.01.1995 wurde das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz in der Bundesrepublik uneingeschränkt gültig. Ein verändertes Verständnis der Hilfe zur Erziehung ist gekoppelt an eine Vielzahl von ambulanten und stationären Hilfsangeboten, die vor allem präventiv wirken sollen. Begrüßenswert ist die familienorientierte Auslegung des Gesetzes, die auf die Einbeziehung der Betroffenen abzielt. Während im KJHG die Inanspruchnahme von Leistungen, also ein passives Abwarten bis zu einer erfolgten Antragstellung auf entsprechende Hilfen verankert war, enthält das am 03.06.2005 verabschiedete Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK) Handlungsnotwendigkeiten im Rahmen der Wächter- und Schutzfunktion der zuständigen Jugendämter also auch die aktive Rolle zur Abwehr von Kindeswohlgefährdung. Ein bis dato strittiger Punkt in der notwendigen Kooperation zwischen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die nicht ausreichende Bereitschaft der Jugendhilfe, ihrer Verpflichtung im Rahmen kriminalpräventativer freiheitsentziehender Unterbringungen bei Kindeswohlgefährdung nach § 1631b BGB flächendeckend nachzukommen.
Resümee
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie und besonders ihre forensische Subdisziplin sind sehr junge Fachrichtungen. Als eigenständiges Wissenschaftsgebiet bildete sie sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts heraus. Ihre Wurzeln liegen natürlich tiefer.
Grundsätzlich war es von alters her so, dass mit Kindern und psychisch kranken Straftätern anders verfahren wurde, als mit Erwachsenen und psychisch Gesunden. Die Klärung der Schuldfähigkeit, die im kindlichen oder jugendlichen Alter immer auch die Frage nach der sittlichen Reife eines Straftäters einschloss, war lange Zeit ausschließlich Sache des Richters. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert schrieben die meisten deutschen Partikular-Gesetzbücher vor, dass der Richter beim Verdacht des Vorliegens einer psychischen Erkrankung eines Straftäters einen Arzt zurate ziehen müsse. Übernahm diese Aufgabe zunächst noch der Stadtphysikus, so kristallisierte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr die Kompetenz der Psychiater heraus. Ihr Wissen ging durch ihre in den neu entstandenen Anstalten gesammelten Erfahrungen weit über das laienhafte anderer Berufsgruppen hinaus. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war das junge medizinische Fachgebiet der forensischen Psychiatrie eine die verschiedenen Dimensionen menschlichen Lebens und somit auch Krankwerdens und Krankseins integrierende Disziplin am Schnittpunkt von Medizin und Jurisprudenz, aber auch Anthropologie, Philosophie, Soziologie, Psychologie und anderer Wissenschaften. Es zeigte sich zunehmend, dass die Psychiatrie zum festen Bestandteil einer ehemals fast ausschließlich justiziellen Domäne geworden war. Den Bedingungsrahmen hierfür bildete ein administrativ organisierter Justizapparat, deren Vertreter bereit waren, bei der Klärung der Zurechnungsfähigkeit auf medizinische und zunehmend psychiatrische Fachkompetenz zurückzugreifen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts war es zu einer zunehmenden Koppelung von Psychiatrie und Justiz über den Begriff der Zurechnungsfähigkeit gekommen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewegte sich die Psychiatrie weg von einer phänomenologisch-anthropologischen Sichtweise hin zu einer stärker empiristisch-naturwissenschaftlichen Fundierung. Der medizinisch-psychiatrische Einfluss auf den Umgang mit Straftätern nahm weiter zu. Der kriminologische Diskurs, nun geprägt von Degenerationslehre und Evolutionstheorie, veränderte sich. Das Konzept der „psychopathischen Persönlichkeit“ galt als eines der wichtigsten Deutungsmuster für kriminelles Verhalten vor allem in der deutschen Psychiatrie und ging mit der Stigmatisierung von Menschen einher, die nun als erblich „asozial“ und „minderwertig“ galten. Die Auswirkungen der Industrialisierung verschärften das Problem der Kriminalität. Ganz besonders wurde dies bei Jugendlichen deutlich. Durch eine Reihe von Gesetzen, u.a. die juristisch verankerte Fürsorgeerziehung, sollte solchen Missständen entgegengewirkt werden. Auch die Psychiatrie wurde in den Prozess der „fürsorglichen Institutionalisierung“ am Beginn des 20. Jahrhunderts eingebunden. Auch wenn man erst auf dem Weg zur Herausbildung einer spezifischen (forensischen) Kinder- und Jugendpsychiatrie war, zeigt sich, dass ein solcher von vornherein an das Problem der Devianz junger Menschen gekoppelt war.
Das in der Weimarer Republik verabschiedete, durchaus fortschrittliche Jugendgerichtsgesetz (JGG) räumte erstmals den Primat der Erziehung vor Bestrafung ein. Damit ging die systematische Errichtung reiner Jugendgerichte, die Einführung der Jugendgerichtshilfe u.a.m. einher. Doch mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 wurde Vieles rückgängig gemacht. Die Erneuerung des Jugendstrafrechts, die dem Dienst an der Volksgemeinschaft untergeordnet und durch vergeltende Strafmaßnahmen geprägt war, hatte eine verschärfte Vorgehensweise gegen „Andersseiende“ zur Folge. Jugendliche, die als erziehbar galten, sollten in die Volksgemeinschaft als wertvolle Mitglieder zurückgeführt werden. Die Mittel hierfür waren ab 1939 sukzessive verschärft worden und mündeten in das Reichsjugendgesetz (RJGG) von 1943. Kinder und Jugendliche, die aus gesundheitlichen, sozialen, politischen oder „rassischen“ Gründen von der Norm abwichen, wurden als „Ballastexistenzen“, „Minderwertige“ oder „Asoziale“ etikettiert. Viele von ihnen fielen Zwangssterilisationen, Zwangsinternierungen und nicht zuletzt dem systematischen Mord zwischen 1939 und 1945 zum Opfer. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie fungierte hierbei zunehmend als selektierende Instanz.
Mit dem Beginn der 1950er-Jahre erfuhr das Jugendstrafrecht eine Änderung und wurde im Prinzip auf den „Stand von Weimar“ zurückgebracht. Erzieherische Maßnahmen rückten wieder in den Vordergrund. Im Sinne des Gesetzgebers werden diese durch das erst 1990/91 in Kraft getretene Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und das 2005 verabschiedete Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK) ergänzt.
Literatur
Castell R (2003) Geschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland in den Jahren 1937 bis 1961. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen
Fegert JM (1986) Zur Vorgeschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Z. Kinder- Jugendpsychiat. 14:126–44
Haack K, Steinberg H, Herpertz SC, Kumbier E (2008) „Vom versteckten Wahnsinn“ – Ernst Platners Schrift „De amentia occulta“ im Spannungsfeld von Medizin und Jurisprudenz im frühen 19. Jahrhundert. Psychiatr Prax. 35:84–90
Haack K, Kumbier E (2013) Verbrechen an Kindern und Jugendlichen in der NS-Zeit. Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother. 41 (Sonderheft): 12–19
Holtkamp M (2002) Werner Villinger (1887–1961). Die Kontinuität des Minderwertigkeitsgedankens in der Jugend- und Sozialpsychiatrie. Matthiesen Verlag Husum
Kaufmann D (1995) Aufklärung, bürgerliche Selbsterfahrung und die „Erfindung“ der Psychiatrie in Deutschland, 1770–1850. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen
Krankenblattarchiv des Zentrums für Nervenheilkunde Universität Rostock (KbAR)
LHAS. 5.12–7/1 Mecklenburg-Schwerinsches Ministerium für Unterricht, Kunst, geistliche und Medizinalangelegenheiten, Nr. 10068: Errichtung einer Anstalt für psychopathische Kinder
Mueller B (1934) Nationalsozialistische Strafgesetzgebung. Nervenarzt 24(1):114–34
Müller-Küppers M (1998) Die Entwicklung der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Nationalsozialismus. Spektrum d. Psychiat. Psychother. Nervenheilk. 27:122–29
Schäfer W (2002) Fürsorgeerziehung im Nationalsozialismus. Online unter: http://www.heimkinder-ueberlebende.org/Fuersorgeerziehung_im_Vaterland_-_1924-1991.html (abgerufen am 25.08.2014)
Schmuhl H-W (2011) Der Nationalsozialismus als biopolitische Entwicklungsdiktatur – Konsequenzen für die Kinderheilkunde. Monatsschrift Kinderheilkunde (Suppl. 1)





























