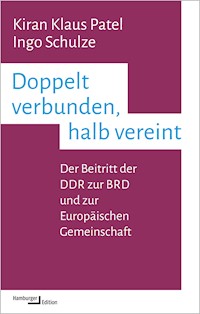22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die EU ist im Krisenmodus. Nach einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte scheint die Union nun erstmals in ihrer Existenz bedroht. Doch ist die heutige Situation wirklich so außergewöhnlich? Auf Grundlage der neuesten Forschung und eigener Archivrecherchen erzählt Kiran Klaus Patel die Geschichte der europäischen Integration im Kalten Krieg neu und taucht damit auch die Entwicklungen der Gegenwart in ein anderes Licht. Das Selbstbild der EU könnte strahlender nicht sein. Sie steht für Friedensstiftung, Wirtschaftswachstum, eine an Werten orientierte Politik sowie ein unaufhaltsam zusammenwachsendes Europa. Und im Rückblick will es so scheinen, als hätten ihre Vorläuferorganisationen dies alles ganz aus sich heraus und nahezu zwangsläufig geschaffen. In seinem mit überraschenden Einblicken gespickten Buch hinterfragt Kiran Klaus Patel diese Standarderzählung und macht deutlich, dass dieses überzogene Selbstbild das heutige Krisenempfinden unnötig verschärft, weil für neu und bedrohlich gehalten wird, was es immer schon gegeben hat. Eine kritische Geschichte, die fragt, wie die EU wirklich entstand – jenseits des Wunschbilds der politischen Sonntagsreden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Kiran Klaus Patel
Projekt Europa
Eine kritische Geschichte
C.H.Beck
Zum Buch
Die EU ist im Krisenmodus. Nach Jahrzehnten des Erfolgs scheint sie nun erstmals in ihrer Existenz bedroht. Doch ist die heutige Situation wirklich so außergewöhnlich? Das Selbstbild der EU könnte strahlender nicht sein. Sie steht für Friedensstiftung, Wirtschaftswachstum, eine an Werten orientierte Politik sowie ein zusammenwachsendes Europa. Und im Rückblick will es so scheinen, als hätten ihre Vorläuferorganisationen dies alles ganz aus sich heraus und nahezu zwangsläufig geschaffen. Auf Grundlage der neuesten Forschung und eigener Archivrecherchen hinterfragt Kiran Klaus Patel dieses Selbstbild und erzählt die Geschichte der europäischen Integration im Kalten Krieg neu. Dabei zeigt er zeigt das Projekt Europa ungeschminkt – jenseits des Wunschbildes politischer Sonntagsreden und billiger Polemik. Wer die Vorgeschichte der EU kennt und weiß, wie sie zu dem wurde, was sie ist, der sieht auch die Entwicklungen der Gegenwart in einem anderen Licht.
Über den Autor
Kiran Klaus Patel ist Professor für Europäische und Globale Geschichte und Inhaber des Jean-Monnet-Lehrstuhls für Geschichte an der Universität Maastricht.
Inhalt
Prolog
I. Europa und europäische Integration
Eine von vielen
Sui Generis
Aus drei mach eins
Gotische und andere Häuser
Die entscheidende unter allen
Dreierlei Antriebskräfte
Primat und Geometrie
Europa und europäische Integration: Bilanz
II. Frieden und Sicherheit
Kalter Krieg als Rahmen
Friede und Fragmentierung in (Klein)westeuropa
Frieden als Motiv, Frieden als Motor?
Sicherheitspolitische Anläufe
Frieden durch Vertrauen
Stabilität im Innern I
EG als Symbol und Synekdoche
Frieden und Sicherheit in der Welt
EG und Détente
Weltpolitik in den 1980er Jahren
Stabilität im Innern II
Jenseits des Kalten Krieges
Frieden und Sicherheit: Bilanz
III. Wirtschaftswachstum und Wohlstand
Die glorreichen Dreißig
Motoren des Wachstums
Eine willkommene Ergänzung
Nach dem Boom
Versteckte Effekte
Fragiles Wissen
Glück, Nostalgie und andere Effekte
Sozialpolitik à la EG
Ein neoliberales Europa?
Wirtschaftswachstum und Wohlstand: Bilanz
IV. Partizipation und Technokratie
Europa konkret machen
Engagement und seine Grenzen
Technokratischer Internationalismus
EG als Adiaphoron
Europa vs. EG
Am Volk vorbei?
Partizipation und Technokratie: Bilanz
V. Werte und Normen
Arbeitsteilung als Ausgangspunkt
Integration als Gefahr
Nagelprobe Spanien
Europarat als Inspiration
Die 1970er Jahre als Scharnierphase
Ein neues Sendungsbewusstsein
Werte und Normen: Bilanz
VI. Bürokratisches Monster oder nationales Instrument
Heim ins Gehäuse
Brüsseler David
Mausgrau, aber wirkungsvoll
Die Mikrophysik des Rechts I: Die Sprengkraft von Likör
Die Mikrophysik des Rechts II: Neue Konzeption und das entscheidende A
Im Rinderkarussell
Herausforderung Umsetzung
Der Seltenheitswert schwarzer Schafe
Brüsseler Monster oder nationales Instrument: Bilanz
VII. Desintegration und Dysfunktionalität
Algeriens Austritt auf Raten
Vom weichen zum harten Austritt
Desintegration und Dysfunktionalität als politische Normalität
Jenseits der Teleologie
Desintegration und Dysfunktionalität: Bilanz
VIII. Die Gemeinschaft und ihre Welt
Der Westen
Empire by Integration
Von schlecht zu schlechter?
Zum Akteur durch Handel
Eurafrique
Afrika assoziieren
Entwicklung à la Yaoundé
Lomés Welt
Gigant im Osten
Kleiner Bruder
Die Gemeinschaft und ihre Welt: Bilanz
Epilog
Projekt Europa: Lehren
Historia Magistra Vitae?
Dank
Anmerkungen
Prolog
I. Europa und europäische Integration
II. Frieden und Sicherheit
III. Wirtschaftswachstum und Wohlstand
IV. Partizipation und Technokratie
V. Werte und Normen
VI. Bürokratisches Monster oder nationales Instrument
VII. Desintegration und Dysfunktionalität
VIII. Die Gemeinschaft und ihre Welt
Epilog
Abkürzungsverzeichnis
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Archivalien
Belgien
Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten von Amerika
2. Quelleneditionen und offizielles Schrifttum
3. Literatur
Abbildungsnachweis
Register
Prolog
Ein Mann steht auf einer Leiter und schlägt mit Hammer und Meißel einen Stern aus der Flagge der EU heraus. 2017 malte der britische Street-Art-Künstler Banksy dieses Wandbild an ein Haus in der britischen Hafenstadt Dover, die seit der Antike ein wichtiger Verbindungspunkt zum Festland ist und heute knapp 20 Prozent des britischen Handels abwickelt. Wer sich hinter dem Pseudonym Banksy verbirgt, ist unbekannt; klar ist, dass sich sein Werk als Kommentar auf den Brexit versteht.
Tatsächlich scheint es heute oft so, als hätte die Europäische Union ihre besten Zeiten längst hinter sich und sei nach Dekaden des Erfolgs in den letzten Jahren in eine Existenzkrise geraten. Vor dem Brexit gab es die Debatte über den Grexit; hinzu kommen die weiteren Probleme der Eurozone oder etwa die Streitigkeiten im Umgang mit Geflüchteten. Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, ob das Einigungsprojekt demnächst scheitern oder zerfallen wird. Der Putz bröckelt, das Abbruchkommando ist unterwegs und die EU agiert im Krisenmodus.
Vor diesem Hintergrund strahlt die Vorgeschichte der Europäischen Union seit den 1950er Jahren in um so hellerem Licht. Immerhin erhielt die Union 2012, sechzig Jahre nach Gründung ihrer ältesten Vorläuferorganisation, den Friedensnobelpreis mit der Begründung, dass sie «über sechs Dekaden hinweg zum Fortschritt von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa» beigetragen habe.[1] Diese Errungenschaften gelten heute als gefährdet; mehr als nur ein Stern droht vom tiefblauen Himmel zu fallen. Insofern passt Banksys monumentales Kunstwerk, das die Außenwand eines dreistöckigen Gebäudes ausfüllt, ganz in unsere Tage und bildet einen direkten Kommentar zu einem der brennendsten Probleme des heutigen Europas.
Abbildung 1 · Banksys Wandgemälde in Dover, 2017
Allerdings verweist das scheinbar so plakative Wandbild auf manches erst auf den zweiten Blick. Man muss zum Beispiel genau hinsehen, um zu erkennen, dass die Wand schon Risse aufwies, bevor der von Banksy gemalte Abbrucharbeiter den Hammer schwang. Außerdem zerstört er den Sternenkranz, kann der Wand selbst jedoch wenig anhaben. Zugleich hat Banksy den Handwerker auf eine wackelige lange Leiter gemalt. Wie weit der Abbruch geht, und ob nicht der Mann gefährdeter ist als die EU-Flagge, lässt das Wandbild offen.
Andere Dinge sind dem Kunstwerk gar nicht zu entnehmen: Die Zahl der goldenen Sterne auf blauem Grund beträgt seit den 1950er Jahren zwölf – woran weder eine Erweiterung der EU noch der Brexit etwas ändern. Und mehr noch: In den ersten dreißig Jahren seiner Existenz war das Sternenbanner gar nicht das Symbol der EU oder ihrer Vorläufer, sondern einer deutlich weniger bekannten, eigenständigen Organisation, des Europarats. Niemand hätte das Wandbild verstanden, hätte Banksy es bereits 1973 gemalt, als das Vereinigte Königreich der damaligen Vorgängerin der EU, der Europäischen Gemeinschaft (EG), beitrat. Dafür war das dargestellte Symbol zu unbekannt – während heute Fotos von Banksys Kunstwerk um die Welt gehen und Medien in den USA, Uruguay, Thailand und Russland über die Aktion berichten, weil jeder sofort versteht, was gemeint ist und warum die Sache wichtig ist. Aber nicht nur das dargestellte Europasymbol leitet zu weiteren Fragen über; dasselbe gilt für den Ort des Kunstwerks. Banksy wählte ein Gebäude, dessen Abbruch ohnehin geplant ist – was die Frage aufwirft, ob das fehlende Sternchen den größeren Lauf der Dinge überhaupt zu verändern mag.
Damit sind die Problemfelder umrissen, um die es in diesem Buch geht. Einerseits erscheint die heutige Krise der EU einmalig tief. Aber ist die Lage wirklich so außergewöhnlich? Das Selbstbild der EU könnte positiver nicht sein. Sie steht für Friedensstiftung, Wirtschaftswachstum, eine an Werten orientierte Politik sowie ein zusammenwachsendes Europa. Ihre Gegner verteufeln sie hingegen als bürokratisches Monster, das Geld verschwendet, nationale Souveränität zersetzt und im besten Fall einfach überflüssig ist, im schlimmsten jedoch brandgefährlich.
Wie immer man das Ergebnis sieht – im Rückblick will es so scheinen, als hätten die Vorläuferorganisationen der heutigen Europäischen Union all dies ganz aus sich heraus und nahezu zwangsläufig geschaffen. Dagegen zeigt dieses Buch, dass das überzogene Selbstbild der EU das heutige Krisenempfinden verschärft, weil für neu und bedrohlich gehalten wird, was es in ähnlicher Form schon zuvor gegeben hat. Dadurch wird der Kern des heutigen Problems übersehen. Zugleich werden hier viele Mythen, die sich um die Geschichte europäischer Integration ranken, auf einen kritischen Prüfstand gestellt und ebenso jene Vorwürfe, mit denen sich die EU so oft konfrontiert sieht. Es geht also um eine kritische Geschichte, die fragt, wie und warum die EU wirklich entstand und was sie leistete – jenseits des Wunschbilds politischer Sonntagsreden und billiger Polemik. Dabei zeigt sich, dass sie sich in ihrer Geschichte fundamental verändert hat, und zugleich, wie unwahrscheinlich ihr heute unbestreitbares Gewicht noch vor wenigen Jahrzehnten war. Vieles, was wir heute in die Anfangszeit des europäischen Einigungsprozesses zurückprojizieren, nahm erst deutlich später klare Formen an.
Um all das zu verstehen, ist es notwendig, sich von gewohnten Denkmustern zu verabschieden. Das gilt erstens für einen Zugriff, der sich auf Motive und Antriebskräfte konzentriert. So ist das Gros der bisherigen Bücher vorgegangen – während die meisten Menschen mehr interessieren dürfte, wie es um die konkreten Ergebnisse und Effekte europäischer Integration bestellt ist. Darüber wissen wir bislang erstaunlich wenig – so wie die EU allgemein für die meisten Menschen überaus abstrakt und wenig greifbar geblieben ist. Sie sind damit nicht allein. So billigen auch viele Historiker, wenn sie die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert beschreiben, der europäischen Integration wenig Raum zu – offensichtlich halten sie diese für einen ziemlich nachrangigen Faktor.[2] Dagegen wird hier gezeigt, dass die Europäische Gemeinschaft in manchen Fragen bereits früh wichtige Effekte erzielte, und in weiteren vor allem seit den 1970er und 1980er Jahren. Allerdings bezog sich dies häufig auf andere Bereiche als jene, in denen sich die EU selbst im Rückblick wichtige Wirkungen zuschreibt. Deutlich wird das vor allem, wenn man sich nicht auf die Binnendynamik zwischen den Mitgliedstaaten beschränkt, sondern auch danach fragt, was europäische Integration in Bezug auf globale Probleme wie die Kubakrise, die Welthandelspolitik und das Ende des Kalten Krieges bedeutete – aber auch für algerische Winzer, argentinische Militärs oder japanische Automobilhersteller. Insgesamt wurden bereits vor dem Maastrichter Vertrag von 1992 die Fundamente für jene bestimmende Position gelegt, welche die EU in unserer Gegenwart einnimmt.
Zweitens geht es hier nicht darum, jeden einzelnen Schritt der europäischen Integration – als dem Zusammenschluss gleichberechtigter, souveräner Staaten, die sich gemeinsame Regeln und Institutionen gegeben haben – nacheinander chronologisch durchzugehen und sich an der Organisationsgeschichte entlangzuhangeln. Da so vieles passierte, verliert man sich dann schnell in der Wiedergabe technischer Details oder – noch häufiger – der Ereignisgeschichte von aufeinanderfolgenden Verhandlungsrunden. Zugleich führt dies leicht zu einem teleologischen Narrativ, das eigentlich nur Vertiefung und Erweiterung als Modi der Geschichte kennt – unterbrochen von gelegentlichen Phasen des Stillstands, die jeweils durch heroische Kraftakte überwunden werden.[3] Geschrieben wird das häufig als Abfolge von Konflikten zwischen großen Männern (und einigen wenigen Frauen), wobei die Rollen klar verteilt sind: Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi und Paul-Henri Spaak, Jacques Delors oder etwa Helmut Kohl geben die Lichtgestalten proeuropäischer Visionäre; Charles de Gaulle, Andreas Papandreou oder Margaret Thatcher die Hauptschurken der Geschichte. In der europakritischen Variante dreht sich die Besetzung einfach um. Dabei wissen wir längst, dass auch Monnet, Adenauer und Spaak nationale Interessenpolitik betrieben und keineswegs für eine idealistisch motivierte Überwindung der Nationalstaaten eintraten[4] – während umgekehrt de Gaulle und Thatcher zwar viel schimpften, sich in manchen Fragen mit der EG jedoch erstaunlich gut arrangierten. Zugleich lässt ein Fokus auf dem politischen Spitzenpersonal die häufig viel interessanteren Akteure der zweiten Reihe übersehen. Nachgelagerte Entscheidungen und der bürokratische Alltag in konkreten Politikfeldern erwiesen sich oft als wichtiger als die Persönlichkeiten der Staats- und Regierungschefs. Ebenso leicht gerät bei einem chronologisch vorgehenden Ansatz aus dem Blick, dass die europäische Option nie die einzige Alternative zum Nationalstaat bildete. Schließlich verdrängt dieser Zugang auch die bereits erwähnte, allentscheidende Frage, wie es jenseits der politischen Bühne um die Effekte der Verhandlungen bestellt war.
Dagegen geht jedes der folgenden acht Kapitel einem zentralen Problemfeld nach, das sich in Zusammenhang mit der Geschichte der EU stellt. Wie sah es zum Beispiel mit ihrem Beitrag aus, für Frieden und Sicherheit zu sorgen? Schuf sie tatsächlich Wirtschaftswachstum und Wohlstand, wie so oft behauptet? Außerdem gilt es, zentrale Spannungsverhältnisse im Einigungsprozess auszuloten, wie jenes zwischen Partizipation und Technokratie. Dabei steht jedes der Kapitel für sich. Ab dem zweiten kann man diese in beliebiger Reihenfolge lesen, und zugleich ergibt sich erst aus der Zusammenschau der verschiedenen Teile ein Gesamtbild.
Der hier gewählte, problemorientierte Ansatz ist nicht mit einem Zuschnitt nach Politikfeldern zu verwechseln. Zum Beispiel spielt die Flüchtlings- und Asylpolitik im Folgenden keine Rolle, da sie erst nach dem hier untersuchten Zeitraum an Bedeutung gewann. Dennoch helfen die verschiedenen Kapitel dabei, die Grundstrukturen auch jüngerer Debatten zu verstehen. Zugleich macht erst der systematisierende Zugriff die Ungleichzeitigkeiten – aber auch die überraschenden Übereinstimmungen – zwischen der Dynamik in so unterschiedlichen Bereichen wie der Frage nach Frieden und Sicherheit, Wohlstand und Wirtschaftswachstum, oder Werten und Normen sichtbar.
Drittens ist es eine Herausforderung, analytische Distanz zu jenen Deutungen zu halten, welche Unterstützer und Gegner des Einigungsprozesses seit den 1940er Jahren selbst produziert haben. Das naheliegendste Beispiel ist die Grundannahme, dass der europäische Zusammenschluss unter den Vorzeichen der heutigen EU sich grundsätzlich von anderen Formen internationaler Kooperation unterscheide und deswegen isoliert zu betrachten sei. Für die einen ist das der Grund, den Prozess europäischer Integration zu preisen; für die anderen, ihn um so mehr als artifiziell zu verdammen. Es ist richtig: Heute nimmt die EU eine Sonderstellung ein, an die Organisationen wie der Europarat oder die OECD nicht heranreichen. Das war aber nicht immer so, wie im ersten Kapitel genauer ausgeführt. Dort wird zugleich erklärt, warum die EG letztlich den Vorrang vor den anderen internationalen Organisationen in Westeuropa erringen konnte und den Charakter einer solchen schließlich weit hinter sich ließ. Spätere Entwicklungen sollte man jedoch nicht mit der Anfangszeit verwechseln. So spielte die EG etwa bei der Sicherung des Friedens in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten eine ziemlich nachrangige Rolle, wurde jedoch später in dieser Hinsicht bedeutsamer. Um zu einer ausgewogenen Analyse zu kommen, müssen die Vorläufer der heutigen EU zu anderen Projekten internationaler Kooperation in Europa in Beziehung gesetzt werden. Deswegen ist es auch so wichtig, eine Vielzahl von Quellen und Perspektiven miteinander zu konfrontieren. Weiterhin wäre es falsch, den in Medien und Politik ohnehin dominierenden deutschen Blick auf Europa in den Mittelpunkt zu stellen; vielmehr ist es unabdingbar, diesen durch andere Perspektiven zu kontrastieren. Nur wer den anderen zuhört, kann die Geschichte europäischer Einigung verstehen.
Dabei sind Worte niemals unschuldig. Besonders der Begriff Europa ist schwierig. Bereits Bismarck betonte, dass unrecht habe oder gar lüge, wer das Wort Europa im Munde führe. Als der Reichskanzler dieses berühmt gewordene Bonmot 1876 auf französisch an den Rand eines Briefes schrieb, reagierte er damit auf eine Aufforderung Russlands, in einer der Krisen jener Zeit im Namen Europas gemeinsam zu handeln.[5] Europa bildete für Bismarck keinen genuin politischen Begriff; Solidarität im Namen des Kontinents war für ihn unmöglich. Die Geschichte seit 1945 hat ihn widerlegt. Und trotzdem verweist seine bissige Bemerkung auf Wichtiges: Wir haben uns heute angewöhnt, Europa zu sagen, wenn wir die Europäische Union meinen, und umgekehrt. Dabei umfasste die EU nie ganz Europa, und zugleich ist die EU aufgrund ihrer institutionellen und rechtlichen Verfasstheit viel konkreter als der in vielerlei Hinsicht vage Begriff Europa. Man kann deswegen die Gleichsetzung von Europa mit der EU und ihren Vorgängern als dreiste Usurpation und ahistorische Verzerrung kritisieren.[6] Man kann aber auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts untersuchen, um zu verstehen, warum eine recht spezialisierte Organisation, die zunächst lediglich sechs westeuropäische Staaten umfasste, heute so häufig mit Europa als Ganzem gleichgesetzt wird. Genau darum geht es in diesem Buch.
Auch der Begriff «Projekt» wirft Fragen auf. Ein Projekt ist laut dem Großen Brockhaus von 1956 «allgemein ein größeres Vorhaben, im engeren Sinne die der Ausführung vorausgehende Planung».[7] Der Begriff erlebte seit der Nachkriegszeit – also genau jenen Jahren, in denen diese Ausgabe des Brockhaus erschien – im Deutschen einen enormen Aufschwung, während er bis dahin kaum gebraucht wurde und eher negativ belegt war. Laut Zedlers Universal-Lexikon von 1741 ist ein «Projectenmacher» jemand, der sich anderen als Erfinder eines Projekts ausgibt, um daraus möglichst großen Gewinn zu schlagen; häufig handele es sich um einen Betrüger. Ähnlich sah es noch Meyers Großes Konversations-Lexikon 1909.[8] Dagegen ist unsere Welt voll von Projekten, und wir verstehen darunter zumeist groß angelegte, geplante Unternehmungen, ohne sie von vornherein mit der Idee des Betrugs zu verbinden. Dagegen hatte der Zedler noch betont, dass ein «blosses Project nicht die geringste Rechts-Krafft» habe, da es sich nur um einen «Entwurff» handele.
Im Folgenden wird der Begriff Projekt nicht auf die eine oder die andere Deutung verengt, sondern als Einladung verstanden, zwischen Planung, Umsetzung und Wirkung sorgfältig zu unterscheiden – unabhängig davon, ob sie sich im Rahmen der EG oder eines anderen organisatorischen Zusammenhangs vollzog. Denn Intendiertes und Realisiertes standen oft in einem überaus komplizierten Verhältnis; Absichten und Effekte sind nicht miteinander zu verwechseln. Keineswegs kam die Planung immer so eindeutig vor der Realisierung, wie es die Brockhaus-Definition nahelegt und wie die meisten vorhandenen Darstellungen zur Geschichte europäischer Integration unterstellen, wenn sie bei den Ideen starten und dann deren schrittweise Verwirklichung darzulegen suchen. Sicherlich, seit dem ausgehenden Mittelalter wurde immer wieder über Frieden durch Föderation in Europa geschrieben, und es ließe sich eine ehrwürdige Ahnengalerie von Vordenkern wie Dante Alighieri, Immanuel Kant oder Victor Hugo präsentieren. Nur: Die längste Zeit blieben diese und ähnliche Ideen äußerst randständig und somit bloß «Entwurff». Für die Geschichte europäischer Integration seit 1945 mindestens ebenso wichtig waren praktische Erfahrungen seit dem 19. Jahrhundert im Bereich der internationalen Kooperation bei ökonomischen und technischen Fragen wie dem Aufbau einer grenzüberschreitenden Infrastruktur, etwa bei der Regelung der Rheinschifffahrt, dem Abbau des Handelsprotektionismus oder später der Entwicklung von Stromnetzen.[9] Während auf den Ersten Weltkrieg bald der Zweite folgte und sich kein dauerhafter Frieden schaffen ließ, leistete eine längere Reihe kaum bekannter Organisationen auf der Ebene von Problemen zweiter Ordnung Beachtliches. Trotzdem: Noch 1945 war politische Integration in Europa nur eine mögliche Zukunft unter vielen – aber eine recht unwahrscheinliche.
Und dennoch war am Anfang der Zweite Weltkrieg. Ohne ihn – ohne seine Zerstörungen, die Delegitimation hypertropher Formen des Nationalismus, den Niedergang der europäischen Vormachtstellung auf der Welt sowie die Furcht vor erneuter Aggression ausgehend von deutschem Boden – wäre der europäische Zusammenschluss nicht vom Reich des Denkbaren ins Reich des politisch Möglichen gewandert.
Zugleich bedurfte es eines weiteren Krieges als unverzichtbarem Kontext, um aus dem Möglichen eine Realität zu machen: des Kalten Krieges. Die gemeinsame Furcht vor dem Kommunismus und dem sich herausbildenden Ostblock unter Führung der Sowjetunion wirkte als äußere Klammer, welche die Staaten enger zusammenschweißte – und die zugleich erklärt, warum sich das Projekt Europa zunehmend nur noch auf Westeuropa bezog. Zugleich heißt dies nicht, dass der Einigungsprozess nur durch den Kalten Krieg bewirkt wurde – ansonsten hätte er dessen Ende nicht überlebt.[10]
Zu dieser antikommunistischen, antihegemonialen Stoßrichtung gegenüber dem Osten gesellte sich ein ambivalentes Verhältnis gen Westen. Viele frühe Europa-Befürworter zielten nicht zuletzt darauf, Westeuropa als «dritte Kraft» auch gegenüber den USA in Stellung zu bringen und damit dem Lagerdenken der Supermächte des Kalten Krieges zu entziehen. In Deutschland war diese Denkfigur in den späten 1940er und den 1950er Jahren besonders stark und findet sich bei dem linkskatholischen Publizisten Walter Dirks genauso wie bei dem pazifistischen Protestanten Martin Niemöller, bei dem rechten Sozialdemokraten Richard Löwenthal sowie bei dem linken Christdemokraten Jakob Kaiser. Auch de Gaulles Europapolitik folgte einem derartigen Kurs.
Trotzdem unterstützten die Vereinigten Staaten den Einigungsprozess massiv. Die Sicherheitsgarantie durch die USA, welche diese zur Hegemonialmacht Westeuropas machte, gehörte so zu den bestimmenden Rahmenbedingungen für alle Suchbewegungen europäischer Kooperation und Integration seit den späten 1940er Jahren.
Diese Kontexte prägten nicht nur die Geschichte der Vorläuferorganisationen der EG, sondern auch andere Anläufe europäischer Zusammenarbeit, von denen im Folgenden die Rede sein wird. Wie schwer sich das «Projekt Europa» aber auch nur für den Bereich der EU und ihrer Vorgänger fassen lässt, zeigt sich an den Begrifflichkeiten: Das, was einmal die Europäische Union unserer Tage werden sollte, änderte öfters Zuschnitt, Aufgaben und selbst den Namen. Ihre Vorgänger setzten sich aus der 1951 gegründeten Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), häufig auch Montanunion genannt, zusammen sowie aus zwei weiteren, 1957 auf Grundlage der sogenannten Römischen Verträge eingerichteten Organisationen, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und Euratom. Das klang recht technisch und war es auch. Erst mit der Zeit schlossen sich diese drei, ursprünglich weitgehend eigenständigen Organisationen enger zusammen, wobei bis zum Maastrichter Vertrag eigentlich von den «Europäischen Gemeinschaften» im Plural zu sprechen wäre. Zu diesen kamen noch die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) und die EG-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, die sich seit den 1970er Jahren langsam außerhalb der drei Kerngemeinschaften institutionalisierten. Mit Maastricht wurde das organisatorische Gefüge neu geordnet. Dieses ist verwirrend – zugleich aber auch recht einfach zu erklären: Es verweist darauf, dass die Geschichte europäischer Integration voll ist mit weitreichenden Hoffnungen, unintendierten Konsequenzen, zunächst beinahe unsichtbaren Neuanfängen und langsamen Umorientierungen.
Wenn im Folgenden von der Europäischen Gemeinschaft für die Zeit vor Maastricht im Singular die Rede sein wird, geschieht dies aber nicht nur aus Gründen der Lesbarkeit. Denn zumindest im Deutschen sprach man seit den 1970er Jahren immer häufiger von der Gemeinschaft im Singular, und ebenfalls seit den 1970er Jahren wurde die EG immer öfter mit Europa gleichgesetzt.[11] Interessanterweise war zum Beispiel im Englischen dagegen der Begriff «Common Market» für die EG gebräuchlicher, was eine ganz andere Sicht in Bezug auf deren Ausrichtung und Gewicht darstellt.
Auch abgesehen von ihrer institutionellen Gestalt ist es schwierig, die EG zu fassen. Es gab nicht die eine Blaupause, auf deren Grundlage sie sich entwickelte. Statt auf einen einheitlichen Willen stößt man häufig auf ein spannungsreiches Handlungsgeflecht unterschiedlicher Akteure. Vertreter verschiedener Staaten trafen aufeinander, wobei nationale Zugehörigkeit keineswegs immer den bestimmenden Faktor bildete. Manchmal war vielmehr die politisch-weltanschauliche Zugehörigkeit ausschlaggebend: Föderalisten, Technokraten, Christlich-Konservative, Sozialdemokraten und viele mehr gaben sich ein Stelldichein, und dasselbe gilt für Vertreter verschiedener Generationen mit ihren jeweiligen Erfahrungsräumen und Erwartungshorizonten. So wurde die EG zur Bühne, auf der sich Aushandlungsprozesse zwischen Regierungen und Dramen der internationalen Politik vollzogen. Auch nichtstaatliche Akteure, wie die Vertreter großer Unternehmen und verschiedener Wirtschaftszweige, Journalisten oder Gewerkschafter, hinterließen ihre Spuren. In vielen Fragen wurde die EG zu deutlich mehr als nur der Plattform oder dem Instrument nationaler Interessenspolitik und ähnelte einem handlungsfähigen Subjekt, das etwas beabsichtigt und umsetzt. Dann gelang es ihr häufig genau aufgrund ihrer Offenheit, mehr als die Summe der Positionen ihrer Mitgliedstaaten darzustellen und einen eigenständigen Kurs zu verfolgen. Insgesamt erinnert die EG deswegen manchmal an eine von den großen Mitgliedstaaten gespielte Marionette; manchmal an Superman, und gelegentlich glich sie Robert Musils Mann ohne Eigenschaften – einem Akteur mit viel Potential und Möglichkeitssinn auf der Suche nach einer sinnvollen Existenz.
Versteht man die Geschichte europäischer Einigung somit nicht als Umsetzung eines großen Planes, sondern nimmt man die Vielfältigkeit und die Wechselfälle der damit verbundenen Projekte ernst, verändert dies die Perspektive. Im Zentrum steht nicht der Fokus auf jenen «immer engeren Zusammenschluß», den in leicht abweichenden Formeln alle großen Verträge seit 1957 beschworen haben.[12] Denn nur auf den ersten Blick scheint es so, als wäre die europäische Integration zumindest bis zum Maastrichter Vertrag diesem Muster gefolgt. In Wissenschaft und Öffentlichkeit war bisher etwa in Bezug auf formale Mitgliedschaft stets von sukzessiven Erweiterungsrunden die Rede. Zum Einigungswerk der sechs Gründerstaaten traten 1973 das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark hinzu. 1981 folgte Griechenland; fünf Jahre später Spanien und Portugal, und bereits vor dem Maastrichter Vertrag wurde durch die deutsche Einheit 1990, in deren Rahmen das Gebiet der DDR zum Raum der EG beitrat, der vordem trennende Eiserne Vorhang überwunden. Dieser gängigen Sicht zufolge wurde die EG immer größer; der Brexit stellt demnach die erste fundamentale Erschütterung und Herausforderung dar.
Karte 1 · Veränderungen in der EG-Mitgliedschaft bis 1992
Dabei wird jedoch übersehen, dass mit Algerien und Grönland bereits vor Maastricht zwei Länder die EG verließen. Ganz allgemein traten zu Erweiterung und Vertiefung stets wichtige Gegentendenzen. Auch jenseits der Frage der formalen Mitgliedschaft gab es Prozesse der Desintegration und Dysfunktionalitäten, die die Geschichte sukzessiver Erweiterung und Vertiefung relativiert – sowie die heute ins Kraut schießenden Deutungen, dass der Einigungsprozess in unserer Zeit erstmals vor seiner Umkehrung stehe.
Viele dieser Spannungen resultierten aus divergierenden Interessen zwischen den Mitgliedstaaten sowie ihrem Widerstand dagegen, die Integration allzu weit voranschreiten zu lassen. Das Projekt Europa war zuvörderst eine Gründung von Nationalstaaten. Für sie war es ein probates Mittel, um sich in Zeiten des Kalten Krieges, der Dekolonisation und der Globalisierung zu behaupten. Ohne die Nationalstaaten hätte sich die europäische Integration in ganz anderer Form entfaltet. Wenngleich es ihnen nicht immer gelang, den Kurs der Entwicklungen ganz festzulegen, drückten sie ihm den entscheidenden Stempel auf. Das zeigte sich in der EG bereits beim Aufbau der Institutionen. Als Robert Schuman 1950 den nach ihm benannten Plan präsentierte, der im Folgejahr zum Abschluss des EGKS-Vertrags führte, sprach er nur über ein supranational geprägtes Exekutivorgan, die spätere Hohe Behörde. In den weiteren Debatten und Verhandlungen wurde dieses Gremium schnell durch einen Ministerrat ergänzt, da die Regierungen der Mitgliedstaaten ihre Rechte keineswegs vollständig an die neue Institution übertragen wollten. Hinzu kam noch eine parlamentarische Vertretung, was die Stellung der Regierungen wiederum etwas relativierte, sowie ein unabhängiger Gerichtshof. Insgesamt entstand ein kompliziertes System von Checks und Balances, in dem die Rolle der Mitgliedstaaten und anderer Akteure gegenüber der Gemeinschaft immer wieder neu austariert wurde. Am spektakulärsten geschah dies 1966, im sogenannten Luxemburger Kompromiss, mit dem der ursprünglich vertraglich festgelegte Weg, die Rolle der Mitgliedstaaten im Verlauf der Zeit einzuschränken, ausgehebelt wurde. Auch danach kam es zu Veränderungen im institutionellen Zusammenspiel, wobei die Vertretungen der Mitgliedstaaten heute in manchen Fragen eine größere Rolle spielen als etwa in den 1970er und 1980er Jahren.
Überhaupt, die 1970er Jahre: Wie im Folgenden gezeigt wird, stellte jenes Jahrzehnt eine Phase tiefgreifenden Wandels dar, da sich die EG erst damals zu einer wirklich bedeutsamen Rolle aufschwang. Ob es um ihren Beitrag zur Sicherung des Friedens, um Probleme des Wohlstands, um die Sicherung von Werten oder eben – noch grundsätzlicher – die Vorrangstellung der EG im Vergleich zu anderen Foren internationaler Kooperation in Westeuropa ging: Jeweils bildeten die 1970er Jahre eine Phase immensen Bedeutungsgewinns, wofür ein Gipfeltreffen in Den Haag im Dezember 1969 eine markante Wegmarke darstellte, ohne dass all diese Entwicklungen auf jene Zusammenkunft zurückzuführen wären. Das ist insofern überraschend, da die 1970er Jahre in Bezug auf europäische Einigung lange Zeit als Krisenphase galten; man hat sie sogar als die «finstere Zeit» in der Geschichte der EU bezeichnet.[13]
Viele der Neuanfänge der 1970er Jahre verstärkten sich in der Folgedekade. Deswegen bildete der Maastrichter Vertrag in mancherlei Hinsicht eher Abschluss als Neuanfang, da bereits in den zwei Jahrzehnten zuvor die Basis für die weiteren Entwicklungen gelegt worden war. Zugleich sollte die Bedeutung der Folgejahre nicht unterschätzt werden – während in den 1990er Jahren die meisten Menschen noch glaubten, die Rolle der EU ignorieren zu können, hat sich das in den letzten zehn Jahren grundlegend geändert. Dass die Effekte europäischer Integration überaus weitreichend wurden, hatte seinen Ursprung jedoch in den 1970er und 1980er Jahren.
Deswegen soll der Schwerpunkt der Darstellung auf den Jahrzehnten des Kalten Krieges bis zum Maastrichter Vertrag liegen. Diese Eingrenzung ist auch notwendig, da sich nur für diesen Zeitraum Aussagen gestützt auf Archivmaterial und neueste Forschungen machen lassen – für die allerjüngste Vergangenheit seit den frühen 1990er Jahren ist der hier verfolgte, quellengesättigte und multiperspektivische Zugang schlicht und ergreifend noch nicht möglich.
Letztlich zeichnet dieses Buch somit ein ganz anderes Bild von der Geschichte europäischer Integration als das uns Vertraute. Es versucht die Mauer bleierner Langeweile zu durchbrechen, welche viele Menschen mit dem Thema verbinden. Den für die EG typischen Versuch der Entdramatisierung von Entscheidungen durch das Recht, durch gemeinsame Verfahren und hart verhandelte Kompromisse gilt es als Verfahrensmodus zu verstehen, der sich explizit als Alternative zu nationalem Egoismus, symbolträchtiger Inszenierung und Drang nach Weltgeltung auf globaler Bühne verstand. Zugleich zeigt sich dann, dass die Europäische Gemeinschaft anfangs fragiler und unwichtiger war, als man lange glaubte, und mit den 1970er Jahren genau in jener Zeit wirkliche Bedeutung gewann, in der viele Zeitgenossen sie in einer fundamentalen Krise wähnten. Die Vorläufer unserer heutigen EU haben sich dabei als viel resilienter erwiesen, als man bislang meinte.
Darüber hinaus wird erst angesichts dieses Befunds deutlich, warum die heutige Krise so viel grundsätzlicherer Natur ist als frühere. Denn während bis in die 1970er Jahre die EG noch für tendenziell eher nachrangige Probleme zuständig war und es neben ihr eine ganze Reihe weiterer westeuropäischer Organisationen gab, mit denen sie arbeitsteilig operierte, befinden wir uns heute in einer ganz anderen Lage. Die Tatsache, dass die EU heute das allentscheidende Forum für so viele wichtige Politikbereiche auf europäischer Ebene bildet, macht sie anfällig für eine Fundamentalkrise. Probleme können jetzt leichter von einem Bereich auf den nächsten überspringen, da sie in ein und derselben Organisation verhandelt werden. In der EG der 1960er Jahre – die im Grunde einen großen gemeinsamen Markt mit einer komplizierten Agrarpolitik bildete, während andere Fragen in der Zuständigkeit von Europarat, OECD oder anderen Foren lagen – war das nicht möglich.
Aber die Geschichte hält mehr als eine Lehre bereit. Paradoxerweise kann man die 1970er und frühen 1980er Jahre nicht nur als die schwerste Prüfung der EG in der Zeit des Kalten Krieges verstehen, sondern auch als eine ihrer produktivsten und prägendsten. Wie heute gab es damals keinen vorgefassten Plan, um der Probleme Herr zu werden, und genau das setzte das Projekt Europa in die Lage, sich neuen Herausforderungen und Möglichkeiten anzupassen.
Geschichte ist immer offen. Jede Gegenwart bildet einen Aufbruch ins Unbekannte. Dieses Buch behauptet nicht, in die Zukunft der EU sehen zu können. Die Geschichte des europäischen Einigungsprozesses – als ein zentrales Kapitel der Geschichte unserer Gegenwart – zu kennen ist jedoch zentral, um unsere eigene Zeit zu verstehen und die Zukunft zu gestalten.
I. Europa und europäische Integration
Nach schwierigen, monatelangen Verhandlungen einigte man sich endlich. Laut Artikel 1 hatte das neu geschaffene Forum die Aufgabe, «einen engeren Zusammenschluß unter seinen Mitgliedern zu verwirklichen, um die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe sind, zu schützen und zu fördern und um ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu begünstigen». Laut Präambel des Dokuments ging es jedoch nicht so sehr um Ökonomie und Soziales. Vielmehr sollte die Einrichtung, «die alle europäischen Staaten enger zusammenschließt», in erster Linie der «Festigung des Friedens» dienen. In dem langen Satz, aus dem Präambel und Artikel 1 des entsprechenden Vertrags bestanden, tauchte das (substantiierte) Verb «zusammenschließen» nicht weniger als drei Mal auf – offensichtlich meinte man es ernst.[1]
Gemeint war jedoch nicht die Europäische Union oder einer ihrer Vorläufer. Vielmehr handelte es sich bei dem Dokument um die Satzung des 1949 ins Leben gerufenen Europarats – der bis heute besteht, aber längst nicht so wichtig und bekannt ist wie die EU. Wenn wir heute Europa hören, denken wir automatisch an die EU und Brüssel. Die meisten europäischen Staaten zählen zu ihren Mitgliedern. Es ist die Europäische Union, die für offene Grenzen im Innern sorgt, strukturschwache Regionen unterstützt und gelegentlich ganze Gesellschaften aus der Krise herauszuziehen versucht. Das Schicksal ihrer Mitgliedstaaten ist auf das Engste mit der EU verknüpft – im Guten wie im Schlechten. Denn häufig wird die Union eher mit den Problemen in Europa identifiziert als mit den Lösungen. Will ein Staat aus ihr austreten, hat das Auswirkungen auf den Rest der Union und den gesamten Globus. Nichts liegt also näher, als Europa mit der Europäischen Union gleichzusetzen.
Dieser Versuchung, die im letzten Vierteljahrhundert immer stärker geworden ist, erliegen auch viele Studien zur Geschichte der EG. Sie wird dann so behandelt, als sei sie der einzige oder zumindest der bedeutendste internationale Zusammenschluss im Westeuropa des Kalten Krieges gewesen. Viele historische Studien gehen davon aus, dass die internationale Arena weitgehend leer war, als die europäische Integration begann; dass nationale Akteure sich hauptsächlich zwischen staatlicher Souveränität und Integration à la EG zu entscheiden hatten. Dabei unterschätzt man zweierlei: erstens nämlich, dass die EG zunächst ein fragiler Spätankömmling in einem bereits dicht bevölkerten Feld internationaler Organisationen war; dass es vor 70 Jahren und auch noch in jüngerer Vergangenheit recht unwahrscheinlich war, dass diese eine Organisation einmal mit Europa als Ganzem, oder auch nur mit Westeuropa, identifiziert werden würde. Und zum anderen, dass nicht nur die Geschichte der beteiligten Mitgliedstaaten und der allgemeine zeithistorische Kontext den Einigungsprozess prägten, sondern auch das Beziehungsverhältnis zu anderen westeuropäischen Organisationen und transnationalen Foren. Dies bildet eine wichtige, bislang kaum beachtete Dimension des Einigungsprozesses, gerade für den Kalten Krieg. Deswegen gilt: Europa war nie die EU, und die EU inklusive ihrer Vorgänger nie Europa. Und umso wichtiger ist es zu verstehen, warum diese Gleichsetzung dennoch zunehmend bedeutsamer wurde, und die EG sich aus kleinen Anfängen zum wichtigsten internationalen Zusammenschluss in Europa mausern konnte.
Eine von vielen
In den 15 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges entstand ein ganzes Labyrinth von sich teilweise überlappenden, teilweise konkurrierenden internationalen Organisationen, besonders in Westeuropa. Sie bildeten die Lehre aus den ökonomischen und sozialen Krisen der Vergangenheit sowie den zurückliegenden Dekaden mit Weltkriegen, Völkermord und Vertreibungen. Nie mehr sollten radikaler Nationalismus und Autarkiedenken die Welt in den Abgrund stoßen. Kooperation und Verflechtung galten als die besten Mittel, um das zu verhindern. Zugleich war nicht alles Neuanfang. In Bezug auf das Personal, aber auch die Ansätze zur internationalen Kooperation in Europa, gab es vielmehr Anknüpfungspunkte an die Zwischenkriegszeit.[2] Das blieb jedoch im Hintergrund; vielmehr bemühten sich die Protagonisten europäischer Integration, diese als Umkehr und Neubeginn in Szene zu setzen.
Bereits in den 1950er Jahren erreichten Internationalisierung und Globalisierung ein solches Ausmaß, dass Westeuropas Staaten keine abgeschlossenen Einheiten mehr bildeten – falls sie das je gewesen waren. Zumeist ging es lediglich um die Frage, welche von mehreren verfügbaren europäischen oder internationalen Lösungen sie wählen wollten. Denn in der kurzen Phase zwischen 1945 und 1948 wurden global rund hundert internationale Organisationen gegründet.[3] Schon 1949 beklagte ein norwegischer Experte: Die «Zahl der internationalen Organisationen ist gewaltig angestiegen, und sie steigt noch weiter an. Heute hat die weltweite Öffentlichkeit den Eindruck, dass internationale Anstrengungen unter der übertriebenen Multiplizierung von Organisationen, einem Mangel an Koordination, Verschwendung und Bürokratismus leiden.»[4] In den folgenden Jahren sollte sich der Trend noch verstärken: Von 1951 bis 1960 schwoll die Gesamtzahl internationaler Organisationen weltweit von 832 auf stolze 1255 an. Angesichts des Kalten Krieges lag der geographische Schwerpunkt dieser Organisationen auf dem Nordatlantik, besonders in Westeuropa.[5]
Die EG war somit nur eine unter vielen. Ihre Zuständigkeit kreiste in erster Linie um Probleme der Wirtschaft, aber noch nicht einmal damit war sie allein auf weiter Flur. Mit ihnen befassten sich mehr als 20 weitere internationale Organisationen, die in den ersten 15 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Westeuropa Wurzeln schlugen. Zu den vergleichsweise bekannten – wie dem Europarat und der OECD – gesellten sich viele weitere wie etwa die Wirtschaftskommission für Europa (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE), die EFTA oder die Europäische Zahlungsunion.[6] Hinzu kamen jene, die bereits vor 1945 entstanden waren, wie die in Genf ansässige, global aufgestellte Internationale Arbeitsorganisation (auch bekannt unter der englischen Abkürzung ILO), die in der Zwischenkriegszeit zum Völkerbund gehört hatte und nun eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen wurde. Insofern konnte die EG das breite Feld europäischer Wirtschaftskooperation keineswegs für sich allein reklamieren.
Hinzu kam: Im Vergleich zu vielen anderen Initiativen auf internationaler Ebene umfasste die EG auffallend wenige Mitgliedstaaten; sie war Zwerg, nicht Riese. Die UNECE bildete den ersten größeren Anlauf europäischer Kooperation in der Nachkriegszeit, als sie 1947 im Rahmen der Vereinten Nationen gegründet wurde. Sie war ein Zusammenschluss von ursprünglich 18 Staaten, zu dem in Westeuropa etwa Frankreich und das Vereinigte Königreich gehörten. Sie schloss aber auch ostmitteleuropäische Staaten wie die Tschechoslowakei und Polen ein. Darüber hinaus waren die beiden Supermächte, die USA und die Sowjetunion, Mitglieder. Die UNECE verstand sich als gesamteuropäische Institution, die den Wiederaufbau Europas koordinieren und den Geist des alliierten Bündnisses der Kriegsjahre am Leben erhalten sollte. Letzteres Ziel wurde bereits nach wenigen Monaten obsolet – die Dynamik des sich verschärfenden Kalten Krieges führte dazu, dass sich in der UNECE bald drei Lager bildeten – der Osten, der Westen und die Neutralen. Fortan verstand sie sich als verzweifelter Versuch, eine Brücke zwischen den Blöcken zu bauen. Dies gelang aber nur in Ansätzen. 1948, nur ein Jahr nach der UNECE, gründeten 16 westeuropäische Staaten die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, besser bekannt unter ihrer englischen Abkürzung OEEC. Die OEEC koordinierte die Kooperation der westeuropäischen Staaten im Rahmen des Marshallplans, dem von den USA initiierten Wiederaufbauprogramm für Europa. Im Folgejahr ging der wiederum kleinere Europarat mit seinen zehn Mitgliedstaaten an den Start; 1950 folgte schließlich die Montanunion als erste Vorläuferin der heutigen EU mit ihren ursprünglich lediglich sechs Mitgliedstaaten. Keine der zuvor geschaffenen Organisationen wurde deswegen aufgelöst; vielmehr glichen UNECE, OEEC, Europarat und Montanunion russischen Matrjoschka-Puppen, von denen die Montanunion als Vorläuferin der heutigen EU die kleinste und jüngste war.[7]
Karte 2 · Die Mitgliedstaaten von UNECE, OEEC, Europarat und EG 1958
Die Montanunion stach auch nicht etwa deswegen heraus, weil sie sich mit dem brennendsten Problem der Zeit befasste. Auch wenn Wirtschaftsfragen nach 1945 viel Platz einnahmen, kreiste die Hauptsorge der Menschen darum, nach den Verheerungen der beiden Weltkriege einen weiteren Waffengang zu verhindern. In der Bundesrepublik glaubten zum Beispiel 1950 einer repräsentativen Umfrage zufolge 57 Prozent aller Bundesbürger, dass ein dritter Weltkrieg innerhalb der nächsten zehn Jahre bevorstünde. Laut einer anderen Umfrage hielten zwei Drittel die Zeiten für zu unsicher, um längerfristige Lebenspläne zu machen.[8] Die lebensbedrohliche Versorgungsknappheit bei Kriegsende war vergleichsweise schnell überwunden. Die Angst vor einem nächsten, potentiell alles menschliche Leben zerstörenden Weltkrieg dagegen hielt an, weshalb der Erhaltung des Friedens die größte Sorge vieler Europäerinnen und Europäer galt. Sicherlich, die EGKS leistete dazu einen Beitrag, indem sie die deutsch-französische Versöhnung förderte. Sie sorgte für eine gegenseitige Kontrolle in den kriegswichtigen Sektoren Kohle und Stahl. Ihr Anteil daran, einen Krieg zu verhindern, war jedoch eher indirekt, während andere Organisationen das Thema ganz in den Mittelpunkt stellten. So hatten Frankreich, das Vereinigte Königreich und die Benelux-Staaten bereits 1948 einen militärischen Beistandspakt gegründet, der 1954 die Bundesrepublik und Italien aufnahm und seitdem Westeuropäische Union (WEU) hieß. Für Fragen von Krieg und Frieden war die WEU bedeutsamer als die EG. Und in einem anderen wichtigen Politikfeld, den Menschenrechten, spielte der Europarat seit seiner Gründung eine führende Rolle, nicht aber die EG.[9]
Und damit nicht genug. Das Kleinwesteuropa der werdenden EG war nicht nur in einen Kreis anderer westeuropäischer Organisationen eingebunden, sondern zugleich in ein Netzwerk von Zusammenschlüssen des politischen Westens. Es war Teil des nordatlantischen Raums, den man zunehmend nicht nur geographisch, sondern auch politisch-ideologisch definierte. Als Lehre aus Weltwirtschaftskrise, New Deal und Zweitem Weltkrieg vertraten die USA nach 1945 und mehr noch seit 1947 einen dezidiert internationalistischen Ansatz und setzten auf multilaterale Kooperation – ein Kurs, der ihre Haltung im Kalten Krieg prägen sollte.[10] Washington spielte in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre eine zentrale Rolle beim Aufbau internationaler Einrichtungen – man denke nur an die NATO als Sicherheitsbündnis, das Westeuropa mit den USA als Vormacht des westlichen Lagers zusammenschweißte. Hinzu kamen auf Ebene der Wirtschaft etwa das internationale Handelsabkommen GATT und die Bretton-Woods-Institutionen zur Sicherung einer kapitalistisch orientierten internationalen Währungsordnung, mit der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds als Pfeilern. Sie bildeten das sicherheitspolitische Fundament und den spezifischen ökonomischen Rahmen, ohne die man Aufgaben und Entwicklung der EG nicht verstehen kann. Hinzu kamen Dutzende Bündnisse und Verträge auf bilateraler Ebene – nicht nur mit europäischen Staaten, sondern in der ganzen Welt. Zeitgenössische Kritiker unterstellten besonders US-Außenminister John Foster Dulles eine regelrechte «Paktomanie».[11]
Und noch ein weiterer Faktor bestimmte den Ort der EG auf der internationalen Bühne: Die explizite Konkurrenz durch andere westeuropäische Organisationen. Am deutlichsten galt dies für die EFTA, 1960 als direktes Alternativmodell zur EG unter britischer Führung in die Welt gesetzt. Das Vereinigte Königreich blieb bekanntlich beim Ausbau der heutigen EU zunächst außen vor und trat der EGKS nicht bei. Vielmehr unterbreitete die britische Regierung 1952 und 1957/58 Vorschläge, welche die Rolle der Montanunion bzw. der entstehenden EG in Westeuropa beschnitten hätten. Damit war sie jedoch erfolglos. Daraufhin gründete das Vereinigte Königreich zusammen mit sechs weiteren westeuropäischen Staaten eine direkte Gegenorganisation zur EG, die stärker dem Freihandel verpflichtet war und auf eine weniger intensive Form der Kooperation setzte.[12] Europäische Einigung à la EG war keineswegs alternativlos und hatte selbst innerhalb Westeuropas einen unmittelbaren Rivalen, und 1955 war der Kontinent ökonomisch und politisch stärker geteilt als noch eine Dekade davor.
Wer in den Nachkriegsjahrzehnten über Kooperation in Europa nachdachte, konnte sich deswegen leicht im Labyrinth teilweise überlappender, teilweise miteinander konkurrierender Organisationen verirren. EGKS, UNECE, OEEC, WEU, EG – wer sollte da noch den Überblick behalten? Um die Verwirrung perfekt zu machen, hatte jede dieser Organisationen je nach Sprache unterschiedliche Abkürzungen – was etwa die EGKS auf Englisch zur ECSC und auf Französisch und Italienisch zur CECA mutieren ließ. Manche Organisationen änderten im Verlauf der Zeit ihren Namen, wie etwa die aus dem Brüsseler Pakt hervorgegangene WEU oder die OEEC, die sich 1961 zur OECD (beziehungsweise der OCDE auf Französisch, der OCSE auf Italienisch und der OESO auf Niederländisch) mauserte. Vergessen seien auch nicht die vielen Dutzend weiterer Organisationen auf nachgeordnet-technischer Ebene, wie etwa die CEPT als europäische Dachorganisation im Bereich Post und Telekommunikation oder die Europäische Verkehrsministerkonferenz. Europa, ein Wirrspiel!
Letztlich entstand die EG an der Schnittstelle von drei Prozessen. Erstens war sie in die Welt des Westens eingebunden, mit den USA als wohlwollender Vormacht und einer kapitalistischen Grundausrichtung. Einige dieser Organisationen gingen bereits auf die Phase kurz vor Kriegsende oder noch länger zurück, andere entstanden erst nach 1945. Die Vorstellung einer spezifischen «atlantischen Gemeinschaft» gewann genau in der Gründungsphase der EG enorm an Bedeutung. Damit war nicht nur die machtpolitische Rolle der Vereinigten Staaten in Westeuropa gemeint, sondern auch die gemeinsame Basis von Werten und Interessen, die über eine Vielzahl gemeinsamer Institutionen wie der NATO oder dem Bretton-Woods-System im Bereich der Wirtschaft abgestützt und vertreten wurde. 1964 diagnostizierte ein Experte, kein Thema der internationalen Beziehungen «begünstige es so sehr, viele Worte zu machen, die oft nur sehr lose mit klar identifizierbaren politischen Tatsachen verbunden seien, wie im Fall der atlantischen Gemeinschaft».[13] Es blieb jedoch keineswegs bei Worten, wie sich an den oben erwähnten Organisationen zeigt.[14]
Damit hängt zweitens eng zusammen, dass die Entstehung der EG am Ende eines Prozesses stand, in dem der Kalte Krieg die Spielräume europäischer Kooperation zunehmend prägte und verengte. Nichts verdeutlicht dies so sehr wie der Weg von der UNECE über die OEEC und den Europarat zur EG. Von einer gesamteuropäischen Organisation führte die Entwicklung zum Marshallplan, der zu Beginn der Verhandlungen nur scheinbar für die Sowjetunion offen gestanden hatte und letztlich 1949 Anlass für die Gründung einer Gegenorganisation östlich des Eisernen Vorhangs wurde, des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW). Von dort ging es weiter zum Europarat, der unter seinen Gründungsmitgliedern noch neutrale Staaten zählte, während dies bei der drei Jahre später gegründeten EGKS nicht mehr der Fall war. Ihre Mitgliedstaaten positionierten sich im Ost-West-Konflikt unzweifelhaft im westlichen Lager, auch wenn manche Menschen mit der Organisation die Hoffnung verbanden, ein Europa jenseits des Kalten Krieges errichten zu können. Zugleich spielte die UNECE eine immer geringere Rolle, da ihr gesamteuropäischer Zuschnitt nicht mehr in die Logik des Kalten Krieges passte.
An der EGKS war in diesem Kontext zweierlei besonders: zum einen, dass die Bundesrepublik bereits zu ihren Gründungsmitgliedern gehörte, während sie in den anderen spezifisch europäischen internationalen Organisationen erst später aufgenommen wurde. Das war naheliegend, da der westdeutsche Staat erst 1949 gegründet wurde – das heißt, erst nachdem UNECE oder OEEC ihre Arbeit aufgenommen hatten. Gleichwohl zeigt sich an der EGKS, dass die Furcht vor Deutschland trotz der beiden Weltkriege und anderer Konflikte mit Deutschland, die sich in das kollektive Gedächtnis eingeprägt hatten, ein Jahrfünft nach Kriegsende gegenüber dem Antikommunismus und der Logik des Kalten Krieges ins zweite Glied zurücktrat. Allgemein gelang der jungen Bundesrepublik in den frühen 1950er Jahren der Beitritt in mehrere internationale Foren, etwa Sonderorganisationen der Vereinten Nationen wie der Internationalen Arbeitsorganisation.[15] Insofern war die EGKS nicht die einzige Organisation, die sich die Verständigung mit der Bundesrepublik auf ihre Fahnen schrieb, aber es war die erste unter den europäischen, die deutsch-französische Versöhnung in den Mittelpunkt rückte.
Zum anderen war an der EGKS besonders, dass sie Großbritannien und die skandinavischen Länder nicht umfasste – denn mittlerweile hatte sich gezeigt, dass diese an einer derart engen Kooperation zumindest vorläufig nicht interessiert waren. Auch Hoffnungen der ersten Nachkriegsdekade, Europa als eine Art dritte, neutrale Kraft zwischen den Blöcken aufbauen zu können, erwiesen sich als immer unrealistischer. Seit den späten 1940er Jahren wurden internationale Organisationen zu Arenen, in denen sich Ost- und Westblock formierten und für Kohärenz und Disziplin im eigenen Lager sorgten.[16] Die EG stand somit für die Teilung Europas in Ost und West; nicht für die Überwindung der Blöcke. Alle diese Entscheidungen waren keineswegs unstrittig. So zielte etwa die Politik de Gaulles in den frühen 1960er Jahren darauf, Europas Spaltung zu überwinden, selbst um den Preis von Friktionen im Westen – er war damit jedoch nicht erfolgreich.[17]
Der Kalte Krieg drückte dem Einigungsprozess seinen Stempel auf. Der deutsch-französische Gelehrte Alfred Grosser hat einmal ironisch bemerkt, dass eigentlich Josef Stalin den ersten Karls-Preis der Stadt Aachen verdient hätte: «Ohne gemeinsame Angst hätte es keine Gemeinschaft gegeben.»[18] So, wie die Gründung der OEEC half, den RGW aus der Taufe zu heben, beschleunigte und prägte das Bild vom Osten bald die politischen Entwicklungen im Westen Europas. 1951 zum Beispiel veröffentlichte der ehemalige französische Premierminister Paul Reynaud ein Buch mit dem Titel «S’unir ou périr» (Sich vereinigen oder untergehen), in dem er für einen föderalen Zusammenschluss in Westeuropa warb. Er unterstrich: «Man vergleiche Kominform [überstaatliches Informationsbüro verschiedener kommunistischer Parteien, d. Verf.] und den Europarat. Was für eine Geschwindigkeit und was für eine Effizienz auf der einen Seite! Was für eine Langsamkeit und Ineffizienz auf der anderen!»[19] Auch in späteren Phasen blieb dieser gefühlte Außendruck hoch. Als sich Norwegen zum Beispiel im September 1972 im letzten Moment gegen eine EG-Mitgliedschaft entschied, meinten manche, man müsse das Land nun sich selbst überlassen. Die britische Botschaft in Oslo hielt jedoch bereits wenige Tage nach der Entscheidung fest, dass dies der falsche Ansatz sei: Immerhin gälte es die Implikationen für den Kalten Krieg zu bedenken.[20] Das traf umso mehr angesichts der Schadenfreude der sowjetischen Presse zu, die die norwegische Entscheidung als «ernsthafte Niederlage für NATO- und EWG-Kreise» feierte.[21]
Bezüglich der Zahl ihrer Mitgliedstaaten und ihren Aufgabenfeldern stach die EG anfangs keineswegs heraus – beziehungsweise sie tat es gerade dadurch, dass sie so klein und eng zugeschnitten war. Bei all diesen Organisationen, inklusive der EG, handelte es sich nicht um Vorhaben europäischer Integration, sondern von regionaler Integration in Europa. Im Vergleich zur UNECE, der OEEC oder dem Europarat war die EG auffallend klein, wobei es natürlich auch noch kleinere Formen der Kooperation gab, etwa auf bilateraler Ebene, im Benelux-Kontext oder im skandinavischen Raum. In Westeuropa hatte man im Verlauf der ersten Nachkriegsdekade gelernt, dass «eine wirksame Tätigkeit ausserordentlich erschwert» wird, wenn – wie beim Europarat – der «Kreis seiner Mitglieder sehr weit gespannt» ist.[22] Ob das EG-Prinzip des «klein, aber fein» erfolgreicher sein würde, war jedoch keineswegs ausgemacht. So stand etwa Anfang der 1960er Jahre mitnichten fest, ob die EG einmal der OEEC/OECD den Rang ablaufen würde. Das sollte sich erst in späteren Jahren zeigen.
Keine der Organisationen konnte Europa in Gänze abbilden, und dennoch ging es darum, für Europa zu stehen. Mit diesem Anspruch traten zunächst fast alle an, worauf bereits das Statut des Europarats verwiesen hat. Pathetische Präambeln und die Selbstbezeichnung als «europäische» Organisation gehörten jeweils dazu. Dabei wäre ausgerechnet jener Teil der EG, der sich langfristig zu deren Kern entwickelte, um ein Haar zu einem grauen Mäuschen geworden. Während die EGKS seit der Schuman-Erklärung eindeutig mit europäischem Anspruch auftrat, firmierten die Verhandlungen über die EWG die längste Zeit unter dem technischen Namen «Gemeinsamer Markt». Die symbolkräftige Bezeichnung «Europäische Wirtschaftsgemeinschaft» kam erst spät, kurz vor Vertragsabschluss, auf. Das war scheinbar nur ein kleiner Unterschied. Aber schon 1958 bemerkte ein Mitarbeiter der OEEC, dass dieser Zusatz der Organisation mehr «Sex-Appeal» verleihe. Für einen Gemeinsamen Markt zu streiten, war das eine; sich für eine Europäische Gemeinschaft einzusetzen, etwas deutlich Nobleres.[23]
Sui Generis
Häufig wird gesagt, dass sich die EG in einer Hinsicht ganz grundsätzlich von allen normalen internationalen Organisationen abhob: Sie allein war supranational.[24] Gemeint ist damit, dass nur sie rechtsverbindliche Mehrheitsbeschlüsse fassen konnte, die unmittelbare Wirkung in den Mitgliedstaaten hatten und nicht erst eigens in nationales Recht umgesetzt werden mussten. Unter Supranationalität wird weiterhin häufig verstanden, dass die entsprechende Organisation gewisse Aufgaben, etwa im Bereich der Verwaltung, übernehmen kann und damit an die Stelle einer einzelstaatlich geführten Politik tritt. Alle anderen Organisationen blieben demzufolge einem intergouvernementalen Ansatz verpflichtet, bei dem jeder Mitgliedstaat im Rahmen der Kooperation ein Veto-Recht hat und damit seine staatliche Souveränität unbeschränkt bleibt.[25]
In dieser Frage ist eine genauere Analyse jedoch aufschlussreich. Zum einen waren weder die EGKS noch die spätere EG oder gar die EU unserer Tage vollständig supranational. Die Hohe Behörde der Montanunion erfüllte diese Kriterien mehr als die spätere EG, ohne ganz darauf festgelegt zu sein. Vor allem auf belgisches und niederländisches Drängen wurde aber selbst der Hohen Behörde ein intergouvernemental agierender Ministerrat vorangestellt. Der niederländische Vertreter in den Verhandlungen, Dirk Spierenburg, stellte klar, dass das Mandat der Hohen Behörde «von einem mehr technischen Charakter» sei, während das des Ministerrats «einen mehr politischen Charakter» trage.[26] Eine supranationale Regelung hätte anders ausgesehen. Die Kompetenzübertragung blieb stets partiell und war keineswegs fest in den ursprünglichen Verträgen verankert. Die unmittelbare Wirkung des EG-Rechts in den Mitgliedstaaten zum Beispiel setzte erst der Europäische Gerichtshof seit den frühen 1960er Jahren durch. Die Möglichkeit, rechtsverbindliche Mehrheitsbeschlüsse zu fassen, war außerdem laut den Verträgen für gewisse Übergangszeiten deutlich beschränkt. Und bevor diese Phase vorüber war, einigte man sich 1966 mit dem sogenannten Luxemburger Kompromiss darauf, vom ursprünglichen Weg abzuweichen und auf einen stärker intergouvernementalen Pfad umzuschwenken.[27] All dies zeigt, dass die EG sich einem Idealtyp supranationalen Regierens lediglich annäherte. So sehr sie Sondermerkmale aufwies, befanden sich die supranationalen Anteile keineswegs auf dem Vormarsch. Die EG war deswegen nicht grundsätzlich verschieden von anderen internationalen Organisationen und Foren regionalen Zusammenschlusses. Darauf, wie wichtig diese Sondermerkmale langfristig waren, wird noch zurückzukommen sein.
Zum anderen revidiert die neueste Forschung jene althergebrachte Interpretation, laut der die EGKS die erste Institution mit supranationalen Elementen darstellte. So erfüllte bereits der wenig bekannte Octroi-Vertrag von 1804 zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, der die Schifffahrt auf dem Rhein regulierte, alle zentralen Merkmale der Supranationalität. Zugegeben, der Vertrag hatte nur ein kurzes Leben und wurde bald durch die etwas bekanntere Zentralkommission für die Rheinschifffahrt von 1816 ersetzt.[28] Dennoch zeigt sich hieran, dass Supranationalität älter ist als zumeist angenommen. Die Herausbildung moderner souveräner Nationalstaatlichkeit und Elemente zu deren Relativierung gingen Hand in Hand.
Mögliche Vorläufer und die Grenzen der Supranationalität spielten in den Debatten der 1950er und 1960er Jahre jedoch keine Rolle. Vielmehr betonten vor allem die Protagonisten der neu geschaffenen EG-Institutionen die absolute Neuartigkeit der Situation. Die feierliche Gemeinsame Erklärung der Minister zur Unterzeichnung des EGKS-Vertrags 1951 erklärte zum Beispiel, dass durch die neue «Organisation, die 160 Millionen Europäer umfasst, die Vertragsparteien Zeugnis ihrer Entschlossenheit abgelegt haben, die erste supranationale Institution aufzubauen und so die wirklichen Grundlagen eines organisierten Europas zu legen».[29] Und Walter Hallstein, der mächtige erste Präsident der EWG-Kommission, beschrieb seine Organisation als Schöpfung «sui generis», die er von allen Formen der Kooperation in Europa und darüber hinaus scharf abgrenzte.[30] «Sui generis» – keine Formulierung drückte den unterstellten Sondercharakter und den visionären Anspruch der EG klarer aus als diese beiden Worte in gelehrtem Latein. Politiker und Experten aus einer Vielzahl von Disziplinen bauten bald weiter an diesem Mythos, und so verfestigte sich mit der Zeit ein Bild, das bis heute Prägekraft hat.[31]
In der Anfangsphase war keineswegs ausgemacht, wie wichtig dieser graduelle Unterschied auf institutioneller Ebene letztlich sein würde. Das galt umso mehr, wenn man ein anderes Organ der EG mit einbezieht: das Parlament. Wer Parlament hört, mag versucht sein, an eine Volksvertretung mit legislativen Befugnissen zu denken. Das Parlament der EG hatte zunächst jedoch nur wenige Kompetenzen. Und, ebenso wichtig: Eine parlamentarische Vertretung war auch Teil des Institutionenaufbaus des Europarats und wurde Anfang der 1950er Jahre auch der WEU, der NATO sowie weiteren Organisationen hinzugefügt. Unter diesen Parlamenten stach das EG-Organ keineswegs heraus. Am ehesten tat dies die Beratende Versammlung des Europarats: Denn sie bildete Vorbild und Kontext für andere Organisationen. Die 1954 geschaffene parlamentarische Versammlung der WEU zum Beispiel setzte sich aus den Europarats-Abgeordneten der WEU-Staaten zusammen. Und als die Beratende Versammlung des Europarats im August 1949 zum ersten Mal zusammentrat, reisten dafür alle Staats- und Regierungschefs der beteiligten Länder an. Von so viel symbolischem Kapital konnten die Verfechter der EG in den frühen Jahren nur träumen.[32]
Wenn die EG dennoch als supranational und besonders galt, lag das nicht zuletzt an ihrem einflussreichsten Kritiker in ihrer Frühphase. Charles de Gaulle, Frankreichs Präsident in den prägenden Jahren von 1959 bis 1969, machte kein Hehl aus seiner Ablehnung eines Modells, das auf die Vereinigten Staaten von Europa hinauslaufen konnte. Bei seinem Amtsantritt fürchteten viele Unterstützer des Einigungsprozesses, dass er der jungen EG aufgrund ihrer supranationalen Anteile den Todesstoß versetzen könnte.[33] Diese Option bestand durchaus und verdeutlicht wiederum, wie wenig gefestigt die Rolle der EG im Feld der internationalen Kooperation zu der Zeit war. De Gaulle erkannte aber, dass das geltende System Frankreich keineswegs knebelte, sondern viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnete. Über eine teilweise brüsk und harsch vorgetragene Machtpolitik und mehr noch durch leidenschaftliche Auftritte auf großer Bühne stellte er sicher, dass die supranationalen Anteile der EG begrenzt blieben und sich nicht über zentrale nationale Interessen stellen konnten. Seine Tiraden über Brüssel waren berüchtigt; gerade weil die EG sich aber nicht mit schnellen Schritten auf die Vereinigten Staaten von Europa zubewegte, richtete sich auch das gaullistische Frankreich gut mit ihr ein und verstand es, aus dem Einigungsprozess großen Nutzen zu ziehen.[34] Zugleich war de Gaulle nicht allein: Trotz vieler Lippenbekenntnisse gab es auch in anderen Staaten eine grundsätzliche Skepsis gegenüber der Supranationalität.[35]
Totaliter aliter – vollkommen anders als andere Organisationen – wollte die EG sein, ohne dass sie dieses Kriterium voll erfüllte. Vorläufig handelte es sich eher um einen Anspruch, eine Behauptung als um eine Tatsache. Denn in den Anfangsjahren war sie ein recht kleiner Club unter vielen mit lediglich graduellen Unterschieden zu anderen Organisationen internationaler Kooperation in Westeuropa. Die EG hatte aufgrund der herausgehobenen Stellung der deutsch-französischen Verständigung, ihren supranationalen Anteilen und weiteren Faktoren, von denen noch die Rede sein wird, hohes Potential, aber das war damals nicht unbedingt offensichtlich. All dies verdeutlicht, wie unwahrscheinlich der Aufstieg der heutigen EU zur dominanten Form der Zusammenarbeit und Integration in Europa eigentlich war.
Aus drei mach eins
Wenn bisher der Begriff Europäische Gemeinschaft im Singular verwandt wurde, handelt es sich selbst dabei um das Ergebnis eines längeren historischen Prozesses, dessen Ausgang zunächst keineswegs absehbar war. Denn die EG musste sich nicht nur gegenüber anderen westeuropäischen Organisationen verhalten. Es dauerte außerdem eine ganze Dekade, bis aus mehreren Gemeinschaften eine einzige entstand. Und selbst dann sprach man noch von ihr im Plural. Nachdem sich Belgien, die Bundesrepublik, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande 1952 zur Montanunion zusammengeschlossen hatten, einigten sich dieselben sechs Staaten fünf Jahre später auf zwei zusätzliche Verträge. Im März 1957 bekam die EGKS zwei Geschwister – die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und Euratom. Die neuen Gemeinschaften waren weder Teile der EGKS noch eigenständige Neuschöpfungen. Vielmehr handelte es sich um ein Arrangement, das an siamesische Drillinge erinnerte (sieht man davon ab, dass die erste der Organisationen deutlich früher das Licht der Welt erblickte als die anderen beiden). Denn alle drei Organisationen hatten getrennte Kommissionen (wobei man diejenige der EGKS, um die Sache verwirrender zu machen, Hohe Behörde nannte) und getrennte Vertretungen der Ressortminister der sechs Staaten, die jeweiligen Ministerräte. Sie teilten sich aber auch einige Institutionen, vor allem die parlamentarische Versammlung und den Gerichtshof.
Nicht nur institutionell, sondern auch inhaltlich bildeten die drei Gemeinschaften zudem einen ziemlichen Flickenteppich. Die Montanunion stand für einen sektoralen Zugriff, der gemeinsame Regelungen für die sechs Mitgliedstaaten in den Bereichen Kohle und Stahl brachte. Euratom wählte einen ähnlichen, sektoralen Ansatz für den Bereich der Kernenergie. Im Gegensatz dazu verfügte die EWG über ein breiteres Mandat, sollte sie doch einen gemeinsamen Markt ohne Binnenzölle, mit freiem Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr und gemeinsamen Handelsregelungen gegenüber Drittstaaten erschaffen. Darüber hinaus enthielt der EWG-Vertrag vage gehaltene Ideen über mögliche weitere gemeinsame Politikfelder – etwa eine Gemeinsame Agrar- und eine Gemeinsame Verkehrspolitik. Im Gegensatz zum EGKS-Vertrag mit seinen ins Einzelne gehenden Regeln (traité loi), handelte es sich beim EWG-Vertrag eher um weitgefasste Handlungsermächtigungen (traité cadre). Dieser Ansatz hatte entsprechende Folgen: Die Agrarpolitik wurde binnen zehn Jahren zum sichtbarsten und umstrittensten Politikfeld der EWG, die Verkehrspolitik blieb eine Totgeburt – traité cadre eröffnete weite Handlungsräume, erhöhte aber auch die Wahrscheinlichkeit des Misserfolgs.[36] Eine übergreifende Logik, auf welche Bereiche sich die EG mit welcher Art von Rechtsform konzentrieren sollte, gab es nicht. Ausschlaggebend war vielmehr, worauf sich die beteiligten Regierungen in den Vertragsverhandlungen und manchmal erst in der Phase der Implementierung des Beschlossenen einigen konnten.
Dies zeigt sich besonders an zwei letztlich nicht realisierten Projekten. Denn die 1957 hinzugekommenen Gemeinschaften waren Zwerge im Vergleich zu den Planungen, die in der kurzen halben Dekade zwischen der Montanunion und den Römischen Verträgen weit gediehen waren. In dieser Phase verhandelten die sechs EGKS-Staaten über die Schaffung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG), mit der eine eigene europäische Armee geschaffen worden wäre. Diese wie auch die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) – als der Versuch, eine Art Verfassung für die sechs Mitgliedstaaten zu erschaffen – scheiterten jedoch 1954 am Widerstand der französischen Nationalversammlung, besonders den darin vertretenen Kommunisten und den Gaullisten. Schon vor de Gaulles Wiederaufstieg zum Präsidenten der Republik gingen einer Mehrheit der in Paris versammelten Abgeordneten diese radikalen Pläne zu weit. EVG und EPG hätten Kernbereiche staatlicher Souveränität eingeschränkt und den Einigungsprozess stark vertieft. Was 1957 entstand, waren gemessen an diesen Planungen und Erwartungshorizonten lediglich Schrumpfgemeinschaften, die sich bald auf Produktion und Handel mit Kohle, Stahl, landwirtschaftlichen Gütern und nuklearem Material sowie die Herstellung eines gemeinsamen Markts konzentrierten. Ihnen fehlte jenes übergreifende Dach, das die EPG zu schaffen versucht hatte. Die beiden 1957 etablierten Gemeinschaften stellten somit Erfolge für die EGKS dar, standen aber auch auf dem Trümmerhaufen deutlich größerer Pläne.
Für die EGKS bargen EWG und Euratom außerdem Herausforderungen und Risiken. In der Anfangszeit wanderten wichtige Mitarbeiter aus der Montanunion in die beiden neuen Organisationen und andere Bereiche ab. Pierre Uri, einer von Monnets engsten Mitarbeitern in der Hohen Behörde, hatte bereits in der Verhandlungsphase der Römischen Verträge viel Zeit in Brüssel verbracht und trat im Juli 1959 zurück. Mehrere zentrale Positionen – wie die des Direktors der Finanzabteilung der EGKS – konnten längere Zeit nicht besetzt werden. Zudem kam es häufiger zu Streit, etwa über die Frage, wie die getrennten und die geteilten Organe genau zu funktionieren hätten. Als zum Beispiel EWG-Kommissionspräsident Hallstein die Eröffnungsrede der neuen, gemeinsamen parlamentarischen Versammlung halten wollte, hagelte es in der Hohen Behörde der EGKS Protest: Man selbst sei doch die ältere Behörde und habe deswegen Vorrang. Gerade in der Anfangszeit kam es zu vielen Reibungen, befeuert durch persönliche Eitelkeiten und institutionelle Rivalitäten.[37]
So zeichnete sich bald ab, dass das Verhältnis zwischen den drei Gemeinschaften weder harmonisch noch gleichberechtigt sein würde. Die Erwartungen der EGKS, weiterhin die erste Geige zu spielen, wurden schnell enttäuscht.[38] Aber auch unter den beiden anderen Organisationen war ursprünglich nicht klar, welche größeres Gewicht haben würde. Jean Monnet zum Beispiel setzte auf Euratom. Da sich die EGKS bereits mit Kohle befasste, schien dieser Sektor naheliegend. Außerdem ließen sich hier energiepolitische und sicherheitspolitische Fragen kombinieren, da sich die Kernspaltung bekanntlich auch militärisch nutzen lässt.[39] In den Nachkriegsjahren verbanden sich mit der Kernenergie teilweise geradezu utopische Zukunftserwartungen. Manche Experten glaubten damals, dass es in absehbarer Zukunft Atomtriebwerke für Flugzeuge geben würde und die zivil genutzte Kernenergie den Schlüssel zur Lösung der großen energiepolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft böte. Der Philosoph Ernst Bloch zum Beispiel schwärmte Ende der 1950er Jahre davon, wie das Atom zum Frieden beitrage; wie es aus «Wüste Fruchtland, aus Eis Frühling» schaffen würde. Die Kernkraft vermöge es, «der Menschheit die Energie, die sonst in Millionen von Arbeitsstunden gewonnen werden müßte, in schmalen Büchsen, höchstkonzentriert, zum Gebrauch fertig darzubieten».[40] In den Vertragsverhandlungen war von der «Perspektive einer neuen industriellen Revolution jenseits jeden Vergleichs mit jener der letzten hundert Jahre» die Rede, wie es das italienische Außenministerium festhielt.[41] Solche Hoffnungen lösten sich bald in Luft auf. Auch aus anderen Gründen spielte Euratom bald nur noch eine Nebenrolle, während die EWG