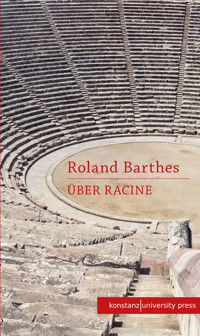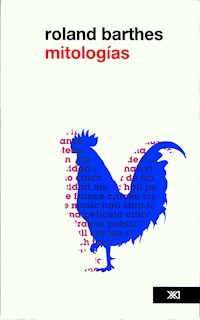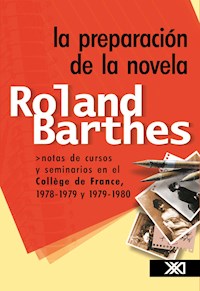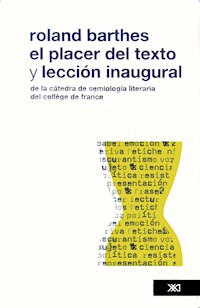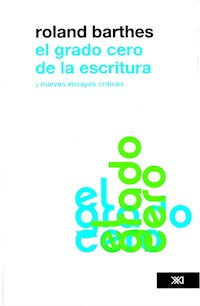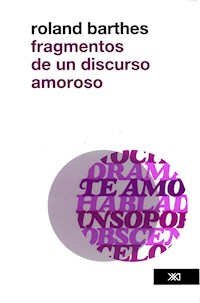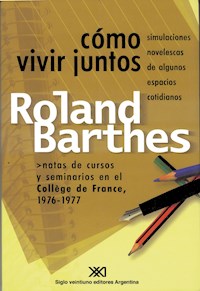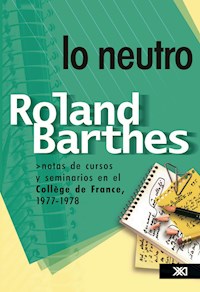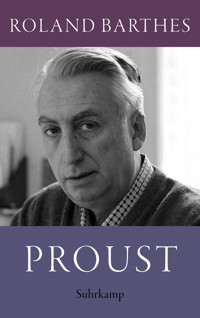
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spricht Barthes von Proust, spricht er meistens von sich selbst. Barthes hat nicht das eine, große Proust-Werk geschrieben, aber sich immer wieder mit seinem Alter Ego auseinandergesetzt. Dieser Band versammelt die wichtigsten Texte von Roland Barthes über Marcel Proust: Zeitschriftenbeiträge, Vorlesungen und Vorlesungsnotizen und eine Auswahl aus Barthes’ fast 3000 hinterlassenen Karteikarten zu Proust. Barthes legt Spuren, öffnet Ausblicke, macht, in der Trauer über den Tod seiner Mutter, Pläne, eine ihrem Andenken gewidmete Recherche, seine eigene »Vita nova«, zu schreiben – was womöglich nur sein früher Tod im März 1980 verhindert hat. Hier erstmals zugänglich gemacht ist ebenfalls die Transkription einer Radiosendung von France Culture aus den 70er Jahren, Spaziergänge mit Roland Barthes auf den Spuren von Marcel Proust in Paris.
»Ich begreife, daß das Werk von Proust, zumindest für mich, das Referenzwerk ist, die allgemeine Mathesis, das Mandala der gesamten literarischen Kosmogonie, wie es die Briefe der Mme de Sévigné für die Großmutter des Erzählers, die Ritterromane für Don Quijote waren.« (Roland Barthes)
Das Dokument einer bedeutenden literarischen Wahlverwandtschaft, ebenso erhellend für das Werk Prousts wie für das von Roland Barthes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Roland Barthes
Proust
Aufsätze und Notizen
Herausgegeben von Bernard Comment
Aus dem Französischen von Horst Brühmann und Bernd Schwibs
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Titel der Originalausgabe: Roland Barthes, Marcel Proust. Mélanges
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2022.
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin 2022© der Originalausgabe: Éditions du Seuil, Oktober 2020
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Brian Barth
Umschlagfoto: Ulf Andersen/Getty Images
eISBN 978-3-518-77385-7
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorbemerkung des Herausgebers
Die parallelen Leben. (
1966
)
Proust und die Namen. (
1967
)
Unterrichtsmaterial zu einer Vorlesung
,
gehalten in Rabat. (
1970
)
Proust. (
1871
-
1922
)
Eine Forschungsidee. (
1971
)
Ein Mensch
,
eine Stadt
:
Marcel Proust France Culture. (
1978
)
1
. Auf der Suche nach dem Faubourg
2
. Unterwegs nach Combray
3
. Im Schatten von Gärten und Wäldern
»Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen«. (
1978
)
Unvollendetes Vorwort zur Taschenbuchausgabe bei Le Livre de Poche. (
1978
)
(Über Proust)
»Das kommt in Gang«. (
1979
)
Auszüge aus »Die Vorbereitung des Romans«
Eine Auswahl von Karteikarten zu Proust aus Barthes
’
umfangreichem Karteikasten
Bildteil
Bibliographie
Fußnoten
Informationen zum Buch
Vorbemerkung des Herausgebers
Auf einer undatierten, gleichwohl auf die späten siebziger Jahre datierbaren Karteikarte bemerkt Roland Barthes über sein Verhältnis zu Proust und sein Motiv, sich (in einer Vorlesung am Collège de France und in einem unvollendet gebliebenen Vorwort) erneut in dessen Werk zu vertiefen:
»[…] eine Rechnung begleichen – oder einfach eine ›Schuld‹, eine Verpflichtung, ein ›Agendum‹ gegenüber einem Werk, über das ich kaum je geschrieben habe, das ich jedoch vielleicht am häufigsten gelesen und wiedergelesen habe – ohne freilich schwören zu können, daß dies in extenso geschah, denn immer habe ich längere Passagen übersprungen.«
Und in der Tat ist es erstaunlich: Barthes hat zu Lebzeiten nur wenig über Proust veröffentlicht. Einen Artikel in La Quinzaine littéraire über das zweibändige biographische Werk von George D. Painter (März 1966); einen Artikel über »Proust et les noms« [»Proust und die Namen«] in einem Sammelband zu Ehren Roman Jakobsons (1967, wiederaufgenommen in Nouveaux essais critiques1972); »Une idée de recherche« [»Eine Forschungsidee«], erschienen 1971 in der Zeitschrift Paragone; ein Vortrag am Collège de France (»Longtemps je me suis couché de bonne heure« [»Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen«]) im Oktober 1978, als Broschüre für einen kleinen Adressatenkreis gedruckt; und einen Artikel in Le Magazine littéraire im Januar 1979 über das berühmte Rätsel des »Ça prend« [»Das kommt in Gang«]. Ergiebige Texte, jedesmal voller Ideen und anregender Fragen, doch alles in allem nicht viel mehr als vierzig Seiten: also ein Nichts, gemessen an Barthes’ gewaltigem Beitrag zur Erneuerung der Proust-Lektüre und zur Einschreibung Prousts in die Moderne.
Manche werden sich auch daran erinnern, wie gebannt sie die drei Sendungen von Jean Montalbetti auf France Culture im Rahmen der Reihe »Ein Mensch, eine Stadt« (1978) verfolgt haben: Gewiß, die besuchten Orte waren zumeist enttäuschend, doch gerade diese Enttäuschung wußte Barthes zu nutzen, um eine Vorstellung zu vermitteln von der ganzen Spannweite der Recherche und der Verwandlungen, die sich darin vollziehen.
Dabei ist Roland Barthes noch sehr jung (17 Jahre), als er Proust entdeckt. Er berichtet darüber einem Schulfreund, Philippe Rebeyrol, in einem Brief vom 30. August 1932:
»Ein Schriftsteller schließlich, über den ich mit Dir sprechen muß, ist Marcel Proust: damit kein Zweifel aufkommt, sage ich Dir zuerst, daß er mir gefällt. Viele Leute finden ihn langweilig, weil seine Sätze sehr lang sind: Proust ist im Grunde ein Prosadichter, das heißt, bei einer einfachen prosaischen Handlung analysiert er sämtliche Empfindungen, sämtliche Erinnerungen, die diese Handlung in ihm weckt, wie wenn ein Beobachter die Kreise untersuchte, die nacheinander, einer aus dem anderen, entstehen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft: er unternimmt diese Analyse mit viel Empfindung, Trauer, manchmal Witz: es gibt Beschreibungen des Lebens in der Provinz (in Du côté de chez Swann) – ich versichere es Dir, ich, der ich dort bin –, die erschütternd wahr sind. Dieser ganze Teil seines Werkes ist sehr interessant und hat mich sehr berührt. Weniger gemocht habe ich den zweiten Band [es handelt sich um Un amour de Swann], der die eigentliche Handlung enthält, für die ich mich ein wenig zu jung halte.«[1]
Im Januar 1953, dem Erscheinungsjahr seines ersten Buches Le Degré zéro de l’écriture [Am Nullpunkt der Literatur], schreibt Barthes in L’Observateur:
»Das Werk von Proust ist progressiv in dem Maße, wie dieser Autor, wenn er Individuen schildert, es verstanden hat, ohne irgendeinen ideellen Rückgriff das Verhalten einer ganzen sozialen Gruppe vor Augen zu führen. Indem sie gleichzeitig den historischen und den überhistorischen Menschen herausarbeitet, trägt die linke Literatur bei zu einer soziologischen Klärung der verschiedenen Momente einer Gesamtgeschichte der Menschen.«
Später, im April 1963, schreibt Barthes in seinem Tagebuch, er »tauche in Proust ein«. Ende Januar 1965 berichtet er, wiederum in seinem Tagebuch, von »Notizen zu Proust«, und Anfang 1966 ist von einem »Seminar über Proust« die Rede. Ende 1969 kommt er darauf zurück, macht sich Notizen, und im Januar 1970 findet man den Vermerk: »Vorbereitung Vorlesung Proust«. Roland Barthes verbringt zu dieser Zeit ein Jahr in Marokko, in Rabat, um dort zu unterrichten, und widmet Proust einen Teil seines Lehrprogramms. Der vorliegende Band enthält das hektographierte, zu diesem Anlaß an die Studenten verteilte Dokument, in dem hinter deutlich pädagogischen Bemühungen um historische Vergegenwärtigung und Kontextualisierung die großen Linien seines Gedankengangs erkennbar sind: À la Recherche du temps perdu als Roman des Schreibens und das Verhältnis zwischen Held und Erzähler, zwischen Leben und Werk.
Doch erst in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre rückt Proust mit einer gewissen Nachdrücklichkeit wieder ins Zentrum der geistigen Welt und der Beschäftigungen von Roland Barthes. 1977 verleiht die Trauer um seine Mutter der Recherche beinahe den Charakter eines Talismans. Barthes sieht in Proust ein Modell, eine Perspektive für die Änderung seines Lebens (und Schreibens), deren er so sehr bedarf. Denn Proust selbst hatte sein Schlüsselerlebnis (den berühmten Wechsel vom mondänen Leben zum zurückgezogenen Schreiben) im Anschluß an den Tod seiner Mutter gehabt, die 1905 starb – zumindest ist das die phantasmatische Sicht, die Barthes davon hat, auch wenn er sich über deren mythologischen Charakter klar ist. Und wenn er sich nach den Fragments d’un discours amoureux [Fragmente einer Sprache der Liebe] an einem Roman versuchte? Nun hat aber gerade Proust in gewisser Weise dieses Modell vollendet, und wie man weiß, war Barthes ein strikter Anhänger des Grundsatzes: modern sein heißt wissen, was schon gemacht worden ist (um es nicht noch einmal zu machen). Der radikal moderne Roman, der in seiner Epiphanie vielleicht nicht einmal von seinem Autor erwartet wurde, wird La chambre claire [Die helle Kammer] sein (geschrieben zwischen 15. April und 3. Juni 1979, erschienen im Februar 1980). Doch das Rätsel Proust dürfte all diese Jahre lang den Trauerprozeß genährt und vielleicht trotz allem, unterderhand, gefördert haben.
Während der Niederschrift von La chambre claire notiert Barthes auf einer Karteikarte:
»Affinität zwischen Proust und dem Photo: das Photo ist die verzweifelte Suche nach der Zeit des Einst: intensive Vergegenwärtigung, in der ich (das Subjekt) mich verliere.
Das wird sehr deutlich in der Ikonographie Prousts: sein Roman ist buchstäblich illustriert (von den Photographien seines Lebens).
Und auch ich – bescheiden, kann man doch auf der Stufe des Schreis nicht den Anspruch erheben, sich als Proust zu denken – versuche hier meine Suche nach der verlorenen Zeit zu schreiben, mit den Photos von Mam. Und die Taktlosigkeit ist dabei nicht größer, als wenn Proust von seiner Mutter und seiner Großmutter zu sprechen beginnt.«
An anderer Stelle ist zu lesen:
»Ich würde gern eines Tages dieses Vermögen des Romans entfalten – dieses Vermögen zur Liebe oder zur Verliebtheit (manche Mystiker unterschieden Agape nicht von Eros) –, sei es in einem Essay (ich habe von einer pathetischen Literaturgeschichte gesprochen), sei es in einem Roman, wobei ich bequemlichkeitshalber jede Form so nenne, die im Verhältnis zu meiner vergangenen Praxis, meinem vergangenen Diskurs, neu ist.«
Genau das wird La chambre claire sein. Die Dramaturgie des »Das ist es!« ist keine andere als die der unwillkürlichen Erinnerung, der Reminiszenz in der Recherche. Die Vergangenheit taucht auf, ist wie durch ein Wunder gegenwärtig, öffnet die Schleusen der Zeit.
Zur gleichen Zeit ist Proust sehr präsent im Unterricht am Collège de France. Zunächst in der Form zweier Seminarsitzungen: »Qu’est-ce que tenir un discours?« im März 1977 (in diesem Band nicht enthalten, weil der »Charlus-Diskurs« dort nur der Aufhänger für eine allgemeinere Analyse des Macht-, Herrschafts- und Einschüchterungseffekts im Diskurs ist). Und vor allem im zweiten Jahr der Vorlesung über La préparation du roman [Die Vorbereitung des Romans] (1979-1980), in der Proust wie ein roter Faden, fast wie ein Kompaß wiederkehrt und dessen bedeutendste Fragmente hier ausgewählt wurden. Diese Vorlesung sollte in ein Seminar münden, in dem die Photographien der Vorbilder für die Personen der Recherche an die Wand projiziert werden sollten.[2] Wenn man die drei wichtigen Sendungen von France Culture und ein unveröffentlichtes, unvollendetes Vorwort hinzunimmt, kann man ermessen, welche überragende Bedeutung Marcel Proust in Barthes’ letzten Lebensjahren hatte.
Natürlich ist es ein rein editorischer Kunstgriff, die Texte und Vorträge Barthes’ über Proust zu einem Band zu versammeln. Es ist aber auch schlicht eine Wiedergutmachung und eine Weise, Proust wieder ins Zentrum von Barthes (oder ebensogut Barthes ins Zentrum von Proust) zu rücken.
Diesem Ensemble haben wir schließlich noch einen unveröffentlichten Text (für eine Zeitschrift, Fiesta letteraria), ein Vorwort, das (wegen urheberrechtlicher Unklarheiten darüber, ab wann das Werk Prousts gemeinfrei wird) unfertig geblieben ist, und eine bedeutende Auswahl von nahezu zweihundert Karteikarten beigefügt. Sie alle stammen aus dem allgemeinen Zettelkasten, in dem Barthes seine auf Bristolkarton festgehaltenen Notizen sortierte, manche beidseitig beschrieben, und den er jeweils im Hinblick auf seine Projekte, seine Forschungen durchblätterte. Von den zwei- oder dreitausend Karteikarten, die Proust gewidmet sind, haben wir uns auf diejenigen beschränkt, die einen Einfall festhalten oder ein wiederkehrendes Interesse oder das Bedürfnis nach einer Synthese erkennen lassen. In ihrer Fülle und ihrem oftmals embryonalen Charakter zeigen sie eine Erkenntnis im Moment ihrer Entstehung und fördern auf anregende Weise unsere Lektüre der Recherche du temps perdu.
In einer Zeit, in der seit einigen Jahren das Totem Proust von der traditionellen Kritik wieder vereinnahmt zu werden scheint, um ihn auf das Niveau des Psychologismus und Biographismus zurückzuholen oder ihn schlicht zu paraphrasieren, trägt die Veröffentlichung dieses Ensembles von Texten, Äußerungen und Notizen Roland Barthes’ auch dazu bei, an einen anderen Proust zu erinnern, einen entschieden modernen, strukturalen und in seiner Form atemberaubend revolutionären Proust. Das ist nicht wenig.
»Sein Œuvre wird nicht mehr bloß als ein Monument der Weltliteratur gelesen, sondern als leidenschaftlicher Ausdruck eines absolut persönlichen Subjekts, das fortwährend auf sein eigenes Leben nicht als ein curriculum vitae zurückkommt, sondern als eine Konstellation von Umständen und Figuren«, bemerkt der Professor am Collège de France in dem Vortrag, den er im Herbst 1978 dort hält. Und im weiteren bekennt er: »Nun kann es meines Erachtens für den, der schreibt, für den, der das Schreiben gewählt hat, ein ›neues Leben‹ nur durch die Entdeckung einer neuen Schreibpraxis geben.« Das Schicksal hat darüber anders entschieden. Niemand weiß, was der Autor der Fragments d’un discours amoureux nach La chambre claire geschrieben hätte.
Bernard Comment
Die parallelen Leben
(1966)[3]
Auf den ersten Blick gibt es nichts, was das Leben Prousts zum Gegenstand einer großen Biographie prädisponieren würde. Es ist nicht das Leben eines Jünglings (Rimbaud), Abenteurers (Byron), Titanen (Balzac) oder Leidgeprüften (Van Gogh); es ist das Leben eines Sohns aus mondäner Familie, müßig, reich (und man weiß, wie sehr wir heute dem Geld eines Schriftstellers mißtrauen), im Dekor – halb haussmannisch, halb normannisch – einer Epoche des Bürgertums, die man im allgemeinen ironisch als Belle Époque bezeichnet: eher ein Stoff für Filme als von literarischem Wert. Und dennoch hat es sich so ergeben: Das Leben Prousts ist faszinierend. Den Beweis dafür liefert das Buch von Painter und das äußerst lebhafte, ja einzigartige Vergnügen, das wir daran finden. Warum?
Ohne Zweifel steht das Proustsche Werk bereits in einem unmittelbaren Verhältnis zum biographischen Genre, weil dieses einzigartige Werk, diese Summa, der Bericht eines Lebens ist, das von der Kindheit bis zum Schreiben reicht; derart, daß Marcel und sein Erzähler ein wenig jenen Heroen der Antike gleichen, die Plutarch in seinen »parallelen Lebensbeschreibungen« (vitae parallelae) gepaart hat. Doch hier taucht ein erstes, letztlich enttäuschendes Paradox auf: Nimmt man sie in ihrer ganzen Ausdehnung (und nicht in ihrer Substanz), so berühren sich die Parallelviten Prousts und seines Erzählers nur an sehr wenigen Stellen; was die eine und die andere gemein haben, ist eine sehr elementare Reihe von Ereignissen oder eher Verknüpfungen: eine lange mondäne Periode, eine tiefe Trauer (um Mutter beziehungsweise Großmutter), ein erzwungener Rückzug in ein Sanatorium, ein freiwilliger Rückzug in das korkverkleidete Zimmer, um das Werk auszuarbeiten. Diese Gemeinsamkeiten nehmen in der Spanne des Werks und des Lebens die gleiche Position ein, doch man muß erkennen, daß sie keineswegs die gleiche Rolle spielen: Der Tod der Mutter hat im Leben Prousts eine entscheidende Zäsur bewirkt, während der Tod der Großmutter an der Existenz des Erzählers nichts ändert, dessen ganzer Kummer an seine Mutter delegiert wird (eine rätselhafte Substitution nebenbei, über die man nachdenken müßte); andererseits dauert der erzwungene Rückzug Prousts sehr kurz (ein paar Wochen in einer Klinik in Boulogne), der des Erzählers (in Die wiedergefundene Zeit) hingegen sehr lange, weil er danach eine mit der Maske des Alters seltsam aufgeputzte Welt entdeckt. Alles in allem besteht zwischen dem erlebten und dem geschriebenen Leben keine Analogie, sondern nur Homologie. Wir haben also zwei Entwürfe, die gemäß bestimmten Andeutungen zwar miteinander in Beziehung zu stehen scheinen, doch diese Beziehung bleibt blaß: Sie ist entweder zu klar oder zu tief. Woher rührt dann das Rätsel dieser beiden Parallelviten? Anders gefragt, wie kommt es, daß wir das Leben Prousts mit der gleichen Gier verfolgen, mit der wir eine Geschichte »verschlingen«?
Die Wahrheit lautet, höchst paradox, daß das Leben Prousts uns nötigt, die Art, wie wir üblicherweise Biographien lesen, einer Kritik zu unterziehen.
Gewöhnlich nehmen wir an, daß uns das Leben eines Schriftstellers über sein Werk Auskunft geben soll; wir wollen eine Art Kausalität zwischen den erlebten Abenteuern und den erzählten Episoden wiederfinden, so als riefen die einen die anderen hervor; wir glauben, daß die Arbeit des Biographen das Werk beglaubigt, das uns »wahrer« erscheint, wenn man uns zeigt, daß es erlebt worden ist; so sehr haben wir das zähe Vorurteil, daß die Kunst im Grunde Illusion ist und daß man sie, wann immer es möglich ist, mit ein wenig Realität, ein wenig Kontingenz beschweren muß. Das Leben Prousts nötigt uns nun aber, dieses Vorurteil umzustürzen: Es ist nicht das Leben Prousts, das wir in seinem Werk wiederfinden, es ist sein Werk, das wir im Leben Prousts wiederfinden. Liest man das Werk Painters (das den Vorzug äußerster Transparenz hat), so entdeckt man nicht den Ursprung der Recherche, sondern liest ein Doppel des Romans, so als hätte Proust dasselbe Werk zweimal geschrieben: in seinem Buch und in seinem Leben. Wir sagen uns nicht (zumindest hatte ich dieses Gefühl): Montesquiou ist eindeutig das Modell für Charlus, sondern ganz im Gegenteil: Es gibt etwas von Charlus in Montesquiou, es gibt etwas von Balbec in Cabourg, es gibt etwas von Albertine in Agostinelli.
Anders gesagt (zumindest mit Proust), nicht das Leben gibt Auskunft über das Werk, sondern es ist das Werk, das ins Leben ausstrahlt, in ihm implodiert und die tausend Bruchstücke verstreut, die ihm vorauszugehen scheinen. Doäzan, Lorrain, Montesquiou, Wilde ergeben, zusammengenommen, nicht Charlus, sondern es ist Charlus, der sich gleichsam aussät und in einigen realen Figuren aufkeimt, in unterschiedlich vielen übrigens, mit jeder Biographie vermehren sie sich maliziös. Diese paradoxale Lektüre entspricht nun dem, was wir von der Philosophie Prousts erahnen (insbesondere seit dem Buch von Gilles Deleuze über Proust et les signes[4] ): Die Proustsche Welt ist eine platonische Welt (viel eher als eine bergsonianische), sie ist mit Wesenheiten, Essenzen bevölkert, und diese Essenzen sind im Werk und im Leben Prousts verstreut: Die Essenz (Charlus, Balbec, Albertine, das »kleine Thema«) fragmentiert sich, ohne sich zu verändern, seine unverminderten Parzellen siedeln sich in Erscheinungen an, bei denen es letztlich nicht darauf ankommt, ob sie fiktional oder real sind.
Wir verstehen dann, wie vergeblich es ist, in der Recherche nach »Schlüsseln« zu suchen. Die Welt liefert nicht die Schlüssel für das Buch; es ist das Buch, das die Welt eröffnet. Gewiß bietet das Leben Prousts selbst ein bevorzugtes Feld für die Verstreuung der Essenzen, doch dieses Feld ist nicht das einzig mögliche. Jedes unserer individuellen Leben kann sich öffnen, um Proustsche Essenzen aufzunehmen; daher das beständige Gefühl, die Welt Prousts in unserem Leben wiederzufinden (ganz wie Swann die Caritas von Giotto oder den Dogen Loredan de Rizzo in dem mit dem Spargelschälen beauftragten Küchenmädchen oder in seinem Kutscher Rémi wiederfand). Wer begegnet nicht heute noch, 1966, in seinem Umkreis M. de Norpois beim Schwadronieren über Literatur oder dem jungen Pechvogel Octave, ungebildet, jedoch kompetent, was Bars, Sport und Klamotten angeht? Die Wahrheit Prousts entspringt nicht einer genialen Kopie der »Realität«, sondern einer philosophischen Reflexion über Essenzen und über Kunst. Wenn also der Leser, der Paradoxie zum Trotz, das Leben Prousts nicht als dem Werk vorausgehend, sondern ihm folgend liest, ist er es, der recht hat, und nicht der Kritiker, der versuchen würde, das Werk Prousts aus seinem Leben zu erklären.
Man kann diese biographische Paradoxie auch anders formulieren: Das Leben Marcels und des Erzählers bilden zwei Ebenen, auf denen sich dieselben Essenzen verstreuen können; was jedoch nicht mehr parallel zwischen ihnen verläuft, weil es eines, einzig, identisch ist, das ist das Schreiben: in ihm schneiden sich die Parallelen. Wenn sich Marcel in sein korkverkleidetes Zimmer einschließt, dann um zu schreiben; wenn der Erzähler der Welt entsagt (bei der Matinee der Guermantes), dann um endlich sein Buch zu beginnen. Anders gesagt, erst dann vereinen die beiden Parallelviten unauflöslich ihre Dauer: Das Schreiben des Erzählers ist buchstäblich das Schreiben Marcels: Er ist weder Autor noch Figur, es gibt nur noch ein Schreiben.
Proust und die Namen
(1967)[5]
Wie man weiß, ist die Suche nach der verlorenen Zeit die Geschichte eines Schreibens. Vielleicht ist es ganz hilfreich, sich diese Geschichte in Erinnerung zu rufen, um besser zu verstehen, wie sie ausgegangen ist, denn es ist dieser Ausgang, der dem Schriftsteller letztlich das Schreiben ermöglicht.
Die Entstehung eines Buches, das wir nicht kennen, dessen Ankündigung jedoch eben das Buch von Proust ist, spielt sich wie ein Drama in drei Akten ab. Der erste Akt spricht den Willen zu schreiben aus: Der junge Erzähler bemerkt in sich diesen Willen in dem erotischen Vergnügen, das ihm die Sätze Bergottes vermitteln, und in der Freude, die er empfindet, die Kirchtürme von Martinville zu beschreiben. Der zweite Akt, der ziemlich lang ist, weil er den größten Teil der Verlorenen Zeit einnimmt, behandelt die Unfähigkeit zu schreiben. Diese Unfähigkeit gliedert sich in drei Szenen oder, wenn man so will, drei Situationen der Enttäuschung: Zunächst vermittelt Norpois dem jungen Erzähler ein entmutigendes Bild der Literatur: ein lächerliches Bild, das zu erreichen er nicht einmal das Talent hätte; ein zweites Bild wird ihn viel später noch mehr deprimieren: eine Passage aus dem Tagebuch der Goncourts, brillant und lächerlich zugleich, bestätigt ihm im Vergleich seine Unfähigkeit, Empfindungen festzuhalten; und schließlich, noch ernster, weil er sich auf seine Empfindsamkeit und nicht mehr auf seine Begabung bezieht, schreckt ihn ein letzter Vorfall endgültig vom Schreiben ab: Als er aus dem Zug, der ihn nach einer langen Krankheit nach Paris zurückbringt, drei Bäume in der Landschaft erblickt, empfindet der Erzähler nichts als Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Schönheit; er beschließt, niemals je zu schreiben; in dem Gefühl, von einem Gelübde, das zu erfüllen er eindeutig unfähig ist, entbunden zu sein, willigt er traurig ein, in die Frivolität der Gesellschaft zurückzukehren und sich zu einer Matinee der Duchesse de Guermantes zu begeben. Hier wird dem Erzähler im Zuge einer wahrhaft dramatischen Wendung, die sich gerade durch diesen Verzicht ereignet, die Fähigkeit zu schreiben unmittelbar wieder in Aussicht gestellt. Dieser dritte Akt nimmt Die wiedergefundene Zeit ein und umfaßt ebenfalls drei Episoden; die erste besteht aus drei aufeinanderfolgenden Momenten der Verzückung: es sind drei Reminiszenzen (San Marco, die Bäume des Zuges, Balbec), ausgelöst durch drei winzige Vorfälle bei seiner Ankunft beim Stadtpalais der Guermantes (die unebenen Pflastersteine des Hofes, das Geräusch eines kleinen Löffels, eine gestärkte Serviette, die ihm ein Diener hinhält); diese Reminiszenzen sind Glücksmomente, die es jetzt zu verstehen gilt, wenn man sie bewahren oder zumindest nach Belieben erinnern will: In einer zweiten Episode, die das Wesentliche der Proustschen Theorie der Literatur ausmacht, bemüht sich der Erzähler, systematisch die Zeichen zu erforschen, die er empfangen hat, und so in einer einzigen Bewegung die Welt und das Buch, das Buch als Welt und die Welt als Buch zu verstehen. Eine letzte Verzögerung wird jedoch die Fähigkeit zu schreiben hinausschieben: Als er den Blick auf die Eingeladenen richtet, die er seit langem aus den Augen verloren hat, bemerkt der Erzähler mit Verblüffung, daß sie gealtert sind: Die Zeit, die ihm das Schreiben wiedergegeben hat, droht, es ihm im selben Moment wieder zu entziehen: wird er lange genug leben, um sein Werk zu schreiben? Ja, wenn er bereit ist, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen, sein mondänes Leben aufzugeben, um sein Leben als Schriftsteller zu retten.
Die Geschichte, die der Erzähler berichtet, hat also alle dramatischen Merkmale einer Initiation; es handelt sich um eine regelrechte Mystagogie, gegliedert in drei dialektische Momente: den Wunsch (der Mystagoge postuliert eine Offenbarung), das Scheitern (er nimmt die Gefahren, die Nacht, das Nichts auf sich), die Himmelfahrt (im tiefsten Scheitern findet er den Sieg). Nun hat Proust selbst, um die Recherche zu schreiben, in seinem Leben dieses Initiationsmuster erfahren: Auf den sehr frühen Wunsch zu schreiben (der sich schon im Lyzeum gebildet hat) folgte eine lange Periode gewiß nicht von Niederlagen, sondern von tastenden Versuchen, als ob das eigentliche und einzige Werk auf der Suche nach sich selbst wäre, sich aufgäbe, sich wieder finge, ohne sich je zu finden; und als ob das des Erzählers, diese negative Initiation, wenn man so sagen darf, aus einer gewissen Erfahrung der Literatur entstanden wäre: die Bücher der anderen haben Proust fasziniert, dann enttäuscht, so wie die Bergottes oder die der Goncourts den Erzähler fasziniert und enttäuscht haben; diese »Durchquerung der Literatur« (um einen Ausdruck von Philippe Sollers zu übernehmen), die dem Weg der Initiation mit all seiner Finsternis und Illusion so sehr ähnelt, hat Proust mittels des Pastiches vollzogen (was könnte Faszination und Entzauberung besser bezeugen als der Pastiche?), mittels leidenschaftlicher Schwärmerei (Ruskin) und Einspruchs (Sainte-Beuve). So näherte sich Proust der Recherche (von der sich manche Fragmente, wie man weiß, schon im Sainte-Beuve finden), doch das Werk konnte noch nicht »in Gang kommen«, »kristallisieren«. Die Haupteinheiten waren vorhanden (Beziehungen von Personen,[6] zentrale Episoden[7] ), sie wurden wie in einem Kaleidoskop in verschiedenen Kombinationen ausprobiert, doch es fehlte noch der verbindende Akt, der es Proust erlauben sollte, die Recherche ohne Unterbrechung von 1909 bis zu seinem Tode zu schreiben, um den Preis eines Rückzugs, von dem man weiß, wie sehr er an den des Erzählers selbst am Ende der Wiedergefundenen Zeit erinnert.
Wir versuchen hier nicht, das Werk Prousts aus seinem Leben zu erklären; wir behandeln einzig Akte innerhalb des Diskurses selbst (folglich poetische und nicht biographische), handele es sich um den Diskurs des Erzählers oder den Marcel Prousts. Nun fordert die Homologie, die ganz offensichtlich die beiden Diskurse regelt, einen symmetrischen Ausgang: Der Grundlegung des Schreibens durch die Reminiszenz (beim Erzähler) muß (bei Proust) eine ähnliche Entdeckung entsprechen, die geeignet ist, in ihrer unmittelbaren Kontinuität die gesamte Niederschrift der Recherche zu tragen. Was also ist das keineswegs biographische, sondern schöpferische Ereignis, das ein bereits konzipiertes, versuchsweise begonnenes, aber noch nicht geschriebenes Werk zusammenhält? Was ist der neue Zement, der uns die große syntagmatische Einheit zu so viel diskontinuierlichen, verstreuten Einheiten liefern wird? Was ermöglicht es Proust, sein Werk zu formulieren? Mit einem Wort, was findet der Schriftsteller symmetrisch zu den Reminiszenzen, die der Erzähler während der Matinee bei den Guermantes erforscht und genutzt hatte?
Die beiden Diskurse, der des Erzählers und der Marcel Prousts, sind homolog, doch keineswegs analog. Der Erzähler wird schreiben, und dieses Futur hält ihn in einer Ordnung der Existenz, nicht der Rede; er hat es mit einer Psychologie, nicht mit einer Technik zu tun. Marcel Proust hingegen schreibt; er kämpft mit den Kategorien der Sprache, nicht mit denen des Verhaltens. Insofern sie zur referentiellen Welt gehört, kann die Reminiszenz nicht unmittelbar eine Einheit des Diskurses sein, und das, was Proust braucht, ist ein genuin poetisches Element (in dem Sinne, den Jakobson diesem Wort gibt): doch muß dieses sprachliche Merkmal, ebenso wie die Reminiszenz, die Kraft haben, die Essenz der Romanobjekte zu konstituieren. Nun gibt es eine Klasse sprachlicher Einheiten, die diese konstitutive Kraft in höchstem Maße besitzt, und das ist die der Eigennamen. Der Eigenname verfügt über drei Eigenschaften, die der Erzähler in der Reminiszenz wiedererkennt: die Kraft der Essenzialisierung (da er nur einen einzigen Referent bezeichnet); die Fähigkeit des Zitierens (da man nach Belieben jede in dem Namen eingeschlossene Essenz aufrufen kann, indem man ihn äußert) und die Fähigkeit der Exploration (weil man einen Eigennamen »entfaltet«, genauso wie man es mit einer Erinnerung tut): Der Eigenname ist in gewisser Weise die sprachliche Form der Reminiszenz. Demnach ist das (poetische) Ereignis, das die Recherche »in Gang gesetzt« hat, die Entdeckung der Namen; zwar verfügte Proust schon seit dem Sainte-Beuve über bestimmte Namen (Combray, Guermantes); doch es scheint, daß er erst zwischen 1907 und 1909 das onomastische System der Recherche in seiner Gesamtheit begründet hat: kaum war dieses System gefunden, schrieb sich das Werk unmittelbar.[8]
Das Werk Prousts beschreibt einen ungeheuren, unaufhörlichen Lernprozeß.[9] Dieser Lernprozeß kennt (in der Liebe, in der Kunst, im Snobismus) immer zwei Momente: eine Illusion und eine Enttäuschung; aus diesen beiden Momenten entsteht die Wahrheit, das heißt das Schreiben; doch zwischen Traum und Erwachen, bevor die Wahrheit auftaucht, muß der Proustsche Erzähler eine zweischneidige Aufgabe erfüllen (denn sie führt zur Wahrheit über zahlreiche Irrtümer). Sie besteht darin, hartnäckig die Zeichen zu befragen: Zeichen, die vom Kunstwerk, vom geliebten Wesen, vom besuchten Milieu ausgehen. Auch der Eigenname ist ein Zeichen und wohlgemerkt nicht nur ein einfacher Index, der bezeichnet, ohne zu bedeuten, wie es die geläufige Auffassung von Peirce bis Russell will. Als Zeichen bietet sich der Eigenname einer Erforschung, einer Entzifferung an: er ist ein »Milieu« (im biologischen Sinne des Ausdrucks), in das man eintauchen muß, indem man sich unbegrenzt in sämtlichen Träumereien treiben läßt, die er mit sich führt,[10] und zugleich ein wertvolles, verdichtetes, duftendes Objekt, das man öffnen muß wie eine Blume.[11] Anders gesagt, wenn der Name (wie wir von nun an den Eigennamen bezeichnen werden) ein Zeichen ist, so ist er ein voluminöses Zeichen, ein stets mächtiges, in seiner Dichte mit Sinn vollgestopftes Zeichen, das keine Verwendung vermindern oder verflachen wird, im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Namen, der in jedem Syntagma immer nur eine seiner Bedeutungen liefert. Der Proustsche Name ist als solcher und in allen Fällen das Äquivalent einer ganzen Lexikonrubrik: der Name Guermantes deckt unmittelbar alles ab, was Erinnerung, Gebrauch und Bildung in ihn hineinlegen können; er kennt keine selektive Beschränkung, das Syntagma, in das er hineingestellt ist, ist ihm gleichgültig; er ist also in gewisser Weise eine semantische Ungeheuerlichkeit, denn er kann, ausgestattet mit sämtlichen Merkmalen des gewöhnlichen Namens, dennoch außerhalb jeder projektiven Regel bestehen und funktionieren. Das ist der Preis – das sind die Kosten – des Phänomens der Hypersemantizität, das ihm innewohnt[12] und das ihn, wohlgemerkt, dem poetischen Wort sehr nahe bringt.
Durch seine semantische Dichte (man möchte fast sagen können: durch seine »Vielschichtigkeit«) bietet sich der Proustsche Name einer veritablen semischen Analyse an, die zu postulieren und zu skizzieren der Erzähler selbst nicht versäumt: Was er als die verschiedenen »Bilder« [figures] des Namens[13] bezeichnet, sind veritable Seme, die trotz ihres imaginären Charakters mit einer vollkommenen semantischen Gültigkeit ausgestattet sind (was einmal mehr beweist, wie notwendig es ist, das Signifikat vom Referenten zu unterscheiden). So enthält der Name Guermantes mehrere Primitiva (um ein Wort von Leibniz aufzugreifen): »Eine Turmfeste ohne stoffliche Dichte, die eigentlich nur ein breiter Streifen orangefarbenen Lichtes war, von deren Höhe der Lehnsherr und seine Dame über Leben und Tod ihrer Vasallen geboten«; »ein goldener, fleuronverzierter Turm, der die Zeiten durchquert«; das Pariser Stadtpalais der Guermantes, »hell leuchtend wie sein Name«;[14] ein Feudalschloß mitten in Paris etc. Diese Seme sind wohlgemerkt »Bilder«, doch in der höheren Sprache der Literatur sind sie nicht minder reine Signifikate der denotierenden Sprache, die einer ganzen Systematik des Sinns offenstehen. Manche dieser semischen Bilder sind traditionell, kulturell: Parma bezeichnet nicht eine Stadt in der Emilia, am Po gelegen, von den Etruskern gegründet, mit 138000 Einwohnern; das wahre Signifikat dieser beiden Silben setzt sich aus zwei Semen zusammen: stendhalische Sanftheit und Schimmer von Veilchen.[15] Andere sind individuell, memorial: Balbec hat als Seme zwei Worte, die einst zu dem Erzähler gesagt wurden, das eine von Legrandin (Balbec ist ein Ort der Stürme, am Ende der Welt), das andere von Swann (seine Kirche ist halb normannische Gotik, halb romanisch), so daß der Name stets zwei Bedeutungen hat: »normannische Gotik« und »Stürme« auf dem Meer.[16] So hat jeder Name sein semisches Spektrum, veränderlich in der Zeit entsprechend der chronologischen Verortung seines Lesers, die seinen Elementen etwas hinzufügt oder wegnimmt, genauso, wie es aufgrund ihrer Diachronizität in der Sprache geschieht. Der Name ist in der Tat katalysierbar; man kann ihn füllen, erweitern, die Zwischenräume seiner semischen Armatur mit unendlich vielen Ergänzungen ausfüllen. Diese semische Ausdehnung des Eigennamens läßt sich auch auf andere Weise definieren: Jeder Name enthält mehrere »Szenen«, die zunächst auf unzusammenhängende, erratische Weise aufgetaucht sind, die jedoch nichts weiter verlangen, als sich zusammenzuschließen und solcherart eine kleine Erzählung zu bilden, denn erzählen heißt immer nur, durch einen metonymischen Prozeß eine beschränkte Anzahl erfüllter Einheiten untereinander zu verbinden: Balbec enthält somit nicht nur mehrere Szenen, sondern darüber hinaus die Bewegung, die sie in ein und demselben narrativen Syntagma versammeln kann, denn diese ungleichartigen Silben waren gewiß aus einer altmodischen Art der Aussprache entstanden, »die ich sicherlich bei dem Gastwirt wiederfinden würde, der mir bei meiner Ankunft einen Milchkaffee servieren und das entfesselte Meer zu Füßen der Kirche zeigen würde und den ich mir als eine lebhaft disputierende, feierlich ernste Gestalt aus einer mittelalterlichen Verserzählung vorstellte«.[17] Weil der Eigenname sich zu einer Katalyse von unendlichem Reichtum anbietet, kann man sagen, daß die gesamte Recherche poetisch aus einigen Namen hervorgegangen ist.[18]
Freilich muß man sie noch wählen – oder finden. Was hier in der Proustschen Theorie des Namens erscheint, ist eines der Hauptprobleme wenn nicht der Linguistik, so doch wenigstens der Semiologie: die Motivation des Zeichens. Zweifellos ist dieses Problem hier etwas künstlich, da es sich in der Tat nur dem Romancier stellt, der die Freiheit (aber auch die Pflicht) hat, Eigennamen zu schaffen, die ganz neu und zugleich »exakt« sind; doch in Wahrheit durchlaufen der Erzähler und der Romancier die gleiche Bahn in umgekehrter Richtung; der eine glaubt in den Namen, die ihm gegeben sind, eine Art von natürlicher Affinität zwischen dem Signifikanten und dem Signifikat, zwischen der Vokalfarbe von Parma und der malvenfarbenen Sanftheit seines Gehalts zu entziffern, während der andere, der einen zugleich normannischen, gotischen und stürmischen Ort erfinden muß, in der allgemeinen Tabulatur der Phoneme einige Laute suchen muß, die zu der Kombination dieser Signifikanten passen; der eine decodiert, der andere codiert, doch es handelt sich um dasselbe System, und dieses System ist auf die eine oder andere Weise ein motiviertes System, das auf einem Verhältnis der Imitation zwischen Signifikant und Signifikat beruht. Codierer und Decodierer könnten sich hier die These des Kratylos zu eigen machen: »Die Eigenschaft des Namens besteht darin, die Sache, so wie sie ist, wiederzugeben.« In den Augen von Proust, der die allgemeine Kunst des Romanciers nur theoretisch untermauert, ist der Eigenname eine Simulation oder, wie Platon sagte (allerdings mit Vorbehalt), eine »Phantasmagorie«.
Die Motivierungen, die Proust angibt, sind von zweierlei Art, natürliche und kulturelle. Die ersten gehören zur symbolischen Phonetik.[19] Hier ist nicht der Ort, die Debatte zu dieser Frage wiederaufzunehmen (früher bekannt unter dem Namen der nachahmenden Harmonie), wo man unter anderen den Namen Platons, Leibniz’, Diderots und Jakobsons begegnen würde.[20] Man braucht sich nur an jenen Text von Proust zu erinnern, der weniger bekannt, doch vielleicht einschlägiger ist als das Sonett der »Vokale«: »… Bayeux, das in seinem edlen, rötlich schimmernden Klöppelgewand so hoch emporragte und dessen Spitze im altgoldenen Schein seiner letzten Silbe erstrahlte; Vitré, dessen Accent aigu die uralten Glasscheiben mit einem Rautenwerk aus schwarzem Holz versteifte; dem weichen Lamballe, dessen weißlicher Ton von Eierschalengelb zu Perlgrau übergeht; Coutances, normannische Kathedrale, die die golden sich rundende Fülle ihres Wortausklangs wie einen Turm aus Butter trägt«, etc.[21] Es geht hier nicht bloß darum, der Opposition i/o den traditionellen Kontrast petit/gros [klein/groß] oder aigu/rond [spitz/rund] zuzuordnen, wie man es gewöhnlich tut: es ist eine ganze Spanne lautlicher Zeichen, die Proust beschreibt. Seine Beispiele zeigen durch ihre Freiheit und ihren Reichtum, daß die phonetische Motivierung nicht unmittelbar zustande kommt: Der Entzifferer schaltet zwischen den Laut und seinen Sinn einen vermittelnden, halb materiellen, halb abstrakten Begriff ein, der als Schlüssel funktioniert und den in gewisser Weise verstärkten Übergang zwischen Signifikant und Signifikat bewirkt: Wenn Balbec eine Bedeutungsaffinität zu einem Komplex von Welle und hohem Kamm, schroffen Felsen und trutziger Architektur aufweist, so deshalb, weil man über ein begriffliches Relais verfügt, das des Rauhen, das sich auf Tastsinn, Gehör und Gesichtssinn gleichermaßen bezieht. Anders gesagt, die phonetische Motivierung verlangt eine innere Benennung: Die Sprache [langue] kehrt in einer Relation heimlich wieder, die man – mythisch – als eine unmittelbare postuliert hat: Die Mehrzahl der vermeintlichen Motivierungen beruht demnach auf Metaphern, die so traditionell sind (das Rauhe, angewandt auf den Klang), daß sie gar nicht mehr als solche empfunden werden, weil sie gänzlich auf die Seite der Denotation übergegangen sind; trotzdem orientiert sich die Motivierung an einer ehemaligen semantischen Anomalie oder, wenn man so will, einer ehemaligen Transgression. Denn natürlich ist es die Metapher, mit der man die Phänomene der symbolischen Phonetik in Verbindung bringen muß, und es würde zu nichts führen, das eine ohne das andere zu untersuchen. Für eine solche kombinierte Untersuchung würde Proust gutes Material liefern: Seine phonetischen Motivierungen enthalten fast alle (außer vielleicht Balbec) eine Äquivalenz zwischen Laut und Farbe: ieu ist altgolden, é ist schwarz, an ist gelblich, blond und golden (in Coutances und Guermantes), i ist purpurn.[22] Darin liegt natürlich eine allgemeine Tendenz: es handelt sich darum, Merkmale auf die Seite des Lauts übergehen zu lassen, die dem Sehen zugehören (genauer gesagt, der Farbe, wegen ihres zugleich schwingenden und modulierenden Charakters); das heißt also, die Opposition zwischen einigen virtuellen Klassen zu neutralisieren, die aus der Trennung der Sinne hervorgegangen sind (doch ist diese Trennung historisch oder anthropologisch? Von wann datieren und woher kommen unsere »fünf Sinne«? Eine erneuerte Untersuchung der Metapher müßte künftig, wie es scheint, das Inventar der nominalen Klassen durchgehen, die von der allgemeinen Sprachwissenschaft belegt sind). Wenn also die phonetische Motivierung einen metaphorischen Prozeß und folglich eine Transgression beinhaltet, so verläuft diese Transgression an bewährten Übergangspunkten, etwa der Farbe: und deshalb erscheinen die von Proust vorgebrachten Motivierungen, so hochentwickelt sie sein mögen, »richtig«.
Bleibt noch ein weiterer Typus von Motivierungen, die eher »kulturell« und insofern denen analog sind, die man in der Sprache findet: Dieser Typus regelt in der Tat die Erfindung der Neologismen, angepaßt an ein morphematisches Muster, und zugleich die der Eigennamen, die ihrerseits von einem phonetischen Muster »inspiriert« sind. Wenn ein Schriftsteller einen Eigennamen erfindet, ist er in der Tat an die gleichen Motivierungsregeln gebunden wie der Platonsche Gesetzgeber, wenn er eine gewöhnliche Benennung schaffen will; er muß die Sache gleichsam »abbilden«, und da das offenkundig unmöglich ist, so doch wenigstens die Art und Weise abbilden, in der die Sprache selbst einige ihrer Namen geschaffen hat. Die Gleichheit des gewöhnlichen Namens und des Eigennamens hinsichtlich ihrer Schöpfung läßt sich gut an einem Extremfall veranschaulichen: wenn nämlich der Schriftsteller vorgibt, gewöhnliche Wörter zu verwenden, die er jedoch frei erfindet: das ist der Fall von Joyce und Michaux; in Voyage en Grande Garabagne hat ein Wort wie arpette – aus gutem Grund – keinen Sinn, ist aber gleichwohl mit einer diffusen Bedeutung aufgeladen, nicht nur wegen seines Kontexts, sondern auch wegen seiner Abhängigkeit von einem lautlichen Muster, das im Französischen sehr geläufig ist.[23] Ebenso verhält es sich mit den Proustschen Namen. Gleichviel, ob Laumes, Argencourt, Villeparisis, Combray oder Doncières existieren oder nicht existieren, weisen sie doch (und eben darauf kommt es an) das auf, was man eine »frankophone Plausibilität« genannt hat: ihr eigentliches Signifikat ist Frankreich oder, besser noch, »Französität« [francité