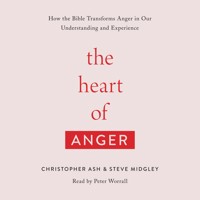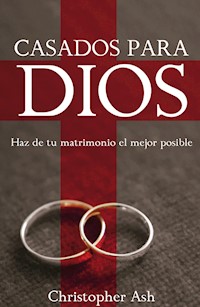Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbum Medien gGmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Die Bibel erklärt
- Sprache: Deutsch
Christopher Ash zeigt uns in diesem Kommentar der Auslegungsreihe Die Bibel erklärt, wie wir das Buch der Psalmen lesen und anwenden können. Er nimmt uns mit durch sechzehn Psalmen-Paare, die unterschiedliche Arten von Psalmen repräsentieren. Dazu gehören einige sehr bekannte und einige, die häufig übergangen werden. Er hilft uns zu erkennen, wie sie durch Jesus erfüllt wurden und wie sie daher zuerst und vor allem auf Jesus hinweisen. So erhalten wir einen neuen Zugang, um die Psalmen zu lesen, uns an ihnen zu erfreuen und sie zu singen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christopher Ash zeigt in diesem Kommentar der Auslegungsreihe Die Bibel erklärt, wie wir das Buch der Psalmen lesen und anwenden können. Er nimmt uns in sechzehn Psalmen- Paare hinein, die unterschiedliche Arten von Psalmen repräsentieren. Dazu gehören einige sehr bekannte und einige, die häufig übergangen werden. Er hilft uns zu erkennen, wie sie durch Jesus erfüllt wurden und wie sie daher zuerst und vor allem auf Jesus hinweisen. So erhalten wir einen neuen Zugang, um die Psalmen zu lesen, uns an ihnen zu erfreuen und sie zu singen.
Die Bibel erklärt
—
Psalmen – Kommentar
Christopher Ash
INHALT
Cover
Titel
Vorwort zur Reihe
Einleitung
1. Am Eingangstor (1 und 2)
2. Der Sieg des Königs (11 und 20)
3. Das Vertrauen des Königs (22 und 23)
4. Der Fels der Zuflucht (31 und 40)
5. Klagen eines Leiters und des Volkes (42/43 und 44)
6. Der König in Bedrängnis (57 und 59)
7. Lieder von der Schöpfung (65 und 67)
8. Gottes König feiern (45 und 72)
9. Der Schmerz des Exils (73 und 74)
10. Freude an der Heimat (84 und 87)
11. Völlige Sicherheit (90 und 91)
12. Gericht und Rettung (95 und 107)
13. Ein Verrat und eine Verheißung (109 und 110)
14. Hinauf nach Zion ziehen (120 – 122 und 126 – 128)
15. Schmerz und Trost im Exil (137 und 139)
16. Das abschließende Halleluja (145 und 148)
Anhang: Psalmen im Neuen Testament
Literaturverzeichnis
Impressum
VORWORT ZUR REIHE
Jeder Band dieser Reihe bietet dir einen Zugang zu einem Buch der Bibel. Jeder Band verfolgt dabei vier Ziele:
• Die Bibel ins Zentrum stellen
• Christus verherrlichen
• Relevante Anwendungen auf das Leben bieten
• Leicht lesbar sein
Wie kannst du dieses Buch verwenden?
Für deine Lektüre. Du kannst das Buch einfach von vorne bis hinten lesen. Dieser Band beschäftigt sich mit den Aussagen eines bestimmten biblischen Buches und will dich dadurch ermutigen und herausfordern.
Für deine Stille Zeit. Du kannst dieses Buch in deiner persönlichen Stillen Zeit durcharbeiten oder zur Vorbereitung auf eine Predigt oder Predigtserie in deiner Gemeinde verwenden. Jedes Kapitel ist in zwei Abschnitte unterteilt und enthält am Ende Fragen zum Nachdenken.
Für deinen Hauskreis. Du kannst dieses Buch als Hilfsmittel verwenden, um Gottes Wort in einer Kleingruppe oder in der Gemeinde zu lehren. Schwierige Verse oder theologische Konzepte werden hier einfach erklärt. Du findest in dem Buch außerdem hilfreiche Illustrationen und Vorschläge für die Anwendung auf unser Leben.
Die Bücher dieser Reihe sind keine wissenschaftlichen Kommentare. Sie setzen weder ein Verständnis der Originalsprachen der Bibel oder ein hohes Maß an biblischem Wissen voraus.
Neben dem Kommentar liegt ein Arbeitsheft vor, das von Kleingruppen oder zum Selbststudium genutzt werden kann. Gruppenleiter können kostenlos eine passende Arbeitshilfe auf unserer Webseite herunterladen. Die Arbeitshilfe für Gruppenleiter bietet historische Hintergrundinformationen, Erläuterungen der zu behandelnden Bibeltexte, Ideen für Extra-Aktivitäten und Hilfen, wie man Menschen am besten dabei unterstützen kann, die Wahrheiten des Wortes Gottes zu entdecken.
Wir beten, dass du letztlich nicht vom Inhalt dieses Buches, sondern vom Inhalt der Bibel beeindruckt sein wirst. Unser Lob gebührt nicht dem Autor dieses Buches, sondern dem Autor der Bibel.
EINLEITUNG
LASST UNS BETEN LERNEN
In weiten Teilen der heutigen christlichen Kirche sind die Psalmen ein vergessener Schatz: Viele Gemeinden gleichen einem verarmten Haus, auf dessen Dachboden unermessliche Reichtümer liegen – aus den Augen verloren, unbeachtet, von den Motten zerfressen und verstaubt. Lasst uns die Psalmen wieder hervorholen und in dem Wunder schwelgen, das in ihnen steckt – in einer Fülle und einem Reichtum der Beziehung zu Gott, an die so viele von uns halb verhungerten Christen nicht einmal im Traum denken.
Ich möchte dich einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen, um beten zu lernen. Genau dafür sind die Psalmen in der Bibel gedacht. Sie geben uns Einblick, wie Jesus in seinem Leben als Mensch beten lernte. Mit ihnen soll auch das Volk Jesu beten, denn durch die Psalmen leitet der Geist Jesu uns im Gebet und im Lobpreis an.
Die Psalmen stehen in der Bibel, damit das ganze Volk Jesu lernt, alle Psalmen zu jeder Zeit zu beten. Was meine ich damit? Betrachten wir das Gegenteil: Jemand erzählte mir begeistert von einem Pastor, der sagte, er lese gewöhnlich so lange durch die Psalmen, bis ihn ein Vers anspreche. Dort halte er so lange inne, bis dieses Angesprochensein verblasst. Dann lese er weiter. Das hörte sich wunderbar an – und trotzdem könnte man kaum einen verkehrteren Ansatz finden, um die Psalmen zu lesen! Wenn ich diesen Ansatz übernehme, setze ich mich ans Steuer. Ich entscheide, was mich anspricht und welche Verse ich behandle. Dabei besteht die Gefahr, dass in den Psalmen (oder Versen), die ich auswähle, nur meine eigenen Sehnsüchte und Gedanken widerhallen. Sie verstärken meine Empfindungen – welcher Art auch immer – und hinterfragen niemals mein Denken oder meine Ansichten.
Die Absicht der Psalmen ist jedoch eine ganz andere. In den Psalmen lernen wir, gemeinschaftlich zu beten – zusammen mit Jesu Kirche aller Zeitalter. Wir lernen, christozentrisch zu beten: Wir lassen uns in unseren Gebeten von Jesus Christus leiten, durch dessen Geist wir die Psalmen beten. Wir lernen, einfühlsam zu beten, indem wir uns mit der größeren Gemeinde identifizieren und uns weniger auf unsere individualistischen (und oft um uns selbst kreisenden) Anliegen konzentrieren. Das ist für viele von uns ein Paradigmenwechsel – besonders für jene, die in individualistischen westlichen Kulturen aufgewachsen sind, in denen das christliche Leben als eine Angelegenheit zwischen Gott und mir verstanden wird, wobei die Betonung auf »mir« liegt. Die Psalmen singen und beten zu lernen, ist eine herausfordernde Angelegenheit und eine aufrüttelnde Erfahrung. Dennoch ist es eine Übung, die uns in das Bild des Gottessohnes, des Herrn Jesus, verwandelt, dessen Gebetsleben von diesen herrlichen Dichtungen geprägt war.
LASST UNS FÜHLEN LERNEN
Ich möchte dich auch einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen, um fühlen zu lernen. Hast du dich jemals gefragt, was wir im Christenleben mit unseren Gefühlen anstellen sollen? Ungefähr seit den 1960er-Jahren, als die charismatische Bewegung einen großen Teil der evangelikalen Welt erfasste, gibt es eine traurige Trennung zwischen dem, was wir »Kopf« (Denken) und dem, was wir »Herz« (Fühlen) nennen. Die einen widmen sich mit Energie und Enthusiasmus den Emotionen. Im Gegenzug halten andere den Verstand hoch. »Du denkst doch nur, aber empfindest nichts!«, sagt ein Christ zum anderen. »Na gut, aber du fühlst nur und denkst nicht nach!«, erwidert der andere. Keines von beiden ist hilfreich.
Die Psalmen sind der von Gott gewählte Weg, unser Denken und unser Fühlen auf eine Weise anzuregen, die leidenschaftlich, wohlüberlegt, richtig und authentisch ist. Sie zeigen uns, wie wir unsere unterschiedlichsten Gefühle ausdrücken können. Mehr noch: Die Psalmen bringen unsere ungeordneten Empfindungen wieder in die rechte Ordnung. Wir entwickeln eine tiefere Sehnsucht nach dem, was wir ersehnen sollen, eine stärkere Abneigung gegen das, wovor wir fliehen müssen, und ein größeres Verlangen nach der Ehre Gottes im Wohlergehen der Gemeinde Christi. Die Psalmen erschaffen in uns eine reichhaltige Palette an korrekt ausgerichteten Emotionen. Es geht weniger darum, dass wir uns in den Psalmen wiederfinden, sondern vielmehr darum, dass sie uns prägen, damit jene gottgegebenen Sehnsüchte, die in ihnen so bewegend zum Ausdruck kommen, tief in uns widerhallen.
WER SCHRIEB DIE PSALMEN WANN UND WARUM?
Die Psalmen wurden über einen langen Zeitraum der alttestamentlichen Geschichte von sehr unterschiedlichen Menschen geschrieben. Der älteste Psalm, dessen Entstehungszeit wir kennen, stammt von Mose (Ps 90), etwa aus der Zeit des Auszugs aus Ägypten. König David, der Jahrhunderte nach Mose lebte, ist der bedeutendste Psalmist, nach dem der Psalter auch pauschal mit »die Psalmen Davids« überschrieben wird. Etwa die Hälfte der Psalmen nennt in der Überschrift seinen Namen. Seit der Salbung durch den Propheten Samuel (vgl. 1 Sam 16), als der Geist Gottes auf ihn kam, sang David Lieder, die vom Geist jenes gesalbten Königs inspiriert waren, der einst kommen sollte (siehe z. B. 2 Sam 22, woraus dann Ps 18 wurde).
König David organisierte Gruppen von Musikern, die Psalmen schrieben und Israel im Tempel beim Gesang anleiteten (siehe z. B. 1 Chr 16 und 25). Seit dieser Zeit schrieben vom Geist inspirierte Dichter während der gesamten Königszeit, im babylonischen Exil und danach Psalmen. Viele stammen von den nachfolgenden Generationen jener Musikgruppen, die David ins Leben rief (z. B. die Psalmen, die mit »Von Asaf« überschrieben sind). Viele andere sind anonym. Ob wir nun den Autor kennen oder nicht, diese Psalmisten »weissagten« (vgl. 1 Chr 25, 1–3). Das bedeutet, dass ihr Schreiben und Singen durch den Geist Gottes geschah, welcher der Geist des kommenden Christus ist (vgl. 1 Petr 1, 10–12). Wir wissen nicht genau, wie und wann die Psalmen durch Gottes Geist inspiriert in ihrer jetzigen Reihenfolge zusammengestellt wurden. Die Anordnung der Psalmen wird unter Theologen heiß diskutiert. Wir wissen jedoch, dass die letzten Psalmen frühestens im babylonischen Exil geschrieben wurden (siehe z. B. Ps 74 und 137). Wahrscheinlich bestand die erste Sammlung aus den Büchern I und II. Das Buch III wurde dann im oder nach dem Exil zusammengestellt. Als Letztes entstanden auch noch die Bücher IV und V.
Gottes Volk sang diese Lieder im Land Israel, im Exil und als es wieder ins Land zurückkehrte. Es sang sie immer noch, als Jesus durch Judäa wanderte. Er und die Autoren des Neuen Testaments machten reichlich Gebrauch von den Psalmen, wie die Liste der wichtigsten neutestamentlichen Psalmzitate im Anhang dieses Buches zeigt. Die Art und Weise, wie sie zitiert werden, bestätigt, dass diese Psalmen ihre Erfüllung in den Worten, dem Leben, dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus finden. Die Psalmen sind die von Gott geschenkten Worte, durch die Jesus seine Gemeinde anleitet, zum Vater zu beten und diesen zu loben.
EIN GEFÜHRTER RUNDGANG
Manche Museen bieten einen Audioführer an. Dieser hebt Exponate hervor und kommentiert sie. Man bleibt vor jedem Objekt stehen, zu denen Informationen verfügbar sind, betrachtet es genau, hört aufmerksam zu und geht dann weiter zum nächsten. In gleicher Weise werden wir uns nicht jeden Psalm ansehen, sondern 32 Psalmen betrachten, und zwar als 16 zusammenhängende Paare. Ich habe einige sehr bekannte Psalmen ausgewählt, aber auch manch andere, die für die große Zahl der weniger bekannten Psalmen stehen. Es ist unsere Aufgabe, auch diese beten zu lernen. Teils ist meine Auswahl willkürlich (sogar persönlich). Ich habe mich aber bemüht, eine repräsentative Mischung verschiedener Arten von Psalmen aus allen fünf Büchern zusammenzustellen.
Es mag frustrierend sein, an so vielen Psalmen nur eilig vorüberzugehen. Ich bete jedoch, dass du dich am Ende unseres Rundgangs besser gerüstet fühlen wirst, um auch jene Psalmen zu untersuchen, die wir außen vor gelassen haben. Auch bete ich, dass du den tiefen Wunsch haben wirst, sämtliche Psalmen für den Rest deines Lebens immer und immer wieder zu deinen Gebeten zu machen – und dass du anderen hilfst, dasselbe zu tun.
Folgende drei Dinge werden wir berücksichtigen, wenn wir bei den einzelnen Psalmen innehalten:
1. Wir werden überlegen, wer da spricht.
In den Psalmen gibt es verschiedene Stimmen. Manchmal hören wir eine autoritäre Stimme, die aus Gottes Höhe zu uns »herab« spricht. An anderen Stellen hören wir einen Menschen, der »nach oben« zu Gott in der Höhe spricht – durch den Geist Gottes, den Geist Christi. Auch hören wir manchmal, wie das Volk Gottes im Gebet oder im Lobpreis gemeinsam oder miteinander spricht. Wir werden stets fragen, was es wohl für den damaligen Psalmisten bedeutet hat, diesen Psalm zu sprechen. Ob es nun König David, ob es ein anderer, namentlich genannter Psalmist oder ob es ein anonymer Gläubiger war – wir müssen überlegen, welche Bedeutung der Psalm damals für den Autor hatte.
2. Wir werden überlegen, was der Psalm zur Zeit des Alten Bundes bedeutete.
Die Psalmen wurden sorgfältig in fünf Büchern angeordnet. Wir können nicht immer genau sagen, weshalb sie exakt die Reihenfolge haben, in der wir sie vorfinden. Es ist aber oft bedeutsam, in welchem Buch ein Psalm platziert wurde. Ich werde jeweils kurz darauf eingehen, wenn wir bei unserem Rundgang zu den einzelnen Büchern kommen. Das ist eine Hilfe für die Überlegung, was es wohl für einen Gläubigen des Alten Bundes (wie Simeon oder Hanna in Lk 2, 25–38) bedeutet hat, diesen Psalm vor Christi Kommen zu sprechen oder zu singen.
3. Wir werden überlegen, was der Psalm für Jesus bedeutet hat und was er nun für uns in Christus bedeutet.
Welche Bedeutung hatte es für Jesus von Nazareth, während seines Erdenlebens diesen Psalm zu singen? Das ist vermutlich die wichtigste Frage überhaupt. Wieder und wieder erschließt sie uns die Bedeutung und die Kraft eines Psalms. Was bedeutete es für Jesus als wahren Menschen, als Vorläufer unseres Glaubens und als vollkommenen Gläubigen, diesen Psalm zu beten?
Das wird uns beim Nachdenken darüber helfen, welchen Unterschied es macht, diesen Psalm jetzt nach Leben, Tod und Auferstehung Christi zu singen. Wie lässt sich die Sprache des Alten Bundes, die der Psalm spricht, in die Erfüllung des Neuen Bundes übertragen? Wie hilft uns die gesamte Bibel, zu erkennen, was die Muster und Vorschattungen des Alten Bundes bedeuten? Ich werde versuchen, uns ein Gefühl dafür zu vermitteln, denn all das wird uns helfen, zu erfassen, was es heute für uns bedeutet, einen Psalm als Gläubige in Christus zu singen – sei es nun allein oder gemeinsam.
IN CHRISTI CHOR EINSTIMMEN
Stell dir vor, du sitzt in einem großen Konzertsaal. Mitten auf der Bühne siehst du Jesus Christus, den Dirigenten und Chorleiter des Volkes Gottes. Hinter ihm steht ein riesiger Chor: seine Gemeinde aller Zeitalter. Dieser Chor singt die Psalmen als die Lieder Jesu, von Jesus geleitet, von Jesus gestaltet, von Jesus geführt und gelehrt.
Was benötigst du, um dort einzustimmen? Du musst die Worte der Psalmen verstehen. Du musst die »Melodie« der Psalmen erfassen. (Damit meine ich die Gefühle und Empfindungen, die sie vermitteln.) Du musst erkennen, welcher Einsatz von dir verlangt wird, um dich dem Chor Jesu anzuschließen und in ihn einzustimmen, denn jeder Psalm verlangt von uns einen gewissen Einsatz. Zuletzt musst du dich von deinem Platz im Publikum erheben und dem Chor beitreten! Das ist das Ziel dieses Buches: uns zu helfen, dies zu tun.
Anmerkung:
In meinem zweibändigen Werk Teaching Psalms (erschienen bei Christian Focus: Bd. 1, 2017; Bd. 2, 2018) habe ich mich ausführlicher mit den Psalmen befasst. Band 1 ist ein Handbuch dafür, wie man die Psalmen in Christus singt, wobei die größten Schwierigkeiten dabei angesprochen werden. Es enthält mehrere Kapitel zu den großen Themen der Biblischen Theologie. Band 2 beinhaltet eine kurze christuszentrierte Einführung in jeden Psalm und ein Kapitel über die generelle Struktur der fünf Bücher des Psalters. Die beiden Bände sind eine nützliche Ergänzung zu diesem Buch. Die Verwendung von Material aus diesen Bänden erfolgt mit Genehmigung. Weitere Quellen sind im Literaturverzeichnis aufgeführt.
PSALM 1 UND 2
1. AM EINGANGSTOR
In den Kapiteln 1 bis 4 dieses Buches werden acht Beispiele aus Buch I des Psalters, das die Psalmen 1 bis 41 umfasst, vorgestellt. Abgesehen von Psalm 1 und 2 sind fast alle diese Psalmen mit »Von David« überschrieben. Gemeinsam mit Buch II (Ps 42 bis 72) bildet dies die größte Sammlung jener »Von David«-Psalmen. Ein Schwerpunkt dieser Psalmen liegt auf Gottes gesalbtem König – das ist zunächst David, dann die Nachfolger Davids und schließlich »des großen Davids größerer Sohn«, der Herr Jesus Christus. Das Wort »Gesalbter« lautet auf Hebräisch Messias und auf Griechisch Christus. David und seine Nachfolger waren gewissermaßen kleine »Messiasse«. Sie zeigen uns etwas von dem Charakter und der Bestimmung des schlussendlichen Messias, des Herrn Jesus Christus.
Psalm 1 und 2 sind wie zwei große Säulen zu beiden Seiten des Eingangstors, das in die fünf Bücher der Psalmen hineinführt. Sie leiten Buch I ein und sind dem gesamten Psalter vorangestellt. Der Kirchenvater Hieronymus (342–420 n. Chr.) beschrieb Psalm 1 als »die Einleitung zu den Psalmen, wie sie der Heilige Geist inspirierte«, und verglich diesen Psalm mit der Haupttür in das Gebäude des Psalters (vgl. Waltke und Houston, The Psalms as Christian Worship, S. 118). Tatsächlich erfüllen Psalm 1 und 2 diese einleitende Funktion jedoch gemeinsam. Im Gegensatz zu fast jedem anderen Psalm in Buch I haben sie keine Überschrift. Nahezu alle anderen sind mit »Von David« überschrieben. Außerdem sind diese beiden Psalmen von Seligpreisungen eingeklammert und schließen jeweils mit Warnungen. Psalm 1 beginnt mit einer Seligpreisung (1, 1:»Wohl dem …«) und Psalm 2 endet mit einer Seligpreisung (2, 12:»Wohl allen …«). Beide warnen gegen Ende vor einem »Weg«, der »vergeht« bzw. auf dem man »umkommt«(1, 6;2, 12). Gemeinsam stecken sie den Rahmen ab und geben entscheidende Hinweise für unseren gesamten Rundgang.
PSALM 1
Psalm 1 ist simpel, problematisch und auf den ersten Blick schlichtweg falsch. Er verkündet eine Seligpreisung (1, 1–3), warnt vor dem Verderben (V. 4–5) und schließt damit, beides nochmals mit anderen Worten auszusagen: die Seligpreisung in V. 6a und das Verderben in V. 6b. Die zweifache Stoßrichtung des Psalms ist nicht zu übersehen.
DER GLÜCKLICHE
Mit den Worten »Wohl dem, der …« (V. 1) wird die Zuversicht ausgedrückt, dass derjenige, der hier beschrieben wird, unter Gottes Gunst steht. Er ist rundum zufrieden und mit Leben, Freude, Frieden und Wohlergehen beschenkt. Es wird festgestellt, dass man diesen Menschen glücklich schätzen wird und dass dieses Glück nirgends sonst gesucht und gefunden werden kann. Das ist eine außerordentlich tiefgründige Feststellung. Sie verlangt eine Entscheidung des Willens und des Herzens: »Jawohl, ich glaube wirklich, dass dieser Mensch – und zwar einzig ein solcher Mensch, wie er hier beschrieben wird – von Gott gesegnet werden wird.« Es ist also eine beachtliche Herausforderung, überhaupt nur in die ersten Worte dieses ersten Psalms einzustimmen!
Der Glückliche wird zunächst durch das beschrieben, was er nicht tut. Das geschieht in drei Stufen, die sich wie ein Crescendo steigern: Erstens ist er derjenige, »der nicht wandelt im Rat der Gottlosen«. Die »Gottlosen« begegnen uns häufig in den Psalmen und in anderen Büchern der Weisheitsliteratur, besonders in den Sprüchen. Es sind Menschen, die sich in den Dienst des Bösen gestellt haben. Die gesamte Ausrichtung ihres Lebens wendet sich gegen Gott. Sie sind mit rebellischem Schritt unterwegs. Von Natur aus möchten wir mit ihnen im Gleichschritt gehen, denn wir mögen es nicht, wenn es so aussieht, als wären wir anders. Vom Schulhof bis zum Seniorenheim wollen wir instinktiv die gleichen Dinge sagen wie die Gottlosen. Wir möchten über die gleichen Witze lachen, die gleichen Werte vertreten und die gleichen Lebensentscheidungen treffen wie die Gottlosen. Egal, wie alt du bist, in welcher Lebensphase du dich befindest, aus welchem Volk oder welcher Kultur du stammst – das ist eine heimtückische Versuchung für dich. Es wird nie leicht sein, in einer unnachgiebigen Welt aus der Reihe zu tanzen. Dennoch wird derjenige gesegnet, der sich entschieden weigert, nach dem Takt dieser Welt zu marschieren.
Zweitens ist der Glückliche jemand, »der nicht … tritt auf den Weg der Sünder«. Das Wort, das hier mit »tritt« übersetzt wird (wörtl. »steht«), deutet auf etwas Beständigeres hin als »gehen«. Jedes Leben ist ein »Weg«, den man »geht«: ein Weg, der durch Entscheidungen geformt wird – große Entscheidungen (wen man heiratet, wo man lebt, welchen Beruf man wählt) wie auch kleinere Entscheidungen. Sünder – Menschen, deren Herz vor Gott nicht recht ist – gehen einen bestimmten »Weg«. Sie sind auf diesem Weg vielleicht gar nicht eilig unterwegs. Möglicherweise »stehen« sie dort bloß als Zeichen der Loyalität – in dem Sinn, wie wir uns bei jemandem erkundigen: »Wo stehst du in dieser Frage?« Diese Leute haben einen »Standpunkt«, eine Einstellung, eine feste Überzeugung. Viele von uns sind von Natur aus schwach. Wir spiegeln das wider, was angeblich einmal ein Medienmogul gesagt hat: »Das sind meine Prinzipien. Aber wenn du diese nicht magst, habe ich auch noch andere.« Wir haben flexible »Prinzipien«, die an den Standpunkt der Menschen um uns herum angepasst werden können. Dennoch wird derjenige gesegnet, der bewusst und absichtlich nicht bei ihnen »steht«.
Drittens wird er beschrieben als jener, »der nicht … sitzt, wo die Spötter sitzen«. Das ist noch gefestigter und noch konfrontativer. Es ist gefestigter, weil sie nicht nur gegangen sind und dann standen, sondern mittlerweile sitzen. Das Sitzen war in der Antike die Körperhaltung, in der man juristische Beratungen vornahm: Ein Richter saß zu Gericht, wie man es auch heute noch kennt. Es war außerdem die Haltung für autoritatives Lehren. Man setzte sich, um zu lehren, wie Jesus es bei der Bergpredigt (vgl. Mt 5, 1) und in der Synagoge (vgl. Lk 4, 20) tat. Es geht also um eine gefestigte Position, in der diese Leute nicht nur ihre eigenen Entscheidungen treffen, sondern auch Autorität beanspruchen. Diese Position ist ausdrücklich konfrontativ. Sie entscheiden sich nicht nur selbst gegen Gottes Weg, sondern sie sind »Spötter«, die für den, der Gottes Weg geht, nur Hohn und Spott übrighaben. Das erleben wir ständig von der moralisch liberalen und theologisch pluralistischen Elite unserer Gesellschaft. Sie verspotten uns – und wie schon der Christ William Paley im 18. Jh. klagte: »Wer kann schon einem Spott widerstehen?«
Es ist sehr schwer, derjenige zu sein, »der nicht« im Gleichschritt geht und sich nicht zu diesen Leuten stellt. Immerhin folgt daraus, dass man den Spott dieser Menschen auf sich zieht. Man mag gesegnet sein, aber der Segen hat seinen Preis.
Damit ist nun gesagt, was der Glückliche nicht tut. Wie kann man diesen Menschen aber positiv beschreiben? Das steht in Psalm 1, 2. Er »hat Lust am Gesetz des HERRN«. Von tiefstem Herzen liebt er den HERRN (den Gott des Bundes), und deshalb liebt er dessen »Gesetz«. Der Begriff »Gesetz« (hebräisch Torah) bedeutet »Unterweisung« oder »Lehre«. Wahrscheinlich bezieht sich das hier vor allem auf die ersten fünf Bücher der Bibel (den Pentateuch) und auf die Botschaften der Propheten, die diese Bundes-Unterweisung verkündigten. Jener Mensch freut sich an der von Gott gegebenen biblischen Unterweisung. Daher »sinnt [er] über seinem Gesetz Tagund Nacht«. Der hebräische Begriff, der hier mit »sinnt« übersetzt ist, bedeutet mehr als nur stilles Nachdenken. Er hat den Unterton, Gottes Lehre und Wahrheit hörbar auszusprechen. Damit geht die Überzeugung einher, dass das, was ausgesprochen wird, die tiefste Herzenshaltung ausdrückt. Dieser Mensch macht nicht nur schöne Worte und sagt das, was man von einem frommen Menschen eben erwartet. Seine Worte entspringen vielmehr der tiefsten Sehnsucht und Freude seines Herzens. Das heißt, dieser Mensch glaubt wirklich, dass derjenige glücklich zu preisen ist, der Gott liebt und auf Gottes Weg geht. Er bekennt und glaubt: »Wohl dem, der …«
In Vers 3 finden wir ein schönes Bild für dieses Glücklichsein. In einem heißen Klima ist die einzige Pflanze, die zuverlässig Frucht bringt, ein Baum, dessen Wurzeln tief hinunter bis zum lebensspendenden Wasser reichen. Damit wird jemand beschrieben, der tief in Gott, der Quelle des Lebens, verwurzelt ist. Deshalb bleibt seine »Frucht« nicht aus. In seinem Leben sieht man Frucht. Was auch immer er tut, »gerät wohl«. (Wenn wir die gesamte Bibel lesen, stellen wir fest, dass »Erfolg« tiefgründiger definiert wird, als wir vielleicht meinen. Entgegen unserer Erwartung beinhaltet er auch Leid, mündet aber schließlich in Herrlichkeit, weil der Mensch dadurch nach Gottes Wohlgefallen geformt wird.) Ein solcher Mensch zeigt Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, unerschütterliche Treue, Frieden usw. – und zwar beständig.
In den Versen 1–3 wird ein schönes Bild dieses glücklichen Menschen gezeichnet. Sein Wohlergehen ist jedoch hart erkämpft. Schließlich wird er zwangsläufig zur Zielscheibe für den grausamen Spott jener, die ihm seine Weigerung übel nehmen, bei ihrer Gottlosigkeit mitzumachen.
SELIGPREISUNG UND WARNUNG GEHEN HAND IN HAND
Die Verse 4–5 warnen, dass es keinen anderen Weg des Segens gibt. Das Gericht wird kommen. Es gibt eine »Gemeinde«, zu der die »Gerechten« (diejenigen, auf welche die Beschreibung aus V. 1–3 zutrifft) gehören. Wer heute auf dem Weg der Sünder steht, wird im Gericht nicht bestehen. Er mag solide erscheinen, sogar gewichtig und bedeutsam. An jenem Tag wird er sich aber als zu leicht erweisen. Er wird zur Zeit der Ernte wie Spreu davongeblasen. Das ist angesichts der selbstbewussten Zuversicht jener, die sich nicht um Gottes Gesetz scheren, schwer zu glauben, aber es ist wahr. Der Reformator Johannes Calvin schrieb im 16. Jh.:
»[D]en gemeinen Verächtern Gottes aber droht zuletzt ein schreckliches Ende, mögen sie sich eine Zeitlang auch glücklich schätzen.«
(Der Psalmenkommentar, S. 43)
In Vers 6 finden wir den eigentlichen Grund, weshalb sowohl die Seligpreisung als auch die Warnung zutrifft. Der »HERR«, der Bundesgott, ist der Grund. Er »kennt« (in liebevoller, vorsehender Weisheit und Fürsorge) »den Weg der Gerechten«. Dieser Weg verläuft in die entgegengesetzte Richtung wie der »Weg der Sünder« (V. 1). Es ist ein schmaler Weg, der zum Leben führt (vgl. Jesu Worte in Mt 7, 14), und Gott kennt jene, die diesen Weg gehen. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg: »der Gottlosen Weg vergeht« im kommenden Gericht.
WIE KÖNNEN WIR DIESEN PSALM HEUTE LESEN?
Der Psalm stellt uns also einen einfachen Gegensatz vor Augen und beschreibt in anschaulicher Sprache zwei Herzensmotive, zwei Auswirkungen im Leben und zwei Schicksale. Der Psalm ist aber auch zutiefst problematisch, denn wir – du und ich – wollen zwar zu den Glücklichen gehören, aber wir wissen, dass wir von Natur aus durch und durch gottlos sind. Wir gehen im Gleichschritt mit den Gottlosen und übernehmen die Gepflogenheiten dieser Welt. Wir stellen uns auf den Weg der Sünder. Tatsächlich sind wir so sehr darauf aus, Bestätigung für den von uns gewählten Weg zu bekommen, dass wir jeden verspotten, der einen anderen Weg geht. Schließlich fühlen sich unsere eigenen Lebensentscheidungen durch diesen Spott besser an. Wir glauben nicht wirklich, dass wir auf keinem anderen, als dem hier beschriebenen Weg das Glück finden. Deshalb ist das Verderben unser Schicksal. Das ist kein angenehmer Psalm.
Hinzu kommt, wie wir bereits festgestellt haben, dass dieser Psalm auf den ersten Blick offenkundig inkorrekt ist. Wie andere Psalmen einräumen, geht es den Gottlosen oft prächtig (vgl. Ps 73 oder Hiob 21). Eine der großen Spannungen, die sich durch den Psalter ziehen, ist die zwischen der Bejahung von Psalm 1 und den geschichtlichen Tatsachen, die ihm rundheraus zu widersprechen scheinen. Wie können wir mit dieser Spannung umgehen?
Die Bibel lehrt, dass es einen – und nur einen – Menschen gibt, auf den die Beschreibung aus Psalm 1 wirklich zutrifft und der es verdient, dieses Glück zu erben. Wenn Jesus von Nazareth sang: »Wohl dem, der…«, glaubte er es mit jeder Faser seines Seins. Er glaubte es, er lebte es, und er suchte das Glück an keinem anderen Ort. Er erfuhr von allen Seiten Druck, mit den Gottlosen im Gleichschritt zu gehen, sich auf den Weg der Sünder zu stellen und bei den Spöttern zu sitzen. Doch er stellte sich entschieden gegen ihre Werte, ihren Hohn und ihr Handeln. Er wurde aufs Schärfste verspottet und empfand den Schmerz über diesen Spott mit einer Intensität, die wir kaum nachvollziehen können. Dennoch freute er sich an der Unterweisung seines Vaters und verkündete sie Tag und Nacht mit Herzenslust und unerschütterlicher Entschlossenheit. Er ist es, der Frucht bringt. Der Bundesgott, sein Vater, kannte seinen Weg. Deshalb ist Jesus der Mensch, auf dem der Segen Gottes, des Vaters, ruht, und der Eine, an dem Gott, der Vater, Wohlgefallen hatte und hat (vgl. Mt 3, 17; 17, 5). Bruce Waltke und James Houston haben recht, wenn sie sagen: »Jesus Christus entspricht als Einziger dem Bild des Gerechten« (The Psalms as Christian Worship, S. 143).
Die Erkenntnis, dass Jesus die Erfüllung von Psalm 1 ist, bewahrt uns vor der Tyrannei des Moralismus. Wo der Moralismus herrscht, macht er uns entweder selbstgefällig und selbstgerecht (wenn wir meinen, es geschafft zu haben) und irgendwann heuchlerisch sowie auf äußere Konformität fixiert (denn äußere Konformität ist alles, was wir imstande sind zu erreichen). Oder er bewirkt in uns verzweifelte Hoffnungslosigkeit (wenn wir erkennen, dass wir ständig versagen). Ohne Jesus spornt uns Psalm 1 nur an, uns noch mehr Mühe zu geben, gut zu sein. Erst wenn wir Jesus als den Gesegneten aus Psalm 1 erkennen, besteht Hoffnung. Denn in ihm – und nur in ihm – ist jegliches Glück zu finden.
Wenn wir Psalm 1 in Christus singen, wird unsere Reaktion deshalb ein Wohlgeruch des Evangeliums und eine Mischung aus mindestens zwei Melodien sein. Zuerst freuen wir uns daran, dass Jesus Christus der Glückliche aus Psalm 1 ist und dass der ganze Segen Gottes auf ihm ruht – und auf uns, wenn wir in ihm sind. Manchmal haben wir das Gefühl, einen Bibeltext erst dann angemessen angewendet zu haben, wenn wir eine messbare Veränderung in unserem äußeren Verhalten feststellen. Es ist jedoch keine Zeitverschwendung, innezuhalten und über das Wunder nachzusinnen, dass Jesus von Nazareth völlig davon überzeugt war, dass Glück tatsächlich allein im freudigen Gehorsam gegenüber dem Gesetz seines Vaters zu finden ist. Seine Gerechtigkeit wird uns aus Gnade durch den Glauben angerechnet. Durch seine Gerechtigkeit sind wir von der Verdammnis errettet.
Außerdem bewegt uns sein Geist, der in uns wohnt: Als solche, die unter der Gnade stehen, beschließen wir mit freudigem Herzen, dass wir ebenfalls mehr und mehr die Eigenschaften dieses Glücklichen aufweisen wollen. Unsere Entschlossenheit, uns vom Druck einer sündigen Welt abzugrenzen, wird gestärkt. Unsere Freude an Gottes Gesetz wird umfassender und tiefer. Unser Vertrauen, dass es schließlich Glück und Frucht geben wird, wird gefestigt. Vielleicht quält uns der Druck einer Welt, die von uns Konformität fordert. Dann wird der in uns wohnende Geist Jesu das Beten dieses Psalms gebrauchen, um unsere Entscheidung zu festigen, anders zu sein. Vielleicht kämpfen wir mit kalter Gesetzlichkeit. Dann wird der Geist Jesu diesen Psalm gebrauchen, um die freudige Liebe zu Gottes Gesetz neu in unseren Herzen zu entzünden. Vielleicht haben wir Angst und sind versucht, Gott zu betrügen, indem wir uns als Christen bezeichnen, dabei aber auf Nummer sicher gehen und weiterhin die Götter der Welt anbeten. Dann wird dieser Psalm unsere Zuversicht darin stärken, dass der Weg Jesu – der Weg von Psalm 1 – wirklich der einzig gute und glückliche Weg für unser Leben ist.
ZUM NACHDENKEN
1. In welcher Hinsicht gehst, stehst oder sitzt du auf dem Weg der Sünder?
2. Wie kannst du Gottes Wort so anwenden, dass es dir hilft, dich von diesen Wegen abzuwenden?
3. Wie würdest du anhand dieses Psalms zusammenfassen, was es bedeutet, glücklich zu sein?
PSALM 2
Es wird angenommen, dass die Absicht von Psalm 2 darin besteht, die Krönung (oder Salbung) eines Königs aus dem Geschlecht Davids zu feiern. Wie wir sehen werden, ist diese Krönung von massiven Konflikten überschattet. Während Psalm 1 von einer gelassenen und reflektierten Klarheit geprägt ist, konfrontiert uns Psalm 2 in eindringlicher Intensität mit gegensätzlichen Wahrheiten.
Der Psalm beginnt mit einem gemeinsamen Wunsch (2, 1–3). Dieser Wunsch wird mit einer zweifachen Deklaration beantwortet (V. 4–9), die in eine folgenschwere Entscheidung mündet (V. 10–12).
DAS MURREN NACH »FREIHEIT«
Das Verlangen der ersten Verse betrifft das, was die Welt »Freiheit« nennt. Wir erfahren, wer dieses Verlangen hat (V. 1–2a), gegen wen es sich richtet (V. 2b) und was es erreichen möchte (V. 3).
»Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich?« (V. 1). »Völker« und »Nationen« sind gängige Bezeichnungen für den Rest der Welt, der nicht zum Volk Gottes gehört. Diese Menschen – von Natur aus wir alle – »toben«: Wir sind uns nicht über vieles einig, aber in diesem Punkt stimmen wir überein! Sie (wir) »murren«. Das Wort, welches hier mit »murren« übersetzt wird, ist das gleiche, das in Psalm 1, 2 mit »sinnen« wiedergegeben wird. Es beschreibt ein hörbares Flüstern oder Murmeln. Der Gerechte aus Psalm 1 richtet sein Nachsinnen hörbar murmelnd auf die Freuden, die er im Gesetz Gottes findet. Diese Menschen hingegen zischeln hörbar rebellierend gegen dieses Gesetz. Das ist »vergeblich«, und wir werden später in diesem Psalm sehen, warum es so ist. Der Begriff »vergeblich« macht deutlich, dass die Frage »Warum?« nicht Ausdruck der Angst, sondern des Erstaunens ist – des Erstaunens über die Torheit dessen, was gleich beschrieben wird: Wie dumm kann man sein?!
Psalm 2, 2a spitzt die Beschreibung der »Völker« und »Nationen« zu und richtet den Blick auf jene, die die größte Macht haben: »Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander«. Mit den Begriffen »Könige« und »Herren« ist mehr gemeint als nur Regierungschefs. Sie schließen alle Menschen ein, soweit sie Macht besitzen oder Einfluss nehmen können. Darunter fallen Medienmogule, Filmregisseure und -produzenten, Nachrichtensprecher und -redakteure, Blogger, Stars und alle, die man »Influencer« nennt. Jeder, der in dieser Welt etwas bewirken kann – also so ziemlich jeder lebende Mensch –, ist darin eingeschlossen. Sie alle führen eine gemeinsame Rebellion an und »halten Rat miteinander«. Solange wir unter uns bleiben, streiten wir uns ziemlich viel. Wenn wir jedoch mit der Autorität Gottes konfrontiert sind, dann sind wir uns einig, dass wir uns dagegen auflehnen müssen.
Vers 2b bringt ans Licht, gegen wen sich Feindseligkeit und Rebellion der Menschen richtet. Wir lehnen uns auf »wider den HERRN und seinen Gesalbten«. Das heißt, wir rebellieren gegen den Bundesgott im Himmel (»den HERRN«) und seine Herrschaft auf Erden, die durch »seinen Gesalbten« zum Ausdruck kommt – seinen gesalbten König, den König aus dem Geschlecht Davids, der von Zion aus regiert. Wir wollen nicht, dass dieser König über uns herrscht. Wir glauben an uns selbst. Wir erklären unsere Unabhängigkeit, beanspruchen unser souveränes, individuelles Recht, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und selbst über unser Leben zu herrschen.
Freiheit definieren wir als Abwesenheit von Einschränkungen, als Freiheit von Gottes Gesetz. Dieser Psalm wird uns aber davon überzeugen, dass diese sogenannte Freiheit uns auf einen schrecklichen Weg des Verderbens bringt. Wahre Freiheit bedeutet nicht, frei von Einschränkungen zu sein. Sie bedeutet, frei dafür zu sein, auf die rechte Weise, in fröhlichem Gehorsam gegen Gottes Gesetz, zu leben. Das war die Vision, die uns Psalm 1 vor Augen geführt hat.
BEGEGNE DEINEM KÖNIG
Dieses universelle menschliche Streben nach Freiheit, das in Psalm 2, 1–3 so energisch zum Ausdruck kommt, wird in den Versen 4–9 mit einer zweifachen Deklaration beantwortet. Im ersten Teil spricht der HERR: Gott im Himmel »lacht« und »spottet« über diese Rebellen. Im Himmel ertönt ein spöttisches Gelächter. Diese Leute (zu denen auch wir gehören) mögen zwar in den Chor der Spötter (vgl. Ps 1, 1) einstimmen, doch dieser Spott wird mit dem schrecklichen Spott des himmlischen Hofes beantwortet. Es handelt sich um einen Spott, der in einen furchtbaren Tadel mündet. In rasendem Zorn erklärt Gott: »Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion«(2, 6).
Von uns wird nicht nur erwartet, dass wir verstehen, was dieser Tadel bedeutet. Wir sollen einen abgrundtiefen Schrecken empfinden, wenn wir ihn hören. Der Gott, der die Welt gemacht hat und in dessen Hand jeder einzelne unserer Atemzüge liegt (vgl. Apg 17, 24–25), ist rasend vor Zorn über unsere Rebellion. Er sagt: »Nein! Ich habe ›auf meinem heiligen Berg Zion‹ einen Beschluss gefasst. Ich habe meinen König ›eingesetzt‹. Es gibt keine Chance, Einspruch einzulegen. Ich werde es mir nicht noch einmal überlegen oder die Sache revidieren. Er ist der ›Gesalbte‹, gegen den ihr euch auflehnt.« Zion ist die Stadt Davids (vgl. 2 Sam 5, 7). Viele Stellen des Alten Testaments verknüpfen Zion und die Bundesverheißungen mit König David (Ps 132 ist ein gutes Beispiel dafür). Hier wird ein König beschrieben, der ganz anders sein wird als die aufrührerischen Könige aus Psalm 2, 1–3. Dieser König wird der Eine sein, der Gottes souveräne Herrschaft auf Erden ausübt, der das Königreich Gottes herbeibringt. Außerdem ist dieser König der Glückliche aus Psalm 1. Das Zeugnis über diesen König, formuliert Calvin,
»erschallt täglich in der ganzen Welt. Zuerst haben die Apostel es bezeugt, daß Christus von Gott dem Vater zum Könige erwählt ist; dann haben die Lehrer nach ihnen dieses Amt übernommen.«
(Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift, Bd. 4, S. 23)
Im zweiten Teil der Deklaration, in den Versen 7–9, spricht der gesalbte König selbst. Er teilt uns mit, was Gott im Himmel zu ihm gesagt hat: »Du bist mein Sohn, heute [am Tag der Krönung/Salbung des Königs] habe ich dich gezeugt« (V. 7).
Der König aus Davids Geschlecht erbt die Verheißung aus 2. Samuel 7: Es wird eine vertraute Vater-Sohn-Beziehung zwischen dem König und dem himmlischen Bundesgott geben. Der König wird der im Ebenbild des himmlischen Gottes geschaffene Mensch sein, der Gottes Regierung auf Erden ausüben wird, zu der Adam in 1. Mose 1 berufen worden war. Dieser König wird den gleichen Charakter besitzen wie Gott im Himmel, so wie ein Sohn dem Vater gleicht.
Der wichtigste Segen, den der Bundesgott seinem gesalbten Sohn, dem König, gibt, ist das Vorrecht des Gebets: »Bitte mich«(Ps 2, 8). Dieser gesalbte König ist der Eine, der das folgende Gebet beten kann und dabei weiß, dass Gott im Himmel es hören und erhören wird – und das ist ein erstaunliches Gebet! In den Versen 8b–9 steht, wie Gott ihm antworten wird:
»[Ich will] dir Völker [die rebellischen Völker aus den Versen 1–3] zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter [oder Stab] zerschlagen [d. h. ihre stolze Rebellion zerschlagen], wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen.«
Der gesalbte König wird aufgefordert, um die Eroberung der Welt zu beten – darum, dass er sämtliche Rebellion aus den Versen 1–3 niederwerfen, alles erben und über die Schöpfung im Namen Gottes, des Vaters, regieren wird. Wenn er dies erbittet, wird sein Gebet vollständig erhört werden.
EINE FOLGENSCHWERE ENTSCHEIDUNG
Hier gilt es nun, eine gewichtige Entscheidung zu treffen. In den Versen 10–12 wendet sich die gebietende Stimme des Psalms an die »Könige« und »Herren« aus den Versen 1–3, nämlich an uns alle, soweit wir über Macht oder Einfluss verfügen. Sie (und wir) werden eindringlich gewarnt:
»Dienet dem HERRN [gegen den ihr euch auflehnt, vgl. V. 2] mit Furcht [ehrerbietiger Furcht] und freut euch mit Zittern [eine frohe, aber ehrfürchtige Kapitulation]. Küsst den Sohn [den gesalbten König, mit dem Kuss der Huldigung] …«
Die furchtbare Alternative ist, »umzukommen«. Das ist eine ernüchternde und eindringliche Warnung. Kehrt um, wendet euch ab von der stolzen Unabhängigkeit der Verse 1–3. Statt euch »wider« den Bundesgott und seinen gesalbten König zu stellen, kehrt um und beugt euch mit frohem Herzen unter die Herrschaft Gottes im Himmel, die in seiner Herrschaft auf Erden durch seinen gesalbten König zum Ausdruck kommt. Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr den »Weg« weiterverfolgt, den diese Verse beschreiben, dann werdet ihr umkommen, ebenso wie die am Ende von Psalm 1 beschriebenen Gottlosen auf einem »Weg« sind, der »vergeht«.
Der Psalm endet jedoch mit einer Einladung, mit einer Seligpreisung: »Wohl allen, die auf ihn trauen!«(2, 12) – auf ihn, Gottes gesalbten König, den Sohn.
Die Entscheidung, Psalm 2 zu singen oder zu beten, beginnt mit einer bewussten Abkehr von der Rebellion, die in den Versen 1–3 beschrieben wird. Wir singen diese Verse mit einer Haltung der Distanzierung. Wir beobachten, hören und bedenken es, aber wir möchten selbst nicht mehr mit jenen identifiziert werden, die in diesen Versen so rebellisch reden.
Sodann hören wir – demütig und nüchtern – auf die zuverlässige zweifache Deklaration Gottes im Himmel (V. 4–6) und des gesalbten Königs auf Erden (V. 7–9). Wenn wir die Warnung und die Seligpreisung der Verse 10–12 hören, bewegt uns das, uns durch die Warnung aufrütteln und durch die Seligpreisung herbeilocken zu lassen. Haben wir den Psalm zu Ende gesungen, dann knien wir zu den Füßen von Gottes gesalbtem König nieder, um auf ihn zu vertrauen und bei ihm unsere Zuflucht vor dem zukünftigen Zorn zu nehmen. Durch den Geist Christi bewirkt das Singen von Psalm 2 in uns, dass unser stolzes Streben nach Unabhängigkeit überwunden wird. Der Psalm vertieft die Überzeugung in uns, dass Jesus wirklich der Herr ist und nichts etwas daran ändern kann. Er bewegt uns dazu, unsere Knie jetzt vor ihm zu beugen, ehe es zu spät ist.
DER MENSCH AUS PSALM 1 IST DER KÖNIG AUS PSALM 2
Zu Beginn der Psalmen halten wir Ausschau nach einem Menschen, der den Merkmalen aus Psalm 1 entspricht, und der König aus Psalm 2 sein wird – ein König, der gerecht ist, und ein Gerechter, der König ist. Die Psalmen 1 und 2 haben uns ein gutes Lebensprinzip und einen guten Herrscher vor Augen geführt. Das gute Lebensprinzip besteht im Gesetz Gottes und dem Segen, den der erfährt, der sowohl Gott als auch sein Gesetz liebt (Ps 1). Damit dieses gute Lebensprinzip in dieser Welt aber zur Entfaltung kommen soll, wird auch ein guter Herrscher benötigt: der König aus Psalm 2, der zugleich der Liebhaber von Gottes Gesetz aus Psalm 1 ist. Diese Kombination aus einem guten König und einem guten Gesetz ist für das Beten der Psalmen von zentraler Bedeutung. Die gleiche Kombination finden wir in 5. Mose 17, 18–20, wo der König angewiesen wird, sich mit Hingabe dem Studium von Gottes Gesetz und dem Gehorsam gegenüber diesem Gesetz zu widmen. Das ist der König, den wir benötigen. Der Grund, weshalb jener glücklich zu preisen ist, der auf den König von Psalm 2 traut (Ps 2, 12), ist, dass die Vorgabe des Königs exakt aus dem guten Gesetz aus Psalm 1 besteht. Die beiden Seligpreisungen (hier und in 1, 1) sind untrennbar miteinander verbunden. Nur der Gerechte aus Psalm 1 kann der Weltherrscher aus Psalm 2 sein.
Die Verheißung aus Psalm 2 wurde in David und seinen Nachkommen vorgeschattet. Sie hallte in der alttestamentlichen Geschichte wider und hat wohl häufig einen absurden Eindruck erweckt, da Davids Erben weit hinter der Gerechtigkeit aus Psalm 1 und der Herrschaft aus Psalm 2 zurückblieben. Dann aber kam der Mann, der die Gerechtigkeit aus Psalm 1 vorlebte und die Verheißungen aus Psalm 2 erbte. Der Rest der Welt verbündete sich und tobte gegen Jesus, den Messias (vgl. Apg 4, 25–26;Offb 11, 18). Doch sowohl bei seiner Taufe (vgl. Mt 3, 17;Mk 1, 11;Lk 3, 22) als auch bei seiner Verklärung (vgl. Mt 17, 5;Mk 9, 7;Lk 9, 35) erklärte Gott, dass er sein Sohn ist. Diese Deklaration wird in Apostelgeschichte 13, 33,Hebräer 1, 5 und 5, 5 aufgegriffen. Das ist der Mann, der die Völker erben (Ps 2, 8 klingt in Hebr 1, 2 an – im Sohn als dem »Erben über alles«) und über sie mit einem eisernen Stab herrschen wird (Ps 2, 9 klingt in Offb 12, 5 und 19, 5 an).
Wenn wir Psalm 2 singen, bekennen wir uns mindestens zu drei Willensentscheidungen. Zuerst und vor allem bestätigen wir, dass auch wir an das allumfassende Königtum Jesu, des Messias, glauben. Eines Tages werden die Königreiche dieser Welt zum Reich unseres Herrn und seines Christus werden (vgl. Offb 11, 15). Wir glauben das und bekennen es ausdrücklich und öffentlich.
Zweitens bekräftigen wir, dass wir Anteil an seiner Herrschaft über die Völker haben werden. Der aufgefahrene Christus verheißt dem, der »überwindet« (d. h. demjenigen, der ihm »bis ans Ende« vertraut und in glaubendem Gehorsam beharrt), dass er ihm »Macht … über die Völker« geben wird, um über sie »mit eisernem Stabe« zu herrschen (Offb 2, 26–27). Er gebraucht die Formulierungen aus Psalm 2, 8–9 für jeden Gläubigen, der im neuen Himmel und auf der neuen Erde mit ihm regieren wird.
Schließlich bekunden wir, auch die Warnung zu beherzigen, dass Rebellion vergeblich ist und unausweichlich ins Verderben führt. Wir fliehen vor dem sinnlosen Stolz, der gegen Gott und seinen Christus aufbegehrt, weil wir die Sinnlosigkeit und das unvermeidliche Scheitern jeglicher stolzen menschlichen Unabhängigkeit durchschaut haben.
Wir standen nun in der Eingangshalle des Psalters. Wir haben über den Glücklichen aus Psalm 1 und den siegreichen König aus Psalm 2 gestaunt. Wir haben darüber nachgedacht, dass ein einziger Mensch – und nur dieser eine Mensch – perfekt diesen beiden Psalmen entspricht: Jesus Christus, der Gerechte, der König aus dem Geschlecht Davids, ist jener gerechte König, den diese Psalmen uns so schön und kraftvoll vor Augen malen. Der Segen wird vom Vater auf ihn ausgegossen. Gesegnet sein heißt, in ihm gefunden zu werden – in ihm allein.
ZUM NACHDENKEN
1. Wie reagierst du darauf, wie Jesus in diesem Psalm beschrieben wird?
2. Wie ermutigt dich Psalm 2, für diejenigen unter deinen Bekannten zu beten, die bewusst gegen Gott rebellieren?
3. Welche Gebetsanliegen für dich und für die Welt werden dir durch diesen Psalm wichtig?
PSALM 11 UND 20
2. DER SIEG DES KÖNIGS
Wenn wir den Psalter durch das Eingangstor betreten, erklingt die Botschaft der beiden Säulen, von Psalm 1 und Psalm 2. Sie verkünden, dass die beste und glücklichste Art zu leben darin besteht, Gottes Gesetz mit Freude und Hingabe zu halten (Ps 1), und dass Gottes guter König die Welt regieren wird (Ps 2). Dann jedoch werden wir ab Psalm 3 in eine Welt geworfen, in der keine dieser vermeintlich beruhigenden Bekundungen wahr zu sein scheint. Ganz im Gegenteil: Den Gottlosen geht es prächtig und Leute, die keine Zeit für Gottes Gesetz haben, verfügen über viel Macht und Einfluss. Das war die Welt, in der David lebte, nachdem er vom Propheten Samuel zum König gesalbt worden war (vgl. ab 1 Sam 16). Das war die Welt, in der König Jesus lebte. Und das ist auch unsere Welt heute.
Als nächstes Psalmen-Paar habe ich zwei Psalmen Davids gewählt, in denen es um den Sieg des Königs trotz Widerstand geht.
PSALM 11
In Psalm 11 begegnet König David einer mächtigen, plausiblen und anhaltenden Versuchung – nämlich der Versuchung wegzulaufen. Der Psalm ist mit »Von David« überschrieben (was generell und auch hier heißt, dass er von David geschrieben wurde) und mit »vorzusingen« (was bedeutet, dass er in der gesungenen Anbetung des Volkes Gottes verwendet wurde).
EIN VOGEL IM STURM
Davids Überschrift (V. 1a) lautet: »Ich traue auf den Herrn.« In den Versen 1b–3 erfahren wir, warum das wichtig ist. Er fährt fort: »Wie sagt ihr denn zu mir: …?« (V. 1). Gewisse Leute haben etwas zu David gesagt, worauf die Antwort lautet, dass er sich dem Bundesgott als seiner Zuflucht anvertraut. Was hatten sie gesagt? »Flieh wie ein Vogel auf die Berge!« (V. 1). Sie sagten: »Lauf weg!« Man kann beobachten, wie Küstenvögel bei Sturm in eine Felsspalte fliehen und sich dort verbergen, ganz in Sicherheit. »Tu das, König David«, drängen sie ihn. »Gib den Versuch auf, der König zu sein, der du gemäß Gottes Auftrag sein sollst.«
Warum ist das eine plausible Versuchung? Das steht in den Versen 2 und 3. Bei Luther 2017 werden diese Verse noch als Worte von Davids Versuchern dargestellt. Das ist gut möglich. Im Hebräischen gibt es keine Anführungszeichen für wörtliche Reden. Es könnten aber auch – wie in anderen Übersetzungen – Davids eigene Worte sein, mit denen er bei sich selbst erwägt, den Versuchern zuzustimmen und wegzulaufen. Wer auch immer es gesagt hat, die Aussage ist jedenfalls wahr und eindrücklich. Das ist ein Grund für Gottes König, seinen Posten zu verlassen! »Sieh doch«, sagt die Stimme, »rings um dich her stehen Bogenschützen bereit, um tödliche Pfeile auf dich abzuschießen.«
In Vers 2 geht es um eine Personengruppe, eine Vorbereitung, eine Handlung und ein Ziel. Die Personen sind »die Frevler«. Wir begegnen jenen Frevlern (oder »Gottlosen«) häufig, besonders in Buch I der Psalmen, wo etwa die Hälfte aller ihrer Erwähnungen im Psalter zu finden ist. Die »Gottlosen« tauchen zum ersten Mal in Psalm 1, 4 auf und sind dann in Psalm 2 das rebellische Volk, das Gottes König nicht über sich herrschen lassen will. In Psalm 11 erscheinen sie in den Versen 2, 5 und 6, spielten zuvor aber auch schon in den Psalmen 9 und 10 eine Rolle. Dort wurden sie »Frevler« oder »die Völker« genannt und fügten dem Gerechten großes Leid zu. Auch in den Psalmen 12 und 14 treiben sie ihr finsteres Unwesen. Diese Gottlosen sind nicht einfach nur Leute, die falsche Dinge tun. Es sind Menschen, die sich mit der gesamten Ausrichtung ihres Lebens gegen Gott stellen.
Ihre Vorbereitung wird anschaulich als die von Bogenschützen beschrieben – sie machen sich bereit, tödliche Pfeile abzuschießen. Da stehen sie, mit angelegten Pfeilen und gespannten Bogen, bereit zum Schuss.
Ihre Handlung besteht darin, »zu schießen« (natürlich – das tun Bogenschützen nun einmal!). Doch damit nicht genug, sie schießen »heimlich«. Es handelt sich hier nicht um einen offenen Kampf, sondern einen Hinterhalt. Es ist bereits ziemlich ernüchternd, wenn Bogenschützen mit ihren Pfeilen auf dich zielen. Absolut furchterregend wird die Sache aber, wenn sich diese Bogenschützen irgendwo versteckt haben. Du hast keine Ahnung, aus welcher Richtung der tödliche Pfeil kommen wird.
Ihre Ziele sind »die Frommen«: jene, deren Lebensausrichtung und Entschluss es ist, so zu handeln, wie es vor Gott und den Menschen recht ist. Obwohl es sich hier um ein persönliches Gebet handelt (vgl. 11, 1: »zu mir«), wird es im Kontext des Kampfes zwischen zwei Gruppen gebetet. Die eine Gruppe sind »die Frevler«, die andere sind »die Frommen« oder »Gerechten«. Mit Letzteren ist der gerechte König aus Psalm 1 und 2 gemeint, gemeinsam mit allen, die zu ihm halten. Diese tauchen hier in den Versen 2, 3, 5 und 7 auf.
Vers 3 macht deutlich, was vor sich geht: »sie reißen die Grundfesten um«. Wenn in der biblischen Poesie von den »Grundfesten« die Rede ist, sind damit die moralischen Grundlagen der Gesellschaft gemeint. Man bezeichnet das auch als »Schöpfungsordnung« – die Pfeiler, auf denen die moralische Ordnung der Welt ruht; die Bollwerke, die die Menschheit vor Chaos, Übel, Krankheit und Tod schützen. Diese Grundfesten werden in den Zehn Geboten zusammengefasst. Das siebte Gebot beschreibt zum Beispiel als eine der moralischen Grundfesten der Gesellschaft, dass sexuelle Intimität ausschließlich auf die Ehe beschränkt ist, innerhalb des festen Bundes zwischen einem Mann und einer Frau. Von den Zehn Geboten ist dies in unserer Gesellschaft vermutlich dasjenige, das am stärksten abgelehnt und verspottet wird. Allerdings werden auch alle anderen Gebote verworfen. So gäbe es beispielsweise keine Lotterie, wenn die menschliche Begierde nicht dadurch angestachelt würde. Rings um David her wurden diese guten Gebote – das Gesetz, das in Psalm 1 gefeiert wurde – über den Haufen geworfen. Beim Bemühen, seinen Auftrag als Gottes König auszuführen, fühlte sich David wie jemand, der mitten im Erdbeben versucht, ein einstürzendes Haus zu stabilisieren. Der Theologe Hans-Joachim Kraus beschreibt das als eine Zeit, in der »alle Ordnungen umgestoßen sind und das Chaos in der Form roher Gewalt losbricht« (Psalmen, Bd. 1, S. 230).
Es scheint ein aussichtsloser Auftrag zu sein: »[W]as kann da der Gerechte ausrichten?«