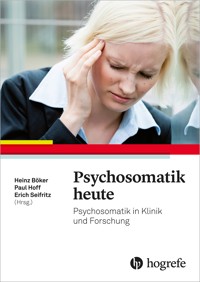
Psychosomatik heute E-Book
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Begriff "Psychosomatik" wird aus unterschiedlichen Perspektiven oft ganz anders akzentuiert. In 21 Kapiteln haben Experten herausgearbeitet, was Psychosomatik nach aktueller Forschung und aus klinischer Sicht für ihre jeweiligen Spezialgebiete bedeutet. > - Welchen Stellenwert haben psychosomatische Zusammenhänge bezüglich unserer Hirnfunktion, der hormonellen Regulation und des Immunsystems? - Welche unterschiedlichen Komponenten beeinflussen somatoforme Schmerzstörungen, das Burnout-Syndrom, den Schlaf oder die Sexualität. - Wo können Psychotherapien bei Depression, Angststörungen oder Schwindelsyndrome ansetzen? - Welche Relevanz haben psychosomatische Störungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie? - Gesundheitsökonomische sowie sozialversicherungs- und haftungsrechtliche Fragen werden sowohl aus Sicht der Konsiliar- und Liaison-Psychiatrie wie auch der Hausarztmedizin dargestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Psychosomatik heute
Psychosomatik heute
Heinz Böker, Paul Hoff, Erich Seifritz (Hrsg.)
Programmbereich Psychiatrie
Heinz Böker
Paul Hoff
Erich Seifritz
(Herausgeber)
Psychosomatik heute
Psychosomatik in Klinik und Forschung
unter Mitarbeit von
Stefan Begré
Heinz Böker
Beatrice Brunner
Dieter Bürgin
Flurin Cathomas
Flurin Condrau
Adriano Fontana
Kaspar Gehring
Simone Grimm
Martin Hatzinger
Barbara Hochstrasser
Salome Iten
Birgit Kleim
Gerhard Klösch
Martha Koukkou
Daniel Marti
Norbert Müller
David Garcia Nuñez
Christopher R. Pryce
Anita Riecher-Rössler
Michael Rufer
Marion Schmidt
Verena Schönbucher
Felix Schürch
Wolfgang Senf
Barbara Seyffarth Golz
Thomas C. Wetter
Simon Wieser
Prof. Dr. med. Heinz Böker (Hrsg.)
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Lenggstrasse 31, Postfach 1931
8032 Zürich
Schweiz
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul Hoff (Hrsg.)
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Lenggstrasse 31, Postfach 1931
8032 Zürich
Schweiz
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. med. Erich Seifritz (Hrsg.)
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Lenggstrasse 31, Postfach 1931
8032 Zürich
Schweiz
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien und Vervielfältigungen zu Lehr- und Unterrichtszwecken, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Medizin/Psychiatrie
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel: +41 31 300 45 00
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.hogrefe.ch
Lektorat: Susanne Ristea
Bearbeitung: Angelika Pfaller, Bad Reichenhall
Herstellung: Daniel Berger
Umschlagabbildung: © Westend61, imagepoint.biz
Umschlaggestaltung: Claude Borer, Riehen
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Finidr s.r.o., Český Těšín
Printed in Czech Republic
1. Auflage 2019
© 2019 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-95628-2)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-75628-8)
ISBN 978-3-456-85628-5
http://doi.org/10.1024/85628-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Historische Entwicklung der Psychosomatischen Medizin
1.1 Begriffe und Gegenstand
1.2 Aus der Geschichte
1.3 Psychosomatische Perspektiven der Neuzeit
1.4 Psychosomatische Medizin heute
2 Krankheitsbegriffe der Medizin und Psychiatrie im historischen Wandel
2.1 Die retrospektive Diagnose
2.2 Die historische Bedingtheit von Krankheitsbegriffen
2.3 Die historische Dynamik psychiatrischer Diagnosen
2.4 Zusammenfassung
3 Hysterien, Konversionen, Psychosomatosen: Zur Bedeutung des Körpers im kulturellen Wandel
3.1 Von der Hysterie zur Psychosomatik: Körpergeschichten
3.2 Von der Gynäkologie zur Nervenheilkunde
3.3 Konversion und Objektbeziehungen
3.4 Psychosomatosen
3.5 Embodiment
3.6 Aktuelle Forschungsansätze in der Psychosomatik und psychosomatisches Denken in der Psychotherapie
3.7 Zusammenfassung
4 Psychosomatik aus der Perspektive eines integrativen Modells der Hirnfunktionen, welche die Biographie kreieren
4.1 Einleitung
4.2 Warum brauchen wir ein Modell?
4.3 Das integrative, systemtheoretisch orientierte Modell der Hirnfunktionen, welche die Biographie kreieren (Koukkou & Lehmann)
4.4 Die menschliche Entwicklung
4.5 Die Bausteine des menschlichen Gedächtnisvermögens; die Inhalte des autobiografischen Gedächtnisses
4.6 Die Entstehung der Emotionen aus der Perspektive des Modells der Hirnfunktionen, welche die Biographie kreieren
4.7 Die Modi der informationsverarbeitenden Hirnprozesse
4.8 Die Entstehung der Psychosomatik aus der Perspektive des Modells der Hirnfunktionen, welche die Biographie kreieren
4.9 Der Stellenwert der Vorschläge des Modells der Hirnfunktionen, welche die Biographie kreieren, für die moderne Psychosomatik
5 Die Psyche im Spiegel der Hormone
5.1 Hintergrund
5.2 Östrogene und Hirnfunktion
5.3 Weiblicher Lebenszyklus
5.4 Östrogene und Depression
5.5 Östrogene und schizophrene Psychosen
5.6 Vorzeitige Menopause bei psychisch kranken Frauen
5.7 Therapeutische Konsequenzen
5.8 Forschungsbedarf
5.9 Schlussfolgerungen
6 Oxytocin und soziales Gehirn: Perspektiven für eine psychobiologische Therapie?
7 Psychoneuroimmunologie – zur Rolle des Immunsystems bei psychischen Störungen
7.1 Psychoneuroimmunologie: Grundlagen und historische Aspekte
7.2 Immunologische Grundlagen und das immunologische Gedächtnis
7.3 Methodische Aspekte der Psychoneuroimmunologie
7.4 Zytokine – Mediatoren des Immunsystems
7.5 Interaktion von Zytokinen und Neurotransmittern
7.6 Neuroendokrines System und Immunsystem
7.7 Zur Rolle der Blut-Hirn-Schranke
7.8 Immungenetik und psychische Störungen
7.9 Zelluläres Immunsystem und psychische Störungen
7.10 Psychische Störungen und Autoimmunerkrankungen
7.11 Schizophrenie und Immunsystem
7.12 Depression und Immunsystem
7.13 Immunologische Effekte von Psychopharmaka
7.14 Antientzündliche Therapie bei depressiven Störungen
7.15 Ausblick
8 Die Depression bei Autoimmunerkrankungen
8.1 Einleitung
8.2 Depressive Symptome beim systemischen Lupus erythematodes
8.3 Depressive Symptome bei der rheumatoiden Arthritis
8.4 Depressionsähnliches Verhalten in Mausmodellen von Autoimmunerkrankungen
8.5 Verändertes Clockgen-System bei Autoimmunerkrankungen und bei der Depression
8.6 Abschließende Bemerkungen
9 Depressionen als Psychosomatosen der Emotionsregulation: Zur Bedeutung der Psychotherapie in der Depressionsbehandlung
9.1 Einleitung
9.2 Herausforderungen in der Depressionsbehandlung
9.3 Depressionen als Psychosomatosen der Emotionsregulation
9.4 Psychotherapie der Depression
9.5 Top-down- und Bottom-up-Effekte als Funktion therapeutischer Interventionen
9.6 Kasuistik
9.7 Ergebnisse der Psychotherapieforschung bei depressiv Erkrankten
9.8 Neuropsychodynamische Perspektiven in der Depressionsbehandlung und Depressionsforschung
9.9 Zusammenfassung
10 Psychotherapie bei Alexithymie: Grundlagen und Praxis am Beispiel des psychosomatischen Schwindels
10.1 Grundlagen zur Alexithymie
10.2 Alexithymie und Psychotherapie am Beispiel des psychosomatischen Schwindels
10.3 Zusammenfassung
11 Angststörungen: Was trägt zur Effektivität von Psychotherapie bei?
11.1 Wirksamkeit von Psychotherapie bei Angststörungen
11.2 Raum zur Verbesserung der Psychotherapie bei Angststörungen
11.3 Personenzentrierte Medizin und Psychotherapie von Angststörungen
11.4 Translationale Forschung zur Steigerung der Effektivität von Psychotherapie bei Angststörungen
12 Somatoforme Schmerzstörungen: Theorie und Praxis
12.1 Einführung
12.2 Definitionen
12.3 Diagnostik
12.4 Häufigkeit chronischer Schmerzen
12.5 Kosten chronischer Schmerzzustände
12.6 Verlauf und Prognose somatoformer Schmerzstörungen
12.7 Schmerzmodelle – eine Auswahl
12.8 Therapeutischer Zugang
12.9 Begutachtung und versicherungsrelevante Aspekte
13 Burnout: psychiatrisches Leiden oder Modewort?
13.1 Einleitung
13.2 Begriffsbestimmung
13.3 Epidemiologie
13.4 Burnout aus medizinischer Sicht
13.5 Klinische Präsentation von Burnout
13.6 Risikofaktoren für Burnout
13.7 Therapiestrategien
14 Schlafstörungen
14.1 Einführung
14.2 Methoden der schlafmedizinischen Diagnostik
14.3 Symptomatik und Therapie wichtiger Formen der Insomnie
14.4 Therapieprinzipien insomnischer Störungen
14.5 Symptomatik und Therapie wichtiger Formen der Hypersomnie
14.6 Symptomatik und Therapie wichtiger Formen der Parasomnien
14.7 Symptomatik und Therapie wichtiger Formen schlafbezogener Bewegungsstörungen
14.8 Zirkadiane Rhythmusstörungen
14.9 Zusammenfassung
15 Sexualtherapie – Sexualität im Fokus der psychotherapeutischen Behandlung
15.1 Sexualität – ein psychosomatisches Phänomen?
15.2 Wie Sexualität in den Fokus der Behandlung rückt
15.3 Indikationsgebiete der Sexualtherapie
15.4 Die sexualtherapeutische Abklärung
15.5 Sexualtherapeutisches Vorgehen
15.6 Chancen und Grenzen somatischer Therapien
15.7 Zusammenfassung
16 Innen und Außen: Zur Psychosomatik und zur Bedeutung des Körpers für die Kontrolle seelischer Spannungen bei Kindern und Adoleszenten
16.1 Neuroanatomie
16.2 Dynamisch-stukturale versus dimensionale versus kategoriale Diagnostik
16.3 Entwicklungsanalytische Überlegungen zum Innen und Außen (in Anlehnung an Winnicott)
16.4 Alterität
16.5 Psychophysische Übergangsbereiche
16.6 Fallbeispiel
16.7 Fazit
17 Dissoziation bei Jugendlichen
17.1 Einleitung
17.2 Historische Perspektive: Von der Hysterie zur Dissoziation
17.3 Theoretische Modelle
17.4 Neurophysiologische Befunde
17.5 Dissoziative Störungen in der Klassifikation nach ICD-10 und DSM-5
17.6 Komorbidität und Differenzialdiagnose
17.7 Fallbeispiele
17.8 Behandlungsansätze
17.9 Fazit
18 Zwischen Psyche und Soma: Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie als integrative Schnittstelle
18.1 Einleitung
18.2 Die Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie: ein Modell für die Zukunft
18.3 Konsiliar- und Liaison-Psychiatrie: Epidemiologie
18.4 Wichtige Krankheitsbilder im psychiatrischen Konsiliar- und Liaison-Dienst
18.5 Zusammenfassung
19 Psychosomatik: Schnittstelle zwischen Hausarztmedizin und Psychiatrie
19.1 Der „psychosomatische“ Patient in der hausärztlichen Sprechstunde
19.2 Der „psychosomatische“ Patient: Ein „schwieriger“ Patient?
19.3 Die Hausarztmedizin – Steckbrief einer medizinischen Fachrichtung
19.4 Der Hausarzt als Lotse
19.5 Der Hausarzt als geduldiger Motivator
19.6 Der Hausarzt als Arzt und Psychotherapeut für psychosomatische Patienten
19.7 Die Psychosomatik in der Hausarztmedizin
20 Die gesellschaftlichen Kosten der psychosomatischen Krankheiten
20.1 Einleitung
20.2 Unterschiedliche Dimensionen der Krankheitskosten
20.3 Definitionen von psychosomatischen Krankheiten im Kontext von Krankheitskostenstudien
20.4 Kosten der psychosomatischen Krankheiten
20.5 Zusammenfassung
21 HWS-Distorsion aus dem Blickwinkel des Sozialversicherungs- und Haftungsrechts
21.1 Einleitung
21.2 Unfallversicherung
21.3 Invalidenversicherung
21.4 Haftpflichtrecht
21.5 Private Versicherungen
21.6 Beweisrechtliche Überlegungen
21.7 Entwicklungen
21.8 Konklusions-/Handlungsempfehlung
Sachwortregister
Vorwort
Der Titel des vorliegenden Buches macht deutlich, dass es um eine aktuelle Bestandesaufnahme dessen gehen soll, was der Begriff „Psychosomatik“ heute in klinischer Hinsicht, aber auch mit Blick auf den Forschungsstand und dessen Perspektiven bedeutet. Trotz dieses Fokus auf aktuellen Entwicklungen erschien es den Herausgebern wegen der komplexen, in verschiedenen Ländern und Sprachräumen unterschiedlich akzentuierten Entwicklung des Begriffes Psychosomatik unabdingbar, auch seine konzeptuelle und wissenschaftshistorische Dimension einzubeziehen.
Genau diesem Aspekt sind die ersten drei Kapitel gewidmet, dies mit Blick auf die Psychosomatik im engeren Sinne (Wolfgang Senf), auf den medizinischen Krankheitsbegriff generell (Flurin Condrau) sowie auf die komplexe Entwicklung von der Hysterie zur Psychosomatose (Heinz Böker). Sodann erörtern die Kapitel 4 – 8 spezifische psychosomatische Zusammenhänge im Sinne der Bedeutung somatischer Befunde für das vielgestaltige klinische Erscheinungsbild: Es geht dabei um den Stellenwert der Hirnfunktion (Martha Koukkou), der hormonellen Regulation (Anita Riecher-Rössler, Simone Grimm) und des Immunsystems (Norbert Müller, Christopher Pryce mit Koautoren).
Psychotherapeutische Herangehensweisen stehen wiederum in den Kapiteln 9 – 11 im Vordergrund, angewandt auf depressive Störungen (Heinz Böker), Schwindelsyndrome (Michael Rufer) und Angststörungen (Birgit Kleim mit Salome Iten). Es folgen konzeptuelle und klinische Fragen zu den somatoformen Schmerzstörungen, einem ebenso heterogenen wie sozialmedizinisch relevanten Bereich (Stefan Begré), und zu dem in der jüngeren Vergangenheit häufig und kontrovers diskutierten Burnout-Syndrom, dessen Positionierung zwischen medizinisch erfassbarem Leidenszustand und auf postindustrielle Arbeitsbedingungen abzielendem Schlagwort erörtert wird (Barbara Hochstrasser). Zwei große, keineswegs nur im medizinischen Kontext bedeutsame Bereiche des menschlichen Lebens, Schlaf und Sexualität, werden in den Kapiteln 14 und 15 sowohl in diagnostischer und therapeutischer Hinsicht als auch, speziell mit Blick auf sexualtherapeutische Optionen, in ihrer Funktion als Schnittstellen zu Werthaltungen und Erwartungen der Gesellschaft dargestellt (Thomas Wetter mit Gerhard Klösch, David Garcia Nuñez mit Verena Schönbucher).
Die Relevanz der psychosomatischen Dimension für die Kinder- und Jugendpsychiatrie findet in den folgenden beiden Kapiteln Ausdruck, in denen die Bedeutung des Körpers für den Umgang von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Spannungen reflektiert wird (Dieter Bürgin) und das Phänomen der Dissoziation im Kontext des Jugendalters zur Sprache kommt (Barbara Seyffarth Golz mit Daniel Marti). Schließlich umkreisen die abschließenden Kapitel 18 – 21 die Einbindung psychosomatischen Arbeitens in die gesamtmedizinische Versorgung einschließlich gesundheitsökonomischer sowie sozialversicherungs- und haftungsrechtlicher Fragen (Simon Wieser mit Koautoren, Kaspar Gehring). Dabei kommt den beiden Feldern der Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie einerseits und der Hausarztmedizin andererseits in ihrem Status als interdisziplinäre Schnittstellen par excellence eine herausragende Bedeutung zu (Martin Hatzinger, Felix Schürch).
Die Herausgeber hoffen, dass es durch die facettenreichen Beiträge des vorliegenden Bandes gelingen wird, die wissenschaftliche und klinische Debatte um psychosomatische Themen zu fördern und, im besten Fall, neue Forschungsfragen anzustoßen. Ein großer Dank gebührt den Autorinnen und Autoren der 21 Kapitel, die sich mit beeindruckendem Engagement der Darstellung ihrer jeweils speziellen Sicht auf die Psychosomatik angenommen haben, sowie dem Hogrefe Verlag in Bern, der die Planung und Entstehung des Buches nachhaltig gefördert hat. Dabei möchten die Herausgeber besonders Susanne Ristea, Programmleiterin Psychiatrie, Gesundheitswesen und Medizin, sowie Eveline Widmer herzlich für ihre stets konstruktive und hilfreiche Begleitung danken.
Zürich, im Oktober 2018
Heinz Böker, Paul Hoff, Erich Seifritz
1 Historische Entwicklung der Psychosomatischen Medizin
Wolfgang Senf
1.1 Begriffe und Gegenstand
Der Begriff „psychosomatisch“ setzt sich aus den griechischen Worten psyche (Hauch, Atem, Seele) und soma (Körper, Leib) zusammen und kennzeichnete allgemein die leib-seelische Ganzheit des Menschen. Als wichtiger Gegenstand vieler Wissenschaften, insbesondere jedoch der Philosophie und Theologie, geht es dabei in der Heilkunde um die Dynamik der wechselseitigen Beziehungen zwischen den psychischen, körperlichen und sozialen Vorgängen in ihrer Bedeutung für Gesundheit und Krankheit.
Psychosomatik erfasst somit nicht nur die somato-psychischen oder die psycho-somatischen Dimensionen von Krankheit und Gesundheit, sondern mit den sozialen Vorgängen ebenso die interpersonalen Beziehungen und damit auch die spezifischen Interaktionen zwischen Arzt und Patient. Gegenstand der Psychosomatische Medizin ist somit nicht alleine das psycho-somatische oder somato-psychische Geschehen im Subjekt, sondern auch ebenso seine Bezogenheit zu seiner Umwelt.
1.1.1 Holistisch und psychogenetisch
In der Psychosomatischen Medizin werden eine holistische und eine psychogenetische Perspektive unterschieden.
In der holistischen Perspektive ist Psychosomatische Medizin eine prinzipielle Betrachtungsweise in allen Disziplinen der Medizin, die, so alt wie die Heilkunde selbst, nicht dem Körperlichen weniger, sondern dem Seelischen mehr Beachtung schenkt (Weiss & English 1943).
Der Begriff holistisch geht zurück auf das griechische holos, das Ganze. Nach der holistischen psychosomatischen Auffassung sind bei j e d e r körperlichen Krankheit, also bei Krebs wie bei der Organtransplantation, bei Herzinfarkt wie bei Diabetes etc. die Krankheitsentstehung sowie der Krankheitsverlauf i m m e r auch von der psychischen Verfassung und von der psychischen Krankheitsverarbeitung des kranken Menschen abhängig. Aus der holistischen Perspektive ist Psychosomatische Medizin
eine Wissenschaft von den Beziehungen biologischer, psychologischer und sozialer Determinanten, sowohl in Gesundheit wie auch bei jeder Krankheit,ein Zugang zur medizinischen Praxis, der den Einfluss psychosozialer Faktoren bei der Untersuchung, Prävention, Diagnostik und Behandlung aller Erkrankungen einbeziehteine klinische Tätigkeit im Zwischenbereich von Medizin und Verhaltenswissenschaft, was den Status einer Grundlagenwissenschaft beansprucht mit einem bestimmten Zugang zum Kranken, der für alle medizinischen Disziplinen von Bedeutung ist.Der psychogenetische Ansatz ist die Krankheitslehre von der psychischen (Mit-)Verursachung bestimmter Erkrankungen, bei denen psychische Faktoren maßgeblich und regelhaft für die Entstehung der Krankheit verantwortlich gemacht werden. Es liegen dann keine erkennbaren organischen Befunde (z.B. Infektion, Durchblutungsstörung am Herzen, Labor) vor, welche die Krankheitsentstehung aus dem somatischen Befund erklären. Ursache der Krankheit sind objektivierbare Störungen der psychischen Erlebnisverarbeitung, die zu gestörten körperlichen Funktionsabläufen und dadurch zu körperlichen Symptombildungen führen. Die krankhafte Störung der Erlebnisverarbeitung entsteht durch innerpsychische, meist unbewusste Konflikte und Fehlhaltungen infolge gestörter Entwicklungs- und Lernprozesse aus der gesamten lebensgeschichtlichen Entwicklung, die durch akute Konfliktsituationen aktiviert werden.
Von einer seelischen Verursachung wird bei den folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
Es liegen keine organischen Ursachen vor, welche die Erkrankung in Entstehung und Verlauf erklären könnten.Ursachen der Erkrankung sind objektivierbare krankhafte Störungen der innerseelischen Erlebnisverarbeitung, die zu gestörten körperlichen Funktionsabläufen bzw. zu psychischen Symptombildungen führen.Ursachen für die krankhafte Störung der innerseelischen Erlebnisverarbeitung sind innerpsychische unbewusste Konflikte und Fehlhaltungen als Folge gestörter Entwicklungs- und Lernprozesse aus der gesamten lebensgeschichtlichen Entwicklung, die durch aktuelle auslösende Situationen aktiviert werden.Die Erkrankung ist nur durch psychotherapeutische Behandlungen ggf. in Verbindung mit somatischer Therapie zu beeinflussen.1.1.2 Integriert oder eigenständig
Primär ist die Psychosomatische Medizin eine interdisziplinäre Perspektive in allen medizinischen Fachbereichen eben mit dem besonderen Fokus auf die Dynamik der wechselseitigen Beziehungen zwischen den psychischen, körperlichen und sozialen Vorgängen bei Gesundheit und Krankheit. Die psychosomatische Perspektive kann – oder sollte – von allen Ärzten in allen medizinischen Fachbereichen eingenommen werden. Insoweit gibt es auch die internistische, die gynäkologische, dermatologische etc. Psychosomatik mit eigenen Organisationsstrukturen.
Erst sekundär bezeichnete der Begriff Psychosomatische Medizin auch ein mehr oder weniger eigenständiges medizinisches Fachgebiet. Hier bestehen sehr unterschiedliche Entwicklungen und aktuelle Strukturen in den Gesundheitssystemen verschiedener Länder.
In Deutschland ist die Psychosomatische Medizin und Psychotherapie ein eigenständiges medizinisches Fachgebiet, verankert in der Approbationsordnung für Ärzte zur Ausbildung von Medizinstudenten und in der Weiterbildung zum Erwerb des Fachgebietes Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. In den meisten anderen Ländern wird die Psychosomatik – wie sie dann oft bezeichnet wird – überwiegend von der Psychiatrie vertreten und von dieser als eines ihrer Teilgebiete reklamiert. Daraus entstehen vielfältige Konflikte, zumal heute auch die Psychologie mit der psychologischen Psychotherapie die psychosomatische Kompetenz in der medizinischen Versorgung für sich beansprucht. Ein wesentliches Argument ist dabei, dass die Psychotherapie eine wesentliche therapeutische Methode in der psychosomatischen Medizin.
Merke
Gegenstand der Psychosomatischen Medizin ist die leib-seelische Ganzheit des Menschen und dabei die Dynamik der wechselseitigen Beziehungen zwischen den psychischen, körperlichen
und sozialen Vorgängen in ihrer Bedeutung für Gesundheit und Krankheit. Dabei geht es nicht nur um die psychisch verursachten körperlichen Erkrankungen (psychogenetische Perspektive), sondern um die innerpsychische und die soziale Dimension bei jeder Krankheit (holistische Perspektive). In Diagnostik und Therapie kommen psychotherapeutische Methoden zum Einsatz. Im Zentrum steht die Beziehung zwischen dem Kranken und dem Arzt.
1.1.3 Psychotherapie
Die Psychotherapie in allen ihren Ausprägungen ist die spezifische diagnostische und Behandlungsmethode für die Psychosomatische Medizin und ist deswegen eng mit ihr verbunden. Insoweit kann die Entwicklung der Psychosomatischen Medizin nicht unabhängig von der Entwicklung der Psychotherapie gesehen werden. Die Psychotherapie stellt wie die Psychosomatische Medizin eine Besonderheit in der Medizin dar, da Diagnostikum und Behandlungsmethode („Medikament“) die gezielte Anwendung von Kommunikation im Rahmen einer strukturierten psychotherapeutischen Beziehung ist (Senf et al. 2013), oder, in den treffenden Worten von Sigmud Freud, sind Worte das wesentliche Handwerkszeug der Seelenbehandlung.
1.2 Aus der Geschichte
Auch wenn es so scheint, als habe es die psychosomatische Perspektive, so wie wir Psychosomatische Medizin heute verstehen, in irgendeiner Weise schon immer in der Medizin gegeben, gibt es medizinhistorisch dafür keine belastbaren Belege.
1.2.1 Vorzeit
Zwar ließe sich für die leib-seelische Ganzheit des Menschen in Krankheit und Gesundheit schon Plato bemühen, der Sokrates im Dialog Charmides einen jungen Mann, der an Kopfschmerzen leidet, fordern lässt, dass, wenn es den Augen gut werden solle, man den ganzen Kopf und wenn es dem Kopf wieder gut gehen solle, man den ganzen Leib, und wenn es diesem wieder gut gehen solle, den Leib nicht ohne die Seele behandeln soll. Das gründet auf der Vorstellung, von der Seele gehe alles, also sowohl Gutes als auch Böses für den Körper und den ganzen Menschen aus. Auch die Psychotherapie kommt schon ins Spiel, da die Seele nur durch die guten Reden (logoi kaloi) zu heilen sei, wodurch Besonnenheit in den Seelen erwachse. (Nach Bräutigam 1992).
Dass es aber im Altertum wirklich eine Psychosomatische Medizin gab, ist zu bezweifeln. Die Auseinandersetzung um das Leib-Seele-Problem ist von der Antike bis in die Neuzeit eine Domäne der Religion und Philosophiegeschichte und spielte in der Medizin nur eine marginale Rolle, die meist nur von einzelnen Außenseitern propagiert wurde. Die Beachtung des Leib-Seele-Problems war in der Medizin der Frühzeit wie des Mittelalters, die sich immer einem Naturalismus verbunden sah, eher spärlich. Wie sonst hätte die Entstehung der Hysterie auf den Uterus projiziert werden können? Im wissenschaftlichen Verständnis um die Erscheinungen und Risiken von Krankheit und die Voraussetzungen und Bedingungen für Gesundheit standen religiös geprägte Krankheitskonzepte im Vordergrund, in denen es um Schuld, Sühne, das Böse oder das Teuflische ging.
Die bevorzugten Erklärungsmodelle und die Erfolge der Medizin kamen auf dem Weg in die Neuzeit unstrittig alleine aus den Naturwissenschaften. Und für die Naturwissenschaft gab es keine Seele, weil man sie nicht sehen und nicht anfassen konnte. Die Medizin sah den Organismus so wie der Begründer der modernen Physiologie Claude Bernard (1813–1878), als eine bewundernswerte Maschine, ausgestattet mit den wunderbarsten und zartesten Mechanismen; Krankheiten wurden als Störungen und Defekte der Maschine Körper verstanden. Und die Seele? Sie wurde der Theologie und der Philosophie zugewiesen oder der Magie. Durch den medizinischen Materialismus mit einem mechanistischen Körperbild, vertreten auch durch den Arzt und Philosophen Julien Offray de Lammetiere (1709–1751) mit seinem Werk „L’Homme machine“ (1875) bekam die Medizin den enormen Aufschwung, in dem die Psychosomatik keinen Platz hatte. Dem steht nicht entgegen, dass der zwischenmenschlichen Beziehung schon immer in der Medizin eine große Bedeutung zugekommen ist (Entralgo 1982).
1.2.2 Neuzeit
Die leib-seelische Ganzheit ist erst in der Neuzeit energischer in die Medizin eingezogen. Der Begriff Psychosomatik wurde vermutlich erstmals 1818 von Heinroth (1773–1843) benutzt. Als Mediziner, Philosoph und Psychiater hatte er den ersten Lehrstuhl für „psychische Therapie“ in Leipzig inne. In der Tradition der „Psychiker“ versuchte es jedes Krankheitsgeschehen vor allem in seinen psychischen und lebensgeschichtlichen Gesamtzusammenhängen zu verstehen, wenn auch immer im Verhältnis zur Somatik. In seinem Denken stand aber eine religiös-moralistische Deutung von Krankheit im Vordergrund, die Seelenstörung wurde als Folge des Abfalls vom Gottesglauben oder als das Böse und Teuflische schlechthin interpretiert. Als Ursachen von Tuberkulose, Epilepsie und Krebs wurden böse und sündhafte, vor allem sexuelle Gelüste angesehen, das Krankheitsrisiko waren diese negativen Persönlichkeitseigenschaften. In dem Glauben an eine sog. Krebspersönlichkeit oder an das Konstrukt des alexithymen Charakters findet dies bis heute Ausdruck.
Zu nennen wäre noch für die romantische Bewegung Novalis (1772–1801), der in seinem Aphorismen schon eine Art Psychophysiologie geschaffen hat, dabei aber weit über die leib-seelische Wechselwirkungen hinaus die Verstrickungen des Individuums mit der Umwelt betont. Vielleicht ist er ein Vorläufer des systemischen Ansatzes in der Psychosomatik.
Tatsächlich fanden die Psychosomatik als Verführerin zur leib-seelischen Wechselwirkung auf der einen Seite und die traditionelle Medizin als der prinzipientreue Naturalist auf der anderen Seite erst in der Neuzeit richtig zueinander und wurden erst dann – zumindest zeitweise – zu einem Paar. Kulturhistorischer Hintergrund dafür war der Paradigmenwechsel dahingehend, als das Subjekt im Sinne Kants als autonomes Individuum definiert wurde: Autonomie ist der Grund der menschlichen und jeder vernünftigen Natur, und im Sinne Fichtes sind alle Gegenstände unserer Erfahrung ausschließlich von unserem Ich abhängig. Der Mensch wird zum selbstverantwortlichen Individuum, das Subjekt wird zum Gestalter seines eigenen Schicksals. Die Psychosomatische Medizin, so wie wir sie heute verstehen, ist ein Kind der Moderne.
1.2.3 Protagonisten
Wesentliche Einflüsse dazu kamen zum einen aus der Hysterieforschung des Neurologen Pierre Janet (1853–1947) und seiner Umgebung und zum anderen aus der Psychoanalyse von Sigmund Freud, auch er Neurologe wie auch Charcot, die als Repräsentanten der herrschenden Wissenschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit der Hypnose experimentierten in dem Versuch, die unerklärlichen Körpererscheinungen vor allem der Frauen aus dem Bildungsbürgertum zu verstehen und zu heilen. Sie diskutierten zwar über die unbewussten psychischen Ursachen, waren aber immer auch bemüht, eine rein materialistische neurophysiologische Erklärung für die psychischen Symptome zu finden.
Die weitgehende Psychologisierung der Psychosomatischen Perspektive in der Medizin erfolgte erst später vor allem durch die Entwicklung und Verbreitung der Psychoanalyse Anfang des 20. Jahrhunderts.
Konstituierend für die Psychosomatische Medizin, wie wir sie heute verstehen, waren am Anfang des 20. Jahrhunderts Neurologen und Internisten. Zuerst zu nennen sind die Neurologen Janet, Freud, Charcot und ihre Schüler; sie haben die „psychotherapeutische“ Beeinflussbarkeit hysterischer Nervenleiden durch Hypnose und Suggestion erkannt und diese Methoden gezielt therapeutisch eingesetzt. Sie hatten die Suggestivkräfte des Mesmer’schen animalischen Magnetismus als Wirkprinzip und damit die prinzipielle psychologische Beeinflussbarkeit körperlicher Erscheinungen, also die Methode der Psychotherapie, wissenschaftlich erfasst, sie weiter erforscht und weiterentwickelt. Das Konzept der Konversion wurde zur Grundlage der sich vehement entwickelnden Psychosomatik.
Zu nennen ist dann vor allem die Heidelberger Schule der Psychosomatischen Medizin mit den Internisten und Neurologen Ludolf Krehl (1861–1937), Richard Siebeck (1883–1965 und Viktor von Weizsäcker (1886–1957). Zeitgleich entstand eine internistisch geprägte Psychosomatik an der Berliner Charité mit Friedrich Kraus (1858–1936), der in seinem Werk „Allgemeine und spezielle Pathologien der Person“ (1926) zwischen „Koretikalperson“ und „Tiefenperson“ unterschied und Gustav von Bergmann („Funktionelle Pathologie“ 1932). In Hamburg wirkten Artur Jores (1901–1982), der Krankheit als Ausdruck menschlichen Scheiterns interpretierte, und sein Schüler Thure von Uexküll, bekannt durch das Standardwerk Psychosomatische Medizin (1979); er prägte den Begriff der Ausdruckskrankheit, ein Konzept, das sich an die Konversion anlehnte, und entwickelte daraus eine Systemtheorie der Psychosomatik.
Die Liste der Protagonisten der Psychosomatischen Medizin und ihrer Konzepte ließe sich fortsetzen. Mit dem beginnenden 20. Jahrhundert nahm die Psychosomatische Medizin einen enormen Aufschwung nicht nur in den verschiedenen medizinischen Bereichen, sondern es gab unterschiedliche Richtungen: die Psychoanalytische Psychosomatik (Charcot, Breuer, Freud, Groddeck, Schultz-Hencke, Schur, Alexander, Weiss), die Tiefenpsychologische Psychosomatik (Adler, Boss), die Internistische Psychosomatik (von Krehl, Siebeck, Kraus, von Bergmann, Brugsch, Jores, Uexküll), die Neurologische Psychosomatik (Bechterew, von Weizsäcker, Mitscherlich, Christian, Goldstein), die Psychophysiologische Psychosomatik (Pawlow, Cannon, Seyle), die Psychobiologische Psychosomatik (Flanders Dunar, Engel, Weiner) etc. Sie alle können an dieser Stelle lediglich erwähnt, nicht aber in ihrer Bedeutung gewürdigt werden.
1.3 Psychosomatische Perspektiven der Neuzeit
Die Psychosomatische Medizin war im 20. Jahrhundert unterschiedlichsten Einflüssen ausgesetzt und unterlag enormen Veränderungen, in denen sich die Wissenschaftsgeschichte der Medizin des vergangenen Jahrhunderts spiegelt. Was sind nachhaltige Perspektiven in der Psychosomatischen Medizin?
1.3.1 Krankheiten als solche gibt es nicht, wir kennen nur kranke Menschen
Mit dieser Formulierung hat der Heidelberger Internist Ludolf von Krehl das psychosomatische Grundprinzip der leib-seelischen Ganzheit auf den Punkt gebracht (Krehl 1932): „Wenn wir die Krankheiten des Menschen erforschen, so beschreiben wir den Ablauf einen Lebensvorganges am einzelnen Menschen, d.h., wir beschreiben die Beschaffenheit des Menschen, an dem die Bedingungen, unter denen, und die Art und Weise, wie jener Vorgang abläuft. Damit ist schon gesagt, dass nicht der Mensch als solcher (auch den gibt es nicht), sondern der einzelne kranke Mensch, die einzelne Persönlichkeit in Betracht kommt.“ Krehl wendete sich gegen eine Medizin, die Krankheit nur noch als ein organbezogenes lokales Geschehen betrachtet. In seinem medizinischen Personalismus (Christian, 1989) ging Krehl so weit, dass er die wahre Fortentwicklung der Medizin nicht mehr in der Naturwissenschaft, sondern in der Geisteswissenschaft gesehen hat.
Diese holistische Perspektive hat damals für die heutige Medizin nachhaltig Raum bekommen. Der Mensch als Individuum, das Subjekt, steht im Fokus. So ist neben der Organik der Erkrankung die Lebensqualität des Kranken in den Vordergrund gerückt, eine klinische Onkologie ist ohne psychoonkolgische Perspektive weder in der Versorgung noch in der Forschung denkbar, zur Behandlung von Diabetikern gehört die psychosoziale Begleitung dazu, das ist auch selbstverständlich in der Palliativmedizin. Krehl hat vielleicht dahingehend Recht, als die „psychosomatischen“ Aufgaben oft weniger von Medizinern als von sozialen Berufen übernommen worden sind.
1.3.2 Einführung des Subjektes in die Organpathologie
Mit Viktor von Weizsäcker, einem Schüler von Krehl, wird das Subjekt konstituierend für das psychosomatische Denken: neben der objektiven Realitätdes körperlichen Geschehens steht gleichbedeutend die subjektive Realität des kranken Menschen. Objektive Realität meint die Naturgeschichte der Krankheit mit all ihren oft schwerwiegenden medizinischen und psychosozialen Folgen. Subjektive Realität meint die Bedeutsamkeit, die der Kranke in seiner Erkrankung auf dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte verleiht und die den Krankheitsverlauf wesentlich beeinflusst. Objektives und Subjektives stehen in einer beständigen Wechselwirkung: „Nichts Organisches hat keinen Sinn, nichts Psychisches hat keinen Leib“ (1934).
Das Individuum als Person ist nicht auf das Körperliche reduzierbar, Krankheit wird zu einer „Weise des Menschseines“. Dem Arzt erscheint der Kranke so, wie er sich erlebt, nicht wie er lehrbuchmäßig objektiv zu sein hat: sein subjektives Bild bekommt objektiven Wert. Deshalb ist in Diagnostik und Therapie neben der naturwissenschaftlichen Analyse und Behandlung der Symptome stärker auf den einzelnen Kranken selbst einzugehen, auf seine Erlebnisse, seine Vergangenheit und seine Zukunftserwartung. Die von v. Weizsäcker entwickelte Grundhaltung der medizinischen Anthropologie sieht „Krankheit als eine Weise des Menschseins: Der Mensch hat nicht nur seine Krankheit, sondern er macht sie auch, sie hat etwas mit seiner Wahrheit, mit seiner Existenz zu tun.“ (1944). Im lebensgeschichtlichen Kontext des: „Warum gerade jetzt?“ erscheinen die medizinischen Phänomene vor dem Hintergrund persönlich wichtiger Daten oder psychosozialen Belastungssituationen.V. Weizsäcker blickt in der biografisch orientierten Medizin auf den Schnittpunkt von Krankengeschichte, Lebensgeschichte und Zeitgeschichte, also nicht alleine auf das „Was“ der aktuellen Symptome, sondern auch auf das „Wann“ als das Krankwerden in der besonderen biografischen Situation, meist auf starke persönliche, aber auch äußere gesellschaftliche Krisen.
1.3.3 Krankheit als Konflikt
Alexander Mitscherlich, ein Schüler von v. Weizsäcker, hat seiner Sammlung von Aufsätzen zur psychosomatischen Medizin den programmatischen Titel Krankheit als Konflikt gegeben. In der Tradition der Freud’schen Psychoanalyse versteht er die psychosomatischen Krankheiten als Ausdruck innerer Konflikte, in der Krankheit drückt sich nach seinem Verständnis individuelles und soziales Leid aus. Der Arzt muss im psychoanalytischen Behandlungsverlauf die inneren Konflikte entziffern und begreifen, damit Heilung stattfinden kann.
Mitscherlich vertritt mit dem historischen Konzept der 2-phasigen Verdrängung als Erklärungsansatz für psychosomatische Chronifizierungsprozesse einen psychogenetischen Ansatz. Diese psychogenetische Perspektive, die zunächst ausschließlich durch die Psychoanalyse bestimmt und dominiert war, ist vor allem dort zur Grundlage geworden, wo sich die Psychosomatische Medizin als ein eigenständiger Bereich mit einer eigenen Krankheits- und Behandlungstheorie etabliert hat. Overbeck und Overbeck (1998) geben einen ausführlichen Überblick über die heute mehr historisch bedeutenden Modelle der psychoanalytischen Psychosomatik. Das sind u.a. die Ausführungen zur Konversion von Rangel, das Konzept der Re- und Desomatisierung mit Ich-Regression im Rahmen einer Metapsychologie der Somatisierung von Schur oder das Konzept zur Entwicklung des Körper-Ich von Hoffer. Zu nennen sind auch die rasch vergangenen Konzepte wie die 2-phasige Verdrängung von Mitscherlich zur Erklärung von Chronifizierungsprozessen oder die Darlegungen von de M’Uzan zur Psychologie des psychosomatisch Kranken aus der Sicht der französischen Schule mit dem Konzept des „pensé opératoire“.
Diese Sichtweise, dass die Psychosomatik voll und ausschließlich von der psychologischen Ebene her betrieben werden könne, ging von dem Konversionsmodell von S. Freud aus, mit dem hysterische körperliche Symptome erstmals psychogenetisch verständlich wurden. Es wurde dann aber auf nahezu alle Krankheiten generalisiert, vor allem in der psychoanalytischen Psychosomatik. Grundlage war die Dynamik der innerpsychisch wirksamen Kräfte, wie sie von Freud konzeptualisiert wurde. Vor diesem Hintergrund wurde dann auch primär organischen Krankheiten, wie etwa Krebserkrankungen, ebenfalls eine Psychogenese als primär ursächlich unterstellt.
1.3.4 Überwindung des psychologischen Reduktionismus
Eine erste Distanzierung von diesem psychologischen Reduktionismus erfolgte mit Franz Alexander (1943). Unter dem Stichwort vegetative Neurose vertritt er die Auffassung, funktionelle Körperstörungen sind über Sympathikus- und Parasympathikusaktivierungen vermittelte psychophysiologische Folgen unverarbeiteter intrapsychischer Affektspannungen und nicht wie bei der Konversion ein symbolischer Ausdruck dahinterliegender unbewusster psychischer Konflikte. Vereinfacht gesagt, stellt eine vegetative Neurose keine unbewusste Fantasie dar, wie bei der Konversion, und drückt auch nicht die Emotion selbst aus, sondern sie entsteht als die physiologische Begleiterscheinung eines konstanten oder periodisch wiederkehrenden emotionalen Zustandes, der dem Subjekt nicht bewusst ist.
Ein überdauerndes Konzept auf psychoanalytischer Grundlage ist die Theorie der somatopsychosomatischen Störung von Engel und Schmale (1967). Die Autoren prägen den Begriff „somatopsychisch-psychosomatisch“ für eine Gruppe von Störungen mit primär biologischen Faktoren, welche für die psychische Entwicklung wie auch die somatische Anfälligkeit beeinflussend sind. Aus ihrer Sicht ähneln sich Patienten, die den gleichen biologischen Faktor aufweisen, sowohl psychisch wie in der Disposition zu einer spezifischen Krankheit. Die Auslösesituation, also die Lebenssituation, in welcher die Krankheit ausbricht, wird als die entscheidende Periode betrachtet, in der die beteiligten psychischen Faktoren hervortreten und beobachtet werden können. Als die typische nicht spezifische Ausbruchssituation haben die Autoren den Komplex des „giving up – given up“ beschrieben, in dem Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit die charakteristischen Affekte für den Ausbruch einer psychosomatischen Erkrankung sind. Sie setzen das insbesondere in eine Beziehung zu einem realen oder auch fantasierten Objektverlust. Letztlich handelt es sich um eine Spezifitätshypothese in dem Sinne, dass spezifische Persönlichkeitsmerkmale zu der Erkrankung führen.
1.4 Psychosomatische Medizin heute
Spätestens das 1977 erschienene Buch Psychobiology and Human Disease von Herbert Weiner markierte die Wende zur heutigen modernen Psychosomatik, also hin zur Psycho-Biologie. Biologische und psychische Regelkreise beeinflussen sich wechselseitig im Positiven wie im Negativen. Aus den psychosomatischen Modellen der Krankheiten, die Weiner in seinem Werk definiert, ist eine Vielzahl von beteiligten Fachdisziplinen abzuleiten: außer der psychologischen Medizin auch die Neurophysiologie, die Psychophysiologie, die Biochemie, die Immunologie, Endokrinologie und Epidemiologie sowie die Genetik und noch andere.
Die Psychosomatische Medizin ist mit einem somato-psycho-sozialen Ansatz, manchmal wird noch der spirituelle hinzugegeben, prinzipiell interdisziplinär angesiedelt, und die psychosomatische Klinik hat heute alle erforderlichen somato-psycho-sozialen Methoden kompetent zu repräsentieren. Die klinischen und Forschungsperspektiven der Psychosomatischen Medizin sind in Abbildung 1-1 zusammengefasst. Psychosomatische Forschung stellt sich gegenüber den anfänglichen empiriefernen ausschließlich psychologischen Theorien, die wie gute Feen an der Wiege des Faches standen, heute als umfangreicher, komplexer und notwendigerweise ebenen- und methodenübergreifender dar.
Abbildung 1-1: Krankheits- und Forschungsmodell der Psychosomatischen Medizin
Die Erforschung der Dynamik der wechselseitigen Beziehungen zwischen den psychischen, körperlichen und sozialen Vorgängen in ihrer Bedeutung für Gesundheit und Krankheit ist auch heute noch die große Herausforderung für die Psychosomatische Medizin.
Literatur
Alexander, F. (1971). Psychosomatische Medizin. Grundlagen und Anwendungsgebiete. Berlin: de Gruyter.
Bräutigam, W., Christian, P. & von Rad, M. (1992). Psychosomatische Medizin. Stuttgart: Thieme.
Christian P. (1989). Anthropologische Medizin. Theoretische Pathologie und Klinik psychosomatischer Krankheitsbilder. Berlin: Springer.
Entralgo, P.L. (1982). Arzt und Patient. Zwischenmenschliche Beziehungen in der Geschichte der Medizin. München: Kindler.
Engel, G. L & Schmale, A.H. (1967). Psychoanalytic theory of somatic disorder. J Am Psychoanal Ass 15, 344–365.
Herzog, W., Beutel M.E. & Kruse, J. (Hrsg.) (2013). Psychosomatische Medizin und Psychotherapie heute. Zur Lage des Fachgebietes in Deutschland. Stuttgart: Schattauer.
Krehl, L. (1932). Entstehung, Erkennung und Behandlung Innerer Krankheiten, I. Band, Pathologische Physiologie. Berlin: F.C.W. Vogel.
Overbeck, G. & Overbeck, A (1998). Seelischer Konflikt – körperliches Leiden. Reader zur psychoanalytischen Psychosomatik. Frankfurt/M.: Rowohlt.
Senf, W., Broda, M. & Wilms, B. (2013). Praxeologie integrativer Psychotherapie. In: W. Senf, M. Broda & B. Wilms (Hrsg.), Techniken der Psychotherapie. Ein methodenübergreifendes Kompendium. (S. 29–54). Stuttgart: Thieme.
Weiner, H. (1977). Psychobiology and Human Disease. New York, Oxford: Elsevier.
Weiss, E. & English, O.S. (1943). Psychosomatic Medicine. The Clinical Application of Psychopathology to General Medical Problems. Philadelphia: W.B. Saunders.
Weizsäcker v., V. (1933). Der Gestaltkreis, dargestellt als psycho-physiologische Analyse des optischen Drehversuchs. In Gesammelte Schriften in zehn Bänden, hrsg. von P. Achilles, D. Janz, M. Schrenk & K.F.v. Weizsäcker. Bd. 4, V, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
2 Krankheitsbegriffe der Medizin und Psychiatrie im historischen Wandel
Flurin Condrau
Medizingeschichte und die Psychiatrie liegen einander in mancherlei Hinsicht nahe, denn beide Disziplinen beschäftigen sich immer wieder mit der Bedeutung grundlegender Krankheitsbegriffe. Schon ein kurzer Blick in die Medizingeschichte verdeutlicht, dass Krankheitsbegriffe keine fixierten Kategorien von historischer Dauer, sondern eher dynamisch-wandelbare Kategorisierungsversuche darstellen. Der vorliegende Beitrag versucht, anhand der medizinhistorischen Diskussionen der Frage nachzugehen, was Krankheiten aus der Sicht der Medizingeschichte sind, wer sie definiert, welche zeitliche Gültigkeit solche Begriffe haben und wie daraus Konzepte werden, die wiederum historisch gehaltvoll analysiert werden können. Deshalb soll im ersten Teil das Problem der retrospektiven Diagnose behandelt werden, das die neuere Medizingeschichte spätestens seit den 1980er Jahren beschäftigt: lassen sich moderne Krankheitsbegriffe auf vergangene Krankheitsbeschreibungen anwenden? Im zweiten Abschnitt dieses Beitrages wird unter Rückgriff auf den bekannten Medizinhistoriker Erwin Heinz Ackerknecht die Frage nach der historischen Bedingtheit von Krankheitsbegriffen aufgeworfen, die zu einer kurzen Analyse des Begriffes Framing of Disease nach Charles Rosenberg hinleitet. Im dritten Teil des Aufsatzes soll anhand ausgewählter psychiatrischer Begriffe mit Hilfe der neueren Forschungsliteratur vorgeführt werden, welche historische Dynamik sich hinter psychiatrischen Diagnosen verbirgt, bevor in einer kurzen Bilanz die verschiedenen Argumente zusammengezogen und auf die Ausgangsfrage bezogen werden sollen.
2.1 Die retrospektive Diagnose
Eine zentrale Herausforderung für die Medizingeschichte besteht in der Frage, ob sich mit aktuellen Begriffen der Medizin etwas über die Vergangenheit sagen lässt. Die Medizingeschichte diskutiert dieses Problem seit langem unter dem Begriff der retrospektiven Diagnose. Während die meisten populärwissenschaftlichen Arbeiten etwa die Tuberkulose schon bei Hippokrates nachgewiesen sehen, ist die Medizingeschichte deutlich vorsichtiger, weil schnell klar ist, dass mit modernen diagnostischen Begriffen immer auch Konzepte gemeint sind, die so in der Vergangenheit kaum nachzuweisen sind (Dormandy, 1999). Seit den 1980er Jahren hat sich deshalb in der wissenschaftlichen Medizingeschichte doch ein grundlegender Konsens entwickelt, demzufolge es aufgrund historischer Symptombeschreibungen sehr schwierig ist, zu modernen Diagnosen zu kommen (Brügelmann, 1982). Schließlich handelte es sich hier um klassische Ferndiagnosen in extremis, weil die zeitliche, kulturelle und geografische Distanz jede Überprüfung von Symptomen oder die Überprüfung sogenannter Vitalwerte weitgehend unmöglich machen würde. Im Sinne einer konsequenten Historisierung der Vergangenheit lässt sich demnach die ärztlich festgelegte Todesursache zum Zeitpunkt des Todes bestimmen, die später nicht mehr verhandelt werden kann (Cunningham, 2002). Trotzdem gibt es immer wieder Publikationen, die mit einem aktuell-medizinischen Interesse an die Medizin der Vergangenheit herantreten, was dann meist in einer Überschätzung der Gegenwart und Unterschätzung der Vergangenheit gipfelt (Shorter, 1991).
Komplizierter wird die Frage jedoch, wenn man nach den wichtigsten Todesursachen des neunzehnten Jahrhunderts fragt. In europäischen Ländern begann sich bekanntlich im Verlauf des Jahrhunderts das statistische Zeitalter durchzusetzen, so berichtete etwa das englische General Registrar’s Office seit 1834 die Zahl der Todesfälle und kurze Zeit später auch der Todesursachen (Szreter, 1988). Im Rahmen der sogenannten Sozialgeschichte der Medizin wurden dann diese historischen Krankheitsdaten durch sinnvolle Kategorienbildung so weit vereinheitlicht, dass gültige Auswertungen möglich wurden (Spree, 1981). Das führte zu griffigen und auch durchaus plausiblen Interpretationen der Daten, wonach beispielsweise Infektionskrankheiten im Verlauf des 19. Jahrhunderts an Bedeutung zu verlieren begannen und sich im 20. Jahrhundert degenerative Krankheiten sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten als Todesursachen durchsetzten (McKeown, 1976). Diesen Interpretationen wurde aber entgegengehalten, dass auch hier mit nicht eindeutigen Krankheitsbegriffen gearbeitet wird. Lassen sich beispielsweise Schwindsucht, Auszehrung und Phthisis zu einer Kategorie der Tuberkulose vereinheitlichen? Nur der letzte Begriff basiert auf der bakteriologischen Idee der Krankheitsverursachung, während die vorhergehenden Bezeichnungen konstitutionelle bzw. umweltbezogene Krankheitserklärungen darstellten, die nichts über den zwar heute denkbaren, aber von den Zeitgenossen nicht erwogenen Erreger aussagten. Man kann das weiter entwickeln: Selbst in der post-bakteriologischen Zeit lassen sich unterschiedliche Konzepte und Interpretationen der Tuberkulose finden, die verdeutlichen, dass ein historischer, kultureller und medizinischer Kontext einen Krankheitsbegriff spezifizieren, von dem man eigentlich annehmen möchte, dass die bakteriologische Analyse Klarheit hätte schaffen können (Worboys, 2010). Selbst scheinbar eindeutige Krankheitsbegriffe können demnach im klinisch-medizinischen Alltag ihre Eindeutigkeit verlieren. Überträgt man solche Meinungen auf den Versuch, historische Daten, also Krankheits- oder Todesursachenzahlen, gehaltvoll zu interpretieren, stellen sich demnach Kategorisierungs-, Bezeichnungs- und Erhebungsprobleme. So müsste man selbst bei diagnostisch klaren somatischen Erkrankungen bis weit ins 20. Jahrhundert selbst denjenigen Kategorien Vorsicht entgegenhalten, die begrifflich einfach in die moderne Diagnostik zu übersetzen sind (Bryder, 1996). In der Zeitschrift Social History of Medicine trafen in einer interessanten Kontroverse zur Bedeutung von Infektionskrankheiten im 19. Jahrhundert die grundsätzlichen Meinungen aufeinander (Condrau & Worboys, 2007 sowie die Erwiderungen in der gleichen Zeitschrift). Auf der einen Seite halten Demographiehistoriker und historische Epidemiologen an der Idee fest, mit Hilfe von quantitativen Daten etwas über die Krankheitsverteilung und Todesursachen der Vergangenheit auszusagen. Sie versuchen, dem Material so viel Informationen über die Vergangenheit zu entlocken, wie es eben geht. Dabei halten sie grundsätzlich an einer Begrifflichkeit fest, die nicht weit von der oben angesprochenen retrospektiven Diagnostik entfernt ist. Aus dieser Sicht dominiert die Frage nach den modernen Kategorien in der Vergangenheit. Wie das Wissen bzw. die Zahlen in der Vergangenheit zustande kamen, wird demgegenüber in die Quellenkritik verwiesen, beeinflusst also höchstens die Gültigkeit bzw. die Reichweite der Aussagen, nicht aber den konzeptionell angestrebten Aussagegehalt selbst (Mitchell, 2011). Demgegenüber argumentieren die Historiker des medizinischen Wissens und auch die neueren Vertreter der sogenannten disease history (ein deutschsprachiger Begriff überzeugt hier nicht), dass die Krankheitsbegriffe und Konzepte so stark historisch gefasst ist, dass sie sich nicht zu längeren Zeitreihen zusammenführen lassen. Damit werden lange Zeitreihen – wie zum Beispiel die Datenreihen McKeowns – aus der Sicht der Wissens- und Begriffsgeschichte selbst zu erklärungsbedürftigen Artefakten. Aus dieser Perspektive entwickelt die Forschung also kaum noch Freude an den Datenreihen, sondern interessiert sich eher dafür, warum solche Daten gesammelt wurden, welche Konzepte hinter den einzelnen Kategorien standen und warum sich die Staaten im 19. Jahrhundert überhaupt für Gesundheitsstatistik zu interessieren begannen.
2.2 Die historische Bedingtheit von Krankheitsbegriffen
Aber wie kann die Medizingeschichte mit Krankheitsbegriffen der Vergangenheit vernünftig umgehen? Es lohnt sich in diesem Zusammenhang, die Klassiker des Faches wieder zu lesen, um zu sehen, welchen Traditionen der Krankheitsgeschichte das Fach in den letzten Jahrzehnten gefolgt ist und wie diese weiterentwickelt wurden. Besonders hilfreich ist hier das Werk von Erwin Heinz Ackerknecht, der 1957 das kurz zuvor gegründete Medizinhistorische Institut der Universität Zürich übernahm und bis 1971 erfolgreich führte. Ackerknecht studierte zunächst Medizin, promovierte bei Sigerist in Leipzig. 1932 floh er als trotzkistischer Agitator nach Paris, wo er alsbald das Fach der Ethnologie studierte, bevor er in die USA emigrierte und bei Sigerist in Baltimore seine Karriere fortsetzte. Ackerknecht steht damit für eine interdisziplinäre Tradition der Medizingeschichte zwischen Medizin, Geschichte und Anthropologie, wie sie sich in den USA zwischen ungefähr 1930 und 1960 etablierte.
Für Ackerknecht war es klar, dass sich die Geschichte nicht evolutorisch verstehen lasse. Als Medizinhistoriker glaubte er nicht an einen stetigen, beinahe teleologischen Fortschrittsgedanken, der das Neue als zwangsläufig besser gegenüber dem Alten betrachtete. Lange vor vielen Fachkollegen begann Ackerknecht deshalb, die Dynamik des Wandels in der Medizin zu untersuchen. Diese Beschäftigung mit dem kontinuierlichen Wandel in der Medizin kam bei Ackerknecht nicht von ungefähr. In seinen wichtigsten Arbeiten wandte er sich von der mehr oder weniger eitlen Selbstdarstellung der Medizin ab und begann sich interdisziplinären Konzepten zu öffnen. Für Ackerknecht war das vor allem die Ethnologie, die er in Paris bei Marcel Mauss, dem führenden französischen Ethnologen seiner Zeit und Lehrer des einflussreichen Claude Lévi-Strauss, studierte. Die Verbindung der Medizingeschichte, die er als Mediziner schreiben wollte, mit der Ethnologie brachte ihn zu interessanten Arbeiten zur Ethnomedizin. In einem Grußwort zum 80. Geburtstag wurde Ackerknecht sogar als Leitfossil der Ethnomedizin bezeichnet, weil er zeitlebens für das interdisziplinäre und, heute würde man sagen, transnationale Studium der Medizin, ihrer Geschichte und Praxis warb (Schiefenhövel, 1986).
Ackerknecht empfahl, sich von der Geschichte der großen Ärzte ab- und stattdessen der Geschichte der Krankheiten zuzuwenden. So schrieb er schrieb in einer 1945 erschienenen Publikation zur Geschichte der Malaria: „Most medical historians have the fatal tendency to write rather the history of doctors than the history of medicine and disease.” (Ackerknecht, 1945, S. 4). Die Geschichte der Krankheiten verfolgte er mit dem Ziel, mehr darüber zu erfahren, was die Medizin und die in ihr tätigen Ärzte tatsächlich machten. Diese Forderung formulierte er frühzeitig, sie prägte sein Schaffen im Bereich der Krankheitsgeschichte ein halbes Jahrhundert vor dem sogenannten Practical Turn in den Geistes- und Sozialwissenschaften (sehr anregend dazu: Mol, 2002, S. 1–27). Ackerknecht interessierten deshalb die Konstellationen in Bezug auf die Infektionskrankheiten mehr als die daran beteiligten Ärzte. Ähnlich wie er als Ethnologe die Grundkonzepte von Krankheit und Gesundheit als kulturell vermittelt betrachtete, so war er als Historiker vor allem an der Praxis der Medizin interessiert, die er für vielfältig geformt hielt. In einem sehr interessanten, 1967 in Zürich geschriebenen Text hielt er fest: „The medical history we read and write today is still based mostly on the writings of an elite of medical men. We are primarily students of scientific literature. Excellent as this may be, it teaches us relatively little concerning what this elite actually did & even less of what the average physician or surgeon did.” (Ackerknecht, 1967, S. 211–214) Er erkannte so, dass sich zwischen der wissenschaftlichen Literatur und der medizinischen Praxis ein Graben öffnete, was die ständige Auseinandersetzung verschiedener Positionen und Interessen in der Medizin konzeptionell fassbar macht. Damit erreichte er Positionen, die seit den späten 1970er Jahren die Sozialgeschichte der Medizin sowie die neue Wissenschaftsgeschichte prägen sollten.
Mit dieser konsequenten Historisierung der Medizin interessierte sich Ackerknecht nicht nur für die Praxis der Medizin jenseits der wissenschaftlichen Publikation, sondern auch für einen weiteren Kernbegriff der Medizin: dem Begriff der Krankheit. Das nicht auf den ersten Blick zu verstehende Interesse an der „Primitiven Medizin“, wie Ackerknecht seine ethnologischen Arbeiten damals nannte, erklärt sich dadurch, dass er offenbar zeigen wollte, dass Krankheiten selbst auch ein kulturelles oder eben historisches Phänomen sind: „Actually such facts as whether a person gets sick at all, what kind of disease he acquires & what kind of treatment he receives, depend largely on social factors … even the notion of disease itself depends rather on the decisions of society than on objective facts.“ (Ackerknecht, 1947, S. 142f.). Damit befand sich Ackerknecht eindeutig auf dem Weg zu einem wissenschaftstheoretischen Relativismus. Die Medizin- und Wissenschaftsgeschichte wird ja seit einigen Jahren ganz stark von der Idee einer historischen Soziologie des Wissens geprägt, die Ackerknecht selbst allerdings eher weniger beeindruckte. Aus der Position des angelsächsichen Empirikers überzeugten ihn die neuen Beiträge etwa von Michel Foucault und anderen nur wenig (Rosenberg, 2007, S. 528). Aus Anlass seiner Emeritierung erschien 1971 ein Sammelband mit den wichtigsten ethnomedizinischen Beiträgen, der an Stelle einer Einleitung ein längeres Interview enthielt. Die Herausgeber befragten darin Ackerknecht zum Verhältnis von Geschichte und Ethnologie. Ackerknecht wiederholte darin seine Äußerungen über die notwendige kulturelle Definition von Krankheiten: „What is a disease is not decided on the basis of the fact that there is a biological change. (…) But only when society decides that this biological change is disease, then it becomes a disease.“ (zit. nach Ackerknecht, 1971, S. 15). Es lässt sich an dieser Stelle lediglich festhalten, dass die Medizingeschichte diese interessanten Studien Ackerknechts zu wenig rezipiert hat.
Ganz offensichtlich von Ackerknecht beeinflusst war hingegen sein bereits mehrfach genannter Schüler Charles Rosenberg. Bereits in dessen frühen Arbeiten taucht der Zusammenhang von Krankheit und Gesellschaft wieder auf. Etwa da, wo Rosenberg die Cholera-Pandemien des 19. Jahrhunderts zu gesellschaftspolitischen Testfällen für die betroffene Gesellschaft macht (Rosenberg, 1966). Später entwickelte Rosenberg seine Ideen weiter und sprach 1992 auf der Basis seiner eigenen, vielfältigen Arbeiten zur Geschichte von Infektionskrankheiten von einem Framing of Disease. Sein Konzept war relativ einfach: im Kern seien Krankheiten zwar vermutlich biologische Entitäten, die aber erst innerhalb eines bestimmten Rahmens zu gesellschaftlichem Sinn gelangen könnten. „In some ways disease does not exist until we have agreed that it does, by perceiving, naming & responding to it.“ (Rosenberg, 1992, S. xiii). Das klingt nach Ackerknecht, ist aber auch der Auseinandersetzung mit dem radikalen Relativismus in der Tradition Foucaults geschuldet. Die Kontroversen zwischen sozialer Konstruktion und ahistorischer, weil biologischer Realität hielt Rosenberg offenbar für wenig ergiebig; er wollte daher mit seiner Framing-Idee einen Konsens vermitteln, um die Forschung inhaltlich weiterzubringen. Dieser der schon von Ackerknecht bewunderten angelsächsichen Tradition der empiristischen Geschichtsschreibung geschuldete Vorschlag Rosenbergs blieb selbstverständlich nicht unwidersprochen, hat aber doch wesentlich zur Entspannung der Frage beigetragen (Cooter, 2004).
2.3 Die historische Dynamik psychiatrischer Diagnosen
Man kann die Geschichte der Psychiatrie als Paradebeispiel für die Fragen nach den Ursachen, Definitionen und Ansichten von Krankheiten lesen. Das lässt sich auch an neueren Überblicksdarstellungen nachvollziehen (Lawlor, 2012). Im Anschluss an Rosenberg wäre demzufolge die Geschichte der Psychiatrie auch als eine Geschichte von solchen Framing-Prozessen zu sehen, in denen immer wieder andere Spezialisierungen miteinander um eine durchsetzungsfähige Position ringen und schließlich eine Art Konsens erzielen können, nach denen Diagnosen und Krankheiten bezeichnet, klassifiziert und erklärt werden können.
Das war offensichtlich bei der Hysterie-Diagnose der Fall, einem der ältesten und langlebigsten Krankheitsbegriffe der Geschichte. Hierbei hilft Rosenbergs Ansatz, eine vorschnelle Kontinuität einer stabilen Krankheitskategorie zu verhindern und die Analyse vor allem auf die immer neuen Bedeutungszusammenhänge einer scheinbar stabilen Kategorie zu verdeutlichen. So verweisen viele Berichte über die Diagnose Hysterie auf ihre lange Bekanntheit; sie stamme angeblich von Hippokrates selbst. Beschäftigt man sich aber mit den Texten selbst, lässt sich diese einfache, lineare Behauptung nicht so einfach aufrecht erhalten, weil die Worte und ihre Bedeutungen nicht einfach übersetzt werden können. „The questions raised by hysteria are not only legion but often directly contradictory.“ (King, 1993, S. 11). Für die Geschichte der modernen Psychiatrie erhielt die Diagnose Hysterie dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine herausragende Bedeutung, weil sie zeitweise das Bild der Psychiatrie prägte. So integrierte der Pariser Neurologe Jean-Martin Charcot mit seinen halböffentlichen Aufführungen von hypnotisch erzeugter Hysterie diese psychiatrische Kategorie in den Alltag des Krankenhauses, während er gleichzeitig auch eine kulturelle Repräsentation der Krankheit schuf, die den performanten Charakter der Krankheit betonte (Didi-Hubermann, 1982).
Die Literatur zur Geschichte der Hysterie ist kaum noch zu überschauen, aber es zieht sich ein roter Faden der Betonung weiblichen Verhaltens durch alle Geschichten hindurch. Dabei wurde oft genug der Zusammenhang zur Mutterschaft als auslösendes, wenn nicht sogar erklärendes Moment betont (Marland, 2003). Darauf aufbauend wurde sogar die Hypothese verfolgt, im 19. Jahrhundert habe die Psychiatrie systematisch weibliches Verhalten medikalisiert und dieses überproportional in Anstalten versorgt (Showalter, 1985). Diese Behauptung hielt allerdings einer kritischen Überprüfung der Evidenz nicht statt, weil der Vorwurf an die Psychiatrie, sie habe insgesamt oder vor allem weibliches Verhalten medikalisiert, deutlich zu kurz greift, und weil – wie Freud auch schon festhielt – die Diagnose Hysterie ja durchaus auch bei Männern vorkommen konnte (Busfield, 1994). Schließlich wurde die „Disappearance“ von Hysterie auch schon beklagt, weil damit ein unspezifischer und damit auch kulturell gut lesbarer Krankheitsbegriff im Kontext der Einführung von Chlorpromazin verloren gegangen sei (Micale, 1993; 1995). Andrew Scull, wichtiger Psychiatrie-Historiker und einst Autor des einflussreichen Buches Museums of Madness, das die Psychiatriekritik in die Medizingeschichte integrierte, schrieb in seiner kürzlich erschienen Biographie der Hysterie: „More frequently, though, diseases vanish because medical fashions change, understandings of disease alter & previous ways of classifying nature and its pathologies are superseded.“ (Scull, 2009, S. 175; Scull, 1979). Das Konzept der Biographies of Diseases-Reihen (einmal bei Oxford University Press und einmal bei Johns Hopkins University Press) ist natürlich sehr reizvoll, aber intellektuell nicht unproblematisch: wenn Biographien über Krankheiten geschrieben werden können, erhalten die Krankheiten zunächst einen stabilen Charakter zugeschrieben, was eigentlich die Relativität des Krankheitsbegriffes wieder aus dem Spiel nimmt.
Ein analoges, zeitlich jedoch viel enger gefasstes Beispiel findet sich in der Geschichte der psychiatrischen Diagnostik und Therapie im Ersten Weltkrieg. Unter dem Begriff Shell Shock wurde eine Vielzahl von Symptomen gefasst, die typischerweise mit der Fronterfahrung von Soldaten in Verbindung gebracht wurden. Zwar wurde schon bei Hysterie im 19. Jahrhundert immer wieder festgehalten, dass auch Männer daran litten. Aber in der Zahl und Auswirkung waren die vielen tausend Patienten – alles prinzipiell militärtaugliche und auch durchaus kampferfahrene Männer jüngeren Alters – doch ein Novum. Zunächst dachte die englische Armeeführung noch, es handle sich um Feigheit vor dem Feind, weshalb die ersten Shell-Shock-Fälle wegen Hochverrats exekutiert wurden (Putkowski & Sykes, 1998).
Interessant ist der Begriff des Shell Shock für diesen Aufsatz vor allem, weil er im Ersten Weltkrieg instabil geblieben ist. Kurz nach Rosenbergs Sammelband über Framing, argumentierte Chris Feudtner mit dem Konzept: eine instabile Kategorie wurde zur Grundlage eines komplizierten Aushandlungsprozesses zwischen Frontärzten, Armeeführung und der Politik, die aus je eigenen Gründen den Begriff prägen und damit eine Krankheitskategorie festzulegen versuchen, die nicht ohne Weiteres aus der „Realität“ gewonnen werden konnte, weil diese dafür zu widersprüchlich war (Feudtner, 1993). Dabei ist für Feudtner entscheidend, dass Shell Shock selbst sich nicht als Kategorie eignet, weil unterschiedliche Phänomene, Diagnosen, Therapien darunter gefasst werden – es handelt sich also eher um ein Krankheits-System (disease system) als um einen einfachen Diagnosebegriff (vgl. auch Feudtners Studie über Diabetes: Feudtner, 2003). So verschob sich beispielsweise die Art und Weise, wie man Shell-Shock-Fälle beschrieb. In den ersten Monaten und Jahren der Debatte hielt man die Erfahrung von Artilleriebeschuss für zwingend notwendig. Als jedoch immer mehr Fälle auftauchten, die offensichtlich nicht durch solchen Beschuss ausgelöst wurden, verlor die quasi-physikalische Erklärung der Diagnose an Bedeutung. Stattdessen verschob sich die Aufmerksamkeit mehr und mehr zu psychologischen Erklärungen der Krankheitsentstehung. Feudtners Analyse deutet aber auch die Grenzen der Rosenberg’schen Idee eines Framing of Disease an: 1917 wurde der Begriff des Shell Shock schon wieder verboten. Auch konzeptionell rückt die Forschung in jüngster Zeit von der Idee eines radikalen Bruches mit der Vorkriegszeit und der damit verbundenen offenen Situation, in der dann framing möglich wurde, ab. Stattdessen werden eher die Kontinuitäten in der Psychiatrie der Vorkriegs-, Kriegs- und Zwischenkriegszeit betont, die Diskussion während des Krieges viel stärker beeinflussten, als bisher angenommen wurde (Loughran, 2009). Die Frage muss hier offen bleiben, ob man Shell Shock auch als Fanal eines für damalige Verhältnisse neuartigen therapeutischen Optimismus lesen kann, der in der Zwischenkriegszeit dann zu Insulin-Therapien, psychiatrischer Chirurgie sowie Elektroschocktherapie führte.
2.4 Zusammenfassung
Was lässt sich nun aus den kurzen historiografischen Überlegungen zur Geschichte der Medizin, Erwin H. Ackerknechts Gedanken zu Krankheitskategorien und der Analyse über Hysterie und Shell Shock lernen? Den Ausgangspunkt nahm dieser Beitrag bei der Frage der retrospektiven Diagnose.
Merke
Aus der Sicht der jüngeren Medizingeschichte ist die rückwärtsgewandte Frage nach modernen Krankheitskategorien in der Vergangenheit mit größter Vorsicht zu behandeln. Zweifel sind angezeigt, ob moderne Krankheitsbegriffe überhaupt viel zum Verständnis historischer Epochen und Prozesse beitragen könnten.
Die Psychiatriegeschichte steht hier vor einem ganz analogen Problem: woran die Insassen der psychiatrischen Anstalten um 1900 „wirklich“ litten, lässt sich etwa auf Basis des verfügbaren Quellenmaterials nicht sagen.
Ferner zeigt dieser Beitrag, dass die Medizingeschichte reich an Beispielen über Krankheitsbegriffe und Kategorien ist, die einem dynamischen Veränderungsprozess unterworfen waren. Stellvertretend für viele andere Diagnosen zeigen Begriffe wie Hysterie oder Shell Shock, dass sich populäre und wissenschaftliche Definitionen überlagern und dass sich Bedeutungszusammenhänge solcher Begriffe auch verändern können. Das spricht für die Framing Idee Rosenbergs, die ja nahelegt, die gesellschaftlichen Definitionen solcher Kategorien als historisch zu erklärende Durchsetzungsprozesse zu untersuchen.
Es mag in der Geschichte der Psychiatrie besonders offensichtlich sein, trifft aber im Grunde auf die Geschichte der Krankheiten insgesamt zu, dass Krankheitsbegriffe ihre Bedeutung verändern. Manchmal werden bekannte Begriffe auch radikal auf den Kopf gestellt – wenn beispielsweise Helicobacter pylori plötzlich den Begriff des Magengeschwürs ändert. Oft verlaufen diese Prozesse auch langsamer, aber dass Krankheitsbegriffe verschwinden oder sich verändern, kann keine Überraschung sein. Zu stellen sind dann genau solche Fragen wie: Warum, in wessen Interesse und durch wen erfolgten Veränderungen in der Begrifflichkeit, den Kategorien und Definitionen von Krankheit?
Literatur
Ackerknecht, E.H. (1945). Malaria in the Upper Mississippi Valley 1760–1900, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1945.
Ackerknecht, E.H. (1947). The Role Medical History in Medical Education. Bulletin of the History of Medicine, 21, 135–145.
Ackerknecht, E.H. (1967). A Plea for a „Behaviorist“ Approach in Writing the History of Medicine. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 22, 211–214.
Ackerknecht, E.H. (1971). Medicine and Ethnology. Selected Essays, Hrsg. von H.H. Walser & H.M. Koelbing. (S. 7–29). Bern: Hans Huber.
Brügelmann, J. (1982). Der Blick des Arztes auf die Krankheit im Alltag 1779–1850. Medizinische Topographien als Quelle für die Sozialgeschichte des Gesundheitswesens, Freie Universität Berlin, Berlin.
Bryder, L. (1996). ‚Not Always One and the Same Thing‘. The Registration of Tuberculosis Deaths in Britain, 1900–1950. Social History of Medicine, 9, 253–266.
Busfield, J. (1994). The Female Malady? Men, Women and Madness in Nineteenth Century Britain. Sociology, 28, 259–277.
Condrau, F. & Worboys, M. (2007). Epidemics and Infections in Nineteenth Century Britain. Social History of Medicine, 20, 147–158.
Cooter, R. (2004). „Framing“ the End of the Social History of Medicine. In F. Huisman & J.H. Warner (Hrsg.), Locating Medical History. The Stories and Their Meanings (pp. 309–337). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Cunningham, A. (2002). Identifying Disease in the Past: Cutting the Gordian Knot. Asclepio, 54, 13–33.
Didi-Hubermann, G. (1982). Invention de l’Hysterie: Charcot et l’Iconographie Photographique. Paris: Macula.
Dormandy, T. (1999). The White Death: A History of Tuberculosis. New York: New York University Press.
Feudtner, C. (1993). „Minds the Dead have Ravished“: Shell Shock, History & the Ecology of Disease-Systems. History of Science, 31, 377–420.
Feudtner, C. (2003). Bittersweet. Diabetes, Insulin & the Transformation of Illness. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
King, H. (1993). Once upon a Text: The Hippocratic Origins of Hysteria. In S.L. Gilman et al. (Hrsg.), Hysteria Beyond Freud (pp. 3–90), Berkeley: California University Press.
Lawlor, C. (2012). From Melancholia to Prozac. A History of Depression. Oxford: Oxford University Press.
Loughran, T. (2009). Shell-Shock and Psychological Medicine in First World War Britain. Social History of Medicine, 22, 79–95.
Marland, H. (2003). Disappointment and Desolation. Women, Doctors and Interpretations of Puerperal Insanity in the Nineteenth Century. History of Psychiatry, 14, 303–320.
McKeown, T. (1976). The Modern Rise of Population. London: Edward Arnold.
Micale, M.S. (1993). On the „Disappearance“ of Hysteria: A Study in the Clinical Deconstruction of a Diagnosis. Isis, 84, 496–526.
Micale, M.S. (1995). Approaching Hysteria and its Interpretations. Princeton, NY: Princeton University Press.
Mitchell, P.D. (2011). Retrospective diagnosis and the use of historical texts for investigating disease in the past. International Journal of Paleopathology,1, 81–88.
Mol, A. (2002). The Body Multiple. Ontology in medical practice. Durham: Duke University Press.
Mosse, G.L. (2000). Shell-Shock as a Social Disease. Journal of Contemporary History, 35, 101–108.
Putkowski, J. & Sykes, J. (1998). Shot at Dawn. Executions in World War One by Authority of the British Army Act. Barnsley: Pen & Sword.
Rosenberg, C.E. (1966). Cholera in Nineteenth-Century Europe. A Tool for Social and Economic Analysis. Comparative Studies in Society and History, 8, 135–162.
Rosenberg, C.E. (1992). Introduction. Framing Disease: Illness, Society & History. In C.E. Rosenberg & J. Golden (Hrsg.), Framing Disease. Studies in Cultural History (pp. xiii–xxvi). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Rosenberg, C.E. (2007). Erwin H. Ackerknecht, Social Medicine & the History of Medicine. Bulletin of the History of Medicine, 81, 511–532.
Schiefenhövel, W. (1986). Erwin Ackerknecht zum 80. Geburtstag am 1. Juni 1986. Verfügbar unter http://www.agem-ethnomedizin.de/download/erwin_ackerknecht.pdf (17.08.2017).
Scull, A. (1979). Museums of Madness. The Social Organization of Insanity in Nineteenth-Century England, London: Allen Lane.
Scull, A. (2009). Hysteria. The Biography. Oxford: OUP.
Shorter, E. (1991). Doctors and their Patients. A Social History, New Brunswick: Transaction.
Showalter, E. (1985). The Female Malady: Women, Madness & English Culture, 1830–1980. New York: Pantheon Books.
Spree, R. (1981). Soziale Ungleichheit vor Krankheit und Tod. Zur Sozialgeschichte des Gesundheitsbereichs im Deutschen Kaiserreich, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Szreter, S. (1988). The Importance of Social Intervention in Britain’s Mortality Decline 1850–1914. A Reinterpretation of the Role of Public Health. Social History of Medicine 1, 1–38.
Worboys, M. (2010). Before McKeown: Explaining the Decline of Tuberculosis in Britain, 1880–1930. In F. Condrau & M. Worboys (Hrsg.), Tuberculosis Then and Now (pp. 148–170). Montreal: McGill-Queen’s University Press.
3 Hysterien, Konversionen, Psychosomatosen: Zur Bedeutung des Körpers im kulturellen Wandel
Heinz Böker
„Leib bin ich ganz und gar“
F. Nietzsche: Also sprach Zarathustra (1883–1885)
„Körper sind nicht einfach biologische Fakten. Sobald wir Körper betrachten, von Körpern sprechen, mit Körpern umgehen, betreten wir eine Interpretationsebene. Diese prägt die Wahrnehmung des Biologischen. Damit werden Körper zum Konstrukt, haben eine kulturelle Formierung und eine Historizität.“ I. Ritzmann, 2012.
3.1 Von der Hysterie zur Psychosomatik: Körpergeschichten
Der Körper und die mit ihm verknüpften Phänomene wurden im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende mit unterschiedlichen Erklärungsmodellen verknüpft. Die Bedeutung des Körpers unterlag einem Wandel, der von vielfältigen kulturellen, religiösen, gesellschaftlichen und ökonomischen Faktoren bestimmt wurde. Im Fokus dieses Buchbeitrags steht die Entwicklung der Konzepte der Hysterie, der Konversion und der Psychosomatosen.
Zur Einstimmung auf die Vielfalt der individuellen und kulturellen Kontexte, in die die jeweilige Symptomatik und die ihr zugeschriebene Bedeutung eingebettet ist, werden vier sehr unterschiedliche Kasuistiken, als Körpergeschichten apostrophiert, geschildert:
3.1.1 Herr A: Psychogene Schmerzen
Herr A. erkrankte im Alter von 20 Jahren in seinem 2. Studienjahr an einer psychogenen Schmerzsymptomatik.
Herr A. stammt aus einem behüteten Elternhaus. Er musste sein – an einem weit entfernt vom elterlichen Wohnort – aufgenommenes Studium im 2. Semester unterbrechen, da er nicht mehr in der Lage war, zu schreiben und sich zu konzentrieren.
Vorangegangen war die für ihn überraschende Mitteilung seiner mehrjährigen Freundin, sich von ihm trennen zu wollen.
Die Schmerzen waren verbunden mit der Vorstellung, dass ihm seine Finger, die ganze Hand und die Füße abgeschnitten würden. Sein Denken und Fühlen kreiste um den stärker werdenden Schmerz.
Herr A. bemerkte, dass es ein stimmungsvolles Bild in ihm gab, welches die Schmerzen verschwinden ließ. Er sah sich selbst als Kind am Arm seiner Mutter und fühlte sich heftig von ihr angezogen. In ihm tobte ein heftiger Kampf: Gab er dem Bild nach, war er schmerzfrei. Gleichzeitig nahm seine Angst wieder zu, in einen Strudel zu geraten und in einem „schwarzen Loch“ zu verschwinden.
Wenn er mit seinem PKW in Richtung Heimat auffuhr, lösten sich die Schmerzen ebenfalls auf. Er hatte aber zugleich das Gefühl, die Richtung ändern und die Distanz vergrößern zu müssen, „um nicht unterzugehen“.
Eine psychoanalytisch orientierte Fokaltherapie vermittelte ihm eine Sicherheit, die es ihm erlaubte, sein Studium fortzusetzen.
Der symbolische und kommunikative Gehalt der psychogenen Schmerzsymptomatik erschloss sich Herrn A. erst in einer späteren, mehrjährigen Psychoanalyse. Die Konflikte des Patienten um Autonomie, Trennungsangst und -schmerz und die mit den eigenen Bedürfnissen einhergehenden Schuldgefühle – vor dem Hintergrund eines oszillierenden, sowohl durch emotionale Ferne wie durch Intrusion gekennzeichneten Mutterbildes – bildeten sich in der Übertragungsbeziehung ab und wurden so dem bewussten Erleben zunehmend zugänglich.
Sprachferne Zusammenhänge erschlossen sich ihm in einer – zeitweilig – begleitenden Körperpsychotherapie.





























