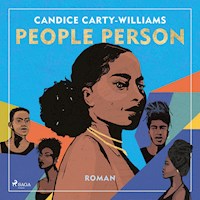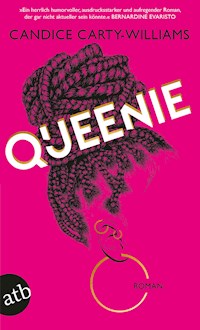
9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»›Queenie‹ wurde die ›Schwarze Bridget Jones‹ genannt. Aber dieses Buch ist noch viel besser.« Sunday Times.
Queenie ist ein Naturtalent. Darin, sich Ärger einzuhandeln. Zum Beispiel in der Zeitungsredaktion, wo sie die Zeit vertrödelt, anstatt endlich über die Themen zu schreiben, die ihr wichtig sind: Black Lives Matter, Feminismus, seelische Gesundheit. Oder mit ihrem braven weißen Boyfriend, der sie nicht gegen seinen (»Er hat’s nicht so gemeint«) rassistischen Onkel verteidigt. Als die Beziehung zerbricht, sucht Queenie Trost in der digitalen Datinghölle und trifft eine falsche Entscheidung nach der anderen. Die Welt schaut ihr zufrieden dabei zu: ist denn von jungen (Schwarzen) Frauen anderes zu erwarten? Eben. Erst als es fast zu spät ist, stellt sich Queenie den wichtigen Fragen: Wie kann ich die Welt zu einem besseren, gerechteren Ort machen? Und mich in ihr ein bisschen glücklicher?
Ausgezeichnet als bestes Buch und bestes Debüt des Jahres bei den British Book Awards.
»Carty-Williams hat die Geschichte einer Schwarzen Frau aufgeschrieben und daraus ›die‹ Geschichte unserer Zeit gemacht.« TIME Magazine.
»Großartig: am Puls der Zeit, lustig, herzzerreißend.« Jojo Moyes.
»Ein wichtiges, aktuelles, entwaffnendes Buch, das längst hätte geschrieben werden müssen. Eines das jeder Schwarzen Frau und Heerscharen weiterer Leser*innen unendlich viel bedeuten wird.« Guardian.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
»›Queenie‹ wurde die ›Schwarze Bridget Jones‹ genannt. Aber dieses Buch ist noch viel besser.« Sunday Times
»Großartig: am Puls der Zeit, lustig, herzzerreißend.« Jojo Moyes
Queenie ist ein Naturtalent. Darin, sich Ärger einzuhandeln. In der Zeitungsredaktion, in der sie arbeitet, mit ihrer chaotischen jamaikanischen Familie, mit ihrem braven weißen Langzeitfreund. Als die Beziehung zerbricht (»Wir machen eine Pause«), sucht Queenie Trost in all den düsteren Ecken, die die Datinghölle des dritten Jahrtausend zu bieten hat. Sie trifft eine falsche Entscheidung nach der anderen und die Welt schaut ihr zufrieden dabei zu: ist denn von jungen (schwarzen) Frauen was anderes zu ewarten? Eben. Als man schon kaum mehr hinschauen kann, stellt sich Queenie endlich ihrem Leben und den dazugehörigen Fragen: Wie kann ich die Welt zu einem besseren, gerechteren Ort machen? Und mich in ihr ein bisschen glücklicher?
Ein gnadenlos ehrlicher Roman, der jede*n begeistern wird, der schon einmal nach der wahren Liebe gesucht und stattdessen etwas viel Aufregenderes gefunden hat.
Über Candice Carty-Williams
Candice Carty-Williams, geboren 1989, ist das Resultat einer Affäre zwischen einem jamaikanischen Taxifahrer, der kaum mal was sagt, und einer Jamaikanisch-Indischen Rezeptionistin mit Lese-Rechtschreibschwäche, die jeden Tag mehr sagt als alle anderen Menschen auf der Welt. Sie ist Journalistin und Drehbuchautorin, ihre Texte erschienen u.a. im Guardian, in der Vogue und der Sunday Times. ›Queenie‹ ist ihr erstes Roman, war ein großer Bestseller in England und vielfach für Literaturpreise nominiert. Candice Carty-Williams lebt in South London.
Twitter und Instagram: @CandiceC_W.
Henriette Zeltner-Shane, geboren 1968, lebt und arbeitet in München, Tirol und New York. Sie übersetzt Sachbücher sowie Romane für Erwachsene und Jugendliche aus dem Englischen, u.a. Angie Thomas’ Romandebüt »The Hate U Give«, für das sie mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 ausgezeichnet wurde.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Candice Carty-Williams
Queenie
Roman
Aus dem Englischen vonHenriette Zeltner-Shane
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Dank
Impressum
Für all die Queenies da draußen– ihr seid gut genug. Glaubt mir.
In liebevoller Erinnerung an Dan O’Lone und Anton Garneys
Kapitel 1
QUEENIE:
In den Steigbügeln.Wünschte, du wärst hier …
Ich machte mein Handy aus und schaute wieder an die Zimmerdecke, bevor ich es wieder anmachte und noch ein »xx« hinterherschickte. Um Tom zu beweisen, dass ich nicht so emotional unbeteiligt war, wie er mir vorwarf.
»Könnten Sie mit Ihrem Po auf der Liege bitte gaaanz nach vorn rutschen?«, bat mich die Ärztin. Ich schob mich zentimeterweise näher an ihr Gesicht. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die das schaffen.
»Tief einatmen, bitte!«
Sie sagte das ein bisschen zu fröhlich und schob dabei ohne weitere Vorwarnung etwas in mich rein, das sich anfühlte wie der am wenigsten ergonomische Dildo der Welt. Dann bewegte sie ihn wie einen Joystick in mir herum. Dazu legte sie noch eine kalte Hand auf meinen Bauch, drückte sie alle paar Sekunden nach unten und verzog, jedesmal wenn ich quiekte, den Mund. Um mich von diesem Rumgestocher in meinen Innereien abzulenken, checkte ich mein Handy. Keine Antwort.
»Was machen Sie denn so … Queenie?«, fragte die Ärztin mit Blick auf meine Patientenkarte.
Reichte es noch nicht, dass sie praktisch in mich reinsehen konnte? Musste sie außerdem auch noch wissen, was für einem Job ich täglich nachging?
»Ich arbeite bei einer Zeitung«, sagte ich und hob den Kopf, um Blickkontakt aufzunehmen, weil mir das höflicher vorkam.
»Das ist ja mal ein schicker Job!« legte sie nach, während sie weiter in mir rumstocherte. »Und was genau machen Sie bei der Zeitung?«
»Ich arbeite bei The Daily Read. In der – autsch – Kulturredaktion. Programme, Rezensionen und –«
» – in der Technikabteilung? Verstehe«, sagte sie.
Ich stützte mich auf meine Ellbogen, um sie zu korrigieren, schwieg jedoch, als ich ihre besorgte Miene sah. Ich schaute zu der Krankenschwester, die hinter ihr stand und exakt genauso besorgt dreinblickte, dann wieder zu meiner Ärztin. Sie sah immer noch besorgt aus. Mein eigenes Gesicht konnte ich zwar nicht sehen, aber wahrscheinlich spiegelten sich ihre Mienen darin.
»Bleiben Sie kurz so, wir werden nur eben – Ash, könnten Sie mal Dr. Smith holen?« Die Schwester eilte hinaus.
Es vergingen viele unangenehme Minuten, bis die Schwester mit einem Arzt zurückkam, der genauso durchschnittlich aussah, wie sein Name vermuten ließ.
»Lassen Sie uns mal einen Blick aus der Nähe darauf werfen …«, sagte Dr. Smith, beugte sich vor und spähte zwischen meine Beine.
»Was ist das Problem? Können Sie sie nicht finden?«, fragte ich und machte mir Sorgen, dass meine Gebärmutter die Spirale vielleicht absorbiert hatte. Genauso wie ich nach wie vor immer fürchtete, dass jeder Tampon, den ich je eingeführt hatte, noch irgendwo in mir herumflog.
»Was meinst du, Ray?«, fragte die Ärztin ihren Kollegen.
»Weißt du, vielleicht sollten wir noch Dr. Ellison dazuholen«, erwiderte Dr. Smith, richtete sich wieder auf und stemmte die Hände in die Hüften.
»Auf dem Gang habe ich eine Putzkraft gesehen, die Erbrochenes aufgewischt hat, vielleicht sollten Sie die reinholen, damit sie auch noch einen Blick drauf wirft«, schlug ich den drei medizinischen Fachkräften vor, die jetzt alle auf das Ultraschallbild starrten.
»Aha! Seht mal, da ist die Spirale!«, sagte da meine Ärztin mit der Begeisterung von jemand, der soeben einen neuen Planeten entdeckt hat, und zeigte auf einen Fleck auf meiner Bildschirm-Gebärmutter. Erleichtert lehnte ich mich auf der Untersuchungsliege zurück. »Aber könnten Sie sich trotzdem wieder anziehen und noch mal kurz im Wartezimmer Platz nehmen? Wir müssen uns nur eben besprechen, dann rufen wir Sie wieder rein.«
»Trau bloß nie einem Mann mit Sternzeichen Zwilling.«
Ich ließ mich auf den freien Stuhl neben Aunt Maggie plumpsen.
»Hier«, sagte sie und hielt mir ein Fläschchen mit Desinfektionsgel hin. Sie quetschte etwas davon auf meine Handfläche, und sobald ich es verteilt hatte, ergriff sie meine Hand, um ihre Aussage zu bekräftigen. Eigentlich hatte ich gedacht, wenn Maggie mich begleitete, würde ihre Anwesenheit als richtig Erwachsene mich beruhigen, doch stattdessen übertrug sich nur ihre zwanghafte Angst vor Krankheitserregern auf mich.
Ich versuchte, mich auf das sich schon von der Wand ablösende Klebeschild der Gynäkologischen Abteilung zu konzentrieren, um meine Hand nicht ihrem Griff zu entziehen.
»Du weißt doch, dass ich nicht an Astrologie glaube.«
Sie drückte meine Hand noch fester. Wahrscheinlich zur Strafe. Ich schlängelte sie aus ihrem Griff und verschränkte die Arme, wobei ich die Hände in meine Achselhöhlen steckte, damit sie sie nicht mehr erwischte.
»Deine Generation glaubt ja an gar nichts«, erklärte meine Tante. »Aber hör zu, was ich dir jetzt sagen werde, denn es ist nur zu deinem Besten. Zwillingsmänner nutzen einen aus. Die nehmen dir alles, was du hast, und quetschen dich aus. Sie geben dir nie was, weil es ihnen gar nicht um dich geht, sondern immer nur um sich selbst. Und dann lassen sie dich mit gebrochenem Herzen zurück, als Häufchen Elend am Boden. Das habe ich schon eine Million Mal gesehen, Queenie.«
Die Frau gegenüber von uns drehte eine Handfläche nach oben und machte zustimmend: »Mhmm.«
»Wie du ja weißt, halte ich mich von allen Männern fern, bis auf unseren Herrn Jesus und Vater, weil ich seit 1981 keine Zeit mehr für sie habe. Aber glaub mir, vor den Zwillingen musst du dich in Acht nehmen. Lässt du dich mit einem Mann ein, der im Juni geboren ist, kannst du dich drauf verlassen, dass das Ärger gibt.«
Ich riskierte einen Einwurf – »Aber Tom ist im Juni geboren!« – und bereute es sofort.
»Oh! Ja, eben! Das sage ich doch gerade!«, rief Maggie. »Und wo steckt er, bitte?« Sie sah mich fragend an. »Du sitzt hier im Krankenhaus und von ihm weit und breit keine Spur!«
Ich machte den Mund auf, um zu argumentieren, dass nicht alle zu einer bestimmten Zeit im Jahr geborenen Männer Variationen von Luzifer auf Erden wären, doch weil sie jedes Thema stets Länge mal Breite erörterte, hatte Maggie noch mehr zu sagen. In dem immer voller werdenden Wartezimmer hielt sie mit ihrer besten Draußenstimme mir (und allen anderen, die rundherum saßen) einen Vortrag. Während ich mir viel zu viele Sorgen darüber machte, was da in meiner Gebärmutter los war, um überhaupt etwas davon an mich ranzulassen, nickte die Frau gegenüber geradezu aggressiv und starrte dabei Maggies kastanienbraune Perücke an, als könne sie ihr jeden Moment vom Kopf fallen. »War Prince nicht auch Zwilling?«, fragte ich. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Juni Geburtstag hatte.«
»Prince – Gott hab ihn selig – war Prince«, sagte Maggie und sah mir direkt in die Augen. »Astrologie war und ist nicht auf Prince anwendbar … Aber wenn du dich auf einen Zwilling einlässt, wirst du es bereuen. Diese Männer lieben die Jagd, glaub mir. Wenn sie einer Frau nachstellen, fühlen sie sich stark und glauben, ihr Leben habe einen Sinn. Und wir wissen schließlich alle, dass Männer sich ohne eine Aufgabe ziellos fühlen. Aber bei den Zwillingsmännern ist das noch mal eine ganz andere Geschichte«, redete Maggie sich in Rage. »Haben sie die Frau schließlich erobert, lassen sie sie fallen. Sie lassen sie fallen, als würden sie sie nicht mal kennen. Zwillingsmännern ist es egal, wem sie wehtun, wen sie benutzen oder übergehen müssen, die kriegen das, verdammt noch mal, gar nicht mit.«
»Bist du dir sicher, dass du nicht von weißen Männern sprichst, Maggie?«, fragte ich und kniff die Augen leicht zusammen. Sie schien sich da auf jemand ganz Bestimmten einzuschießen.
»Denk doch, was du willst«, sagte sie, verschränkte die Arme und kräuselte die Lippen. »Schließlich bist du ja diejenige, die glaubt, sie hätte ihren weißen Ritter gefunden. Und jetzt schau dich an!«
Maggie ist viel Frau. Eine Erscheinung in jeder Hinsicht. Jede Woche lässt sie sich eine neue, noch überraschendere Perücke machen. Sie trägt nicht gern Schwarz, weil sie es zu deprimierend findet, und jederzeit mehr als ein Muster, selbst wenn sie nur zu Hause herumwirtschaftet, denn: »Jesus will, dass wir Farbe in unserem Leben haben.« Diese Farbenobsession ist ihrer kurzen Karriere als Künstlerin geschuldet, in der sie jedoch nichts anderes erschaffen hat als Gewese um sich selbst. Maggie ist auch extrem religiös, aber je weniger davon die Rede ist, desto besser. Meine Tante und meine Grandma benutzen Religion immer als Stock, mit dem sie auf alle anderen eindreschen. Und sich länger als eine Sekunde damit zu beschäftigen, würde heißen, ihr Zeit zu widmen, die ich nicht habe.
Ich saß schon sprungbereit auf der Stuhlkante, um das Krankenhauspersonal diesmal daran zu hindern, wieder meinen vollen Namen herumzuschreien.
»Was könnte sie daran hindern, mich zu googeln, kaum dass ich hier raus bin?«, fragte ich Maggie, weil ich ihren Redeschwall eindämmen wollte. »Gibt es Gesetze dagegen?«
»Wer soll dich googeln?«, fragte sie zurück.
»Jeder hier im Wartezimmer«, antwortete ich leise.
»Du bist doch kein Promi, Queenie«, sagte Maggie. »Sei nicht so paranoid.«
»Queenie Jenkins?«, blökte die Krankenschwester von vorhin. Ich tätschelte Maggies Knie, um ihr klarzumachen, dass ich wieder rein musste, und sprang auf. Sie redete einfach weiter.
Die Schwester erwiderte mein Lächeln nicht, sondern legte nur sanft eine Hand auf meine Schulter. So trottete ich den Klinikflur hinunter und ließ mich wieder in den Raum führen, der roch, als hätte jemand dort einen Eimer Bleiche ausgekippt.
Nervös schaute ich zu dem Ultraschallgerät, das in der Ecke vor sich hin brummte.
»Sie können Ihre Sachen dort ablegen«, sagte sie und zeigte auf den Stuhl neben der Tür. Zum zweiten Mal, und diesmal vielleicht noch mehr, wünschte ich, Tom säße dort. Aber mir blieb keine Zeit zum Lamentieren, weil die Krankenschwester mich anstarrte. Also warf ich meine Tasche darauf.
»Können Sie Ihre Strumpfhose und die Unterhose ausziehen und Ihre Beine wieder in die Steigbügel legen? Ich gehe inzwischen die Ärztin holen.«
»Noch mal?«, fragte ich und warf dabei den Kopf in den Nacken wie ein mürrischer Teenager.
»Ja, bitte.« Damit verließ sie den Raum.
Ich hätte für diesen Termin eine Jogginghose anziehen sollen. Erstens, weil ich sowieso darin leben würde, wenn ich könnte, und zweitens, weil Strumpfhosen totaler Mist sind. Um sie anzuziehen, muss man eine Mischung aus Tanz und Verrenkung aufführen. Das sollte man sich nur einmal täglich antun, in privater Umgebung. Ich holte mein Handy heraus und schrieb meiner besten Freundin, die mit ihrem Nachmittag wahrscheinlich etwas weniger Schreckliches anzufangen wusste, eine Nachricht.
QUEENIE:
Darcy. Die bestehen drauf, mich ein zweites Mal zu untersuchen! Dann habe ich dieses Gerät öfter in mir drin gehabt als Tom in den letzten paar Wochen
Die Ärztin war eine forsche Frau mit freundlichen Augen, die eindeutig schon viel weibliche Angst gesehen hatten. Sie kam zurück ins Zimmer gefegt. Dann sprach sie sehr langsam und erklärte, dass sie etwas noch mal überprüfen müsse. Ich richtete mich auf.
»Wonach suchen Sie denn?«, fragte ich. »Sie haben doch gesagt, die Spirale wäre da.«
Sie antwortete, indem sie sich schnalzend ein Paar Latexhandschuhe überstreifte. Also lehnte ich mich wieder zurück.
»Okay«, gab sie nach einer Pause, und nachdem sie dieses Ding wieder in mich reingeschoben hatte, von sich. »Ich habe einen Kollegen um eine zweite Meinung gebeten. Und auf den zweiten Blick sieht es nun so aus – also, besteht irgendeine Möglichkeit, dass Sie schwanger waren, Queenie?«
Ich richtete mich gleich wieder auf. Meine Bauchmuskeln waren bestimmt schon geschockt und dachten bei dieser Häufigkeit, das wäre ein Workout.
»Entschuldigung, wie meinen Sie das?«
»Nun ja«, sagte die Ärztin mit Blick auf den Ultraschall, »es sieht aus, als hätten sie eine Fehlgeburt gehabt.«
Ich hob eine Hand an meinen Mund und vergaß, dass ich darin etwas hielt. Mein Telefon fiel mir aus der Hand und auf den Boden. Die Ärztin schenkte meiner Reaktion keinerlei Beachtung, sondern schaute weiter auf den Bildschirm.
»Warum?«, fragte ich und wünschte mir verzweifelt, sie würde mich ansehen und merken, dass diese Neuigkeit mir durchaus etwas ausmachte.
»Das kann bei den meisten Formen von Verhütung vorkommen«, erklärte sie mir nüchtern und hielt dabei die Augen, die ich vorhin noch für freundlich gehalten hatte, weiter starr auf den Bildschirm gerichtet. »Die meisten Frauen merken gar nichts davon. Immerhin hat das Ding seinen Job gemacht.«
Nachdem sie den Raum schon wieder verlassen hatte, blieb ich noch lange auf der Untersuchungsliege liegen.
* * *
»Ach, ihr beide werdet wunderschöne Kinder bekommen«, sagte Toms Großmutter und sah uns über den Tisch hinweg an. Joyce war schon am Grauen Star operiert worden, konnte aber anscheinend trotzdem in die Zukunft schauen.
»Deine hübsche, glatte braune Haut, Queenie, aber heller. Wie ein schöner Milchkaffee. Nicht zu dunkel! Und Toms grüne Augen. Dein dichtes Haar, Queenie, diese dunklen Wimpern, aber Toms hübsche gerade Nase.« Ich schaute mich um, weil ich sehen wollte, ob sonst noch jemand am Tisch von ihren Worten geschockt war, doch anscheinend fand man sie akzeptabel.
»Ich glaube nicht, dass man sich das wie bei einem Phantombild aussuchen und zusammensetzen kann, Joyce«, sagte ich und spielte nervös an der Pfeffermühle herum.
»Stimmt«, sagte Joyce. »Das ist wirklich eine Schande.«
Als wir später im Bett lagen, drehte ich mich zu Tom und ließ mein Buch sinken. »Was stimmt nicht mit meiner Nase?«
»Was meinst du?«, fragte Tom und war mit seiner Aufmerksamkeit noch bei irgendeinem Tech-Artikel, den er gerade auf seinem Handy las.
»Deine Grandma. Beim Abendessen hat sie gesagt, unser künftiges Baby sollte deine ›hübsche gerade Nase‹ haben.«
»Hör gar nicht auf das, was sie sagt. Sie ist doch einfach nur alt«, sagte Tom und legte sein Handy auf den Nachttisch. »Deine Nase ist hübsch und weich. Vielleicht sogar das, was mir an deinem Gesicht am besten gefällt.«
»Oh, danke, nehme ich an?« Ich griff wieder nach meinem Buch. »Tja, dann hoffen wir mal, dass unsere Kinder keinen von meinen matschigen Zügen erben.«
»Ich habe nicht matschig gesagt, sondern weich. Und mir wäre es lieber, wenn unsere Kinder mehr nach dir kommen als nach mir – dein Gesicht ist interessanter als meins. Und ich liebe deine Nase. Fast so sehr, wie ich dich liebe«, sagte Tom und drückte mir dazu mit dem Zeigefinger auf den erwähnten Körperteil.
Anschließend drehte er sich so, dass ich mich an ihn kuscheln konnte. Obwohl ich kein Mensch war, der sich überhaupt je besonders sicher fühlte, tat ich das jetzt. Aber nur für eine Sekunde.
»Dann hast du also schon darüber nachgedacht?«, fragte ich und schaute zu ihm hoch.
»Über deine Nase? Klar. Ich finde, du hast eine wunderhübsche Nase.« Er lehnte sein Kinn an meine Stirn.
»Nein. Über unsere Kinder. Künftige Babys.«
»Ja, das hab ich alles schon geplant. In sechs Jahren, wenn wir dann ein Haus besitzen und ich dich vor den Altar gezerrt habe, dann werden wir auch Kinder haben«, sagte Tom lächelnd. »Drei sind die richtige Anzahl.«
»Drei?«
»Eins wird egoistisch, zwei bedeuten, dass sie dauernd miteinander wetteifern, aber wenn man drei hat, können sie anfangen, aufeinander aufzupassen, sobald das Älteste acht ist.«
»Okay, okay. Drei kaffeebraune Babys. Aber milchkaffeefarben, ja? Genau wie Grandma sie bestellt hat.«
* * *
QUEENIE:
Tom, hallo
QUEENIE:
Siehst du meine Nachrichten?
QUEENIE:
Ich ruf dich an, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin
QUEENIE:
Muss zur Apotheke und ein paar Tabletten besorgen
QUEENIE:
Sag Bescheid, wenn ich irgendwas mitbringen soll
Ich saß auf dem Flur, schaute auf das zersplitterte Display meines Handys und wartete darauf, dass Tom antwortete. Ein paar Minuten verstrichen, und schließlich kehrte ich ins Wartezimmer zurück. Schon auf dem Weg dorthin konnte ich Maggie hören.
»Eines Tages, das ist inzwischen schon Jahre her, meinte mein Ex-Mann, er würde nur schnell tanken fahren. Und wissen Sie was? Er blieb fünfzehn Stunden weg! Als er zurückkam, sagte ich: ›Terrence, wo hast du getankt? In Schottland?‹« Sie machte eine Kunstpause. »Danach hab ich ihm erklärt, er soll verschwinden. Ich hatte ein Baby zu versorgen, Rechnungen zu bezahlen, da konnte ich irgendwelchen Unfug, den Männer so anstellen, nicht gebrauchen.« Maggie legte wieder eine Pause ein, um ihr Dekolleté zurechtzurücken. »Am Tag nachdem er weg war, ging ich zum Arzt und sagte: ›Hören Sie, machen Sie mir einen Knoten in meine Eierstöcke, denn ich will keine mehr!‹ Das können Sie mir glauben. Die eine, die ich habe, ist jetzt fünfzehn und macht mir nichts als Sorgen. Ständig geht es nur um Make-up, Jungs, falsche Wimpern und Videos für YouTube. Dafür ist meine Mum nicht aus Jamaika hergekommen, damit ihre Enkelin auf Schulbildung pfeift.« Maggie verschränkte die Arme und löste sie wieder. »Ich gehe in die Kirche und bete. Ich bete für mich, ich bete für meine Tochter, für meine Nichte. Ich muss einfach hoffen, dass er mich hört, Marina.«
Wie konnte es sein, dass meine Tante und die Fremde sich schon mit Vornamen ansprachen? So lange war ich ja dann doch nicht weg gewesen. Ich ließ mich neben meine Tante plumpsen. Marina, die gegenüber saß, nickte heftig, obwohl Maggie schwieg.
»Was haben sie gesagt?«, fragte Maggie mich und packte schon wieder ihr Desinfektionsgel aus.
Ich wich der Frage aus. »Nichts. Wirklich. Nur Frauenprobleme, du weißt schon.«
»Was für Frauenprobleme?« Maggie gehört zur ersten Generation jamaikanischer Einwanderer und ist daher eine Frau, die automatisch Anspruch auf Informationen über andere hat.
»Einfach Frauenprobleme!«, beharrte ich und zwang mich zu einem, wie ich hoffte, überzeugenden Lächeln.
Maggie und ich standen an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus. Sie sprach von irgendwas, auf das ich mich nicht wirklich konzentrieren konnte, während ich zu den drei gigantischen Hochhaustürmen hinaufschaute, die gegenüber so hoch aufragten, dass dunkle Wolken ihre Spitzen fast verhüllten. Ich hielt den Kopf im Nacken, weil ich hoffte, dann würden die Tränen, die mir in die Augen stiegen, nicht herauslaufen.
»Queenie, was hat die Ärztin gesagt?« Meine Tante musterte mich aus schmalen Augen. »Diesen Mist von wegen ›Frauenprobleme‹ nehm ich dir nicht ab. Muss ich es aus dir rausquetschen?«
Wie hatte ich nur glauben können, sie bereits von dem Thema weggelotst zu haben?
»Sie wollte sich meinen Gebärmutterhals ansehen, Maggie«, sagte ich in der Hoffnung, dass sie sich damit zufriedengeben würde. »Irgendwas von wegen der wäre schmal?«
Sie sah mich an und verzog verärgert und schockiert das Gesicht. »Wie bitte? Musst du mich so in Verlegenheit bringen?«, sagte sie mit zusammengebissenen Zähnen und blickte um sich. »Wir reden in der Öffentlichkeit nicht über unsere Vs.«
»Aber ich habe doch gar nicht Vagina gesagt, sondern Gebärmutterhals«, erwiderte ich.
Sie presste die Lippen zusammen.
»Wie auch immer, da kommt der Bus!«
Der 136er kroch die Lewisham High Street hinunter und Maggie sprach hundert Wörter für jeden Meter, den wir vorankamen.
»Weißt du, damals, als Mum herübergekommen ist, da haben sie Schwarzen Frauen Implantate und Spiralen eingesetzt, ohne dass wir davon wussten, weil wir nicht schwanger werden sollten.« Sie legte den Kopf schräg. »Damit wir uns nicht fortpflanzten. Das ist wirklich wahr!« Sie zog die Augenbrauen hoch. »Mums Freundin Glynda, die, die Mum arm futtert, wenn sie zu Besuch kommt. Also, die konnte jahrelang nicht schwanger werden und wusste nicht, warum. Deshalb hättest du dir dieses Ding gar nicht erst einsetzen lassen sollen. Aus politischen und gesundheitlichen Gründen. Du weißt doch gar nicht, was das mit dir anstellt.«
Sie war so aufgebracht, dass ihre riesigen Plastikohrringe einen Soundtrack zu ihren Worten lieferten.
»Die Körper Schwarzer Frauen kommen mit so was nicht gut zurecht. Hast du das nicht gelesen? Chemisches Ungleichgewicht und Absorption durch unser Melanin – das wirkt sich auf Zirbeldrüse und Hypophyse aus. Außerdem quillt man auf.«
Maggie legte eine Pause ein, um Diana anzurufen, also probierte ich es bei Tom. Die ersten drei Male hatte es einfach nur geklingelt, aber jetzt landete ich in der Mailbox. Es war schon nach sechs, aus der Arbeit musste er da schon weg sein.
»Geht er immer noch nicht ran?«, fragte Maggie.
»Hä?« Ich schaute aus dem Fenster. »Wer, Tom? Doch, er hat mir eine Nachricht geschrieben, dass wir uns gleich zu Hause treffen.«
Sie wusste, dass ich log, aber weil meine Haltestelle als nächste kam, konnte sie mich dazu nicht mehr in die Zange nehmen.
»Bist du dir sicher, dass du nicht am Sonntag mit mir in die Kirche willst? Da sind alle willkommen. Sogar du, mit dieser Spirale.« Sie musterte mich aus den Augenwinkeln. »Gott wird selbst die Frevelhaftesten erretten …« Ich verdrehte die Augen und stand auf.
»Ich rufe dich morgen an«, sagte ich, bevor ich wie eine Flipperkugel durch den Bus trippelte und mich dabei bemühte, möglichst nichts und niemand mit meinen Händen zu berühren, bevor ich ausstieg.
Als die Türen zugingen und der Bus wieder anfuhr, blieb ich stehen und winkte meiner Tante. Das machen wir in unserer Familie so. Eine nervige und zeitraubende Sache.
Als ich zu Hause ankam, war es kalt in der Wohnung. Ich ließ mir ein Bad ein und schlüpfte aus den Kleidern. Als ich sah, dass das klebrige Gel vom Ultraschall am Zwickel meines Slips klebte, rümpfte ich die Nase und warf ihn in den Korb mit der Schmutzwäsche. Ich setzte mich auf den Wannenrand. Die Blutung hatte zwar aufgehört, aber die Krämpfe waren noch da.
Nachdem ich mir ein Kopftuch um die Haare gebunden hatte, stieg ich in die Wanne. Im Wasser sitzend drückte ich auf meinen Bauch und zuckte zusammen, wenn ich eine empfindliche Stelle traf. Warum war das passiert? Ich war fünfundzwanzig. Ich würde jetzt kein Baby bekommen. Offensichtlich nicht. Aber es wäre schön gewesen, die Wahl zu haben. Dass ich mir ein Verhütungsmittel in meinen Körper hatte einsetzen lassen, deutete darauf hin, dass ich kein Baby wollte. Daher wäre meine Entscheidung wohl gewesen, nicht wirklich ein Kind austragen und aufziehen zu wollen, aber darum ging es gar nicht.
»Wäre ich dafür bereit gewesen?«, fragte ich mich laut und streichelte dabei meinen Bauch. Meine Mum war fünfundzwanzig gewesen, als sie mit mir schwanger war. Das sagt wohl alles darüber, wie unvorbereitet ich gewesen wäre. Ich lehnte mich zurück und eine Art Gefühllosigkeit umfing meinen Körper, während das heiße Wasser meine kalte Haut berührte.
Inzwischen war es schon Mitternacht und Tom immer noch nicht zu Hause. Ich konnte nicht schlafen, weil es sich anfühlte, als versuche meine Gebärmutter, aus meinem Körper rauszukommen. Also stellte ich ein paar Kartons auf und begann, meine Hälfte unserer Habseligkeiten im Wohnzimmer einzupacken. Damit es wenigstens so aussah, als würde ich bald ausziehen. Eine Schneekugel aus Paris von unserem ersten gemeinsamen Urlaub; einen seltsam hässlichen Porzellanesel aus Spanien von unserem zweiten Urlaub und ein türkisches Augen-Amulett von unserer dritten Reise. Ich wickelte all diese Souvenirs unserer Beziehung sorgsam in mehrere Lagen Zeitungspapier und klebte das noch mit Klebeband fest. Dann machte ich mit den Tellern und Bechern weiter, bevor ich innehielt und den Esel wieder auspackte. Ich wickelte ihn aus und stellte ihn zurück auf den Kaminsims. Falls ich eine Erinnerung an unsere Beziehung zurücklassen würde, dann dieses Ding, das ich in meiner neuen Bleibe sowieso nicht haben wollte. Danach machte ich weiter und wütete geradezu mit Papier und Klebeband, bis ich zu den zwei Bechern auf dem Abtropfgitter kam. Einer war mit einem T verziert, der andere mit einem Q.
* * *
»Warum hast du bloß so viel Zeugs?«, fragte Tom, lehnte sich an einen Karton, auf dem »Verschiedenes 7« stand und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Ich besitze nur ein paar Hoodies und zwei Paar Socken.«
»Keine Ahnung. Vielleicht bin ich, ohne es zu merken, sammelwütig geworden?«, sagte ich und nahm sein Gesicht in meine Hände. »Aber du hast dich entschieden, mit mir zu leben, also musst du jetzt auch mit dem ganzen Zeugs leben.«
»Na schön, ich bereue es nicht«, sagte Tom und küsste mich auf die Stirn. »Queenie, für jemanden, der eigentlich Kartons schleppen sollte, hast du eine sehr trockene Stirn.«
»Ja, das mag schon sein, aber ich schleppe auch nicht, sondern organisiere«, erklärte ich ihm. »Und ich sorge dafür, dass Kartons, auf denen ›Küche‹ steht, auch in die Küche kommen.«
»Tja, also wenn du dann schon in der Küche bist, könntest du vielleicht wenigstens Tee kochen?«
»Ja, jetzt wo du es erwähnst. Deine kluge Freundin hat eben den Karton mit dem Wasserkessel gefunden und auf dem Weg hierher Milch und Teebeutel besorgt«, sagte ich. »Aber ich weiß nicht, wo die Becher sind.«
»Schau mal in meinen Rucksack. Meine Mum hat uns Becher gekauft. Als Geschenk zum Einzug, meinte sie.«
Ich fand Toms Rucksack im Flur. Als ich ihn aufmachte, entdeckte ich darin zwei Geschenkpakete, die jeweils einen weißen Becher enthielten. Ich wusch sie ab, kochte uns Tee und fischte die Beutel in Ermangelung eines Löffels mit den Fingern heraus.
»Wie kann es sein, dass du dir dabei nicht die Finger verbrennst?«, fragte Tom, der gerade mit einer Schachtel unterm Arm in die Küche kam.
»Das tue ich, aber ich rede nicht drüber«, sagte ich und hielt ihm einen dampfenden Becher hin. »Die sind schick. Wo hat sie sie her?«
»Keine Ahnung«, sagte Tom und nahm einen Schluck.
»Oh, Moment mal, du hast den Becher mit dem Q«, stellte ich fest und streckte die Hand danach aus.
»Der gehört jetzt mir«, sagte er und hob ihn so hoch, dass ich nicht drankam. »So, wie du mir gehörst«, fügte Tom hinzu und legte einen Arm um mich.
»Weißt du«, meinte ich, »egal, in welchem Ton du das sagst, es klingt gruselig und besitzergreifend.«
»Gruselig und besitzergreifend.« Tom nahm einen weiteren Schluck Tee und lachte. »Sind das die Eigenschaften, wegen denen du dich anfangs zu mir hingezogen gefühlt hast?«
* * *
Ich packte, bis ich so erschöpft war, dass ich auf dem Sofa einschlief. Umgeben von Kartons mit über die Jahre angehäuftem unwichtigem Zeug, das ich wahrscheinlich nicht weiter durch mein Leben schleppen müsste. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, ertönte mein Wecker gemeinerweise aus dem Schlafzimmer. Tom war immer noch nicht da. In der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit krümmte ich mich, als Schmerz meinen Bauch zusammenzog. Eine Frau gab mir eine leere Plastiktüte und sagte: »Wenn Sie schon brechen müssen, könnten Sie es dann wenigsten da rein tun? Keiner will das so früh am Morgen auf den Boden spritzen sehen.«
Ich schlich zu spät ins Büro, machte meinen Computer an und schummelte mich mit aufgesetztem Lächeln durch den Vormittag. Das Fernsehprogramm geriet mit dem Programm der Clubs durcheinander, und ich bat Leigh, das in Ordnung zu bringen, bevor unsere Chefin Gina es bemerkte. Eines Tages wird er mir erklären, ich solle meine Arbeit selbst erledigen, aber solange ich mir im Detail anhöre, wie es mit der DJ-Karriere seines Boyfriends Don bergab geht, sieht er mir eine Menge Dinge nach.
Mittags trat ich an Darcys Schreibtisch, ein graues Metalldock in einer ruhigen Ecke des Büros, das sie sich mit der stillen Jean teilt, der ältesten und am längsten bei The Daily Read beschäftigten Korrektorin der Welt. Die von allen so genannte stille Jean war eine gespensterbleiche Frauengestalt, die nicht so recht zur Ästhetik einer hippen Institution auf dem Nachrichtensektor passen wollte. Außerdem schien sie mich zu hassen, ohne je mit mir gesprochen zu haben. Oder mit irgendwem sonst, um genau zu sein.
»Mahlzeit, Jean«, sagte ich und verbeugte mich. Sie gab ein abschätziges Geräusch von sich und nickte kurz, bevor sie ihre erstaunlich schicken Kopfhörer wieder aufsetzte. Ich legte beide Hände auf Darcys Kopf und begann, ihr dickes, schweres braunes Haar zu streicheln. Das war eine Betätigung, die sie glücklicherweise genauso befriedigend fand wie ich, also keine Abmahnung aus der Personalabteilung für mich.
»Bitte, mach weiter. Das ist wirklich das Beruhigendste überhaupt«, sagte sie. Dabei schaute ich auf ihren Bildschirm und begann die E-Mail, die sie gerade schrieb, laut vorzulesen:
»Simon, du kannst doch nicht erwarten, dass ich meine Wünsche und Bedürfnisse neu ausrichte, damit sie dir passen. Obwohl du weißt, dass ich mich an einem anderen Punkt in meinem Leben befinde als du dich in deinem, zeigst du kein Verständnis, sondern benutzt das fast schon als Waffe –«
Die stille Jean sah uns an und seufzte für jemanden, der seine Stimmbänder so selten benutzt, unerwartet laut.
»Queenie! Wir wär’s mit ein bisschen Privatsphäre!«, fauchte Darcy und drehte sich um. Ihre strahlend blauen Augen bohrten sich in meine dunkelbraunen.
»O-oh. Was ist denn passiert?«, fragte sie.
»Einiges«, stöhnte ich und schlug mit dem Kopf so fest gegen die Trennwand, dass die stille Jean auf ihrem Stuhl hochfuhr.
»Alles klar. Dann lass uns gehen. Komm!«, flötete sie, sah Jean entschuldigend an und zog mich auch schon mit sich fort. Obwohl Darcy mich erst wirklich kurz kennt, ist sie die intuitivste meiner besten Freundinnen. Seit dreieinhalb Jahren arbeiten wir zusammen und unterhalten uns an jedem Wochentag, was bedeutet, dass wir einander besser kennen als uns selbst.
Sie ist sehr hübsch und ihr Teint so rosig wie ihre Aussichten. Sie sieht aus wie eines dieser Mädchen während des Krieges, deren Fotos die Soldatenehemänner abends küssten. Man könnte meinen, dieses Schönheitsideal gelte heutzutage nicht mehr unbedingt, aber bei ihr funktioniert es.
Darcy schob mich in den Lift und zwang mich dabei, einem Mann auf den Fuß zu steigen, den ich noch nie gesehen hatte. Er trug ein Tweedsakko und eine Brille, die zu groß für sein Gesicht war. Hätte sich mein Gehirn nicht komplett auf Liebeskummer konzentriert, dann hätte ich dieses Gesicht übrigens attraktiv gefunden. Er sah mich an und machte den Mund auf, um sich zu beschweren, sah mich dann aber nur weiter an, bis er den Blick auf sein Handy senkte.
»Das kommt alles in Ordnung, Queenie«, flüsterte Darcy und legte einen Arm um meine Schultern.
»Du weißt doch nicht mal, was in Unordnung ist«, zischte ich zurück, »deshalb kannst du das gar nicht beurteilen.« Der Aufzug hielt im Erdgeschoss und wir schoben uns hinaus, während aus meinem Mund mit hundert Stundenkilometern pro Stunde Worte über Trauer, Verrat und Verlassenheit schossen.
»Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll! Es ist schon so lange so schlimm, Darcy. Es hört gar nicht mehr auf«, erklärte ich ihr, und je gereizter ich wegen meiner blöden Lage wurde, desto schneller lief ich. »Wir streiten an jedem einzelnen Tag. Über absolut nichts. Und zwar so heftig, dass er begonnen hat, die Wochenenden wieder bei seinen Eltern zu verbringen. Und wenn es ganz schlimm ist, dann bleibt er sogar unter der Woche dort und pendelt! Aus Peterborough! Als es letztes Wochenende so richtig zur Sache ging, hat er mir erklärt, er brauche eine Pause und fände, ich solle ausziehen.«
»Du meine Güte!« Darcy zuckte zusammen. »Hat er das ernst gemeint? Oder war er bloß sauer?«
»Darcy, ich habe verdammt noch mal keine Ahnung. Wir waren die ganze Nacht auf, haben geredet und darüber gestritten, und dann habe ich eingewilligt, für drei Monate auszuziehen, damit wir uns die Sache danach noch mal ansehen können.«
»Warum bist du diejenige, die auszieht, wenn er doch bei seinen Eltern wohnen kann? Du hast diese Möglichkeit schließlich nicht.« Darcy hakte sich bei mir unter.
»Er meint, er kann es sich leisten, in der Wohnung zu bleiben, weil mein Einstiegsgehalt im Vergleich zu seinem Big-Boy-Fucking-Webentwickler-Salär nichts ist.«
»Ist das ein wörtliches Zitat?«, fragte Darcy entsetzt.
»Wenn es um Geld geht, war er schon immer so, also sollte es mich nicht überraschen, dass er es jetzt gegen mich verwendet.« Darcy drückte meinen Arm fester an sich. »Ich verstehe nur nicht, warum er sich so aufführt. Er weiß doch, dass ich ihn liebe«, stieß ich hervor. »Warum, verdammt noch mal, sieht er das nicht?«
Meine explizite Sprache war nichts für einen Restaurationsbetrieb, daher lotste Darcy mich von der Kantine weg und zu dem winzigen Park in der Nähe unseres Büros. Ich schätze, man kann es einen Park nennen, auch wenn es eigentlich nur Flecken feuchter Erde und ein paar kahle Zweige sind. Trotzdem ist es schön, mitten in London etwas zu haben, das Ähnlichkeit mit einer Grünanlage besitzt. Wir wehrten die scharfe Oktoberluft ab, indem wir uns auf einer Holzbank aneinanderschmiegten, die gefährlich wackelte. Vor allem, als ich sie mit wildem Geruckel auf die Probe stellte.
»Er weiß doch, dass es bei mir Sachen gibt. Er weiß schon immer von meinen Sachen, also warum hat er dann kein Verständnis dafür?« Ich sah Darcy fragend an, redete aber schon wieder weiter, bevor sie irgendwas dazu sagen konnte. »Es könnte alles gut sein. Wir nehmen uns eine Auszeit, ich ziehe für eine Weile aus, kriege einen klaren Kopf, dann ist in ein paar Monaten alles gut, ich ziehe wieder ein und wir werden für immer glücklich miteinander.«
»Wie Ross und Rachel, nur gemischt?«, schlug Darcy vor.
»Ist Friends eigentlich für immer der einzige Vergleich, der dir einfällt?«, fragte ich sie. »Dabei gibt es in Friends überhaupt keine Schwarzen.«
»Ich denke, du musst ihm einfach ein bisschen Zeit lassen, und etwas Freiraum. Wenn du erstmal weg bist, wird ihm klar werden, wie schwer es ist, dich nicht mehr um sich zu haben«, sagte Darcy.
Sie ist sehr lösungsorientiert. Der willkommene Gegenpart zu meiner Impulsivität und Unfähigkeit, Dinge zu durchdenken. »Habt ihr miteinander geschlafen?«
»Nein, obwohl ich es durchaus versucht habe.« Ich seufzte. »Er hält es für eine schlechte Idee. Dabei ist es schon einen Monat her, dass wir Sex hatten.«
Darcy zuckte zusammen.
»Es macht mich echt fertig. Ich wünschte, alles wäre einfach gut«, sagte ich und lehnte meinen Kopf an Darcys Schulter. »Was, wenn es das Ende ist?«
»Es ist nicht das Ende!«, versicherte Darcy mir. »Tom liebt dich. Er leidet nur gerade. Ihr leidet beide, vergiss das nicht. Diese ganze Auszeit-Sache ist Gift für seinen Stolz. Männer geben nicht gern zu, dass sie in irgendwas gescheitert sind, schon gar nicht in Beziehungen. Ich habe Simon mal eine Auszeit vorgeschlagen. Als Reaktion hat er eine dreimal so lange Sitzung bei seinem Therapeuten gebucht und sich die Augenbraue piercen lassen. Das wird schon wieder besser werden.« Darcy lehnte ihren Kopf an meinen. »Oh! Was haben die denn übrigens gestern im Krankenhaus gesagt? Du weißt schon, bei dem Ultraschall?«
»Ach, alles gut.« Es hatte keinen Sinn, ihr davon zu erzählen. »Ist nur der Stress oder so was.«
»Aber Tom hat dich begleitet, oder?«
»Nein, er ist Sonntagabend zurück nach Peterborough. Seither hab ich ihn nicht gesehen und nichts von ihm gehört.«
»Machst du Witze?«, quiekte Darcy. »Möchtest du für ein paar Tage zu mir und Simon kommen? Hast du denn immer noch diese Bauchschmerzen? Wir können uns um dich kümmern.«
»Nein, mir geht’s gut«, sagte ich.
Es tat nicht mehr weh, aber anstelle des Schmerzes war etwas anderes getreten, irgendwas Schweres, was ich nicht so richtig identifizieren konnte.
Um noch ein bisschen Zeit totzuschlagen, bevor ich nach Hause ging, wo mich alles an meine zerbrechende Beziehung erinnerte, legte ich auf dem Heimweg einen Stopp in Brixton ein. In der Hoffnung, meinen Appetit mit meinem liebsten Comfort-Food anzuregen, wollte ich mir Jamaica Bun besorgen. Ich stieg die Stufen aus der U-Bahn nach oben und blieb dann erst einmal stehen, um wieder zu Atem zu kommen.
Der Duft der Räucherstäbchen von den Straßenverkäufern brachte mich zum Niesen, als ich Richtung Markt abbog. Ich sprang über verdächtige Pfützen und schlängelte mich wie immer zwischen gefühlt tausenden von Menschen durch. So gelangte ich nach Brixton Village und folgte dem Weg zur karibischen Bäckerei, der sich mir von samstäglichen Einkaufstouren mit meiner Grandma ins Gedächtnis eingebrannt hatte. Als ich um die Ecke bog und direkt in die Bäckerei eintreten wollte, stand ich plötzlich vor einer trendigen Burgerbar voller junger Paare. Die Männer trugen alle bunte Oversized-Hemden und ihre Begleiterinnen bunte, überteuerte Jacken.
Stirnrunzelnd ging ich den Weg noch mal zurück, bog um diverse Ecken und überzeugte mich davon, dass ich mir die Bäckerei nur eingebildet haben konnte, denn ich landete wieder vor dem Burgerladen. Dort stand ich eine Minute lang und versuchte, mich an frühere Besuche zu erinnern.
* * *
»Hallo, hallo, Susie, wie isses?« Meine Grandma lächelte die dicke Jamaikanerin hinter der Theke an. Die ganze Bäckerei duftete so süß. Und zwar nicht eklig süß, sondern zuckerig, warm und vertraut. Ich stellte mich auf Zehenspitzen, spähte über die Theke und sah, wie Susies makellos weiße Schürze über dem weichen, runden Bauch spannte.
»I’m good, tank you darlin! Und du?«, erwiderte die Frau und ließ einen Goldzahn aufblitzen. »Und die Kleine da, die wird schon groß!«
»Groß und kräftig!« Meine Grandma lachte rau, während sie antwortete.
Ich schaute grimmig zu ihr hoch.
»Warum ziehste denn so’n Gesicht? Sie sagt doch nur, dass du wächst«, meinte ein älterer Jamaikaner, der gerade aus dem Hinterzimmer gekommen war.
»Sie is einfach zu empfindlich, Peter.« Meine Grandma winkte mit einer Hand ab. »Aber egal, gib mir nen Bun – nicht den, den großen. Nee, nee, den größten. Genau den – und zwei Hard-Dough-Brote, eine Bulla und nen kleinen Rührkuchen für meinen Mann, um mal wieder ’n Lächeln in sein sauertöpfisches Gesicht zu zaubern.«
Die Frau reichte mir lächelnd eine riesige braune Tüte mit Backwaren über die Theke. »Musst Grandma helfen, sie wird ja nicht ewig da sein.«
»Warum muss Susie so makaber daherquasseln?«, flüsterte meine Grandma mir schmallippig zu, als wir rausgingen. »Manchmal sind Jamaikaner einfach zu vertraulich.«
* * *
Weil diese Erinnerung mich darin bestärkte, dass ich richtig war, ging ich mit frischer Entschlossenheit zu einer Fischbude gegenüber.
»Entschuldigen Sie?«, sagte ich zu einem Fischhändler, der gerade Tintenfische von seiner Auslage in einen Behälter warf. »Gab es hier gegenüber eine Bäckerei?« Ich zeigte auf die Burgerbar, deren Neonlicht bis zu einigen anderen Läden und Buden strahlte. Erst da bemerkte ich, dass an vielen davon GESCHLOSSEN oder UMGEZOGEN auf den Rollläden stand.
Der Fischhändler antwortete nicht.
»Die Front war dunkelgrün, mit Brot im Schaufenster? An den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern«, fuhr ich fort und bemühte mich, nicht auf die Aktivitäten der Tintenfische zu achten, während ich über Essen sprach, das ich mochte.
»Weg«, sagte der Mann schließlich. Dann knallte er den Behälter auf den Boden und wischte sich die Hände an seiner Schürze ab. »Konnten Miete nicht mehr zahlen«, erklärte er in gebrochenem Englisch. »Dann diese Leute kamen.« Er deutete auf das Burger-Lokal.
»Was?«, quiekte ich. »Wie hoch ist die Miete denn?« Wie konnte es denn sein, dass man die Miete so erhöht hatte, dass Leute, die sowieso schon gezwungen gewesen waren, speziell nach Brixton zu ziehen, hier zu leben und eine Community zu bilden, verdrängt wurden, um Platz für kommerziell erfolgreiche Burgerbars zu machen?
Er zuckte nur mit den Achseln und ging weg, wobei seine Gummistiefel auf dem nassen Boden bei jedem Schritt ein quietschendes Geräusch erzeugten.
* * *
QUEENIE:
Tom, bist du heute Abend zu Hause?Sag mir Bescheid
Ich stand an der Bushaltestelle, als die Bauchschmerzen wieder anfingen. Zusammengekrümmt holte ich tief Luft, und als ich mich wieder aufrichtete, hielt vor mir ein schwarzer BMW. Die wummernden Bässe daraus trafen mich mit jedem Beat. Das Beifahrerfenster senkte sich und süßlicher Rauch quoll heraus. Instinktiv wich ich einen großen Schritt zurück und hielt dabei immer noch die Hände wie schützend über meinen Bauch.
»He, dicker Batty«, rief eine vertraute Stimme lachend.
Es war mein ehemaliger Nachbar Adi, ein sehr kompakter und gut aussehender Pakistani mit so präzise gestylter Gesichtsbehaarung, dass es wirkte, als habe er einen Laser benutzt. »Wie geht’s deinem dicken Booty, seit du die Ends verlassen hast? Endlich für mich bereit?« Er lachte wieder.
»Adi! Lass das!«, sagte ich verlegen und trat näher an den Wagen ran. »Leute können dich hören!«
Kaum war ich in das Haus von meinem Dad gezogen, hatte Adi mir unermüdlich nachgestellt, sowohl vor als auch nach seiner prachtvollen Desi-Hochzeit mit dem Mädchen, das schon acht Jahre seine Freundin gewesen war. Wann immer ich ihm begegnete, sprach er sehr nüchtern und ausführlich darüber, dass schwarze Frauen für muslimische Männer verbotene Früchte seien. Aber hauptsächlich ließ er sich über dicke schwarze Hintern aus.
»Lass mich dich mitnehmen, ja?« Er lächelte. »Aber nicht, wenn dir schlecht ist. Ich hab gesehen, wie du dich zusammengekrümmt hast.«
»Mir geht’s gut, danke«, sagte ich und reckte einen Daumen hoch.
»Dann steig ein, hinter mir kommt ein Bus.« Er beugte sich rüber und öffnete die Beifahrertür.
Ich machte den Mund auf und wollte ablehnen, aber da ließ ein noch nie dagewesener Schmerz meine Knie weich werden. Also stieg ich in den BMW.
»Pass auf das Leder auf!«, rief er mit höherer Stimme, als ich sie je bei ihm gehört hatte. »Die Sitze sind Maßanfertigungen.«
Kaum hatte ich die Tür geschlossen, raste Adi so schnell los, dass ich mich fühlte wie in einem Fliehkraft-Simulator.
»Warte, ich schnall mich noch eben an«, sagte ich und griff unbeholfen hinter mich.
»Bei mir bist du sowieso in Sicherheit, is ja wohl klar.« Er lächelte wieder und legte eine Hand auf meinen Oberschenkel. Sein breiter silberner Ehering blitzte.
»Adi«, sagte ich und nahm seine Hand weg. »Beide Hände ans Steuer.«
»Wie ich schon sagte«, fing er an, »ist dieser dicke Booty jetzt bereit für mich? Er sieht übrigens noch dicker aus.«
»Er hat noch genau dieselbe Größe, Adi.«
Warum war ich in den Wagen gestiegen? Es wäre besser gewesen, einfach direkt an der Bushaltestelle zusammenzuklappen.
Das Handy brummte in meiner Tasche. Ich nahm es heraus und las Toms Nachricht auf dem Display. Mein Magen zog sich zusammen.
TOM:
Gerade deine Nachricht gesehen. Heute Abend nicht da.
»Ich kann dein Leben verändern, weißt du, Queenie.« Adi legte seine Hand wieder auf mein Bein. »Mädchen wie du, Mann wie ich? Ich kann dir garantieren, dass du noch nie so guten Sex hattest.«
Diesmal ließ ich seine Hand liegen.
* * *
Nachdem Adi mich abgesetzt hatte und mit quietschenden Reifen davongefahren war, stand ich mit dem Schlüssel in der Hand vor der Haustür und hoffte, Tom hätte es sich anders überlegt und wäre da. War er nicht.
Die Wohnung war kalt, wieder mal. Ich kroch ins Bett und versuchte es mit kathartischem Weinen, aber es funktionierte nicht. Überhaupt nicht. Kyazike rief an. Ich drückte ihren Anruf weg. Maggie rief an. Weil ich wusste, dass sie mir nur erzählen würde, dass Jesus die Lösung war, drückte ich sie auch weg. Dann rief meine Grandma an. Weil man ihre Anrufe nicht wegdrückt, ging ich ran.
»Hallo Grandma«, krächzte ich.
»Was ist passiert?« Sie merkte immer, wenn etwas passiert war.
»Nichts.«
»Du weißt, dass ich immer weiß, wenn etwas ist, Queenie«, brummte sie. Also erklärte ich, dass ich Kopfschmerzen hätte. »Nein, hast du nicht. Wir kriegen keine Kopfschmerzen. Es ist wegen dem weißen Jungen, nicht wahr?«
»Das sagt man nicht!«
»Ist er weiß oder nicht? Hör mal – wenn du traurig bist, dann musst du dagegen ankämpfen. Wenn ich mir erlaubt hätte, traurig zu sein, als ich mit vierzehn mit Maggie schwanger war, was wäre dann aus mir geworden?« Alle Antworten meiner Grandma haben karibischen Bezug, der mich zu der Einsicht zwingt, dass meine Probleme trivial sind.
»Ich weiß, aber das war damals anders.«
»Glaubstu etwa, Leid schert sich um Zeit?« Ihr Patois klingt immer dann deutlich heraus, wenn sie selbstgerecht wird.
Wieder schlief ich auf dem Sofa ein, diesmal allerdings mit einer Wärmflasche. Ich wachte vom Geräusch fließenden Wassers auf. Mühsam richtete ich mich auf, stolperte Richtung Badezimmer und machte unterwegs Licht in der vollkommen dunklen Wohnung.
Tom saß auf dem Rand der Badewanne, das Gesicht von mir abgewandt, und fühlte die Temperatur des Wassers mit einer Hand. Dann drehte er das kalte Wasser ab, stand auf, und seine große Gestalt verspannte sich ein wenig, als er mich sah.
»Ich wusste nicht, dass du auf bist«, sagte er leise. »Hast mich erschreckt.«
»Tut mir leid. Ich dachte, du würdest heute Abend nicht herkommen.«
»Ich hab zu lange gearbeitet und den letzten Zug zurück nach Hause verpasst.« Er schob sich an mir vorbei. »Es braucht vielleicht noch eine Minute nur heißes Wasser.«
»Aber hier ist doch zu Hause«, sagte ich zu ihm.
Er antwortete nicht.
Ich fing an, mich auszuziehen, während Tom am Türrahmen lehnte. Der Rollkragenpullover blieb an meinem Kopf hängen, und so konnte Tom mich in meinem früher einmal weißen, jetzt eher farblosen BH und mit zappelndem Oberkörper sehen.
»Bist du dir sicher, dass du eine Pause von alldem hier willst?« Ich zwang mich zu einem Lachen, das durch den Wollstoff gedämpft wurde. Ich befreite mich gerade rechtzeitig, um noch zu sehen, wie er die Augen verdrehte und sich abwandte.
»Du hast also gepackt.« Ich hörte ein unmissverständliches Zittern in Toms Stimme. »Wann gehst du?« Er räusperte sich.
»Kannst du mir noch bis nächste Woche Zeit geben?«, fragte ich, stieg in die Wanne und drehte den Hahn für das heiße Wasser zu. »Dann haben wir noch ein paar Tage miteinander.«
Tom schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Queenie.« Er klappte den Klodeckel zu und setzte sich, das Gesicht von mir abgewandt, darauf. »Ich werde morgen wieder zu Mum und Dad zurückfahren.«
»Und wann reden wir?«, fragte ich mit ganz kläglicher Stimme.
»Ich weiß es nicht, Queenie«, sagte er und stützte den Kopf in die Hände.
Ich schlug mit der flachen Hand aufs Wasser. »Mein Gott, ich weiß nicht, warum du so sein musst!«
»Warum ich so sein muss?« sagte er mit brüchiger Stimme. »Die letzten Monate waren schrecklich. Ich versuche zum Beispiel immer noch, dir den Scheiß zu verzeihen, den du auf dem Geburtstag meiner Mum abgezogen hast. Aber Queenie, in dieser ganzen Beziehung hast du dich geweigert, mit mir zu reden.«
Es verschlug mir den Atem. Mir war nicht bewusst gewesen, dass er so empfand, und schon gar nicht hatte ich damit gerechnet, dass er es aussprach.
»Du sagst mir nie, was los ist«, fuhr er fort. »Nie! Du igelst dich immer ein, weinst und sperrst dich im Bad ein, während ich davor auf dem Boden sitze und dir versichere, dass ich da bin, falls du reden willst, aber nie kommt etwas. Du hast mich in dieser Beziehung so oft von dir weggestoßen.«
»Aber das sind meine Angelegenheiten!«
»Wir haben alle Angelegenheiten, Queenie!«, schrie Tom. »Und ich hab mir mit deinen echt Mühe gegeben.«
»Tom«, sagte ich leise. »Wie scheiße ich mich auch benommen habe, du hast mir doch immer verziehen.«
»Ja, hab ich.« Er blickte auf seine Füße. »Aber ich weiß nicht, ob ich das noch kann.«
An diesem Abend schliefen wir im selben Bett ein. Ich an Toms Rücken gekuschelt. Als ich im Morgengrauen aufwachte, war er fort. Neben mir auf dem Nachttisch stand ein Becher mit schon kalt gewordenem Tee. Das Q darauf starrte mich verächtlich an.
Kapitel 2
Anstatt beim Umzug zu helfen, beobachtete ich Leigh aus dem Büro und Eardley, einen Freund der Familie und kleinsten Möbelpacker der Welt, wie sie gefühlt hunderte Kartons und IKEA-Taschen voller Bücher, Zeugs und Klamotten in mein neues Zuhause schleppten.
Meine neue Unterkunft war nicht ideal. Für 750 Pfund im Monat war es das billigste Zimmer, das ich in Brixton hatte finden können, und zwar in einem Haus, an dem seit seiner Erbauung im viktorianischen Zeitalter offenbar nichts gemacht worden war. Als ich zur Besichtigung kam, bröckelte es von außen, Unkraut und Efeu wucherten fast bis zur Tür rein und füllten den ganzen Vorgarten aus. Ich wusste nicht, und weiß es bis heute nicht, ob da irgendwas Totes vor sich hin gammelt, aber definitiv stieg der fiese Geruch nach irgendwas Unbekanntem und Unsichtbarem von dort auf.
Als ich das Haus betrat, haute mich ein anderer Geruch um, und auch das war, wenig überraschend, kein guter. Die Küche scheint, obwohl braun, beige und in altmodischem Design, abgesehen von den feuchten Flecken absolut okay zu sein. Trotzdem sehe ich mich darin nicht kochen. Und ich sehe mich auch ganz sicher nicht auf den senfgelben Sofas im Wohnzimmer sitzen.
»Nur die hier noch«, meinte Eardley mit starkem Yorkshire-Akzent, der nicht zu seiner dunkelbraunen Haut und den Goldzähnen zu passen schien, während er mit Mums alter Frisierkommode vorbeirumpelte. Die angeschlagene, fleckige Antiquität war das unhandlichste Möbelstück, das ich je besessen habe. Es machte Umziehen zur Plage, aber trotzdem schleppte ich es überall mit hin. Früher habe ich meiner Mum stundenlang zugesehen, wie sie sich vor dem darauf angebrachten Spiegel zurechtmachte. Ich saß dann immer auf dem Bett hinter ihr und beobachtete, wie sie die Lockenwickler herausnahm und sich das Haar dann mit kleinen, zarten Händen aufsteckte. Um zu sehen, wie sie verschiedene Lotionen und Zaubermittel auftrug, von denen ich aufgrund meines Alters noch nichts verstand und eigentlich bis heute nichts verstehe, rückte ich noch näher.
Eardleys kahler Kopf glitzerte vor Schweiß, als er die Hände in die Hüften stemmte und sich erst zur einen, dann zur anderen Seite dehnte. Mit dem Ärmel seines blauen Overalls wischte er sich über die Stirn.
»Ich brauch nur mal ’ne Sekunde, weil mein Rücken sich anfühlt, als würde er gleich schlappmachen!« Eardley war immer so fröhlich, trotz der extremen Umstände und der Kurzfristigkeit, die ich ihm zumutete. Aber jedes Mal, wenn ich ihm zusah, wie er den Frisiertisch gegen alle Boden- und Wandflächen knallte, die er finden konnte, starb ein kleiner Teil von mir.
»Können wir bitte nur das bisschen hier noch fertig machen?«, meinte Leigh und fuhr sich mit den Händen durch sein blond gefärbtes Haar. Er schaute in den Himmel und reckte den Hals, um etwas von der leichten Brise abzukriegen. Seine grünen Augen funkelten im Sonnenlicht. »Meine Haut hat den perfekten Ton für meine Foundation, und wenn ich länger in der Sonne bleibe, werde ich dunkler. Dann passt es nicht mehr, Eardley.«
»Okay, dann packen wir’s noch mal«, sagte Eardley und streckte seinen drahtigen Körper. »Mein Rücken wird das schon aushalten.«
Ich überließ es Eardley und Leigh, sich darum zu kümmern, die Sachen ins Haus zu tragen, und ging selbst nach oben ins Schlafzimmer. Das war dunkler, trüber und kleiner, als ich es in Erinnerung gehabt hatte. In allen vier Ecken lauerten Schimmelflecken, das Fenster zum Garten war klein und dreckig, der Teppich billig und beige, wie so ungefähr der Rest des Hauses, und die gelben Wände hatten Flecken und Risse.
Drei Sekunden später kam Leigh rein, während ich gerade eine der vielen feuchten Stellen inspizierte. Waren die seit meinem ersten Besuch hier gewachsen?
»Gehst du zu der Party morgen?«, fragte Leigh und hockte sich auf einen Stapel Kartons.
»O Gott, was für eine Party?« Inzwischen war ich auf einen Karton geklettert, um näher an den feuchten Fleck zu kommen. In letzter Zeit konnte ich mir überhaupt keine Termine merken.
»Die von James«, sagte Leigh. Ich starrte ihn fragend an. »Frans Boyfriend? Darcys Freundin Fran aus der Schule? Die uns letzte Woche eingeladen hat?«
»Ach, ich hasse diese Partys.«
Als Darcy anfing, mich zu diesen Partys einzuladen, dachte ich, das wäre so eine Art soziales Experiment mit versteckter Kamera, nach dem Motto ›wirf eine schwarze Person mit ein paar verwöhnten weißen Leuten zusammen und schau, was passiert‹. Aber letztlich kann man diese Treffen eigentlich reduzieren auf ›die rich kids und ich‹.
»Keiner geht zu Partys, weil er sie mag«, sagte Leigh. Wir gehen entweder hin, weil wir allen anderen zeigen wollen, dass wir besser sind als sie, oder um uns abzulenken.«
»Und was ist es bei dir?«
»Ersteres. Aber bei dir, mein Herzchen, ist es Letzteres. Du musst aufhören, über Tom und diese Trennung – sorry, ›Pause‹, oder wie auch immer ihr es nennt – nachzudenken.«
»Na gut«, sagte ich und fing sofort an, in den Taschen zu wühlen, um etwas zum Anziehen zu finden. »Du wirst aber da sein, ja?« Meine Bedürftigkeit fand ich selbst erbärmlich. Dabei war ich erst einen Tag von Tom weg.
»Ich schau mal, ob ich nach Dons Gig vorbeischauen kann. Aber ich will nichts versprechen, denn wahrscheinlich bin ich total zu«, sagte Leigh, stand auf und zwinkerte seinem Spiegelbild im schmutzigen Fenster zu.
Ich war so überrascht, wie jeder es wohl wäre, dass ich in ein Haus mit irgendwelchen Fremden aus dem Internet gezogen war. Die Aussicht darauf erfüllte mich mit Schrecken, Furcht und einer gesunden Portion Ekel, aber bei einem Jahresgehalt von 21000 bekam ich eben nichts Größeres als die Garage von irgendwem.
Die Mitbewohner selbst kamen mir nicht so schlimm vor, aber sehr nervös machte mich die Vorstellung, mit weißen Leuten zusammenzuwohnen. Einfach, weil ich weiß, dass meine Maßstäbe ererbter karibischer Sauberkeit an eine klinische Zwangsneurose grenzen.
Ich wuchs damit auf, dass meine Grandma Flaschen, Tetrapacks, einfach alles abwusch, bevor es in unseren Kühlschrank durfte, und sie hängte dich mit den Ohren an die Wäscheleine, wenn du mit Schuhen durch ihr Haus liefst.
Das Zusammenleben mit Tom zählte nicht, weil ich ihn erzogen habe und wir ein paar Proberunden im Ferienhaus seiner Familie in der Türkei absolvierten, was uns fast, aber nicht ganz, auseinandergebracht hätte.
Mein neues Zuhause war mir von meinen damals noch zukünftigen Mitbewohnern gezeigt worden: Rupert, 29, ein bisschen kleiner als ich, was ihn sichtlich ärgerte, vermied Blickkontakt: Im Grunde genommen nicht viel mehr als ein posher Typ mit Bart und diesen Segelschuhen und ohne Socken. Obwohl wir schon Ende September hatten.
Das Mädchen oder die Frau, Nell, ist 35, arbeitet in einem Deli und trägt ihre kurzen blonden Haare als hohe Zöpfchen. Sie ist die Nettere der beiden und hat schon gestanden, ein Alkoholproblem zu haben. Das demonstrierte sie gleich, als sie mir mit einem Riesenglas Weißwein in der Hand um 11:30 Uhr vormittags die Tür aufmachte.
So schlimm das alles klingt, es war noch die beste von einigen sehr, sehr schlimmen Wohnmöglichkeiten. Wie leben sieben Leute zusammen, die sich nur zwei Bäder teilen, lautete meine erste Frage, als ich Zimmer Nummer eins in Stockwell sah. Und zwar im obersten Stock eines schmalen dreistöckigen Hauses. Alle Etagen waren das reine Chaos, was sich wahrscheinlich nicht vermeiden lässt, wenn sieben Leute sich in ein Haus mit fünf Schlafzimmern quetschen, das mehr schlecht als recht dafür umgebaut wurde. In mindestens einem davon teilte ein Bettlaken den großen Raum in zwei.
Ich musste beim Reinkommen über mindestens zehn Fahrräder steigen, und die Küche war so vollgeräumt, dass ich geschworen hätte, wer immer dort wohnt, spielt Geschirr-Jenga.
Das Zimmer, ein Schnäppchen für 800 Pfund monatlich, war absolut winzig. Ich hätte da kaum mein Bett reingekriegt, ganz zu schweigen von den Büchern, die ich nie im Leben irgendwo zurücklassen würde. Als der winzige Möchtegern-Withnail im dreckigen Trenchcoat und mit Flipflops, der mir das Zimmer gezeigt hatte, mich rausbrachte und erzählte, er würde sich melden, da wussten wir beide, dass das nicht passieren würde.
Das zweite Angebot, das ich mir ansah, war eine Einzimmerwohnung in Camberwell. Völlig außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten, aber ich hatte ein YouTube-Tutorial zum Thema Feilschen gesehen, das ich hier in die Praxis umsetzen wollte. Ich musste CityMapper benutzen, um überhaupt hinzufinden, und wurde von der App auf eine besonders reizvolle Strecke durch die Stadt geschickt.
Die Gegend sah sehr grau aus, aber wie ich befürchtet hatte, war ich in die Irre geführt worden. Also kürzte ich durch den nicht so besonders grünen Park Camberwell-Green mit dem kleinen Spielplatz in der Mitte ab.
Ich war spät dran, deshalb schwitzte ich aus jeder Pore, als ich in die Straße einbog, wo die Wohnung sich befand, und an einer Flotte Nigerianer vorbei kam, die plaudernd in schicken Autos saßen. Ich ging zur Nummer 23 und starrte dabei so oft auf die Karte in meinem Handy, dass ich wahrscheinlich aussah wie ein Wackeldackel.
»Hallo, hübsches Mädchen, bist du meine Fünf-Uhr-Verabredung?«, fragte ein Mann mit starkem polnischem Akzent, während er aus dem Auto stieg, das er gerade schwungvoll neben mir geparkt hatte. Er brachte den Gestank von abgestandenem Zigarettenrauch mit. Sein Anzug war billig und sein Haar schon etwas dünn.
»Queenie. Sorry, ja, hab mich verlaufen.« Ich schlüpfte aus meiner Jacke und zog sie durch den Gurt meines Rucksacks.
»Okay, keine Sorge, in fünf Minuten kommt der Nächste, also schnell, schnell!« Er lächelte auf eine Art, die vermuten ließ, dass er dachte, ich fände sie charmant.
Warum machen die das? Dieses Organisieren von vierzig Besichtigungen auf einmal, damit alle Panik kriegen und mit Geld für diese überteuerten und untergepflegten Schachteln um sich werfen, die jemand als Wohnung verkleidet hat?
Als wir drin waren, musste ich mich total verdrehen, damit wir auf dem zehn Quadratzentimeter großen Flur nicht zu einer Person verschmolzen. Ich stand in der Wohnung und versuchte auszurechnen, wie irgendwas von meinen Möbeln auf so engem Raum Platz finden sollte. Der Makler haute mich aus den Schuhen und Socken, als er mir die Höhe der Monatsmiete verriet.
»Eintausendzweihundert?«, quiekte ich und schlug mir in einer Geste, die eigentlich gespielten Schocks vorbehalten ist, die Hand vor den Mund. Das hier war ein echter Schock.
»Also, weißt du, das sind die Lebenshaltungskosten in London, hübsches Mädchen.«
»Mein Name ist Queenie«, erinnerte ich ihn. »Die Lebenshaltungskosten in London? Hier gibt es noch nicht mal eine Waschmaschine.«
»Waschsalon in der Nähe, kein Problem. Du packst alles in eine Tasche, bringst es die Straße runter, fünf Pfund, easy.«
»Es gibt keinen richtigen Herd.«
»Da ist Platz für eine Mikrowelle, ja? Und schau, eine Herdplatte.« Er öffnete einen der drei Schränke, um mir zwei Kochplatten mit Stecker zu zeigen. Das Gerät sah mich so an, als wüsste es schon, dass es nie genügen würde.
»Aber das ist nur ein Zimmer! Die Küche ist das Schlafzimmer! Da könnte ich mir meine Bolognese vom Bett aus kochen!«