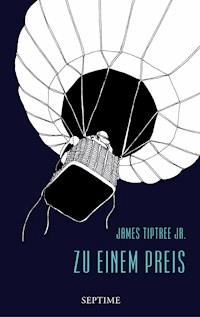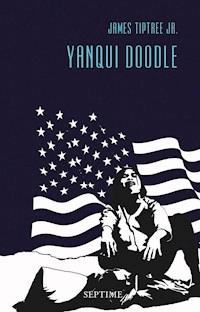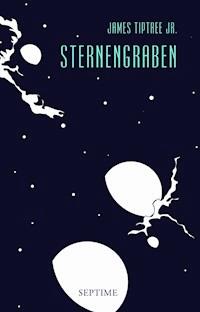15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sämtliche Erzählungen
- Sprache: Deutsch
Die drei hier erstmals in einem Band versammelten und neu übersetzten phantastischen Erzählungen teilen sich die gleiche Hauptfigur und die mystisch-fremdartige Beschaffenheit dieser Welt des Quintana Roo. "Die Küste zu unserer Rechten gehört zum Bundesstaat Quintana Roo. Falls Sie Yucatán noch nie gesehen haben, stellen Sie sich den weltgrößten durchweg flachen grün-grauen Teppich vor. Ein leer wirkender Landstrich. Wir passieren die weiße Ruine von Tulum und den klaffenden Schnitt der Straße nach Chichén Itzá, ein halbes Dutzend Kokosnussplantagen und dann bis ganz zum Horizont nur noch Riffe und niedriges Dschungelgestrüpp, ganz so, wie es vor vierhundert Jahren die Konquistadoren gesehen haben."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autorin
Titelseite
Buchanfang
Kurze Vorbemerkung zu den Maya des Quintana Roo
Was die See bei Lirios anspülte
Der Junge, der auf Wasserskiern in die Ewigkeit fuhr
Hinter dem toten Riff
Die einzelnen Erzählungen
Die Werkausgabe
Leseproben
Band 1: DOKTOR AIN
Band 2: LIEBE IST DER PLAN
Band 3: HOUSTON, HOUSTON!
Band 4: ZU EINEM PREIS
Band 6: STERNENGRABEN
Band 7: YANQUI DOODLE
Die Mauern der Welt hoch
Helligkeit fällt vom Himmel
James Tiptree Jr. – Quintana Roo
Sämtliche Erzählungen , Band 5
Copyright © 2011, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Originaltitel: James Tiptree Jr. – Tales of the Quintana Roo
Copyright © 1986 by James Tiptree Jr.
Lektorat: Anja Kootz
Umschlag: Jürgen Schütz
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-903061-31-6
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
Mit einem Nachwort von Anne Koenen
ISBN: 978-3-902711-04-5
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.twitter.com/septimeverlag
Über die Autorin
James Tiptree Jr.
(1915-1987) ist das männliche Pseudonym von Alice B. Sheldon. Tiptrees geheimnisvolle Identität faszinierte die Fans und gab Anlass zu vielen Spekulationen, freilich glaubten alle, es müsse sich um einen Mann handeln. Die Aufdeckung, noch zu ihren Lebzeiten, war ein Schlag: Diese knappen, harten und frechen Kurzgeschichten, die nur allzu häufig mit dem Tod enden, waren von einer alten Dame mit weißen Federlöckchen verfasst worden.
Sie zählt unter Science-Fiction-Fans zu den großen Klassikern, gleich neben Philip K. Dick und Ursula K. Le Guin. Ihre Kurzgeschichten, die sie erst im Alter von einundfünfzig Jahren zu schreiben begann, und von denen einige wohl zu den besten des späten 20. Jahrhunderts gehören, brachten ihr schnell Ruhm und zahlreiche Auszeichnungen ein.
Dennoch litt sie ständig unter schweren Depressionen und Todessehnsucht. Nach einem vorab geschlossenen Selbstmordpakt erschießt Sheldon im Alter von einundsiebzig Jahren erst ihren vierundachtzigjährigen Mann und dann sich selbst.
James Tiptree Jr.
Quintana Roo
Sämtliche Erzählungen
Band 5
Aus dem Amerikanischen von Frank Böhmert
Für Carlos Antonio González
Gestorben mit 42 Jahren bei einem Flugzeugabsturz am 17. Oktober 1984, zuletzt Gouverneur von Cozumel; Freund, Gastgeber und Lehrer, Angler und Naturforscher. Sein Tod macht Quintana Roo und alle, die ihn kannten, ärmer.
Kurze Vorbemerkung
zu den Maya des Quintana Roo
Das Quintana Roo – ausgesprochen kin tana ro – ist ein wirklich existierender und sehr fremdartiger Landstrich. Die lange, wilde Ostküste der Halbinsel Yucatán gehört zwar offiziell zu Mexiko, aber nicht von der Psyche her. Ein Tagebuch des Alltagslebens an seinen Dschungelstränden könnte stellenweise als Beschreibung des Lebens auf einem fremden Planeten durchgehen.
Die Zahl der heute lebenden Maya geht in die Millionen, von Mexiko über Honduras und Guatemala bis weiter nach Süden, und die Unterschiede zwischen den Stämmen und Stammesdialekten werden oft ernster genommen als Landesgrenzen. Die Maya muten von allen amerikanischen Indianern am östlichsten an, aber ohne jede orientalische Püppchenhaftigkeit. Zu ihren schräggestellten Augen kommen eine nach hinten geneigte Stirn und ein starker Knochenbau – und eine große Hakennase. Die Nase und die Stirn gelten, weil sie an Schlangen erinnern, als Schönheitsmerkmale, und früher haben die Mütter ihren Kindern ein Brett vor den Kopf gebunden, um diese Schrägstellung zu erzielen. Ein weiteres Schönheitsmerkmal der Maya ist das Schielen; sie sehen alle, vor allem die Kinder, so über Kreuz wie Siamkatzen – weil Mütter ihren Babys ein Wachskügelchen vor die Nase zu hängen pflegten, um ihren Blick darauf zu fixieren. Hinzu kommt – wobei ich das nicht persönlich bestätigen kann; Maya sind sittsam – das blaue Muttermal, das die Frauen angeblich genau am Ende der Wirbelsäule haben.
Wenn man, gepackt von der Mayaphilie, erst einmal anfängt zu reden, kann man kaum wieder damit aufhören, aber vielleicht gestattet mir die Leserschaft eine letzte allgemeine Feststellung: Die Maya sind nie »unterworfen« worden und sich dessen oftmals sehr bewusst. Sie unterscheiden sich ebenso sehr von den stammesgemischten, häufig versklavten Indianern des mexikanischen Festlands wie ein waschechter Hochlandschotte von einem verklemmt-höflichen, standesbewussten Londoner. Nichts von dieser Heuchelei à la »Sí, sí, Señor«. Sie sehen einem von Kindesbeinen an fest ins Auge und wollen wissen, was man bei ihnen verloren hat. An der Küste des Quintana Roo gibt es noch heute (also 1984) Dörfer, die ihr verbrieftes Recht ausüben, sich nicht zu integrieren und nicht zu modernisieren. Man besucht sie nur auf Einladung. Der ehemalige Gouverneur war ein Freund von mir, und wenn er solchen Dörfern seinen feierlichen Besuch abstattete, machte er sich allein auf den Weg und ging die letzten zwanzig Kilometer zu Fuß, auf sacbé-Straßen. (Das sacbé-Netz ist das Straßensystem der alten Maya und besteht heutzutage aus überwachsenen Aufschüttungen, die kreuz und quer durch den Dschungel verlaufen, und manchmal weiß niemand, wohin.)
Ein Besucher, der Yucatán verstehen möchte und warum gewisse Dinge eher als »yucatekisch« denn als »mexikanisch« bezeichnet werden, sollte wissen, dass sich die Maya vor gar nicht allzu langer Zeit erhoben und für ihre Unabhängigkeit gekämpft haben, zuvörderst gegen Mexiko. Und die USA – also wir – haben Truppen geschickt, um Mexiko zu helfen. Darum war es bis vor kurzem sehr wichtig, und in manchen Gegenden ist es das vielleicht heute noch, dass ein schiffbrüchiger Seemann oder ein verirrter Wanderer, der sich plötzlich von kleinen mahagonifarbenen Männern mit schräggestellten Augen und meterlangen Macheten umzingelt sah, betonte, kein yanqui zu sein, sondern vorzugsweise ein Brite. (Die Briten hatten auf der Seite der Maya gestanden.)
Die Kämpfe endeten 1935, und zwar nicht mit einer Niederlage, sondern mit einem ausgehandelten Friedensvertrag. (Wie kurz das erst her ist, wurde mir wieder deutlich, als ich begriff, dass der Generalsekretär der Mayatruppen in demselben Jahr gestorben ist, als ich das erste Mal dorthin fuhr.) Daraufhin hatte Mexiko die Halbinsel prompt in drei Teile geteilt: die Provinzen Yucatán und Campeche und das Bundesterritorium Quintana Roo. (Ein Territorium ist ungefähr das, was unser Alaska einmal gewesen ist; Mexiko besitzt noch ein zweites drüben in Baja California.) Das Quintana Roo wurde vor zehn Jahren zu einer Provinz, aus Verwaltungsgründen. Es ist nach dem Helden des Unabhängigkeitskampfes benannt, Andrés Quintana Roo, dessen edler Kopf heute in Bronze gegossen über den zócalo von Cozumel wacht. Hätten die Maya nicht ganz so viel Wert auf die Klärung uralter Fehden gelegt wie vor ihnen die Schotten und die nordamerikanischen Indianer, sondern auf die Fähigkeit, sich gegen den gemeinsamen Feind zu vereinen, würden die Landkarten der Region von Campeche südwärts heute vielleicht ziemlich anders aussehen.
Die gegenwärtige Einzigartigkeit des Quintana Roo wird, das ist ebenso gewiss wie bedauerlich, in der anbrandenden Flut des westlichen, des gringo-Lebensstils untergehen. Aber hier und da findet sich ein Interesse für die Jahrtausende alte Mayakultur. Und unter der Oberfläche fließen Gezeiten und uralte Strömungen von großer Kraft. Der Großteil des Stoffes der hier versammelten Geschichten ist Fakt. Und was den fiktiven Anteil betrifft, wer könnte seine Hand dafür ins Feuer legen, dass ihn mir nicht die viertausend Jahre alten Stimmen zugetragen haben, die in den Nächten des Quintana Roo flüstern und murmeln?
James Tiptree Jr.
Polaroids, die niemand will,
liegen an denselben Stellen
wie einst der Spanier tote Sklaven.
Und ab und zu wird sich still
den Gräbern aus fünfhundert Jahren
ein Tourist hinzugesellen.
Drum meide lieber, so du kannst,
was lächelt aus den blanken Wellen.
Was die See bei Lirios anspülte
Der alte Vorarbeiter der Kokosranch sah ihn als erster.
Es war ein Tag des brüllenden, sengenden Südwinds. Der Strand rauchte unter den peitschenden Kokospalmen, und die Karibische See raste vorbei wie eine Million weiße Teufel, die nach Kuba vierhundert Meilen weiter im Norden wollten. Als ich nach unten ging, weil ich sehen wollte, was Don Pa’o Camool da anstarrte, konnte ich gegen den wütenden Flugsand kaum die Augen offen halten.
Der Strand war leer bis zum dunstigen Horizont: blendendes Korallenweiß, das nur mit undeutlichen Hieroglyphen aus Teer und Tang gefleckt war.
»¿Qué?«, bellte ich über das Windgeheul.
»Caminante.«
Fasziniert sah ich genauer hin. Von den caminantes hatte ich schon gehört, den Wandersleuten der alten Zeit, die ihr Leben lang nichts anderes taten, als diese lange, wilde Küste rauf- und runterzutreiben. Eine der dunklen Spuren bewegte sich. Vielleicht.
»¿Maya caminante?«
Der Alte – er war zehn Jahre jünger als ich – spuckte kräftig auf eine Geisterkrabbe, die der Wind vorbeischob. »Gringo.« Er warf mir einen scharfen Seitenblick zu, wie immer, wenn er dieses Wort benutzte.
Dann verzog er das Gesicht zu einer seiner wilderen Mayagrimassen, was ebenso viel- wie nichtssagend war, und stapfte unter den Schlägen seiner großen, altmodischen machete wieder das Kliff rauf, zurück zu seinem Mittagessen.
Meine Augen waren mit Salz und Sand verkrustet. Auch ich zog mich auf meine windzerfressene Veranda zurück, um zu warten.
Was schließlich an der Flutlinie in Sicht geschlurft kam, war ein schwarzes Gerippe, ein Strichmännchen mit wehenden Wuschelhaaren um den Kopf herum. Als der Mann bei der Kompasspalme stehen blieb und sich umwandte, um zur rancho hochzuschauen, rechnete ich halb damit, dass die See durch seine Rippen glitzerte.
Die rancho war eine auseinandergezogene Reihe aus fünf kleinen Pfosten-und-Strohdach-Hütten, drei rauchenden Kopra-Trockengestellen und einem Brunnen mit einer Eimerwinde. Ganz am Ende hatte der Besitzer eine casita zum Vermieten stehen, ein Häuschen mit zwei Räumen, auf dessen Veranda ich saß.
Die Erscheinung hielt schnurstracks auf mich zu.
Aus der Nähe sah ich, dass es tatsächlich ein gringo war: Die Haare und der Bart, die sein von der Sonne geschwärztes Gesicht peitschten, waren unter ihrer Kruste rosagrau. Sein ausgezehrter Körper war schwarzverkohlt, mit einigen weißen Narbenlinien auf den Beinen, und bis auf ein Paar ausgefranste Shorts und seine schweren Ledersandalen war er nackt. Über den Schultern hatte er ein kümmerliches Deckenbündel und eine Feldflasche hängen. Er konnte ebenso gut sechzig wie dreißig sein.
»Kann ich etwas Wasser bekommen, bitte?«
Das Englisch kam ein bisschen eingerostet heraus, aber das Erschreckende war die Stimme – eine klare, junge Stimme direkt aus einer Vorstadt des Mittleren Westens.
»Aber ja.«
Die Sonne glitzerte auf einem Haimesser an seinem Gürtel und offenbarte den guten Schliff der Schneide. Ich zeigte zu einer Schattenstelle auf dem Steinweg bei der Veranda, wo ich den Fremden im Auge behalten konnte, und sah zu, wie er dort zusammensank, dann ging ich hinein. Selbst hier sind solche unpassend jungen Stimmen wie die seine nichts Neues; mit ihnen spricht das menschliche Treibgut, das die tropischen Breitengrade in der Hoffnung runtergondelt, morgen oder vielleicht nächstes Jahr den Kopf wieder in Ordnung zu kriegen. Manche dieser Gestalten sind herzzerreißend, ein paar auch gefährlich, solange sie durchhalten. Ich wusste, dass von der rancho aus schräggestellte Augen zusahen – aber das Haus war nicht einsehbar, und nur ein Dummkopf hätte sich darauf verlassen, dass ein Maya den einen alten gringo vor dem anderen schützte.
Aber als ich rauskam, saß er immer noch da, wo ich ihn zurückgelassen hatte, und sah auf den grellen Mühlgraben der See hinaus.
»Danke … vielmals.«
Er nahm einen langsamen, zittrigen Schluck, dann noch zwei und setzte sich aufrechter hin. Dann, bevor er noch mehr trank, schraubte er seine Feldflasche auf, spülte sie aus und füllte sie sorgfältig aus meinem Krug. Das Spülwasser goss er auf meinen kümmerlichen Kasuarina-Sämling. Ich sah, dass die Flasche unter ihrem kühlenden Lappen eine robuste, eloxierte Sealite war. Das Messer war ein erstklassiges, altes Puma. Auch waren seine abgetragenen Sandalen geflickt; und dass er sie trug, deutete zugleich auf Status und auf Vernunft hin. Als er das Glas erneut hob, leuchteten die Augen, die mich aus seinem sonnenverbrannten Gesicht anstarrten, in einem ruhigen, klaren, hellen Haselnusston.
Ich nahm meine Tasse kalten Tee und machte es mir gemütlich.
»Buut ka’an«, sagte der junge Mann, inklusive Maya-Knacklaut. »Der Stopfer.« Er ruckte mit seinem wilden Bart zu dem glosenden Sturm um uns herum und erklärte zwischen langsamen Schlucken: »So nennt man ihn … weil er bläst, bis er den Norden vollgestopft hat, verstehen Sie … und dann kommt es alles als Nordoster zurückgerauscht.«
Von der hiesigen Müllhalde wehte ein Fetzen meines Schreibmaschinenpapiers herüber. Der Fremde klatschte eine Sandale darauf, glättete es und steckte es zusammengefaltet zu seinen Sachen. Dabei bäumte sich plötzlich eine Palmwurzel in der Nähe auf und wurde zu einem großen Leguan. Das Wesen starrte uns über seinen Kehllappen hinweg mit der gespreizten Wachsamkeit an, die es aus dem Jura hierhergebracht hatte, ruckte zweimal anlaufmäßig und flitzte hektisch watschelnd davon, mit hocherhobenem Schwanz.
Wir grinsten beide.
»Noch mehr Wasser?«
»Gern. Sie haben gutes Wasser hier.« Er konstatierte es wie eine bekannte Tatsache, was auch zutraf.
»Wo hatten Sie Ihre Flasche gefüllt?«
»In Pájaros. Punta Pájaros. Weilchen her!«
Ich machte den Krug reichlich erschüttert noch mal voll. Alles Grundwasser kommt aus einer Lagunenmündung einen Kilometer weiter südlich. Selbst wenn man bedachte, dass er nach Norden unterwegs war, mit dem Wind – hatte dieser Mann oder Junge wirklich mit nur einer Flaschenfüllung die dreißig Meilen sengender, knochentrockener Sandbank zwischen hier und dem Leuchtturm bei Pájaros hinter sich gebracht? Zumal es in Pájaros gar kein Wasser gab; die Fischer, die dort ab und zu kampieren, nehmen immer ein Ölfass voll mit und halten sich ansonsten angeblich mit Bier und Tequila am Leben, und noch mit anderen Flüssigkeiten, die allgemein nicht als trinkbar erachtet werden. Kein Wunder, dass er die Flasche ausgespült hatte, dachte ich und ging mein Päckchen Mineralstofftabletten suchen. Man kann an dieser windigen Küste auch ohne den tosenden »Stopfer« unmerklich austrocknen, bis hin zur Herzinsuffizienz.
Aber er lehnte fast beiläufig ab und starrte weiter auf das Meer hinaus.
»Da sind doch alle Elektrolyte, die man braucht. Wenn man vorsichtig ist. Unser Blut ist eigentlich abgewandeltes Meerwasser … stimmt doch, oder?«
Es kam wieder Leben in ihn, und er sah mich direkt an, prüfend beinahe. Sein Blick wanderte zu der Zimmerecke hinter uns weiter, wo meine Bücherregale aus Treibholz durch die Glasschiebetüren, die sich schon lange nicht mehr schieben ließen, kaum zu sehen waren. Er nickte. »Ich habe gehört, dass Sie jede Menge Bücher haben. Muy pesados – schwere Bücher. Libros sicológicos. Stimmt das?«
»Ähm.«
Dieser Zufallsbesuch nahm einen unangenehmen Zug an. Wobei es mich nicht befremdete, dass dieser Mann etwas über mich wusste – der Klatsch strömte diese Küste seit dreitausend Jahren munter rauf und runter. Allerdings hatte ich jetzt den Eindruck, dass ihn eigentlich diese »schweren psychologischen Bücher« hierhergezogen hatten, und das machte mich nervös. Wie viele Experimentalpsychologen hatte ich oft schreckliche Schwierigkeiten, irgendwelchen besorgten Fremden zu erklären, dass sich ein umfassendes Wissen über das kognitive Verhalten von Ratten eben nicht klinisch anwenden ließ.
Aber seine Antennen waren bestens in Schuss. Er wickelte bereits seine Feldflasche ein und hängte sich sein Bündel wieder um.
»Hören Sie, ich wollte Sie nicht stören. Die Brise lässt nach. Nachher wird es schön. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich einfach zu dem angetriebenen Baumstamm da runter und ruhe mich ein bisschen aus, bevor ich weiterziehe. Danke für das Wasser.«
Die »Brise« heulte mit dreißig Knoten, und der große Mahagonistamm unten am Strand war im Flugsand kaum zu sehen. Wenn das ein Trick war, dann ein lachhafter.
»Nein. Sie haben mich bei nichts gestört. Wenn Sie noch abwarten wollen, dann bleiben Sie ruhig hier im Schatten.«
»Ich hab schon mal bei dem Stamm gepennt.« Er grinste mich aus seiner knochigen Höhe an. Sein Tonfall war nicht aufgesetzt, sondern einfach ruhig und entschieden, und seine Zähne waren sehr weiß und geputzt.
»Dann nehmen Sie wenigstens noch ein paar Grapefruits mit; ich habe mehr, als ich essen kann.«
»Oh, ja, gut …«
Im Rückblick lässt sich kaum sagen, an welcher Stelle und warum es mir anscheinend wichtig wurde, dass er nicht ging, sondern blieb. Auf jeden Fall hatte sich mein Eindruck von ihm ungefähr an diesem Punkt radikal geändert. Ich betrachtete ihn jetzt als kompetent, was diesen Landstrich und sein merkwürdiges Leben betraf, wie auch immer es aussehen mochte; zweifelsohne war er mir an Kompetenz voraus. Kein Treibgut. Und er brauchte auch nicht irgendwelche normale Hilfe. Aber im weiteren Verlauf des Abends gewann ich durch irgendetwas – vielleicht durch eine Projektion meinerseits, vielleicht durch das unablässige Heulen des Windes – vielleicht auch nur durch die seltsame Art, wie sich das Meereslicht in seinen blassen Augen spiegelte – den Eindruck, dass er, nun ja, gezeichnet war. Nicht etwa »vor die Hunde gegangen« – was hierzulande nichts Ungewöhnliches ist, vor allem wenn man sich weigert, den richtigen Beamten seinen Obolus zu entrichten. Auch nicht »traumatisiert« durch irgendeine schlimme Erfahrung. Oder verfolgt von Feindesaugen. Ich hatte bloß das beunruhigende Gefühl, dass mein Gast gerade in einer besonderen Beziehung zu einer dunklen und mächtigen Kraft stand, der gegenüber er extrem verwundbar war – ich wusste nicht, was für eine, nur dass sie dort draußen auf ihn wartete, irgendwo im einsamen Sand.
Aber was er sagte, hätte zunächst kaum weniger bedrohlich klingen können. Er verstaute die schrumpeligen Grapefruits und erzählte mir, dass er diese Küste jedes Jahr hinuntergewandert kam. »Manchmal komme ich runter bis Belice, bevor ich wieder umdrehen muss. Sie waren nicht hier, als ich auf dem Weg nach Süden vorbeigekommen bin.«
»Dann sind Sie jetzt also auf dem Heimweg. Haben Sie es bis Belice geschafft?«
»Nein. Dafür ging das Geschäft zu lange.« Er ruckte mit dem Bart in die ungefähre Richtung der Staaten.
»Dürfte ich fragen, was für ein Geschäft das ist?«
Er grinste; ein verschmitztes, schwarzes Gerippe. »Ich entwerfe Swimmingpools in Des Moines. Den Bau übernimmt größtenteils mein Partner, aber für die Spezialanfertigungen braucht er meine Entwürfe. Wir haben auf dem College damit angefangen, vor fünf Jahren. Es ist richtig gut angelaufen; wir haben dermaßen Geld gemacht, dass ich abhauen musste. So bin ich hier gelandet.«
Das musste ich erst mal sacken lassen. Ich goss mir noch ein bisschen abgestandenen Tee ein. Würde mein Papierfetzen als Skizze für die repräsentative Veranda irgendeines braven Bürgers in Iowa enden?
»Sind Sie je einem der alten caminantes über den Weg gelaufen?«
»Davon gibt es nur noch ein paar, alte Männer inzwischen. Versteckter Stern Smith – Estrella Escondida Camal. Camol, Camool, das ist das hiesige Smith, müssen Sie wissen. Er bleibt inzwischen eigentlich immer in der Nähe von Pájaros. Und Zeig-nicht-auf-Regenbogen.«
»Äh, wie bitte?«
»Auch noch ein caminante; ich weiß nicht, wie er heißt. Wir haben zugesehen, wie zum Sonnenuntergang dieser Sturm vorbeizog, ja? Ist Ihnen vielleicht aufgefallen – die können diesen fantastischen doppelt und dreifachen arco iris werfen. Regenbogen. Der erste, den ich je gesehen habe. Ich hab darauf gezeigt, und da wurde er ganz aufgeregt und hat meinen Arm runtergerissen. ›¡No puncto!‹ – nicht zeigen, verstehen Sie!« Er rieb sich nachdenklich den Ellenbogen. »Er spricht nicht viel Spanisch, aber er hat mir klar gemacht, dass irgendetwas Böses aus dem Regenbogen springen und meinen Arm hinunter direkt in mein Ohr flitzen würde. Und jetzt sage ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ›No puncto‹, und wir lachen uns eins.«
Mein Besucher schien es zu genießen, sich mit jemandem zu unterhalten, der im Gegensatz zu seinen Kunden in Des Moines ein bisschen über diese Küste Bescheid wusste. Aber sein Blick schweifte immer wieder zu der sturmgepeitschten See, und er hatte sein Deckenbündel nicht wieder abgenommen.
»Wie kommen Sie denn über diese beiden Riesenbuchten zwischen hier und Belice? Die können Sie doch unmöglich umwandern? Oder hat man da inzwischen auch gerodet?«
»Bis jetzt nicht. Kein bisschen. Was nicht unter Wasser liegt, ist laut Friedensvertrag Stammesland. Ich hab eine Luftaufnahme mit drei namenlosen Dörfern darauf gesehen. Aber ich weiß, wo ein paar sacbé rauskommen – Sie wissen schon, die alten Mayastraßen. Das sind jetzt kaum mehr als Dämme mit Kalkbelag. Einmal traf ich auf einer diesen Mann, der trug keine Hosen. Wwwt!, war er verschwunden … ich hätte gern mehr davon erkundet, aber –«
Sein Blick schweifte erneut ab, er runzelte die Stirn über den Wind. »Ich hab es gehasst, so weit rein zu müssen … ins Landesinnere.«
»Und wie kommen Sie dann rüber?«
»Ach, ich sorge dafür, dass ich auf einem Fischerboot mitfahren kann, indem ich was repariere. Es ist nicht zu fassen, was dieses Klima mit Maschinen anstellt. Die halten sie mit Draht und Bier am Laufen. Ich hab ein paar Leute, die jedes Jahr nach mir Ausschau halten. Wenn ich bloß einen Satz Werkzeuge dort lassen könnte, aber –«
Was aus denen dann wurde, wussten wir beide.
»Manchmal nehmen sie mich die ganze Strecke mit, oder sie setzen mich bei Punta Rosa ab, und ich wandere runter und lass mich über Espíritu Santo mitnehmen.«
Ich fragte ihn nach dem ziemlich geheimnisvollen Küstenstreifen zwischen den beiden riesigen Buchten.
»Der Strand ist voller Felsen; man muss auf die Gezeiten achten. Aber oben auf dem Kliff ist ein alter Fahrweg für Jeeps. Fünf, nein, Moment – sechs Kokosplantagen. Und der Gurkenpalast, haben Sie von dem gehört?«
»Sie meinen, es gibt ihn wirklich?«
»Aber ja. Dieser stinkreiche politico aus Mexiko. Die Essiggurken waren nur ein Nebengeschäft. Ich schätze, er wollte sich ein Paradies schaffen. Ecktürme, Buntglasfenster, mindestens ein Dutzend Gästehäuser, alles komplett gefliest. Eine Start- und Landebahn. Und jedes einzelne verdammte Teil mit dem Leichter reingebracht, durch das Riff. Man erzählt, er sei ein paar Mal runtergekommen, aber seinen Geliebten hätte es nicht gefallen. Heutzutage ist natürlich alles überwuchert. Es gibt noch einen alten Hausmeister, der das Zeug ab und zu runterschneidet und beim Springbrunnen Mais anbaut. Der Punkt ist, das ganze Anwesen zeugt von exquisitem Geschmack. Also wirklich schön, meine ich. Art déco der Neunzehnhundertdreißiger, erste Klasse.«
Die beinahe zusammenhangslosen Worte dieses wilden, halbnackten Fremden – und überhaupt der Gurkenpalast –
ließen mein Gefühl für die Wirklichkeit zerbröckeln. Das kommt im Quintana Roo öfters vor.
»Und anscheinend hat nie jemand die Bude leergeräumt. Ich bin in den Küchentrakt rein, da stand die so ungefähr erste Mikrowelle der Welt. Lange bin ich aber nicht geblieben – im Wohnzimmer war ein lebender Tiger am Pennen.«
»Sie meinen doch bestimmt einen Jaguar?«
»Nein. Ein richtiger Tiger aus Indien, mit Streifen. Und riesengroß. Der Mann muss einen Zoo gehabt haben, wissen Sie – es gab dort auch Vögel, die nicht hierhergehören. Dieser Tiger lag auf einer weißen Samtcouch auf dem Rücken und schlief tief und fest, die Pranken über der Brust gekreuzt. Der schönste Anblick, den ich je gesehen habe …« Er blinzelte und fügte leise hinzu: »Fast.«
»Was ist passiert?«
»Er ist aufgewacht und wie ein Blitz über meinen Kopf hinweg zur Tür rausgeschossen.« Mein Gast grinste nach oben, als ob er das große Tier immer noch über sich hinwegfliegen sah. »Ich hab mich natürlich hingeworfen und bin wie ein Wahnsinniger in die andere Richtung gekrabbelt. Ich hab nie jemandem davon erzählt. Aber als ich ein paar Jahre später wieder dort vorbeikam, war sein Kopf oben auf der Mauer aufgespießt. Ein Jammer.«
»Das ist eine prächtige Geschichte.«
»Sie ist wahr.«
Sein Tonfall ließ mich rasch sagen: »Davon gehe ich aus. Darum ist sie ja gut; irgendwelche Lügengeschichten sind nichts wert … Hören Sie, dieser Wind wird so schnell nicht nachlassen. Vielleicht möchten Sie lieber reinkommen und sich waschen oder so, während ich uns etwas zu essen auftreibe. Ist Ihnen Tee recht, oder möchten Sie lieber eine Cola oder eine cerveza?«
»Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Tee ist prima.«
Als er mir nach drinnen folgte, erblickte er sein Spiegelbild in der sandigen Scheibe und gab ein Pfeifen von sich. Dann hörte ich ein Klirren: Er hatte rasch das Messer abgeschnallt und es unmittelbar hinter der Schwelle abgelegt.
»Sie sind wirklich buenas gente, wissen Sie das?«
Ich wies zu der alten, schwerkraftgespeisten Dusche. »Werden Sie nicht zu sauber, das zieht die chiquititas an.«
Er lachte – der erste unbekümmerte, junge Ton, den ich von ihm hörte – und fing an, seine Taschen auszuleeren; er hatte eindeutig vor, gleich so drunterzusteigen, mit Shorts und allem.
Ich stellte den Kessel auf meinen Gaskocher und fing an, Käse und Schinken auf eine Platte zu häufen. Als ich gerade aufgoss, kam er wieder raus, und ich hätte uns beinahe beide verbrüht.
Seine Haut war immer noch schwarz verbrannt und zeigte einige Narben mehr, die anscheinend von einem Korallenriff stammten. Die Grundfarbe der nassen Shorts war immer noch Khaki, aber sie wurden nun von Flicken mit einem kräftigen mexikanischen Blumenmuster belebt, und oben und unten ragten rosa Streifen von weniger verbrannter Haut hervor. Der Effekt wurde buchstäblich und im übertragenen Sinne von seinem feuchten, glatt anliegenden Haupt- und Barthaar gekrönt: Um seine Schmutzschicht erleichtert, schimmerte und leuchtete es so knallrot, wie ich es selten in echt gesehen hatte – oder auch in unecht.
Er schien sich seiner veränderten Erscheinung überhaupt nicht bewusst zu sein und sah sich aufmerksam die Küchenecke und meine Bücherwand an.
»Mögen Sie Geschichten?«, fragte er. »Für eine Kostprobe dieses echten Ahornsirups da oben liefere ich Ihnen eine richtig gute. Ich möchte Sie nämlich was dazu fragen.«
Ich war zu sehr damit beschäftigt, das Tablett und meine Wahrnehmung wieder in Ordnung zu bringen, um weiter meinen Argwohn zu pflegen, und antwortete schlicht: »Aber gern.«
Er sah selig zu, wie ich eine ordentliche Fuhre in einen Plastikbeutel gab und diesen in einem von der See ausgescheuerten Waschmittelbecher sicherte.
»Sie sehen sich auch am Strand nach Sachen um …«
»Mein supermercado«, sagte ich.
»Ja, genau.« Sein Ernst kehrte wieder zurück. »Alles, was man braucht … wird einem geschickt.«
Als wir es uns gemütlich gemacht hatten, sah ich, dass der »Stopfer« tatsächlich etwas nachließ. Die Kokospalmen fegten den Sand in einem Wind, der ein, zwei Dezibel leiser geworden war; und das Meer dahinter gewann ein bisschen von seinem wunderbaren karibischen Türkiston zurück, durchschossen vom grellen Limonengrün der Korallenuntiefen. Die weißen Lemminge der Bucht rasten immer noch nordwärts; aber nun war das entfernte Riff wieder zu sehen, eine große, wogende, brodelnde Schneeverwehung, umfunkelt von den Diamanten der Nachmittagssonne. Die Nacht versprach, schön zu werden.
»Die Geschichte fängt tatsächlich sogar hier draußen an, bei Ihrer Nordspitze.« Mein Gast zeigte mit seinem Stück Käse dorthin und nahm einen kleinen Bissen. »Der Abend war fantastisch – totenstill, Vollmond. Man konnte Farben sehen. Es war, als sähe man sich einen sonnigen Tag durch ein dunkles Tuch an, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Ich nickte; die Beschreibung war perfekt.
»Ich ging so vor mich hin und sah mir das Meer an, wie ich das immer tue. Wissen Sie, dass es einen alten Pass durch das Riff da draußen gibt? Man kann ihn jetzt nicht sehen.« Er spähte nach links und legte geistesabwesend den Käse hin. »Na ja, man kann ihn schon sehen, wenn man ihn kennt. Aber egal, da fiel mir jedenfalls diese Stange auf, die aufwärts zeigte. Ich meine, zuerst sah ich sie und dann nicht mehr, und dann tauchte sie wieder auf und schimmerte im Mondlicht. Ich dachte, irgendein Schwachkopf hätte versucht, dort die Fahrrinne zu markieren. Und dann sah ich, dass die Stange lose war und in der Strömung herumschaukelte. Sie wissen bestimmt, dass es hier eine Drei-Knoten-Strömung bis ganz nach Norden rauf gibt.«
»Ja. Aber nun essen Sie lieber, die Geschichte hat Zeit. Sonst läuft der Käse noch weg.«
Ich gab ihm etwas Schinken auf einer tortilla. Er bedankte sich, nahm einen großen Bissen und legte den Rest auf sein Knie; dabei starrte er immer noch auf das Riff, als wolle er jede Einzelheit wieder wachrufen.
»Ich ging langsamer, um mit ihr Schritt zu halten. Jede große Woge wusch sie dichter heran. Sie schien fast zu verschwinden, und dann kam sie wieder hoch, größer als vorher. Eine Zeitlang dachte ich, es könnte irgendeine große Leuchtstoffröhre sein – Sie wissen ja, wie die reinkommen, schaukelnd –, aber als sie dann auf der Innenseite des Riffs ankam, wurde mir klar, dass eine Lampe unmöglich so riesig sein konnte, und irgendwas war auch noch mit dem oberen Ende. Dann war sie aus dem Riff draußen und trieb reichlich schnell nach Norden rauf. Einfach nur diese große schaukelnde Stange im Meer, die mal länger und mal kürzer wurde – vielleicht zwei Meter hoch manchmal. Ich blieb neben ihr und konnte es verdammt noch mal nicht fassen. Inzwischen dachte ich mir, dass es vielleicht die Spiere einer Boje war, mit einer Kette daran, die sie aufrecht hielt.«
Er brach ab und sagte in einem anderen Tonfall: »Dieser Bursche mit der blauen Mütze. Ist das Ihr Boy?«
Ich kniff die Augen zusammen. Eine wohlvertraute, verbeulte, hellblaue Kapitänsmütze verschwand gerade hinter der Düne neben der rancho.
»Das ist Ek. Unser hiesiger niño.« Ich tippte mir in der universellen Geste an die Schläfe, die hierzulande »Kind Gottes« bedeutet. »Was so passiert, wenn es in der Verwandtschaft kreuz und quer geht. Ek ist der Meinung, mein Wachmann zu sein.«
»Als ich letztes Jahr hier durchgekommen bin, hat er mich mit einer machete von Ihrem Brunnen vertrieben.«
»Eigentlich ist er ganz harmlos. Aber ein kräftiger Kerl.«
»Ja … Na ja, dieses Ding jedenfalls, was immer es war, hat mich irgendwie fasziniert. Wenn es hängenblieb, habe ich mich in den Sand gesetzt und gewartet, bis es wieder freikam. Weil ich es nämlich haben wollte. Wenn es sich um eine Boje handelte, dann waren da vielleicht wertvolle Messinstrumente zu holen. Ich hatte schon von Leuten gehört, die Finderlohn für so was bekommen haben – ach Quatsch, das ist bloß das, was ich mir selber weisgemacht habe. In Wirklichkeit wollte ich dieses Ding einfach bloß haben. Ich hatte das Gefühl – hört sich vielleicht verrückt an –, dass es für mich bestimmt war. Irgendwie kann ich das nicht richtig erzählen. Verstehen Sie, irgendwas kommt von ganz allein aus dem Meer rein, und weit und breit ist niemand außer Ihnen –«
»Ich weiß genau, was Sie meinen. Dieses Tablett hier wurde auch so angetrieben. Ich habe einen halben Vormittag damit verbracht, es mir zu holen, in einem Nordoster.«
Er strich über das edle Holz des Tabletts und nickte mit seinem unfassbar knalligen Kopf, als hätte ich irgendeinen Test bestanden.
»Ja. Alles, was man braucht … Na ja, zu diesem Zeitpunkt floss das Wasser jedenfalls eher wieder raus aus der Bucht, und mir wurde klar, dass dieses Ding für eine ganze Weile nicht mehr dichter herankommen würde. Aber wir waren ungefähr auf halbem Weg zu dieser Landspitze, an der die Strömung zurückfloss. Was man hier in der Gegend Landspitze nennt, ist ungefähr so hoch wie eine flache Hand, aber diese eine hat wirklich Einfluss auf die Strömung. Vielleicht zehn Meilen weiter. Irgendein verrückter Yankee hat mal versucht, dort einen Ferienort hochzuziehen. Lirios.«
»Ja. Die Lilien. Ich bin in dem Jahr hierhergekommen, als die Behörden ihn rausgeworfen haben. Zweckentfremdung von Ackerland haben sie es genannt. Er hat anscheinend einen Riesenberg Schulden hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn davor auch ordentlich ausgenommen haben; er hatte große Pläne. Ist noch was davon übrig?«
»Nur ein paar Fundamente mit hübschen Fliesen und Teile eines Bauwagens. Ein Bursche namens Pedro Ángel aus Tres Cenotes wohnt dort mit seiner Familie; er betreibt eine cantina mit einer Sorte Schnaps. Unter anderem. Der pozo – der Brunnen – ist immer noch brauchbar. Dort hätte ich mir mein Wasser geholt, wenn Sie nicht dagewesen wären.«
Ich dachte an diese zusätzlichen Meilen und schüttelte den Kopf. »Ek hätte das nicht mit Ihnen machen dürfen. Ich rede mal mit Don Pa’o.«
Er sah zu mir herüber, nach der Art der Maya. »Lassen Sie gut sein. Ich meine, das wird nichts helfen. Danke jedenfalls. Sagen Sie – sind Sie sicher, dass Sie das hören wollen?«
»Absolut. Aber vorher sollten Sie diesen Schinken von seinem Elend erlösen; Sie haben ihn jetzt sechsmal in die Hand genommen. Möchten Sie lieber irgendwas anderes essen?«
»Oh. Nein, der ist prima.« Gehorsam nahm er zwei kleine Bissen und trank etwas Tee und sah einen Moment lang viel jünger aus, wie ein Junge. Sein Blick war immer noch auf das Riff gerichtet, das allmählich zur Ruhe kam. Selbst ich konnte jetzt das Zickzack dunkleren Wassers sehen, die alte Fahrrinne. Wir hatten Ebbe. Eine einsame Wolke spiegelte sich rosig am glitzernden Horizont, und die Palmen machten auch nicht mehr einen solchen Lärm. Es würde wirklich eine schöne Nacht werden – mit einem prächtigen Vollmond, wie mir jetzt wieder einfiel. Ich hatte längst vor, meinen Besucher auf einer Hängematte im »Arbeitszimmer« einzuquartieren. Die Gastfreundschaft der Maya stellt einen nicht vor Probleme; in jedem Winkel sind Wandhaken angebracht, und die meisten Geschäftsreisenden haben sogar ihre eigene Hängematte dabei.
»Jedenfalls, da war ich also und lief immer mit diesem Ding mit, während es lange, langsame Hüpfer machte und größer und kleiner wurde. Dieser Strand im Mondlicht …« Seine Stimme wurde weicher; das Gesicht in seiner feuerroten Umrahmung war immer noch das eines Jungen – aber nun von einer tieferen Empfindung überschattet.
»Der Mond begann gerade, dicht bei der Küste unterzugehen, so dass er die Stange richtig aufleuchten ließ, und ungefähr zu der Zeit, als wir bei Lirios ankamen, sah ich, dass sie keine Markierungen aufwies, sondern etwas um sie herumgeschlungen war. Wenn sie hoch herauskam, konnte ich so eine Art weiße Wülste sehen, und dann fing irgendwelches dunkles Zeug an, sich zu lösen und im Wasser zu treiben. Zunächst hielt ich es für Seetang, dann kam ich auf die Idee, dass es sich um eine alte Fahne handelte. Und das hatte ich bis jetzt nicht sehen können, weil diese Kette, oder was die Stange sonst beschwerte, sie im tiefen Wasser weiter unten hielt. Aber nun zuckelte das Ding die Untiefen heran und kam viel weiter raus. Und dann blieb es bei Lirios auf der Sandbank hängen, und ich sah, dass es sich um ein langes, schmales Bündel handelte, das an der Stange festgebunden oder da herumgewickelt war. Es blieb dort hängen, bis eine Woge es herumdrehte und direkt auf mich zu trug.
Und da sah ich das Gesicht.«
Sein eigenes Gesicht war jetzt zur See gewandt, so dass ich mich zu ihm hinüberbeugen musste, um die gepressten Worte zu verstehen.
»Es war ein Mensch, nicht wahr, oder eine – eine Leiche. An dieses Rundholz gebunden, mit langen schwarzen Haaren, die hin- und herflossen, und in irgendetwas Weißes eingewickelt, das zwischen den Leinen hervorschlackerte und zu trocknen anfing, wo es nicht mehr ins Wasser reichte … Dieser Mensch musste natürlich tot sein. Aber ich dachte nicht lange nach, als ich dieses Gesicht sah … Es … die …« Er schluckte. »Jedenfalls gibt es da einen hässlichen Rückfluss. Angeblich gibt es ja so was wie eine Unterströmung nicht, aber es fühlt sich wie eine an. Ein Sog. Ich bin dort rausgewatet, rausgestolpert, ja. Es ist steil dort und voller Steine. Nicht wie hier. Aber ich schwimme viel.«
Ich unterdrückte einen Widerspruch. Dem Yankee, der Lirios gebaut hatte, waren vier Gäste abhandengekommen, bevor er den Einheimischen Glauben geschenkt hatte: Die Brandung dort eignet sich nicht zum Schwimmen, nicht einmal an den ruhigsten Tagen.
»Bei der ersten Welle, die mich hochhob, sah ich, dass das Ding überhaupt keine Boje war; es tauchte noch mehr Zeug neben dem Rundholz auf. Als ich das nächste Mal einen Blick darauf werfen konnte, sah ich Seitendecks und den oberen Teil einer Achterkajüte. Eine schicke alte Pinasse, nicht wahr, vielleicht acht oder zehn Meter lang. Und poliert – der Mond spiegelte sich im Holz und auf dem Messing. Die – die Person war an den abgebrochenen Mast gebunden.«
Er nahm noch einen Mundvoll kalten Tee, den Blick auf eine innere Vision gerichtet. Er schien sich Mühe zu geben, das Ganze sehr genau und undramatisch zu schildern.
»Poliert …« Er nickte; ja. »Nasses Holz kann glänzend aussehen, aber doch nicht diese Ruderdollen oder was das war. Teufel, ich hab’s ja gespürt unter den Fingern! Ich bin bis dorthin, verstehen Sie, ohne jeden Gedanken. Ich meine, ich hatte noch nie mit Leuten zu tun gehabt, die tot sind. Nicht wirklich tot-tot. Nur auf der Beerdigung meines Großvaters, und sein Sarg war mit einer Glasscheibe versehen gewesen. Das hier war etwas ganz anderes. Ich dachte an Fische, die schon eine Weile tot waren, und wäre beinahe umgekehrt. Und dann zeigte mir die nächste Welle das Gesicht von Nahem, und die Augen – ihre Augen waren offen. Inzwischen war ich mir sicher, dass es sich um eine Frau handelte. Ihre Augen schienen mich im hellen Mondlicht direkt anzusehen. Sie leuchteten – nicht tot. So riesig …
und ihr Arm bewegte sich oder trieb, als würde er an den Leinen ziehen. Also machte ich weiter.«
Seine Hand berührte instinktiv das Messer, das er neben sich gelegt hatte.
»Mein Bein stieß gegen etwas neben ihr an der Bootsseite – daher habe ich die hier.« Er wies auf eine lange graue Narbe. »Und ich machte mich daran, die Leinen durchzuschneiden, die alle zwischen diesem Seidenstoff waren. Das Boot rollte uns unter Wasser. Ich weiß noch, wie ich dachte: ›Oh Gott, ich schneide in totes Fleisch; sie geht mir noch in Stücke.‹ Und das Boot rollte noch schlimmer; es stieß mit dem Kiel auf und war dabei zu kentern.« Er holte lange Luft. »Aber dann traf mich ihr Arm, und er fühlte sich fest an. Also schnappte ich ihn mir und atmete noch mal tief ein und schnitt unter Wasser die Leinen um die Füße durch und stieß uns beide kräftig von dem Ding ab, bevor es sich endgültig rumdrehte.« Er holte wieder Luft, dachte zurück.