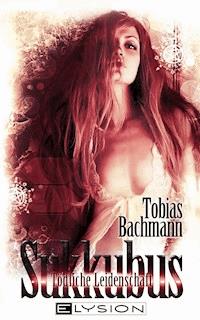Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Clube de Autores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ben Carter ist der letzte Überlebende einer unbekannten Katastrophe - denkt er zumindest. In Wirklichkeit ist er nur ein Experiment, das der teuflische Mephisto und seine verschwörerische Organisation mit ihm spielt. Doch welche Rolle hat Mephistos Gegenspieler, der bizarre Christ_2.0 wirklich inne? Und gibt es das höllische New Eden nur in einer parallelen Wirklichkeit? Jenseits des Todes muss Carter übermenschliche Kräfte aufbringen, um ein aus den Fugen geratenes Gleichgewicht wieder herzustellen. Doch alsbald muss er einsehen, dass er in diesem Kampf niemanden trauen darf. Am wenigsten sich selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
R.I.P.
Die Ruhe nach dem Tod
von Tobias Bachmann
R.I.P.
Die Ruhe nach dem Tod
von Tobias Bachmann
Inhalt
Prolog 9
Sozialpädagogischer Entwicklungs- und Abschlussbericht 13
Anfang 17
ERSTER TEIL: Stadt der Toten 21
Kapitel I: SCHLEUSE 23
Kapitel II: AUSSTOPFUNG 67
Kapitel III: BEWEISLAST 97
ZWEITER TEIL: Florenz 139
Kapitel IV: REINKARNATION 141
Kapitel V: AKZEPTANZ 179
DRITTER TEIL: New Eden 207
Kapitel VI: RENNAISANCE 209
Kapitel VII: CHRIST_2.0 275
Kapitel VIII: MÖBIUSBAND 303
GOLEM 335
Schluss 343
Wie man einen Menschen ausstopft 345
Epilog 349
Nachwort des Autors 351
Für Theo Visser,
ohne den es dieses Buch in seiner jetzigen Form nicht geben würde.
Aber er kann nichts dafür.
»Aufs innigste zu wünschen. Sterben – schlafen –
Schlafen! Vielleicht auch träumen!«
William Shakespeare (Hamlet)
Prolog
Es ist das Nicht-Verstanden-werden, was dem Menschen Seelenqualen bereitet. Schlimmer jedoch ist es, wenn man sich selbst nicht versteht, wobei dies in Carters Fall wörtlich zu nehmen ist. Immerhin half ihm eine psychotherapeutische Behandlung, die unwirkliche Begebenheit zu vergessen.
Etwas hatte ihn geweckt, wobei er nicht sagen konnte, ob es ein Geräusch oder eine kaum merkbare Berührung war. Ein Luftzug mochte ausgereicht haben. Carter rappelte sich auf, blickte in Maries schlafendes Gesicht und beobachtete einen Moment lang verzückt das verhaltene Lächeln um ihre Mundwinkel. Es mussten schöne Träume sein, in denen sie friedlich schlummerte.
Die drückende Blase meldete sich und erinnerte ihn daran, dass es Dinge gab, die sich nicht aufschieben ließen. Carter rappelte sich aus der Bettdecke und stand auf. Der Bewegungssensor unter dem Bett reagierte und ließ schales Dämmerlicht über den Fußboden gleiten. Den Sensor hatte es im Sonderangebot gegeben. Eine tolle Sache, dachte Carter, der es nicht mochte, bereits am Morgen grellem Licht ausgesetzt zu sein. Er mochte die Dämmerung ebenso, wie das Zwielicht des beginnenden Tages.
Meistens langte karge Beleuchtung aus, aber das war nicht immer so. Er hatte noch keine paar Schritte nacheinander gesetzt, als er verdutzt innehielt. Irgendetwas stimmte nicht.
Mit wachen Sinnen blickte er sich im Halbdunkel des Schlafzimmers um, und hätte es nun gerne ein wenig heller gehabt. Er sah Marie auf dem Bett und hörte ihre leisen, gleichmäßigen Atemzüge. Sein Blick löste sich von ihr, glitt über das Bett, die Wände entlang. Er beobachtete die Vorhänge, die sich wegen des gekippten Fensters kaum merkbar im Wind beugten. Sah die Tür, die einen Spalt breit offenstand, sah das Monstrum von Kleiderschrank, den er vor einigen Wochen erst erstanden und unter vielen Fluchen und ohne fremde Hilfe aufgebaut hatte. Nirgendwo war etwas Ungewöhnliches zu sehen.
Und doch: In der Ecke zwischen Tür und Wand, dort wo sich manchmal der Berg mit ihrer Dreckwäsche türmte, dort war etwas.
Jemand.
Carter zitterte und beinahe ohne sein Zutun hob sich seine Hand und deutete auf den fremden Eindringling, den er nur allzugut kannte. Bei dem Eindringling handelte es sich groteskerweise um niemand anderen, als um ihn selbst.
Tatsächlich hätte Carter annehmen können, dass es sich um sein Spiegelbild handeln mochte, doch der Raum barg nicht eine einzige Möglichkeit sich zu spiegeln. Die Vorhänge waren zugezogen, wodurch eine Brechung des Lichtes in den Scheiben unmöglich war. Und auf eine Spiegeltür an ihrem Kleiderschrank hatten er und Marie aus Kostengründen verzichtet.
Carter fürchtete sich vor einem Trugbild, das ihn zu verhöhnen schien.
Dabei war die Halluzination äußerst schwach, kaum erkennbar, ja beinahe durchsichtig. Einer Silhouette gleichend stand sie Carter gegenüber und versuchte, den Bewegungen nach mit ihm zu kommunizieren, doch er verstand kein Wort. Das heißt: Es war ihm, als würde er ein leises Wispern vernehmen. Doch es glich eher einem Hauch. Einem Schwall in Worte getränkter Luft, als dem Reden eines ...
Eines Geistes?
Einer Illusion?
»Was bist du?«, raunte Carter, dessen Stimme nicht gerade aus überzeugender Festigkeit heraus sprach. »Bist du ich?« Nicht mehr als ein krächzendes Flüstern.
Er glaubte, den Geist bestätigend Nicken zu sehen. Dann bewegten sich die Lippen der Illusion. Ein tonloser Redeschwall. Gerne hätte er eine Fernbedienung genommen, um den Ton lauterzustellen. »Ich verstehe dich nicht«, sagte er stattdessen. »Du bist zu leise.«
Und noch während Carter an seinem Verstand zweifelte, rannte sein Geisterego auf ihn zu. Der Illusionscarter kam immer näher, jedoch mit einer verhältnismäßig langsamen Geschwindigkeit, die Carter trotzdem viel zu schnell vorkam. Es waren diese traumgleichen Widersprüche, wie man sie im realen Leben eigentlich nicht kennt. Vielleicht träume ich das alles nur, dachte Carter noch, als der Geist auch schon heran war.
Doch anstelle eines zwangsläufigen Zusammenprall, rannte die halb unsichtbare oder durchsichtige Gestalt durch ihn hindurch und verflüchtigte sich augenblicklich.
Und egal, wie sehr sich Carter auch noch im Kreis drehte, da war nichts mehr zu sehen von der Spukgestalt.
Nicht ohne sich weiterhin umzusehen, ging Carter aufs Klo. Dort stellte er fest, dass er vor lauter Angst in die Hose gepinkelt hatte, ohne es bemerkt zu haben. Er tat die Schlafanzughose in die Wäsche und wusch sich notdürftig mit einem Waschlappen. Unentwegt stellte er sich derweil Fragen, ob er an geistiger Umnachtung litt. Wurde er verrückt? War das nun ein Traum oder Wirklichkeit gewesen?
Ohne eine Antwort parat zu haben, begab er sich zurück ins Schlafzimmer. Wieder sah er sich um, konnte aber nichts sehen oder feststellen. Dort wo er vorhin gestanden hatte, befand sich nun ein nasser Fleck am Boden. »Scheiße«, murmelte er.
Aus dem Kleiderschrank holte er sich einen neuen Schlafanzug und zog ihn sich an. Dann kroch er zurück in sein Bett. Er zitterte, aber nicht vor Kälte. Haltsuchend klammerte er sich an Marie, der er am nächsten Morgen kein Wort davon erzählte.
Dies war vor etlichen Jahren.
Man möge sich streiten, ob dies der Beginn von allem war.
Sozialpädagogischer Entwicklungs- und Abschlussbericht ...
... steht zu oberst auf der Akte geschrieben. Auf dem Deckblatt prangt das Emblem der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ein Foto. Schwarz/weiß. Es zeigt einen verwahrlost dreinschauenden Jungen. Sein Blick ist ängstlich der Kamera zugewandt.
Auf der nächsten Seite steht der Name des Kindes sowie sein Geburtsdatum. Es ist zu lesen, wann der Junge in die Einrichtung kam und zu welchem Datum er entlassen werden soll.
Was folgt, ist ein recht interessanter Abschnitt, der beschreibt, wie es zur Aufnahme in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen ist: »Die Umstände, unter denen Chris bei uns stationär aufgenommen wurde, dürften allseits bekannt sein. Sein Fall ging durch die Presse und jugendgerichtlich durch sämtliche Instanzen. Es ist nicht Aufgabe dieses Berichtes, erneut auf die Details einzugehen, weswegen ein kurzer, recht allgemein gehaltener Abriss seiner prägenden Lebensstationen ausreichen soll.
Chris ist neun Jahre alt, als seine Eltern auf tragische Weise bei einem terroristischen Anschlag ums Leben kommen. Ein Selbstmordattentat. Der Junge verbrachte die Zeit bei seinen Großeltern. Wegen angeblicher Stigmata, die sich nach dem Tod seiner Eltern auftun, wird der elfjährige Chris aus der Dorfgemeinschaft verstoßen. Die Großeltern, christlichen Glaubens erzogen, fühlen sich maßlos überfordert und wissen nicht, wie sie mit dem Jungen umgehen sollen, der aus Händen und Füßen und an der Flanke blutet und der in aller Öffentlichkeit von seinen Mitmenschen daher bloßgestellt wird. Die Umstände müssen für ihn sehr belastend gewesen sein. Öffentliche Hänselungen und Ähnliches bleiben nicht aus.
Wenige Jahre darauf sterben die Großeltern und er ist auf sich allein gestellt. Aufgrund der Stigmata wird der nun Elfjährige aus dem christlich geprägten Dorf vertrieben und treibt sich ab dann herum. Erst als Jugendlicher kehrte er wieder zurück und fordert Vergeltung. Da ihm diese verwehrt wird, lässt er sich in der Öffentlichkeit kreuzigen und löst damit eine Welle der Empörung aus.«
An dieser Stelle ist ein Zeitungsartikel dem Bericht beigefügt, der über die Selbstkreuzigung des Jungen berichtet. Ein krisseliges Schwarzweißfoto ist auch dabei. Weiter heißt es: »Wie er in den therapeutischen Wochenstunden erklärt, hoffte er, dass sein Tod etwas bewirken würde. Auf die Frage, was, antwortete Chris nur, ›Etwas, mit dem ich selbst wohl am wenigsten rechne. Etwas, das die ganze Welt verändern könnte, sofern sie nur bereit dazu ist.‹. Diese und weitere Äußerungen aus Hoffnung bergen Ressourcen für den jungen Mann, dem wir uns nun und auf den folgenden Seiten näher widmen möchten.
Am Tag der Selbstkreuzigung wurde er polizeilich aufgegriffen und von einem Untersuchungsrichter als unmittelbar gefährdend für das Allgemeinwohl eingeschätzt. Man übergab ihn der Obhut unserer Einrichtung, wo er nun die Gelegenheit erhält, seine Jugendjahre unter wertschätzenden, und normalen Bedingungen abschließen zu können.«
Hier hat jemand mit einem schwarzen, dicken Filzstift in krakeligen Buchstaben an den Rand die folgende Notiz geschrieben: »Diese Geschichte wird keinen Anfang und kein Ende haben!« Wer der Verfasser dieser Botschaft ist, konnte bis dato nicht geklärt werden.
»In unserer Wohngruppe für Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen ist er nunmehr gut integriert«, heißt es weiter. »Er wird von den anderen akzeptiert, zieht sich selbst jedoch weiterhin verstärkt aus sämtlichen Geschehen und Aktivitäten zurück. In Einzelsettings ist er gut zugänglich, jedoch zurückhaltend. Er selbst sagt von sich, er habe Angst, dass die Stigmata sich wieder auftun würden. Eine ärztliche Untersuchung ist bereits erfolgt, teilt diese Sorge aber nicht. An den Handflächen und Füßen und an der rechten Flanke seien verwurzelte Vernarbungen zu sehen, die Hinweise auf eine frühkindliche Folter sein mögen, mehr jedoch auch nicht, meint der Hausarzt. Der psychologische Fachdienst spricht von einer weitreichenden Traumatisierung bereits in jungen Jahren, was die Annahme des Allgemeinarztes durchaus stützt.«
Der Rest der Akte wirkt unzureichend, mangelhaft und oft verfälscht. Mehrere Personen müssen auf das Dokument eingewirkt haben. Einige Seiten fehlen – offensichtlich wurden sie herausgerissen. Bestehen bleibt die Hoffnung, dass die Darstellung seines Lebens auf diesen vergilbten Seiten einigermaßen detailgetreu gelungen ist. Und selbst, wenn man die Authentizität der Unterlagen anzweifelt, so muss man sich doch eingestehen, dass der Inhalt gleichermaßen bizarr wie brisant erscheint. Vor allem für jemanden, der es wagt, sein inneres Selbst, den Sinn seiner Geburt, seines Lebens und seines Todes zu erforschen. Teilweise fehlte das Quellenmaterial, was jedoch stets angemerkt wurde.
Dies ist kein herkömmlicher Bericht, sondern ein Spinnennetz, eine Achterbahnfahrt in die Träume eines Menschen, der ewig lebt und doch nie geboren wurde, um seinen nie eintretenden, aber bereits geschehenen Tod hier einmal außer acht zu lassen.
Möge dies also der Anfang sein, der Beginn vom Ende, das Ende des Anfangs ...
Hier.
Im Jenseits.
In der scheinbar unbedeutenden Persönlichkeit eines schier fassungslosen Protagonisten, dessen Anfang sein Ende war.
Anfang
»Dreimal träumte Randolph Carter von der wunderbaren Stadt, und dreimal wurde er fortgerissen, als er noch auf der hohen Terrasse über ihr weilte.«
H. P. Lovecraft (1890-1937)
Es war dunkel und Carters Traum tiefer als das dämmernde Etwas, das man Schlaf getauft hatte.
Euphorisch schritten die Bewohner der unsäglichen Stadt durch ihre gewundenen Pfade. Große Türme zeichneten sich am wolkenfreien Horizont ab und es glitzerte und funkelte, wie wenn Engel ihre Himmelspforten geöffnet hätten, auf dass das göttliche Licht die Bewohner in dezentes Blau färbe.
Keine Schlangen stinkender Blechkarossen wälzten sich durch die Straßen. Nur ein gelegentliches Surren erinnerte daran, dass es auch hier Fortbewegungsmittel gab, diese jedoch ausnahmslos auf die Grenzenlosigkeit der Lüfte beschränkt und von reiner Sonnenenergie angetrieben. Größere Flugschiffe, ellipsenförmig und flach gebaut, besaßen hingegen einen weiteren, zusätzlichen Antriebsstoff, der wiederum die geheimnisvollen Maschinen zu unglaublichen Leistungen befähigte. So konnte man an entlegenen Ecken und Winkeln beobachten, wie diese mit einem Mal vor den Augen des Betrachters unsichtbar wurden. Sie verschwanden stillschweigend und kamen zu anderen, besser erscheinenden Gelegenheiten wieder zum Vorschein. Dort wurden sie oftmals gar nicht bemerkt, denn sie hatten ihre Mission zu erfüllen, und diese war geheim. Manchmal brachten sie Besucher mit, manchmal kamen sie nicht wieder, doch meistens hatten sie Erfolg und wurden jubelnd empfangen.
Der stille Beobachter, der auf der eigentümlichen Terrasse über der utopischen Metropole verweilte, verfolgte sehnsüchtig die geheimnisvollen Szenerien, als sich eine Hand auf seine Schulter legte, er ängstlich herumfuhr, mit entsetzten Augen sah, erkannte und ... ...erwachte.
»Guten Morgen, Ben.« Ein liebevoller Kuss auf seine Wangen holte ihn vollends in die Realität zurück. »Du scheinst schlecht geträumt zu haben. Hast dich die ganze Zeit hin und her gewälzt. Da hab ich dich geweckt.«
»Es war ein wunderbarer Traum«, sagte er. »Du hättest mich nicht zu wecken brauchen.«
Lächelnd zuckte Marie mit den Schultern und verließ das Zimmer.
***
Das zweite Mal träumte Carter von jener absonderlichen Stadt, nachdem er fast erschossen worden wäre. Seitdem er wieder in den Streifendienst zurückversetzt worden war, hatten die alltäglichen Gefahrenquellen für ihn zugenommen und so kam es, dass er bei einer Schießerei lebensgefährlich verletzt wurde.
Mehrere Wochen verbrachte er im Krankenhaus. Obwohl sich sein Gesundheitszustand von Tag zu Tag besserte, wurde ihm der Krankenhausaufenthalt schier unerträglich, da Marie ihm Lebewohl gesagt hatte. Sie bringe es nicht mehr fertig, mit einem Mann zusammenzusein, dessen Leben tagtäglich auf dem Spiel stehe, meinte sie.
Er schritt durch die verträumten Gassen, beobachtete die an ihm vorübereilenden Menschen und stellte missmutig fest, dass es in dieser Stadt keine Gewalt zu geben schien. Dennoch haftete etwas an den Bewohnern, dass in ihm den Gedanken aufkommen ließ, dass er hier keineswegs arbeitslos wäre. Die Gesichter waren es, die ihm diesen Gedanken aufdrängten.
Ovale, große, dunkle Augen, welche an beiden Enden spitz aufeinander zuliefen. Eine kaum vorhandene Nase; lediglich zwei Löcher und eine fast nicht bemerkbare Erhebung ließen sich erkennen. Und ein schmaler, strichgleicher Mund, fest aufeinandergepresst, wenn nicht gar lippenlos.
Sie verzogen keine Miene. Mimik oder andere Gefühlsäußerungen existierten nicht.
Überhaupt schienen sie abnorm zu sein. Ihre Hautfarbe war seltsam gräulich, die allgemeine Statur der Bewohner eher klein und untersetzt.
Auch konnte Carter keiner Unterhaltung folgen, da es schier keine gab und dennoch spürte er, wie die Wesen miteinander kommunizierten.
Sie waren in eigenartige Uniformen gekleidet. Haare besaßen sie nicht und auf Carter wirkten sämtliche Bewohner eher hässlich. Er konnte keine geschlechtsspezifischen Verhaltensmuster erkennen und wenn er eines der Lebewesen ansprach, so wurde er missachtet oder schlicht und einfach nicht wahrgenommen.
Dennoch hatte das Leben der Bewohner und die eigentümliche Stadt im allgemeinen, etwas Reizvolles an sich. Carter schrieb dies der Tatsache zu, dass hier jegliche Form von Gewalt fehlte.
Hier herrschte Frieden!
***
Der dritte und letzte Traum, den Carter von jener Stadt hatte, sollte all seine bisherigen Erkenntnisse verwerfen.
Es war der gewaltigste Traum, dem er jemals erlegen war ...
Erster Teil:
STADT DER TOTEN
»Für jemanden, der mit seinem irdischen Dasein zufrieden ist, ist das Leben ein Fest: und niemand verlässt gern ein gutes Fest.«
Anton Szandor LaVey (1930-1997)
»Wie töricht, sich darum zu sorgen, was nach dem Tode geschieht!«
Ramakrishna Paramahamsa (1836-1886)
Kapitel I: SCHLEUSE
1
Die feuchten Gassen spien ihren stinkenden Saft von den Wänden der Häuser. Düstere Schatten krochen aus Mauervorsprüngen, lugten aus Eingangsportalen hervor und versuchten, die Bewohner der Stadt auf ein unvorhersehbares Verderben vorzubereiten.
Das Verderben nannte sich Nacht, und nicht nur Ben Carter wusste, dass die Nächte dieser Stadt lediglich Verderben brachten. Jeder wusste es. Die meisten Menschen aber versuchten, dergleichen zu ignorieren. Sie begegneten dem Ganzen mit schlichter Resignation oder hatten es bereits vergessen, da sie längst ein Teil jenes Verderbens waren.
Als Carter den Mann fester gegen die Wand drückte, damit der sich nicht wehren konnte, war er sich dieser Sache voll und ganz bewusst. Der Mann war ein Dieb. Ein gewöhnlicher Kleinkrimineller. Einer von vielen. Ein Teil des Verderbens.
»Lass mich los, du Drecksbulle!«, schrie er und Carter packte noch fester zu. Er stemmte sein ganzes Gewicht gegen den Kerl, bis er es riskieren konnte, mit einer Hand nach den Handschellen an seinem Gürtel zu fischen.
Als Polizist bekommt man das Verderben der Nacht unmittelbar vor Augen geführt. Das traf vor allem auf die Nachtschicht zu, die Carter mehr hasste, als alles andere.
Wie er den Kerl mit den Handschellen fixierte, wurde ihm mit einem mal bewusst, dass er ausgebrannt war. Er hatte keine Lust mehr auf den ganzen Scheiß. Schichtdienst und Verbrechen an jeder Straßenecke. Sein Leben hatte er sich anders vorgestellt.
Er packte den Kerl, wirbelte ihn herum und drückte ihn erneut gegen die Mauer.
»Was soll die Scheiße«, protestierte der. »Ich habe Rechte, Mann. Rechte!«
»Ich geb dir gleich ne Rechte«, raunte Carter und stieß ihm seine rechte Faust tief in die Magengrube.
Der andere stöhnte auf und krümmte sich.
Carter hielt ihn fest und drückte ihn wieder nach oben. »Ich habe euch so satt. Gestalten wie du. Überall ist es dasselbe mit euch. Vergewaltigung, Raub, Mord, rassistische Anschläge, Entführung, Überfall ...« Wieder holte er mit der Faust aus und schlug zu.
»Hör doch auf!«, stöhnte der andere.
Carter packte ihn am Revers und zog sein wimmerndes Gesicht ganz nah an seines. »Weißt du, wovon ich träume?«
Der Typ hatte Tränen in den Augen. »Irgendwann einmal eine Nachtschicht absolvieren zu dürfen, in der ich kein einziges mal zu einem Einsatz gerufen werde.«
Der andere lachte auf. »Das wird niemals passieren!«
Nun schlug ihn Carter mit der Rückhand so heftig gegen die Wange, dass sich sein Speichel mit Blut vermengte, das über sein Kinn lief.
Träume werden immer Träume bleiben, dachte Carter bei sich, während er den Kerl vor sich her in Richtung seines Dienstwagens schob. »Insbesondere, wenn es Träume von Frieden und Harmonie sind«, murmelte er. Dann erreichte er den Streifenwagen, öffnete die Hintertür und schob den Mann auf die Rückbank.
Gilbert, sein Partner, wartete hinter dem Steuer. Carter sah, wie er sich zu dem menschlichen Abschaum auf der Rückbank umdrehte und mit ihm sprach. Ihm war egal, was. Carter warf die Tür zu und lehnte sich gegen den Wagen.
Es war eine kühle Nacht. Trotzdem schwitzte er. Ich mach das nicht mehr lange mit, überlegte er und zündete sich eine Zigarette an. Weiß Gott, er hätte besseres zu tun, als das. Außerdem vermisste er Marie. Wegen seiner gottverdammten Arbeit war seine Beziehung zerbrochen. Wieso tat er sich das alles an?
Der elektrische Scheibenheber surrte.
»Hey!«, rief Gilbert. »Alles in Ordnung?«
Carter sagte nichts. Er stand da und rauchte.
»Komm schon. Steig ein. Wir fahren zurück ins Präsidium.«
»Ja doch«, sagte er genervt, inhalierte noch einmal tief und warf die Kippe in den Rinnstein. Dann öffnete er die Beifahrertür und setzte sich neben seinen Kollegen, der den Wagen startete und losfuhr.
Das Arschloch auf der Rückbank war durch eine Trennwand aus Plexiglas von der Fahrerkabine isoliert. Gespräche konnte man nur per Knopfdruck mit dem Gefangenen führen. Dennoch hörte man ihn dumpf brüllen, man solle ihn gefälligst freilassen.
Gilbert seufzte. »Du hast ihn so zugerichtet, stimmts?«
Carter lehnte sich zurück und starrte aus dem Fenster.
»Hey!«, rief sein Kollege nun und Carter blickte auf. »Das warst doch du! Der war doch nicht so blutig, als du ihn gesehen hast.«
Schon möglich, dachte Carter und sagte: »Es war dunkel. Keine Ahnung.«
Sie waren auf Streife unterwegs und Carter hatte ihn unter den Passanten ausgemacht: Harold Warren, wegen mehrfacher Vergewaltigung und Verdacht auf Totschlag gesuchter Zuhälter und Drogendealer. Gilbert hatte am Straßenrand gehalten und Carter war ausgestiegen. Warren hatte das Manöver gesehen und zur Flucht angesetzt. Carter war ihm hinterher und hatte ihn schließlich in der Seitengasse gestellt und ... »Ja, verdammt, ich habe ihm ein paar gegeben.«
Gilbert schlug mit der Hand wütend aufs Lenkrad. »Au Mann. Carter. Warum?«
»Er hat es verdient!«
»Das gibt wieder Ärger, Mann. Richtig, richtig großen Ärger gibt das.«
»Ich nehm das auf meine Kappe«, sagte Carter. Damit war für ihn das Gespräch beendet.
Missmutig starrte er aus dem regennassen Seitenfenster und sah die Lichter der Stadt verschwommen.
»Das wird eine Dienstaufsichtsbeschwerde geben«, murmelte Gilbert neben ihm. »Wenn nicht gar ein Disziplinarverfahren. Was hast du dir nur dabei gedacht?«
»Menschlicher Abschaum«, rief Carter mit einem mal aus. »Das habe ich mir gedacht. Was denkst du denn, was ich mir gedacht habe? Soll ich so einen, wie den da hinten etwa mit Samthandschuhen anfassen? Der hat es doch nicht anders verdient.«
»Wir repräsentieren nur das Gesetzt, wir sind es aber nicht.«
»Ach, halt doch die Klappe. Wir sagen einfach, Warren habe sich gewehrt und ich habe in Notwehr gehandelt.«
Gilbert hielt an einer roten Ampel. »Nein, mein Lieber. So geht das nicht. Ich werde nicht für dich lügen.«
»Dann lass es.« Carter war es egal. Er hätte Gilbert jetzt vorhalten können, wie oft er für ihn bereits den Kopf hingehalten hatte, für ihn Dienste übernommen hatte oder sonst etwas. Immerhin fuhren sie nicht erst seit gestern Streife.
»Ich werde das melden müssen«, sagte sein Kollege nun.
Carter glaubte, sich verhört zu haben. Mit fassungslosem Blick starrte er Gilbert an.
»Ja, was?«, sagte der. »Ich kann da nicht tatenlos zusehen, Ben. Deine Selbstjustiz wird von mal zu mal extremer. Du musst damit aufhören.«
Carter öffnete die Tür. »Ich hab schon verstanden!«
»Ben, was soll das?«
»Mir langt es!«, brüllte er und stieg aus. »Kriech doch deinem Vorgesetzten in den Arsch, während du Meldung machst!« Er knallte die Tür zu und stapfte durch den Regen davon.
Gilbert rief ihm hinterher, er solle zurückkommen, doch ein Hupkonzert des nachfolgenden Verkehrs sorgte dafür, dass er weiterfuhr.
Carter hatte endgültig genug. Seine Karriere als Polizist war hiermit beendet. Und wenn nicht heute, dann in ein paar Tagen, wenn Gilbert seine Beschwerde schriftlich eingereicht hätte.
So ein Arsch, dachte er und kickte wütend eine Coladose vor sich her, bis sie im Rinnstein landete. Er nahm den Platzregen kaum wahr, der den Verkehr auf den Straßen nahezu zum Erliegen brachte.
Carter nahm eine Abkürzung durch diverse Seitenstraßen. Schließlich lief er trotz seiner Uniform durch jene Gassen, in denen armselige Penner des Nachts zwischen Mülltonnen und anderem Schutt ihre Ruhe suchten, und gelangte schließlich zufrieden auf eine Straße, die ihn zum Präsidium führen würde. Sein Entschluss stand fest und er würde ihn sogleich in die Tat umsetzen.
Interessanterweise war Gilbert noch gar nicht da. Vielleicht suchte er nach ihm oder er steckte mit dem Streifenwagen mitten im Verkehr fest. Carter war das egal. Er marschierte auf direktem Wege in die Schreibstube. Die meisten Computer waren unbesetzt. Nachts war hier nie viel los. Er wählte den Nächstbesten, gab sein Passwort ein, öffnete das Schreibprogramm und begann damit seine Kündigung aufzusetzen.
Als er fertig war, druckte er den Wisch aus, unterschrieb ihn und machte sich damit auf den Weg ins Büro der Schichtleitung. Sein eigentlicher Chef würde erst morgen wieder vor Ort sein.
»Ich habe jetzt keine Zeit!«, brüllte Pullman, der diese Woche die Nachtschicht koordinierte.
»Mir egal«, sagte Carter. »Ist wichtig.« Er stand in der Tür und wedelte mit dem Brief in der Hand.
»Was soll das sein? Deine Kündigung? Gib sie morgen dem Chef.«
»Ich komme morgen nicht mehr, und werde jetzt gehen.«
»Du kannst jetzt nicht gehen.«
»Natürlich kann ich«, sagte Carter. »Den Brief schick ich dann mit der Post ab. Schönen Abend noch.« Er wandte sich um und ging. »Hey, Carter. Warte doch mal.«
»Nein, ich will deine kostbare Zeit nicht stören«, rief er zurück und schlug die Tür hinter sich zu.
Kurz darauf verließ er fröhlich pfeifend das Gebäude seiner Einheit, schlenderte über den Parkplatz und beobachtete, wie einige Kollegen von der Sitte ausschwärmten. Als er in seinen Privatwagen stieg, kam gerade Gilbert mit seinem Gefangenen auf den Parkplatz gefahren.
»Sorry, Gilbert, aber du bist ein Arsch«, murmelte Carter. »Und ich habe wirklich keinen Bock mehr auf diese ganze, elende Scheiße!« Er startete seinen Wagen und machte sich zufrieden auf den Heimweg.
Die Scheibenwischer taten ihr Bestes, ihm freie Sicht zu vergönnen, doch es half nicht viel. Carter dachte darüber nach, dass er noch einige persönliche Dinge in seinem Spint hatte, aber die würde er auch morgen noch holen können. Vielleicht würde er sich sogar den Spaß erlauben, seine Kündigung persönlich abzugeben. Mal sehen. Viel wichtiger war ihm, Marie anzurufen, und ihr von seiner Lebensänderung zu erzählen. Die Trennung war noch nicht allzulange her. Vielleicht war es noch nicht zu spät für diesen Schritt.
Als er die Tiefgarage seines Hauses erreichte, steuerte er dort seinen Wagen in die, für seine Wohnung reservierte Parklücke. Hinter ihm fiel das Tor der Tiefgarage krachend ins Schloss.
Er stellte den Motor ab und schnaufte einige Minuten durch. Es ist richtig, was du tust, dachte er. Absolut richtig und längst überfällig. Er wusste nicht, warum ihn bereits jetzt Gewissensbisse plagten.
Angst vermutlich. Unsicherheit wegen der neuen Situation. Er lachte auf, als er aus dem Wagen stieg und zum Aufzug lief. Er passierte die Schleuse, ein feuerfester Zwischenraum, der sich zwischen Tiefgarage und Aufzug befand. Schalldicht war er jedoch nicht, befand Carter, denn deutlich hörte er irgendwo das Donnern eines Flugzeugs. Irgendein Düsenjet, der die Stille der Nacht durchbrach. Kurz darauf ertönte ein Schlag. Carter dachte an das Durchbrechen der Schallmauer.
Ganz schön laut, schoss es ihm durch den Kopf. Er meinte, den Raum vibrieren zu spüren.
Sehr seltsam, dachte er.
»Egal.« Manchmal kam es vor, dass er mit sich selber sprach. »Es geht dich nichts mehr an. Du bist kein Polizist mehr. Du musst nicht nach dem Rechten sehen!«
Entschlossen legte er seine Hand auf die Klinke und verließ den Schleusenraum wieder. Kurz darauf führte ihn der Aufzug hinauf in den siebten Stock. Müde beobachtete Carter, wie ein kleines Lämpchen die Zahl des jeweiligen Stockwerkes zum Leuchten brachte. Alsbald glitten die Türen zur Seite und Carter war binnen weniger Schritte zu Hause.
Seine Wohnung roch muffig. Seit Marie nicht mehr bei ihm war, lief das mit der Haushaltsführung völlig aus dem Ruder. Aschenbecher quollen über und Bierdosen sammelten sich auf Tischen und Anrichten. Überall lagen Kleidungsstücke verstreut auf dem Boden.
Er legte seinen schweren Gürtel mit der Dienstwaffe ab und warf die Mütze in eine Ecke.
Ein widerliches Mikrowellengericht war schnell verspeist und nach zwei Dosen Bier lag Carter im Bett. Er konnte sich nicht erklären, warum er so müde war. Er fühlte sich, wie nach einem Großeinsatz mit Verfolgungsjagd, Schießerei und allem, was dazu gehörte. Zum Glück war das nun alles Vergangenheit, dachte er. Nie mehr werde ich mich um die beschissenen Probleme meiner Mitmenschen kümmern müssen.
Draußen donnerte es erneut. Regen prasselte gegen die Scheiben. Carter schlief ein. Doch sein Traum war in etwa genauso wirr, wie der darauffolgende Tag – und all die anderen Tage, die noch kommen sollten.
2
Aus unerfindlichen Gründen klingelte sein Wecker um sieben Uhr morgens. Fluchend und nur mit Mühe schaffte es Carter, sich aus dem Bett zu erheben. Wie verkatert fühlte er sich, als er sich ins Bad schleppte, um dort verdrossen in den Spiegel zu gucken. Was er sah, entsprach weitestgehend dem, wie er sich fühlte: vor allem unausgeschlafen.
Nachdem er sich geduscht und rasiert hatte, fühlte er sich etwas besser. Er hatte Hunger, doch in Carters Kühlschrank herrschte mit Ausnahme einiger Bierdosen gähnende Leere. So begnügte er sich mit der Zubereitung viel zu starken Kaffees, der für drei große Tassen langte.
Als dieser fertig war, setzte er sich an der Tasse schlürfend an seinen Küchentisch und entsperrte sein Smartphone. Seltsam, dachte er. Keine News. Keine einzige Benachrichtigung und auch kein Termin. Er öffnete die Kalenderapp, die er akribisch führte, seit sein vormaliges, handschriftliches Notizbuch ausgedient hatte, und stellte fest, dass er heute ohnehin freigehabt hätte. Dennoch würde er die Kündigung persönlich vorbeibringen. Die Eier in der Hose musste er schon zeigen, sagte er sich.
Er wollte soeben seine Browserapp öffnen, als der Akku ganz leer war.
»Scheiße aber auch«, murrte er und suchte nach dem Ladekabel. Wo hatte er es nur wieder hin verlegt? Es war immer das Gleiche mit ihm.
Bei der Suche hob er die zusammengelegte Zeitung des letzten Wochenendes an und stieß dabei seine Tasse um, so dass sich der Kaffee quer über den ganzen Tisch ergoss und wie ein brauner Wasserfall an der Tischkante hinab auf den Boden floss.
»Nochmal Scheiße!«
Unverzüglich begann er damit, die Soße aufzuwischen, und saute dabei sämtliche Geschirrtücher ein, die bis dato noch halbwegs für den Abwasch getaugt hätten. Wohl oder übel würde er sich bald um seine Wäsche kümmern müssen.
Als er die mit Kaffee vollgesogenen Tücher zum Wäschetrog brachte und feststellte, dass dieser nahezu überquoll, wusste er, dass er das mit dem Wäschewaschen nicht weiter aufschieben sollte. Seufzend zog er sein Bett ab und begann damit die Dreckwäsche in den Bettbezug zu stopfen.
Seine Wäsche machte Carter immer in der Waschinsel, ein Laden, der hauptsächlich von Studenten aller Couleur frequentiert wurde. Oder eben von frisch gekündigten Ex-Polizisten, grinste Carter, als er den Wäschesack schulterte.
Leider war die Waschinsel am anderen Ende der Stadt, weswegen er mit seinem Wagen dorthinfahren musste. Früher hatte er in der Nähe des Waschsalons seine Wohnung gehabt, doch dann war Marie in sein Leben getreten und als sie beschlossen hatten, zusammenzuziehen, hatten sie sich für diese Wohnung entschieden. Nun lebte er hier alleine und brachte sein Leben nicht richtig auf die Reihe.
Die Wäsche, das war immer Maries Bereich. Sie hatte sich die Waschmaschine ausgesucht und sie hatte die Waschmaschine mit in ihre neue Bleibe genommen.
Daher also der weite Weg zur Waschinsel.
Die Aufzugtür glitt auf und Carter schleppte seinen Wäschesack an den Parkplätzen vorbei durch die Tiefgarage. Er sperrte seinen Wagen auf und wuchtete die Dreckwäsche in den Kofferraum. In der Nähe der Waschinsel gab es eine Reihe hübscher, kleiner Geschäfte; unter anderem einen Buchladen, in dem er schon lange nicht mehr wahr und dem er nun beschloss, einen Besuch abzustatten. Jetzt freute sich Carter regelrecht aufs Wäschewaschen. Keinen Gedanken verschwendete er an das Abgeben seines Kündigungsschreibens. Er startete den Motor, rangierte aus der Parklücke heraus und fuhr langsam auf das Tor zu, das sich durch das alleinige Passieren einer Lichtschranke automatisch öffnete.
... öffnen sollte. Der Mechanismus schien kaputt.
Carter fluchte, da er, macht der Gewohnheit, das Tempo beibehalten und somit fast auf das Tor aufgefahren wäre. Warum ging das verdammte Ding nicht auf? »Verfluchte Technik!«
Er tastete nach der Fernbedienung für das Garagentor, die an seinem Schlüsselbund hing, und drückte den Knopf, doch nichts geschah. Das Tor blieb zu.
Genervt setzte er wieder zurück und parkte seinen Wagen erneut. Kurz überlegte er, ob er einen Zettel schreiben sollte, auf den er geschrieben hätte: »Tor defekt«, aber welchen Sinn hätte das gehabt? Er stieg aus und ging zum Tor, um von Hand daran zu rütteln, in der Hoffnung, es nach oben schieben zu können, aber es saß bombenfest.
Dann fiel ihm der laute Schlag ein, den er gestern Abend noch in der Schleuse zwischen Tiefgarage und Aufzug gehört hatte. Vielleicht war auf der Straße draußen ein Unfall geschehen, überlegte er, und jemand war mit seinem Wagen über die Elektronik gefahren.
Als Nächstes überlegte er, wo er anrufen könnte, und griff nach seinem Handy, um Google zu befragen, doch da fiel ihm ein, dass es oben ohne Akku auf seinem Küchentisch lag, vermutlich noch in einer Lache Kaffee, die er übersehen hatte.
»So ein Scheißtag aber auch«, knurrte er und verließ die Tiefgarage wieder. Über das Treppenhaus erreichte er das Erdgeschoss. Hier, neben den Briefkästen befand sich eine Art Schwarzes Brett, mit Informationen für die Hausbewohner.
»Na toll«, murmelte er, während er die Liste mit den Telefonnummern durchging. »Hausmeister, Hausverwaltung, Aufzugnotdienst ... Aber kein Garagentornotdienst«, stellte er missmutig fest.
Wohl oder übel würde er den Hausmeister anrufen müssen. Er kannte den Kerl. Ein grobschlächtiger, einfacher aber gutmütiger Geselle. Aber um diese Uhrzeit erreichte man ihn eher schlecht, wie Carter aus eigener Erfahrung wusste. Das letzte mal, als er ihn wegen einem Kurzschluss angerufen hatte, der das gesamte Stockwerk ins Dunkel versetzt hatte, war es acht Uhr morgens gewesen, und Carter hatte ihm den Restrausch noch deutlich angemerkt, als der Hausmeister nach zwei Stunden Warten endlich erschienen war.
»Wahrscheinlich hat er gestern auch wieder zu viel gesoffen und ...«, er öffnete die Haustüre, »... schläft nun seinen Rausch aus«, schmunzelte und blieb wie angewurzelt stehen.
»Was zum Teufel ...?« Mehr kam nicht über seine Lippen, als er sich vollends dem Chaos auf der Straße bewusst wurde. Das stillste Chaos, das er je gesehen hatte. Vor seinen Augen, soweit er die Straße entlangblicken konnte, standen zerstörte und gegeneinanderrangierte Fahrzeuge. Eine schier endlose Kolonne Auffahrunfälle zog sich die Straße entlang und soweit Carter es erkennen konnte, vollzog sich der Zug gegeneinandergeprallter Wagen auch in die Seitenstraßen. Autos waren zerstörerisch an die Fassaden der Häuser rangiert, auch gegen die Einfahrt der Tiefgarage, was zweifellos der Grund dafür war, dass diese nicht mehr funktionierte. Und zu allem Überfluss lagen sämtliche Fahrer, Beifahrer und Mitfahrer der Verkehrsmittel tot hinter ihren Lenkrädern beziehungsweise tot daneben, zusammengesunken auf ihren Sitzen. Auch Passanten lagen dahingestreckt auf dem Gehsteig. Der Anblick war ungeheuerlich.
Was Carter vermisste, waren die Behörden. Keine Polizei, keine Feuerwehr, kein Notarzt war da, um das Chaos zu beseitigen, geschweige denn, sich um die Verletzten zu kümmern – wobei sich Carter nach einer gewissen Zeit des staunenden Beobachtens eingestehen musste, dass es keine Verletzten gab. Alle waren tot.
Der gigantische Unfall erstreckte sich die gesamte Straße entlang, ging in den Seitenstraßen weiter und ließ scheinbar keinen Ort aus. Im gegenüberliegenden Haus lehnte eine ältere Dame über der Fensterbrüstung. So wie es aussah, war auch sie tot.
Carter drehte sich prompt um und fuhr mit dem Aufzug in seine Wohnung, um zu telefonieren. Das konnte schließlich nicht abgehen. Wo waren seine Kollegen? Selbst wenn er gekündigt hatte, war er doch noch irgendwo Polizist geblieben. Er musste zumindest seine Dienststelle informieren. Gab es denn keine Mitbürger, die das bereits getan hatten? Aber er hatte nicht mal aus weiter Ferne das Heulen irgendwelcher Sirenen gehört. Überhaupt war ihm das Durcheinander dort draußen zu still erschienen. Wie war es möglich, dass ein so großer Unfall – eine Massenkarambolage – von keinem seiner Kollegen oder Mitbürgern bemerkt worden war?
In seiner Wohnung wählten seine Finger wie automatisch die Nummer seiner Dienststelle und mit pumpendem Herzen lauschte er dem Signalton.
Eine computerisierte Stimme meldete sich: »Zur Zeit ist niemand erreichbar. Bitte bleiben Sie am Apparat.« In seltenen Fällen konnte es sein, dass die freien Leitungen allesamt besetzt waren, die Telefonzentrale überlastet war und das computergestützte System einen freien Anschluss im Telefonverbund des städtischen Polizeiapparates suchen musste. Sollten alle Stricke reißen, wurde man zu einer außerstädtischen Behörde weitergeleitet. Doch nach einer gefühlten Ewigkeit war sich Carter sicher, dass er so niemanden erreichen würde.
Daher wählte er die Privatnummer seines Vorgesetzten, doch auch hier ertönte nur das altbekannte Klingelzeichen, dicht gefolgt von einem automatischen Anrufbeantworter. »Bitte sprechen Sie nach dem Piepton«, sagte dieser.
»Ja, ist denn überhaupt niemand da, wenn man mal jemanden braucht?«, schrie Carter in den Hörer und beendete die Verbindung.
Er versuchte es bei der Feuerwehr mit ähnlichem Ergebnis. Auch Krankenhäuser, ja selbst das Rathaus und weitere Institutionen – überall dasselbe. Es schien, als sei kein Mensch mehr irgendwo erreichbar. Als gäbe es keinen lebenden Menschen mehr, außer ihm selbst.
»Was geht hier nur vor?«
Das Radio schien entweder defekt zu sein oder sämtliche Sender machten Betriebsurlaub. Er konnte einfach keinen Sender auf der Skala finden, der Nachrichten oder Warnungen an die Bevölkerung aussendete. Einige Radiosender spielten Musik und Carter vermutete, dass auch hier Computer eine Playlist abspulten. Auf den meisten Kanälen indes erntete er ausnahmslos weißes Rauschen.
Mit den Fernsehkanälen sah es da nicht anders aus. Computergestützte Programme sendeten Dauerwerbesendungen. Die meisten Sender jedoch brachten ein Testbild oder Ameisenflimmern. Carter ließ von dem Versuch ab, irgendjemanden zu erreichen oder über die öffentlichen Kanäle etwas in Erfahrung zu bringen. Er schnappte sich seinen Mantel und beschloss, zu Fuß die Stadt zu erkunden. Es wäre ja gelacht, wenn die Behörden der Stadt nicht mehr in der Lage wären, einen solchen Unfall zu beseitigen, redete er sich unentwegt ein.
»Und warum ist niemand erreichbar?«, frotzelte er vor sich hin. Vielleicht eine Seuche, dachte er und beruhigte sich selbst sogleich lautstark: »Wenn jeder immer gleich krankmachen würde, wo kämen wir denn da hin? Nicht einmal Musik können sie im Radio senden; wenn sie schon zu faul sind, eine Sendung zu moderieren!«
Carter verließ das Haus und stapfte wütenden Schrittes die Straße entlang. »Ich werde mich beschweren!«, rief er. »Beim Bürgermeister. Bei einem Vertreter der Regierung. Und wenn ich persönlich zum Kanzleramt laufen muss.« Er redete sich in Rage, nur um sich eines nicht eingestehen zu müssen: die Angst, die sich seiner bemächtigte.
Während er die Straßenzüge entlanglief, vermied er es, ins Innere der zerstörten Karosserien zu gucken, um die Fahrer mit ihren Fahrgästen näher in Augenschein zu nehmen. Er hatte sich dafür entschieden, einen nahegelegenen Platz aufzusuchen, der im Normalfall zu jeder Uhrzeit belebt war, was dem Status zu verdanken war, dass es sich um einen beliebten Treffpunkt handelte, gleichsam für Touristen als auch für alkoholisierte Jugendliche. Gerade deshalb wuchs das ungute Gefühl in Carter, je näher er sich dem Ziel seines Fußmarsches näherte; gerade deshalb, weil es so ungewohnt still war; gerade deshalb, weil hier sonst das Leben sprühte. Man war es gewohnt, ein Konzert aus hupenden Fahrzeugen und rufenden, ja gar kreischenden Menschen vernehmen zu können, doch Carter hörte nichts. Nicht einmal eine der sonst so nervenden Tauben gurrte ihn von den Dächern der Häuser her an, obwohl diese, ebenso wie die Menschen, ständig präsent waren, egal, wo man sich in der Stadt aufhielt.
Die Straßen waren leer.
Nein.
Tot.
Dort, wo sich Menschen befinden sollten, lagen Leichen. Dort, wo Autos parken oder fahren sollten, waren gegeneinandergefahrene Fahrzeuge. Das hektische Treiben der Großstadt war der Stille eines Leichenschauhauses gewichen, welche Carter dank seines Berufes persönlich kannte.
Die ihn umgebende Szenerie gefiel ihm überhaupt nicht. Etwas Schreckliches musste passiert sein. Eine Katastrophe, ein riesengroßes Unglück. Er konnte sich nicht im Geringsten vorstellen, was die Ursache für dieses Massensterben sein mochte, das ihn umgab.
Er dachte an Kriege, an terroristische Anschläge, an nukleare Katastrophen und an Chemieunfälle, doch bei all diesen Theorien und Hypothesen fiel ihm ein, dass er selbst ja auch noch am Leben war. Nirgends sah er Schäden irgendeiner Explosion; und schlussendlich blieb immer noch die Frage offen, warum keine Polizei, keine Ärzte, keine Soldaten vor Ort waren, um sich der Sache anzunehmen.
Und wie er endlich den berühmten Platz mit all seinen Reklametafeln erreicht hatte, wusste er, dass nichts mehr so sein würde, wie es einmal war. Das Zentrum – ein gigantisches Erosdenkmal – war kein prächtiges Kunstwerk mehr, sondern nur noch ein Skelett verfallener Steinfassaden und rostiger Streben, zerstört durch das ihm unbekannte Grauen der vergangenen Nacht.
Ein Flugzeug, ein kleiner Privatjet nur, hatte das Bauwerk wohl zerstört. Nach wir vor brennend lag es ungefähr hundert Meter vom Erosdenkmal entfernt. Seine Schnauze hatte sich in ein Gebäude hineingebohrt, das stellenweise über dem kleinen Jet zusammengebrochen war. Verkohlte Menschen lagen um das ehemalige Flugzeug herum und es stank erbärmlich nach verbranntem Fleisch.
»Ein einzelner Toter mag eine Tragödie sein. Eine Millionen Tote sind nur Statistik!« Das Zitat Josef Stalins fiel ihm ein und erschien ihm passend, repräsentierte es in diesem Augenblick für ihn doch nichts anderes als den fortwährenden Kreislauf aus Geburt, Leben und Tod, der nun – hier angesichts des brennenden Flugzeugs mit all den daraus ausgespieenen menschlichen Kadavern – unterbrochen schien.
Fassungslos starrte Carter auf all die Leichen um ihn her, und hörte damit auf, sie zu zählen.
Carter hoffte, dass er sich dieses Horrorszenario nur einbilden würde. Vielleicht wurde er ja wahnsinnig und nichts hiervon war real. Doch als er so von einem Toten zur nächsten Leiche schritt, dachte er an den Holocaust, an die Opfer der Inquisition, an das grausame Abschlachten indianischer Stämme; aber all diese Fälle systematischer Auslöschung menschlichen Lebens hatten gehörige Zeit in Anspruch genommen. Zudem gab es immer auch Überlebende. Und Schuldige.
Diese Vernichtungsaktion hier schien jedoch in einer einzigen kurzen Minute vonstattengegangen zu sein.
»Und warum – in Gottes Namen – bin ich am Leben?«
Dann rannte Carter auf jede Haustüre zu, die er sehen konnte und klingelte und klopfte und schrie, bis er enttäuscht aufgab. Über eine Telefonzelle versuchte er, seinen Bekanntenkreis zu erreichen, versuchte es bei jeglicher öffentlichen Institution, probierte sogar einige willkürlich zusammengewählte Nummern aus, um eventuell eine Verbindung ins Ausland zu erhalten, doch auch diese Versuche blieben erfolglos.
Er meinte, in einem schlechten Horrorfilm erwacht zu sein. Wie hießen sie nicht alle? »I am Legend«, »Last man on Earth«, »Der Omega-Mann« ... Und nun? Wie war der Titel seines Films?
Er würde ihn »Die Ruhe nach dem Tod« nennen, denn das war es letztlich, was er am wenigsten akzeptieren konnte: Um ihn herum herrschte eine Stille, wie sie im tiefsten Grab der Hölle vorherrschen mochte.
Schließlich entdeckte er einen Leichnam in schwarzer Motorradkluft. Die dazugehörige Maschine lag nicht weit von ihm. Es war die einzige Möglichkeit, um sich zwischen den zerstörten Autos einen Weg bahnen zu können. Carter startete die Yamaha und fuhr los. Ohne Helm raste er mit einem Höllentempo durch die Straßen, um die Stadt zu erforschen.
Mit Schaudern erblickte er tote Spaziergänger, die auf den Bürgersteigen lagen; in einem Frisiersalon saßen drei der Kunden wie Puppen in abnormen Stellungen auf den Sitzen; in einem Lebensmittelgeschäft lag der Kassierer über seiner Kasse, Zahlungswillige mit gezückter Geldbörse neben Lebensmitteln und Einkaufswägen in den Gängen; die Arbeiter der städtischen Müllabfuhr lagen tot neben umgestürzten Mülltonnen; an einer Bushaltestelle lehnten zwei tote Männer aneinander; in einem chinesischen Speiselokal hatten die Gäste ihr Ende zwischen aufgetragenen Gerichten gefunden; ein Zeitungsjunge lehnte tot an einem Laternenmast und seine Zeitungen wurden vom Wind davon getragen ... Carter bremste und nahm sich eine Zeitung, in der Hoffnung, eine Antwort auf all seine sich auftürmenden Fragen zu finden, doch auch dieser Wunsch blieb ihm verwehrt.
Verstört blickte er um sich, drehte sich im Kreis, fuhr mit seinen zitternden Händen durch seine schweißverklebten Haare und öffnete gleichzeitig seinen Mund zu einem Schrei, der alles an Wut in sich barg, Wut und Zorn und blinde Verzweiflung. Nachdem mit bebenden Lippen seine Stimme erstarb, sank er wie benommen auf die Knie und begann hemmungslos zu weinen.
Als er sich wieder ein wenig unter Kontrolle hatte, setzte er seine Erkundungstour fort. Der Schnapsladen, den er dabei entdeckte, war reichlich bestückt. Er bediente sich, ohne zu zahlen, da dies zweifellos niemanden mehr interessierte und begab sich wieder zurück auf die Straße. Carter wusste nicht, ob es sinnvoll war, sich in solch einer Situation zu betrinken, doch er sah keine andere Möglichkeit, wie er diesen Schock vorerst überwinden konnte.
Gäbe es noch einen lebenden Menschen in der toten Stadt, so hätte dieser Carter sehen können, wie der lachend über Leichen sprang, wie ein Storch auf den Brüsten einer toten Frau stolzierte, oder einen behaarten, italienischen Muskelprotz mit seinen Fäusten traktierte. Dann aber liefen wieder Tränen über seine Wangen und er wünschte sich, dass nicht er den Toten, sondern der lebende Italiener ihn verprügeln würde. Seine Verzweiflung transformierte sich in Trunkenheit und diese wiederum in neuerliche Verzweiflung.
Stunden später klappte er volltrunken über der Leiche einer alten Frau zusammen und einen Herzschlag darauf umgab ihn lediglich das kalte Dunkel glückseliger Bewusstlosigkeit.
3.
Christ war gerade mal sechs Jahre alt, als man ihn aus der rührseligen Obhut des Kindergartens herausriss, ihm eine Schultüte in den Arm drückte (und eine noch schwere Schultasche über die Schultern hängte), und ihn so ausgestattet auf eine Schule schickte, die gleichermaßen altehrwürdig und berüchtigt war, für all die Schlechtigkeiten, die Generationen von Schülern bislang darin erleben mussten.
Bis dato war Christs Leben ein behütetes. Am ersten Schultag jedoch misslang ihm der Versuch, den Inhalt seiner Schultüte zu beschreiben. Alle wussten in etwa, was in ihren Schultüten auf sie wartete, nur bei Christ verhielt sich die Sache anders. Besser gesagt: Wusste er sehrwohl, was darin war; nämlich nichts als heiße Luft und etwas Süßkram zur Tarnung.
Das war tragisch, für Christ selbst jedoch weitestgehend unerheblich, denn er wusste es nicht besser. Er hatte keine Ahnung darüber, dass die Schultüten seiner Mitschüler vollgestopft waren mit Spielsachen, Schulmaterialien, Buntstiften, Radiergummis und Linealen, Süßigkeiten und Knetgummi. Er wusste nicht, dass andere Kinder Eltern hatten, die ihre Kinder liebten, und alles dafür tun würden, dass es ihren kleinen Lieblingen am ersten Schultag an nichts fehlen würde. Christ ahnte nicht einmal, dass es Eltern gab, die ihre Kinder voll Liebe, Anstand und Geborgenheit erzogen, Eltern, die nicht bei jeder Kleinigkeit zuschlugen, die nicht jeden Tag Alkohol tranken, wie sein Vater es tat und nicht fortwährend Männerbesuch bekamen, wie seine Mutter, sobald der Vater einmal nicht da war. Für Christ war es vollkommen normal, in nicht normalen Verhältnissen aufzuwachsen, und so war all das für ihn in Ordnung und auch gar nicht schlimm.
Was schlimm war, war jener Moment, wo er mit knallrotem Kopf nicht wusste, was er sagen sollte. Er drückte die Schultüte an sich und bemerkte, dass diese nachgab. Er spürte die Leere darin. Die nicht vorhandene Liebe. Das Nichts, das ihn in der Realität dieser Schule Willkommen hieß.
Sein Herz pumpte kräftig, als er auf die Schultüten der anderen Kinder starrte, kurz nachdem die Lehrerin ihn befragt hatte. Er schaffte es noch nicht einmal, seinen Namen zu nennen. Alles, was er stattdessen nur zustande brachte, waren die Tränen auf seinen Wangen und das schluchzende Geräusch, das er von sich gab und das alle anderen Kinder zum Lachen brachte.
Es war ein prägender Moment im Leben des Jungen. Einer dieser Momente, an die man sich nie wieder erinnern wird, weil man sie aus der Notwendigkeit des Selbstschutzes und der leibeigenen Psychohygiene vergisst und verdrängt, die letztlich aber unser weiteres Leben bestimmen. Es sind diese Momente der Demütigung und der Pein, die sich erst im Laufe eines Lebens als besonders prägend für eben dieses herauskristallisieren.
Später – viel später einmal – war sich Christ sicher, dass sein Leben zu diesem Zeitpunkt eine Art Hieb auf den Hinterkopf bekommen habe, einer Delle in der Blechkarosserie eines Autos gleich, die er nie wieder würde ausgleichen können.
4
Es war eine Dunkelheit, die er glaubte zu kennen. Eine formbare Dunkelheit, welche als Schleier über seinen Augen lag, die sich nur langsam, nach und nach, Stück für Stück öffnen wollten. Das Dunkel begann sich in kleine, dünne Fetzen zu teilen. Wie schwebende, schwarze Löcher im Weltraum und dahinter lag nur ein Gang, eine klaffende Öffnung, die man durchschreiten musste, um in die Welt der Lebenden zu treten. Ein kleiner Schritt nur und man würde erwachen. Als Ben Carter diesen Schritt tat, musste er feststellen, dass der Traum, der sich in diesem Moment von ihm löste, gleichzeitig wiederkehrte.