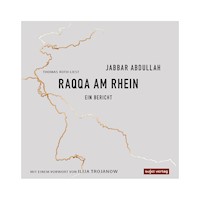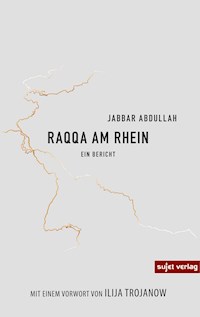
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sujet Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Zwei Jahre später – ich arbeitete mittlerweile am Römisch-Germanischen Museum und war gerade dabei, einen der Türme der mittelalterlichen Kölner Stadtmauer zu restaurieren – kamen plötzlich mehrere Streifenpolizisten auf mich zugeprescht und erklärten, jemand habe mich als Terroristen angezeigt. Auch darüber lächelte ich nur. Eine Arbeitskollegin erklärte mir später, an solche Dinge müsse ich mich gewöhnen, schließlich sei ich nicht nur Ausländer, sondern "auch noch Syrer". Ich lächelte also. Keine Ahnung, warum man in Zeiten von Kriegen und Soldaten, von Flucht, Diktatoren und Rechtsextremen so viel lächelt. Ich verspreche Ihnen, ein guter Geflüchteter zu werden, damit mich alle akzeptieren. Einer, der Schweinefleisch isst, der sich jeden Tag in den Bars betrinkt, der gegen den Bau von Moscheen ist und für ein Kopftuchverbot, einer, der schwarze Körper weiß macht und verhindert, dass auf der Straße, in der Schule und in der Universität eine andere Sprache gesprochen wird als nur die eine. Und der den Rechten in Parlament und Ministerien viele Sitze zugesteht."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jabbar Abdullah
RAQQA am RHEIN
Der vorliegende Text entstand zu einem Teil durch die enge Zusammenarbeit des Autors mit Sonja Oelgart, welche seine mündlichen Erzählungen ins Deutsche übertrug. Weitere Passagen, übersetzte Christine Battermann direkt aus Jabbar Abdullas arabischem Manuskript.
CIP - Titelaufnahme in die Deutsche Nationalbibliothek
© 2020 by Sujet Verlag
Raqqa am Rhein
Jabbar Abdullah
ISBN: 978-3-96202-613-4
Lektorat: Roberto Di Bella, Gerrit Wustmann
Umschlaggestaltung: Kai Kullen
Layout/Korrektorat: Lúcia Rodrigues Maio
Druckvorstufe: Sujet Verlag, Bremen
Printed in Europe
1. Auflage: 2020
www.sujet-verlag.de
VORWORT
von Ilija Trojanow
Es ist eine der wesentlichen Aufgaben der Literatur, Erinnerung zu wahren und Zukunft zu imaginieren. Das motiviert jede Erzählung, auch diese von Jabbar Abdullah. „An jeden Winkel (...)habe ich Erinnerungen. Sie zwicken mich immer wieder im Kopf, als wollten sie mir sagen: ‚Wir sind noch da! Vergiss uns nicht!‘“
Aus literarischer Sicht sind diese aufdringlichen Erinnerungen zugleich eine Herausforderung, weil sie andere, weniger traumatische, weniger einschneidende Erinnerungen überschatten oder gar auslöschen. Schreiben ist stets auch ein Bemühen, die Fragmente der eigenen beziehungsweise der gemeinsamen Erinnerung zusammenzufügen. Nichts anderes tut Jabbar Abdullah, auch wenn er als Flüchtling, der in einer vor wenigen Jahren ihm noch fremden Sprache schreibt, besonders widrige Umstände zu bewältigen hat: „Sie haben meinen Lieblingstisch in Flammen gesetzt, an dem ich so oft mit Papier und Stift gesessen hatte.“ Er muss einführen in eine fremde Welt, er muss die Details des Alltags beschwören, um die untergegangene Normalität zu vergegenwärtigen.
„Raqqa am Rhein“ ist ein Bericht über das Ausgeliefertsein gegenüber der Macht und der Gewalt. „Assads Regime hat meine Schule zerstört, und der IS hat die andere Schule geschlossen (...) unser Leben war schwarz geworden. Niemand konnte mehr den Blick in die Zukunft richten.“ Ohne sichtbare Zukunft herrscht eine unerträgliche Ohnmacht, die es zu überwinden gilt, mit einfachen Formen des Widerstands, seien sie auch so vordergründig hilflos wie das Besprühen der kleinstädtischen Mauern mit revolutionären Parolen gegen die Diktatur und ihre Propaganda. Auch wenn die Parolen schon am nächsten Tag entfernt werden, die Schrift an der Wand ist Ausdruck einer Gegenposition, einer anderen Erzählung, einer widerspenstigen Haltung. Und davon muss immer wieder berichtet werden.
Unvergesslich etwa die Beschreibung einer spontanen Demonstration an der Universität von Aleppo, die von Soldaten und Geheimdienstagenten in Zivil niedergeschlagen wird. Ein kurzer Atemzug der Freiheit, gefolgt von der Brutalität der Macht, die nicht einmal einen Hauch von Hoffnung zulassen will, zulassen darf.
Allerdings weiß ein leidgeprüfter Autor, der Zeugnis ablegt, von seiner Verpflichtung gegenüber den vielen anderen Erinnerungen: „Sie haben nicht nur meine Erinnerungen, sondern auch diejenigen der Millionen von Menschen, die dort gelebt haben, bombardiert.“ Deswegen richtet er seinen Blick, durchaus überraschend mitten in der Erzählung, auf zwei weitere Schicksale, so als könne der Einzelne dem Geschehenen mit eigener Stimme nicht gerecht werden, so als müsste die einzelne Stimme zu einem Chor erweitert werden, weswegen die bemerkenswerten Geschichten der Männer Moomin und Hussam zu vernehmen sind.
Jabbar Abdullahs Bericht endet mit einem Hoffnungsschimmer, der zärtlich ist (Euphrat und Rhein verschmelzen) und zugleich zutiefst politisch, denn seine Rettung ist Folge einer zivilisatorischen Errungenschaft (Asylgesetze, Flüchtlingskonvention, Willkommenskultur), die von xenophoben Teilen unserer Gesellschaft angegriffen, dämonisiert wird. Ohne diese humanen Rahmenbedingungen wäre dieses Buch nicht entstanden, könnte sein deutscher Autor mit syrischem Namen nicht am Ende schreiben: „Ich hoffe, dass das Leben wieder zu uns zurückkehrt .“
Die Hoffnung auf eine Rückkehr des Lebens hält einen am Leben. Wer diese Hoffnung anderen Menschen wegnimmt, der tötet.
PROLOG
Warum lesen Sie dieses Buch? Weil ich ein Flüchtling bin? Weil ich Ihnen eventuell ein paar spannende und interessante Geschichten von Liebe und Krieg in einem orientalischen Land mitbringe, die Sie sich gerne anhören würden? Oder haben Sie gestern ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht gelesen, sich für eine Weile in dieser fantastischen, faszinierenden Welt verloren und Interesse an mir entwickelt, weil ich für Sie einen der vierzig Sklaven verkörpere, welche die Prinzessin eines orientalischen Märchens erworben hat, um mit einem nach dem anderen ins Bett zu gehen?
Schließlich bin ich gewissermaßen von Geburt an Sklave, aufgrund meines Vornamens. Bedauern Sie mich nicht. Wundern Sie sich nicht über den Begriff. Ich wurde als Sklave geboren, um Lust zu verschaffen. Auch meine Mutter ist Sklavin. Jeden Tag von morgens bis abends mühte sie sich ab, Baumwolle zu pflanzen, damit ein paar reiche Völker an billige Textilien kamen. Sie hütete die Schafe, um uns Kinder mit Milch zu versorgen, sodass wir schnell groß wurden und den Krieg in all seiner Hässlichkeit erleben konnten. Um dann eines Tages in billige Schlauchboote zu steigen und überzusetzen in ein fernes Land namens Europa.
Zwar war meine Mutter Sklavin und ich noch ein unreifer Embryo, aber ich war noch frei. Am liebsten wäre ich mein Leben lang, neunzig Jahre statt nur neun Monate, in ihrem Leib geblieben, wäre darin zum Mann herangewachsen, gealtert und erst im Augenblick meines Todes zu Ihnen hinausgekommen oder als gebrechlicher, weißhaariger Greis, schwerhörig und mit trübem Blick. Aber frei.
Ich hätte mir so gewünscht, nicht hinauszumüssen in Ihre Welt voller Kriege und Tragödien wie jene von Hiroshima und Nagasaki, in eine Welt, die den Irakkrieg gesehen hat und den Völkermord an den Armeniern, nicht hinauszumüssen zu Kriegen um Öl und zu Revolutionen, die von den Großmächten zu Kriegen gemacht werden. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie niemals einen Text wie diesen zu lesen bekommen, dass ich mich Ihnen nie als Geflüchteter hätte vorstellen müssen. Denn weder möchte ich Ihr Mitleid noch Hunderte Male gefragt werden: „Wo kommen Sie denn her?“
So wurde ich selbst zum Sklaven. Mein Vater nennt mich schon seit meiner Geburt so, mein vollständiger Vorname lautet Abd Al-Jabbar. Und was bedeutet Abd? Sklave, Sklave Gottes des Allgewaltigen. Mit diesem Namen, den ich nie leiden konnte, bin ich groß geworden, mit ihm habe ich gelebt. Seinetwegen waren mir Gott und mein Vater verhasst. Und meine Mutter liebte ich, weil sie mich nie mit diesem Namen ansprach. Sie nannte mich immer Abûd. Ich hätte mir sehr gewünscht, mein Vater hätte mich in jener Nacht damals um meine Meinung gebeten, bevor er mit meiner Mutter schlief. Dann hätte ich ihn gebeten, sich wenigstens noch zwanzig Jahre Zeit mit mir zu lassen. Zwanzig Jahre? Ach nein, wenn er das getan hätte, wäre ich heute ein Kriegskind, und ein Heckenschütze schösse mir in den Kopf.
Und wie hätte ich es als Kind fertiggebracht, ganz allein vor dem Krieg zu fliehen? Wie hätte ich mit dem Pass meines Bruders reisen, illegal all diese Grenzen überwinden, durchs Meer schwimmen und mein Leben gegen Haie, Wale und die Soldaten der Küstenwache verteidigen sollen? Ich wäre jetzt ein Leichnam ohne Ausweis oder auch ohne jene Erkennungsmarken, wie sie Soldaten im Kampf tragen. Aber das sind sowieso alles nur Gedankenspiele.
Wer sagt denn, mein Vater hätte seine Lust überhaupt unterdrückt, auf meine Bitte gehört und sein Sperma zwanzig Jahre lang zurückgehalten?
Nein, Vater, ich bin stolz auf dich, dass du bei meiner Zeugung dein Verlangen nicht bezwungen, und auch auf dich, Mutter, dass du damals nicht die Pille genommen hast. Ich bin stolz, als Sklave geboren, mich befreit und mich Gott widersetzt zu haben, und statt Abd nenne ich mich nun Jabbar. Jabbar der Allgewaltige, so lautet einer der neunundneunzig Namen Gottes. Damit bin ich Gottes Bruder, Kollege, Freund – oder gleichsam wie Gott.
Meine Mutter heißt Maryam, und Maryam war auch die Mutter Jesu. Jesus ist Gottes Sohn, oder Gott selbst, und ich habe Gott zum Großvater. Meine Mutter ist also irgendwie auch Gottes Ehefrau. Mein Vater aber ist nicht Gott, denn er heißt Hussain, nach dem Enkel des Propheten Muhammad. Mein Vater interessiert mich auch gar nicht, denn er wurde als Mann geschaffen.
Wie schön wäre es, wäre er eine Frau wie meine Mutter! Ich mag Männer nicht. Die einen fangen Kriege an, die anderen arbeiten als Schlepper und überreden die, die sich vor dem Krieg retten konnten, zur Flucht übers Meer. Ich hasse auch das Meer, es ist genauso mörderisch wie die Männer. Mein Vater hat mich nicht gezeugt, weil er mich haben wollte, sondern nur, weil er damals seine Lust nicht unter Kontrolle hatte.
Ich hasse diese Triebe, denn sie sind wie der Mann, sie erheben sich in seinem Körper, kämpfen gegeneinander an und begehen ständig den Fehler, Kinder wie mich zu zeugen. Nur, damit wir dann im Krieg leben. Damit wir von einem Mann, der in seinem korrekten Anzug nur aussieht wie ein Demokrat, getötet oder von einem Milizionär unterjocht werden, der uns Kinder als Soldaten in den Bergen kämpfen lässt, wo wir zu Wilden heranwachsen und uns darauf vorbereiten sollen, Helden und Schlachtlämmer zu werden, die sich seinetwegen und für ihn opfern.
Wäre der Krieg nicht gewesen, hätte ich mein Zuhause nicht verlassen. Dann wäre ich Sklave geblieben. Ich hätte meinen Namen nicht ändern können und auch nicht schreiben, dass ich sie alle hasse: Gott, die Baath-Partei und „meinen“ Staatspräsidenten, die Mörder Rosa Luxemburgs, die Balkanroute und die Pläne sämtlicher Schlepper, Kriegspiloten und Artillerieschützen. Und ich hätte nicht sagen können, dass meine Mutter Gottes Ehefrau ist und ich Gottes Kollege und Enkel bin. Ich bin kein religiöser Mensch. An den Moscheen liebe ich nur die Architektur und die weichen bunten Teppiche. Die krächzende Stimme des Muezzins aber, der seit zehn Jahren in der Moschee neben unserem Haus zum Gebet ruft, kann ich nicht ausstehen.
Ein paarmal habe ich sogar selbst zum Gebet gerufen, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Ich hatte nämlich beim Freitagsgebet einmal gehört, wie der Sheikh zu den Betenden sagte, das mache Gott zornig und erschüttere seinen Thron. Und Gott zornig machen wollte ich, das war meine einzige Waffe. Ich wusste, eines Tages würde er auch mich gegen sich aufbringen, indem er einen zweijährigen Jungen namens Aylan ganz allein, ohne seine Mutter, tot an eine ferne Küste wirft. Und damit, dass er die Tyrannen dazu bringt, meinen einzigen Freund mit einer Kugel in den Kopf zu töten. Und indem er meine Mutter vier Jahre lang in einem Zelt der Vereinten Nationen im Libanon hausen lässt.
Raqqa im Libanon
Die Bewohner von Raqqa sind einfache Menschen. Die meisten von ihnen sind in Landwirtschaft und Handel tätig oder arbeiten in der städtischen Verwaltung. Viele besitzen außerdem ein eigenes Stück Land, mehr oder weniger groß, auf dem sie im Sommer und im Winter die Saat ausbringen.
Doch sind in den letzten Jahren die Erträge immer weiter gesunken. Sie reichen nicht mehr aus, um eine Familie zu ernähren. Dürreperioden sind eine Ursache, ebenso wie gestiegene Preise für Kraftstoff, Saatgut und Dünger. Ihre Ernte müssen sie an den Staat verkaufen, der jedoch die Preise bewusst drückt. Seine Erzeugnisse selbst auf dem Markt anzubieten, ist verboten. Wer doch dabei erwischt wird, muss mit empfindlichen Geldbußen rechnen. Den Bauern bleibt nichts anderes übrig, als sich dem Diktat von oben zu fügen.
Um sich das teure Saatgut leisten zu können, müssen sie sich wiederum vom Staat Geld leihen, ein Kredit, der bereits innerhalb eines Jahres zurückzuzahlen ist. Wem dies nicht gelingt, dessen Land wird vom Staat beschlagnahmt und weiter verkauft, ein Teufelskreis. Dieses Schicksal ist auch meinem Großvater widerfahren, als er seinen Kredit erst nach fünf Jahren tilgen konnte.
So bleibt vielen Landwirten keine andere Möglichkeit, als in andere Regionen wie Damaskus oder Latakia auszuweichen oder sogar ins Ausland zu gehen, um dort den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie zu verdienen.
Viele Männer gehen zum Beispiel in den Libanon. Manchmal ziehen auch ganze Familien um. Sie nehmen harte Arbeit in Kauf, um über die Runden zu kommen und ihren Kindern eine gute Ausbildung bieten zu können.
Ich bin selbst viele Male in den Libanon gefahren, zuerst 2001 nach Tarablus, auch Tripoli genannt, die zweitgrößte Stadt des Landes. Damals besuchte ich noch die 11. Klasse, und es war das erste Mal überhaupt, dass ich meine Stadt verließ, um in den Sommerferien dort auf dem Bau zu arbeiten. Auch andere Mitglieder meiner Familie waren schon oft zuvor zu diesem Zweck in den Libanon gegangen. Bis dahin kannte ich nur den Namen unseres Nachbarlandes und die Erdnüsse, die die Verwandten jedes Mal von ihren Reisen dorthin mitbrachten.
Nun war es an mir, diese Erfahrung zu machen. Zu der Zeit lebten dort bereits drei meiner fünf Geschwister: ein älterer Bruder und meine zwei Schwestern. Mein Bruder arbeitete als Maler bei einer Baufirma, wo er einen Ferienjob für mich gefunden hatte. Meine beiden Schwestern waren Erntehelferinnen. Wir lebten alle vier zusammen in einer kleinen Holzbaracke. Sie stand, gemeinsam mit vielen anderen, auf einem großen, unbefestigten Grundstück, gleich neben der Hauptstraße von Tarablus. Die Lage war zwar sehr zentral, doch die Wohnverhältnisse waren miserabel, so wie für alle Syrer, die dort unsere Nachbarn waren. Auf etwa 40 x 40 Metern drängten sich hier rund zwanzig Hütten. Ihre Dächer bestanden nur aus einer Plastikplane, und wenn es nachts regnete, war das das Prasseln der Regentropfen so laut, dass man nicht schlafen konnte.
Jede Hütte war in einzelne Bereiche unterteilt, nur durch Stoffbahnen voneinander getrennt: eine behelfsmäßige Küche, eine Ecke, die als Bad diente sowie der eigentliche Wohnbereich, wo wir auch schliefen. Ich erinnere mich noch an die kleine Lampe, die in der Mitte des Raumes am Stützbalken hing und wild hin- und herschaukelte, wenn wieder einmal der Wind durch die Bretter pfiff. Es waren nicht mehr als 17 Quadratmeter, für die wir dem Vermieter dieser Hütten jeden Monat 200.000 Libanesische Lira zahlten, also etwa 125 Euro.
Meine Aufgabe in der Baufirma bestand darin, die Wände vor dem Auftragen der Farbe ordentlich abzuschleifen. Nach meinem ersten Tag waren Haare, Gesicht und Kleidung vollkommen von weißem Staub überzogen. Die Arbeit begann um sieben Uhr morgens und dauerte bis sieben Uhr abends. Für zwölf Stunden harter Arbeit gab es gerade einmal neun Dollar.
Ich höre immer noch das Hupen des Transporters, der meine zwei Schwestern jeden Morgen um vier Uhr abholte und sie gemeinsam mit anderen Arbeiterinnen und Arbeitern von der Stadt auf die Felder fuhr. Zum Glück konnten ich und mein Bruder noch zwei Stunden weiterschlafen, doch jeden Morgen hörte ich, halb noch im Schlaf, die schweren Schritte meiner Schwestern wie der anderen Frauen und Männer draußen auf dem Kies. Ihre täglichen Strapazen waren eines der ‚Geschenke‘, welche das Assad-Regimes seinen Menschen machte, die anders kaum genug zum Überleben verdient hätten.
Brot und Geburt
Die Häuser auf dem Land in der Gegend um Raqqa sind in der Regel sehr großzügig geschnitten. Alle Zimmer gehen von einem Innenhof ab, der im Sommer als Terrasse genutzt wird. Jedes Haus ist von mindestens einem halben Hektar Land umgeben, auf dem sich Olivenhaine, Weinstöcke oder auch Gemüsefelder befinden. Auch unsere Familie erntete im Sommer hier Tomaten, Auberginen, Zucchini, Paprika und Okraschoten, im Winter Rettich.
Normalerweise verfügt jedes Haus über vier oder fünf Räume, alle ebenerdig und mindestens fünfundzwanzig Quadratmeter groß. Der arabischen Tradition entsprechend besteht die Einrichtung oftmals nur aus einem großen buntgewebten Teppich und einer Vielzahl von Sitzkissen, die rundum an den Wänden ausgelegt werden. Am Abend kommen oft Verwandte, Freunde und Nachbarn zu Besuch, manchmal mehrere Gruppen auf einmal. Sie erscheinen spontan, einfach dann, wenn es ihnen in den Sinn kommt. Dann stehen sie vor der Tür, rufen laut „Besitzer des Hauses!“ und finden sogleich Einlass. Die Gastfreundschaft gebietet es, dass allen Besuchern gleich Tee und Kaffee angeboten wird. Im Sommer sitzt man dann gemeinsam draußen auf der Terrasse, vor allem nachts, wenn oft noch über dreißig Grad herrschen. Im Winter kommt man im großen Gästeraum zusammen und versammelt sich um die improvisierte Ölheizung. Entgegen dem weit verbreiteten westlichen Klischee sitzen Frauen und Männer hierbei immer zusammen, unterhalten sich und genießen das Beisammensein.
Meine Mutter weiß nicht, wann genau ich geboren wurde. Natürlich ist das Datum in den Familiendokumenten verzeichnet, aber sie kann weder schreiben noch lesen. Wenn sie sich also mit anderen über meine Geburt unterhält, nennt sie keine Jahreszahl, sondern verbindet das immer mit anderen Ereignissen aus jenem Jahr. Zu einer Freundin sagt sie dann so etwas wie: „Jabbar kam im gleichen Jahr auf die Welt, als dein Vater starb.“
Ich habe ihr bei meiner Geburt keine Schmerzen bereitet, so erzählt sie mir immer, noch sonst das Familienleben durcheinandergebracht. Sich selbst kann man natürlich nicht dabei beobachten, wie man auf die Welt kommt, aber das Leben hat mir das einzigartige Geschenk gemacht, die Geburt meiner kleinen Schwester miterleben zu dürfen. Das war 1998 und ich war gerade neun.
An jenem Tag bin ich am Nachmittag aus der Schule nach Hause zurückgekommen. Meine Mutter lag im großen Wohnzimmer, und ich hörte, wie sie vor Schmerzen stöhnte. Sie lag auf einer alten, dünnen Matratze, die deshalb so zerschlissen war, weil sie schon seit Jahren benutzt wurde oder vielleicht auch, weil mein Vater sich für gewöhnlich am Nachmittag mit seinem schweren Körper darauf legte. Meine Mutter schrie und schaute nach oben an die Decke. Aber ich verstand nicht, was es dort zu sehen gab, außer der rauen Betondecke des Zimmers, aus der hier und da immer noch einzelne Eisenstangen ragten. Denn beim Bau des Hauses hatte das Geld nicht gereicht, um auch die Decke ordentlich zu verputzen.
Eine Stunde später kam meine Tante. Vielleicht hatte ein Nachbarskind sie gerufen. Sie sah, dass die Wehen bereits eingesetzt hatten und lief direkt in die Küche, um heißes Wasser in einer großen Schüssel zu holen.
Dann nahm sie zwei weiße Tücher aus einer Nische, die ursprünglich als Fenster geplant, aber dann doch zugemauert worden war und nun von meiner Mutter als Regal genutzt wurde. Ich kannte diese beiden Tücher genau: sie waren einmal Teil der Dschallabija meines Vaters gewesen; so nennt man im Nahen Osten das traditionelle hemdartige Gewand. Ich weiß nicht mehr, warum mein Vater sie nicht mehr tragen wollte. Möglicherweise war sie ihm zu klein geworden. Jedenfalls hatte er darin immer eine gute Figur gemacht. Die Schreie meiner Mutter wurden immer lauter. Tränen liefen mir die Wangen herunter wie Regentropfen an einer Fensterscheibe. Doch meine Tante beruhigte mich. „Deiner Mutter wird es gleich besser gehen und sehr bald bekommst du ein neues Schwesterchen oder Brüderchen“. Dann hörte ich einen Ruf von draußen. Es war unsere Nachbarin Dalal, die beste Freundin meiner Mutter.
Meine Mutter lag auf der Matratze, die beiden Frauen saßen neben ihr, die eine am Kopfende, die andere am Fußende. Was da passiert, habe ich als Kind nicht verstanden. Meine Mutter schrie vor Schmerz, während diese Frauen emsig durch den Raum eilten, ihre Aufgaben und Plätze wechselnd.
In der Zwischenzeit hatte ich mich auf einen der vielen bunten Teppiche im Raum gekauert und beobachtete aufmerksam, was geschah. Die Zeit verging und die Schreie meiner Mutter hielten an. Meine Tante und die Nachbarin waren besorgt, man sah das ihren Gesichtern an. Plötzlich hörte ich die Schreie eines Kindes. Die Nachbarin sagte: „Es ist ein Mädchen und es geht ihr gut“. Meine Mutter war ruhig geworden. Ich konnte mich aber dem kleinen, schönen Wesen noch nicht nähern. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich hatte Angst vor ihm. Aus einer mitgebrachten Tasche nahm meine Tante eine weiße Decke und wickelte meine Schwester darin ein. Sie lächelte.
Hatte ich damals bei meiner Geburt auch so ausgesehen? Hatten sich die Frauen ebenfalls über mich gebeugt, um den kleinen und weichen Körper in Augenschein zu nehmen? Und war die Decke, die meine Mutter nun zudeckte, die gleiche gewesen? Brachten alle Frauen ihre Kinder auf diese Weise zu Hause zur Welt? Warum hatte die Nachbarin meines Onkels zweimal ein Baby aus dem Krankenhaus mitgebracht?
Die Nachricht der Geburt meiner Schwester verbreitete sich in Windeseile und immer neue Nachbarinnen trafen ein, um das Neugeborene zu sehen und meine Mutter zu beglückwünschen. Alle zehn Minuten musste ich aufstehen und die Tür aufmachen. Das Zimmer war schließlich voller Frauen, und meine Mutter lag noch immer auf ihrer alten, zerschlissenen Matratze neben der Wand unter dem zugemauerten Fenster.
Weil damals der Preis für Metall so hoch war, hatte mein Vater schließlich seine Pläne aufgegeben, überall ordentliche Fensterrahmen einzubauen. Wozu braucht man auch so viele Fenster, hatte er sich wohl gedacht. Wichtiger war, dass es vor dem geschlossenen Fenster eine Fensterbank gab, auf der meine Mutter die Kleidung meiner Schwester und die Geschenke der Nachbarinnen ablegen konnte. Aber wo waren all die Geschenke geblieben, die all diese Frauen zu meiner Geburt mitgebracht haben? Hatte sie am Ende nichts davon behalten, sondern alles zum gleichen Anlass weiterverschenkt? „Wir haben nicht so viel Geld, um jeder Frau ein Geschenk zu machen, wenn sie ein Kind gebärt“, hatte mir meine Mutter einmal gesagt.
Ungefähr zwei Stunden nach der Geburt meiner Schwester hörte ich von draußen eine tiefe Stimme. Es war Vater.
Ich lief zur Tür und öffnete sie vorsichtig. Trotzdem gab es ein lautes Geräusch. Doch niemand hörte es und sicher auch meine neugeborene Schwester nicht, denn die Stimmen der Frauen drinnen übertönten alles andere.
Mein Vater stand noch im Hof, unterhielt sich mit einem Passanten. In seinen Händen hielt er drei blaue Tüten. Mein ganzes Interesse galt plötzlich dem Inhalt dieser Tüten, in denen ich etwas Leckeres vermutete. Man konnte nämlich schon an der Form erkennen, dass in einer davon Bananen sein mussten. Ich versuchte vergeblich, sie aus seinen großen Fingern zu lösen. „Jabbar, lass jetzt die Tüten“, sagte mein Vater, als er seine Unterhaltung endlich beendet hatte. „Wie geht es deiner Mutter?“.
Ich berichtete ihm die Neuigkeiten und erzählte auch von den Frauen, die gekommen waren: Dalal, Kabna, Fatha, Zahra und all die anderen. Er lächelte und gab mir eine Banane aus der Tüte. Ich sollte sie jedoch draußen essen, um mich nicht mit den Nachbarskindern zu streiten, die sich natürlich alle im Haus bei ihren Müttern tummelten. Doch ich lief stattdessen in die Küche und legte die Banane in einen Topf, um sie später zu essen.
Mein Vater betrat das Wohnzimmer, ich folgte ihm. Die Frauen begannen mit den üblichen Glückwünschen, und wir dankten jeder einzelnen. Mein Vater setzte sich genau dorthin, wo ich vorher gesessen hatte und bat mich, ihm ein Glas Tee zu bringen. Ich reichte es ihm und lief dann schnell zurück in die Küche, um nach meiner Banane zu schauen. Als ich zurückkam, hatte mein Vater sein Glas bereits geleert. Er trinkt sehr gerne Tee. Allerdings bat er mich nicht, sein Glas wieder aufzufüllen, wie er sonst getan hätte, wohl weil er gerade so in sein Gespräch mit Zahra vertieft war. Sie unterhielten sich vermutlich über Dinge wie Weizenanbau, schlechte Ernten oder auch darüber, wie schwer es sei, die Kredite zu tilgen.
Auch die Nachbarin hatte ihren Tee fast ausgetrunken, so schien es mir. Da Zahra das Glas in ihrer großen, dunklen Hand hielt, konnte ich das nicht genau erkennen. Doch als sie sich an der rechten Schulter kratzte, musste sie es auf den Boden stellen. Es war tatsächlich schon leer. Ich holte also rasch die Teekanne, die in der Mitte des Raumes auf einem alten, schon etwas rostigen Tablett stand. Mein Vater sagte: „Gieß bitte vorsichtig ein, damit du nichts verschüttest und womöglich Zahras Hände verbrühst!“ Ich goss den Tee in hohem Bogen ein und da der Tee bereits gesüßt war, schäumte er. Viele Leute mögen ihren Tee so, gilt doch ein schöner Schaum auch als Zeichen der besonderen Wertschätzung der Gäste. Auf die gleiche Weise füllte ich danach auch Vaters Glas wieder auf.
Alle Gäste saßen auf dem Boden, denn in diesem Raum gab es weder Tisch noch Stühle, sondern nur einen großen Teppich sowie viele breite und schmale Kissen. Meine Mutter legte im Winter noch ein paar Matratzen auf den Teppich, um sich vor der Kälte zu schützen, die vom Boden her heraufkroch. Sie hatte sie von einem fahrenden Händler aus Aleppo erworben. Einen ganzen Monat hatte sie als Erntehelferin gearbeitet, um das Geld dafür zusammenzusparen.
Die Nachbarinnen machten sich schließlich eine nach der anderen wieder auf den Weg nach Hause. Und jede einzelne von ihnen wurde von meinem Vater persönlich verabschiedet. Manchmal begleitete er sie sogar bis zum Gartentor, um das Gespräch noch zu beenden. Als dann endlich alle fort waren, setzte er sich zu meiner Mutter, ganz nahe an ihren Kopf. „Wie geht es dir? Geht es dir besser? Ich habe Bananen mitgebracht. Iss davon, sie geben dir neue Kraft“. Als ich das hörte, erinnerte ich mich wieder an meine Banane. Ich rannte in die Küche und aß sie schnell auf, in der Hoffnung, ich bekäme noch eine neue.
Als ich zurück ins Zimmer kam, waren alle Besucher fort. Nur meine Mutter und mein Vater saßen noch auf ihren Plätzen. Mein Vater näherte sich meiner kleinen Schwester und berührte ihre feinen Gesichtszüge mit seinen großen Fingern. Sie schlief ganz ruhig weiter. Vater schälte eine der Bananen und reichte sie meiner Mutter. Ich legte mich neben sie. Sie biss ein kleines Stück von der Frucht ab. „Hast du auch eine Banane bekommen?“, fragte sie mich. „Ja, ich habe ihm schon eine gegeben“, antwortete mein Vater und machte sich sodann auf den Weg, um das Wudu durchzuführen, die rituelle Waschung. Denn er hatte an dem Tag bisher weder das Zuhr- noch das Asr-Gebet gesprochen, also das zweite und dritte der fünf obligatorischen Gebete im Islam.