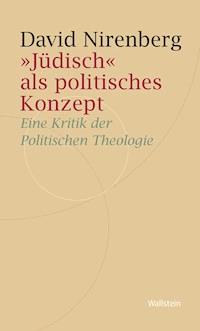Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Das mittelalterliche Jahrtausend
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Über die Verbindung religiöser und rassistischer Diskriminierung. Das Konzept unterschiedlicher menschlicher »Rassen« sowie daraus resultierender Rassismus werden häufig als Erscheinungen der Moderne angesehen, die biologisches Wissen und biopolitisches Denken voraussetzten. Doch die Diskriminierung und Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer biologischen Herkunft ist weitaus älter und lässt sich mindestens bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Wie lässt sich die lange Geschichte dieser kulturellen Grenzziehungen verstehen, und was lässt sich daraus für die heutigen Erscheinungsformen des modernen Rassismus lernen? Als international anerkannter Experte für die Geschichte jüdischer, christlicher und islamischer Kulturen verschränkt David Nirenberg in diesem Essay die Betrachtung von biologisch geprägter Diskriminierung und Verfolgung mit der religiösen Diskriminierung von Menschen. Am Beispiel der kastilischen Christen im 14. und 15. Jahrhundert sowie der muslimischen Almohaden in Nordafrika im 11. und 12. Jahrhundert zeigt er, wie unterschiedliche religiöse Kulturen Konzepte hervorbrachten, die bemerkenswerte Ähnlichkeiten zu moderner rassistischer Diskriminierung aufwiesen. Damit fragt er letztlich nach der Geschichte einer Verbindung von kulturellen Konzepten der Ähnlichkeit und Differenz mit Ideen der biologischen Reproduktion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAS MITTELALTERLICHE JAHRTAUSEND
Herausgegeben von Michael Borgolte
Band 10
David Nirenberg
Rassendenken und Religion im Mittelalter
Über Ideen zur somatischen Reproduktion von Ähnlichkeit und Differenz
Aus dem amerikanischen Englisch von Karin Wördemann
WALLSTEIN VERLAG
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2023
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf
© SG-Image unter Verwendung der Titelillustration eines Drucks (um 1500) des ›Tratado del Alborayque‹ (1455/65) gegen conversos in Kastilien. Das Mischwesen al-burāq, das mythologische Reittier Mohammeds, soll hier die angebliche Unreinheit der Abstammung dieser jüdischstämmigen Christen verbildlichen. Hinweis: Einige Körperteile wurden zum Zwecke der einfacheren Erkennbarkeit rot eingefärbt.
Lithographie: Wallstein Verlag, Göttingen
ISBN (Print) 978-3-8353-5456-2
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8488-0
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8489-7
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Der Streit um die ›Reinheit des Blutes‹ von conversos im iberischen Spätmittelalter
2. Biokulturelle Diskurse über jüdische Abstammungslinien bei den Almohaden seit dem Hochmittelalter
3. Die Suche nach den Ursprüngen des mittelalterlichen Rassendenkens
4. Rassendenken und Religion: Wie weit können wir zurückgehen?
5. Ausblick: Eine Geschichte der miteinander verflochtenen Formen religiöser Ideen über somatische Reproduktion von Gleichheit und Differenz
Zu Person und Werk des Autors
Anmerkungen
Vorwort
Diesem Band liegt ein Vortrag zugrunde, den Prof. Dr. David Nirenberg (Institute for Advanced Study, Princeton) am 6. Dezember 2021 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gehalten hat, auf Einladung von Dr. Jörg Feuchter (Akademie) und Prof. Dr. Dorothea Weltecke (Humboldt-Universität zu Berlin). Es handelt sich also nicht, wie sonst in der Reihe »Das mittelalterliche Jahrtausend« üblich, um die Druckfassung eines Jahresvortrags des Mittelalterzentrums der Akademie. Der Band ergänzt jedoch die Serie von Betrachtungen des Mittelalters aus globaler Perspektive um einen außerordentlich wichtigen Beitrag. Der Reihenherausgeber und die Veranstalter des Vortrages sind David Nirenberg sehr dankbar, dass er das Manuskript zur Publikation zur Verfügung gestellt hat.
Denn der weltweit hoch angesehene Historiker der Judenfeindschaft leistet hier eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit einem viel diskutierten Thema, der Frage nach der Geschichte des Rassismus und besonders danach, was sie mit der Religion zu tun hat. David Nirenberg zeigt, dass das Rassendenken im Mittelalter bei Christen wie Muslimen durchaus schon vorhanden war, seine Ursprünge aber dennoch nicht in dieser Epoche und diesen Religionen liegen. Vielmehr plädiert er überzeugend dafür, die Debatte über den historischen Rassismus nicht auf die Suche nach einem einzelnen Anfangspunkt und auch nicht auf die monotheistischen Religionen zu verengen. Er regt an, breiter und tiefer über den Zusammenhang rassistischer Diskriminierung mit religiösen Vorstellungen über die körperliche Reproduktion von Ähnlichkeit und Differenz nachzudenken. Solche Vorstellungen findet er in vielen religiösen Kulturen, die von der neolithischen Revolution geprägt wurden, also dem menschheitsgeschichtlichen Übergang zu Ackerbau und Viehzucht.
Die redaktionelle Betreuung der Druckfassung übernahm Jörg Feuchter.
Berlin, im März 2023
Michael BorgolteJörg FeuchterDorothea Weltecke
Einleitung
Rasse und Religion, die Schlüsselwörter in meinem Titel, sind jeweils Gegenstand neuer Kontroversen, während wir gerade in das dritte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts eingetreten sind. Unter Religionswissenschaftlern besteht eine zunehmend einflussreiche Schule darauf, dass zwar die Zweckmäßigkeit des Begriffs der ›Religion‹ für viele verschiedene Zeiten und Orte lange für selbstverständlich gehalten wurde, die Bezeichnung jedoch ein Produkt der westlichen Moderne sei und jeden vormodernen oder nichtwestlichen Gegenstand verzerre, auf den sie angewendet werde.[1] Unter denjenigen, die Rassekategorien, Rassendenken und Rassismus erforschen, verläuft die Debatte mehr oder minder völlig umgekehrt: Die Anwendbarkeit des Begriffs ist seit dem Zweiten Weltkrieg größtenteils auf die westliche Moderne beschränkt gewesen, und die unbotmäßigen Schulen sind hier diejenigen, die behaupten, er biete etwas, was für das Verständnis früher Zeiten oder anderer Kulturen von Nutzen sei. In einem solchen Kontext mag das Projekt, mit dem ich beschäftigt bin – eine lange und kulturell vielgestaltige Geschichte des Bereichs von Diskriminierungen, die wir ›Rassismus‹ nennen, und die Rolle der Religion für die Erscheinungsform dieser Diskriminierungen – besonders abwegig erscheinen. In diesem Essay werde ich versuchen, deutlich zu machen, dass wir aus einer langen ›Geschichte von Rassendenken und Religion‹ trotz der andauernden und unvermeidlichen Skepsis hinsichtlich der Stabilität unserer Fachausdrücke und Begriffe doch viel über die Vergangenheit und Gegenwart lernen können.
Insbesondere wenn es um den Begriff der Rasse geht, ist von vielen abgestritten worden, dass dieser überhaupt eine nennenswerte Geschichte hat. Der Anthropologe Ashley Montagu, federführender Autor der UNESCO-Erklärung The Question of Race von 1950, hat dies 1942 in seinem Buch Man’s MostDangerous Myth. The Fallacy of Race so ausgedrückt, indem er sich auf das damals naheliegende Beispiel der Juden bezog. Über viele Jahrhunderte habe gegolten: »Was immer man gegen sie hatte, wurde nie klar definierten biologischen Gründen zugeschrieben. Die ›rassenbezogene‹ Interpretation ist eine moderne ›Entdeckung‹. Das ist der wichtige Punkt, den es zu verstehen gilt. Der Einwand gegen irgendwelche Menschen aus ›rassischen‹ oder biologischen Gründen ist praktisch eine ganz und gar moderne Erfindung.«[2]
Viele kompetente Historiker stimmen heute der Meinung zu, dass wir nur in der Moderne von ›Rasse‹ sprechen sollten, geben aber unterschiedliche Gründe für diese Einschränkung an. Einige betonen wie Montagu das Fehlen eines hinreichenden biologischen Wissens vor einem bestimmten Zeitpunkt in der modernen Geschichte der Wissenschaft. Andere folgen Michel Foucault und verstehen Rassismus als das Erzeugnis einer unverkennbar modernen und westeuropäischen Form von Biopolitik: Im Zuge der Kämpfe um Souveränität im 17. Jahrhundert wurden mittelalterlich-korporatistische Ideen von der Gesellschaft als einer organischen Einheit umgewandelt in Metaphern für die Gesellschaft, die diese als einen Kriegszustand zwischen zwei unversöhnlichen Gruppen oder Körpern schildern.[3] Wieder andere verweisen auf die europäische Besiedlung Nord- und Südamerikas und den darauf folgenden transatlantischen Sklavenhandel als Ursprünge von Rassendenken und Rassismus. Noch andere machen darauf aufmerksam, dass das Wort ›Rasse‹ selbst relativ modern ist, denn im Englischen trat es vor der Mitte des 16. Jahrhunderts im semantischen Feld der Züchtung oder Fortpflanzung gar nicht in Erscheinung.[4]
Keines dieser Argumente sollte uns daran hindern, die lange Geschichte des Begriffs ›Rasse‹ zu untersuchen. Argumente, die sich auf das biologische Wissen berufen, können zum Beispiel gar nicht uneingeschränkt gelten, und zwar nicht nur deswegen, weil viele Gesellschaften (wie wir noch sehen werden) ein umfangreiches Wissen über Züchtung und Fortpflanzung besaßen, sondern auch deshalb, weil selbst noch der vorgeblich stärkste biologische Rassismus kulturell bleibt – was ebenso wichtig ist. So erklärt sich die Unzulänglichkeit eines verhältnismäßig gängigen Arguments, das sich dagegen richtet, im Hinblick auf das Mittelalter von ›Rasse‹ zu sprechen: »Während die Sprache des Rassendenkens [in mittelalterlichen Quellen, Anm. d. V.] – gens, natio, ›Blut‹, ›Abstammung‹ etc. – biologisch ist, war dessen mittelalterliche Realität fast gänzlich kulturell.«[5] Wenn diese Verteidigung angemessen wäre, gäbe es überhaupt kein Zeitalter, bei dem wir von Rassendenken oder Rassismus sprechen könnten. Die Critical Race Theory hat uns gelehrt, dass ein ›wirklich biologischer‹ moderner Rassismus nicht existiert. Wir könnten genauso gut sagen: »Während die Sprache des Rassendenkens in den modernen Quellen biologisch ist, ist dessen moderne Realität fast gänzlich kulturell«. Sowohl in den mittelalterlichen als auch in den modernen Fällen sind die Systeme der Diskriminierung ein Ergebnis kultureller Arbeit, nicht der biologischen ›Realität‹.[6]
Um diesen Punkt noch einmal anders auszudrücken: Niemand hätte Bedenken, das Aufblühen europäischer Theorien über Schwarze im 18. Jahrhundert als ›Rassendenken‹ zu qualifizieren, doch viele davon beruhten auf Theologien, Reproduktionstheorien und Bio-Logiken, die denen sehr ähnlich sind, die zuvor schon über Jahrtausende verfügbar waren, wie man an den Wettbewerben erkennen kann, die von prominenten intellektuellen Organisationen der Zeit abgehalten wurden und die sich damit befassten, die Unterschiedlichkeit zwischen den Menschen zu erklären. Einige einflussreiche Theoretiker des späten 18. Jahrhunderts, wie Immanuel Kant und Johann Friedrich Blumenbach, stützten sich bei ihrem Rassendenken mehr auf Versionen der Klimatheorie als auf genetische Argumente, selbst wenn jene Theorien damals unter vielen Naturwissenschaftlern bereits in Verruf gerieten. Umgekehrt wurden viele Beispiele für die Hybridität und ihre Gefahren, die bei rassistischen Autoren im 19., 20. und 21. Jahrhundert hoch im Kurs stehen, selbst nach der großen Verbreitung der darwinistischen Evolutionslehre weiterhin einem Bereich landwirtschaftlicher Tierzucht entnommen, der bereits in der antiken und der mittelalterlichen Welt gut bekannt war.[7]
Argumente, die sich am Vokabular festmachen, finde ich ebenfalls nicht überzeugend. Die Tatsache, dass das Wort ›Rasse‹ nicht vor dem 18. Jahrhundert und das Wort ›Antisemitismus‹ nicht vor dem 19. Jahrhundert Einzug ins Deutsche hielten, lässt (anders als manche unterstellt haben) nicht darauf schließen, dass in der früheren Geschichte der deutschsprachigen Länder keine ähnlichen Ideen feststellbar sind. Das Wort ›Ambivalenz‹ wurde im Deutschen oder im Englischen erst im 20. Jahrhundert geprägt, doch die Erfahrung eines Konflikts widerstreitender Gefühle haben Menschen sicherlich gemacht, bevor das Wort existierte. Ohne die Bedeutung der Etymologie irgendwie schmälern zu wollen, sollten wir anerkennen, dass die Geschichte von Begriffen nicht auf unsere Kenntnis von Substantiven verkürzt werden kann.[8]