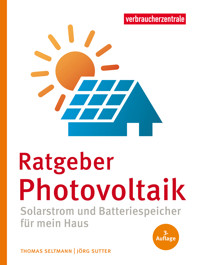
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbraucherzentrale NRW
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Sparen Sie Energie - und schonen Sie die Umwelt Wer ein Stück weit unabhängig von den Preiskapriolen der Energieversorger werden will, kümmert sich um die Anschaffung einer Photovoltaikanlage. Dabei unterstützt der neue Ratgeber mit wertvollem Praxiswissen. Er beantwortet alle wichtigen Fragen rund um die eigene Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, die Ladestation fürs E-Auto und die Anbindung an die Wärmepumpe - – und bietet in der 3. Auflage aktuell Wissenswertes von A wie Autarkiegrad bis Z wie Zuschüsse. Neue Regelungen seit Februar 2025: Wird an sonnigen Tagen zu viel Solarstrom produziert und an der Strombörse ein negativer Strompreis erzielt, entfällt die unmittelbare Vergütung. Stattdessen verlängert sich die 20-jährige Förderungszeit. In Zeiten solcher Solarspitzen werden Batteriespeicher und ein intelligentes Energiemanagement umso wichtiger. Dazu gehört auch die Möglichkeit, den Strom an der Strombörse direkt zu vermarkten. Ganz wichtig werden intelligente Messsysteme (Smart Meter). Werden sie bei neuen Anlagen nicht installiert, dürfen nur noch 60 Prozent der Nennleistung eingespeist werden. Kosten und Nutzen einer Photovoltaik-Anlage stellen sich damit anders dar als vor der Gesetzesänderung. Mit ergänzenden Online-Tools erleichtert der Ratgeber das Kalkulieren mit den spezifischen Gegebenheiten vor Ort sowie dem jeweiligen Energiebedarf. - Bestandsaufnahme am Objekt - Photovoltaikanlagen heute: Was muss ich wissen? - Wirtschaftlichkeit: Finanzierung, Förderung, die Anlage mieten oder kaufen,Strom nutzen und/oder verkaufen etc. - Aufbau, Einbau, Anschluss: Wer macht was? - Laufender Betrieb: Kontrolle, Wartung,Strommanagement, Versicherung, Steuern, rechtliche Fragen - Solarmodule für die Steckdose: Was bei kleinen Photovoltaikanlagen zu beachten ist - Umwelt und Nachhaltigkeit von Photovoltaikanlagen und Batterien - Mit den neuen gesetzlichen Regelungen, die im März 2025 in Kraft getreten sind
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unser Service für Sie
Wenn neue Gesetze und Verordnungen in Kraft treten oder sich zum Beispiel Förderbedingungen oder Leistungen ändern, finden Sie die wichtigsten Fakten in unserem Aktualisierungsservice zusammengefasst. Mit dem Klick auf www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/aktuell sind Sie dann ergänzend zu dieser Auflage des Buches auf dem neuesten Stand.
Diesen Service bieten wir so lange, bis eine Neuauflage des Ratgebers erscheint, in der die Aktualisierungen bereits eingearbeitet sind. Wir empfehlen, Entscheidungen stets auf Grundlage aktueller Auflagen zu treffen. Die lieferbaren aktuellen Titel finden Sie in unserem Shop: www.ratgeber-verbraucherzentrale.de
Thomas Seltmann, Jörg Sutter
Ratgeber Photovoltaik
ISBN Print: 978-3-86336-427-4
ISBN E-Book: 978-3-86336-364-2
3. Auflage 2025
© Verbraucherzentrale NRW, Düsseldorf
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung der Verbraucherzentrale NRW. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Das Buch darf ohne Genehmigung der Verbraucherzentrale NRW auch nicht mit (Werbe-)Aufklebern o. Ä. versehen werden. Die Verwendung des Buchs durch Dritte darf nicht zu absatzfördernden Zwecken geschehen oder den Eindruck einer Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW erwecken.
ISBN 978-3-86336-427-4
ISBN 978-3-86336-363-5 (E-Book PDF)
ISBN 978-3-86336-364-2 (E-Book EPUB)
Herausgeber
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.
Helmholtzstraße 19, 40215 Düsseldorf
Telefon 02 11/9 13 80-10 00
www.verbraucherzentrale.nrw
Autoren
Thomas Seltmann, Jörg Sutter
Koordination
Frank Wolsiffer
Lektorat
Kristina Raub-Küster, Düsseldorf
Layout, Satz und Umschlaggestaltung
Ute Lübbeke, Köln
www.LNT-design.de
Layout und Satz der 3. Auflage
Lala Majidova, Düsseldorf
www.lav-ka.de
Gestaltungskonzept
Lichten Kommunikation und Gestaltung,
Hamburg
www.lichten.com
XML-Layoutsatz
pagina GmbH, Tübingen
www.pagina.gmbh
Druck
AZ Druck- und Datentechnik GmbH, Kempten
Redaktionsschluss: Februar 2025
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Inhaltsverzeichnis
Über dieses Buch
Familie Fuchs plant
Rahmenbedingungen beachten
Solarstrom vom Balkon
Die wichtigsten Fragen und Antworten
So geht Photovoltaik
Licht als Energiequelle
Sonne speichern
Technik mit Zukunft
Familie Fuchs will Solarstrom
Nutzungsmöglichkeiten ausloten
Welche Möglichkeiten bietet mein Haus?
Standort und Strahlung
Dachorientierung
Dächer von Dritten nutzen
Energieverbrauch
Was kann Photovoltaik – und was nicht?
Wie viel Energie kann ich ernten?
Systematisch vorgehen
Neubau oder Nachrüstung im Bestand
Baurecht und Netzanschluss
Nützliches Technikwissen
Solarzellen und Module
Wechselrichter und Systemtechnik
Batteriespeicher
Platzierung und Montagetechnik
Kabel und Zubehör
Schutz vor Blitz und Überspannung
Netzanschluss und Einspeisung
Elektroauto zu Hause tanken
Wärme aus Solarstrom
Smarte Funktionskontrolle
Stromzähler und Smart Meter
Steuerbare Verbraucher und Anlagen
Wie sich Photovoltaik rechnet
Angebote und Preise
Finanzierung
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und Einspeisevergütung
Zuschüsse und Förderkredite
Kosten im laufenden Betrieb
Keine Angst vor dem Finanzamt
Online-Tools zum Kalkulieren
Mieten statt kaufen
Photovoltaik ohne Vergütung
Umlagen und Stromsteuer
Ü20-Anlagen
Die Anlage planen, kaufen und anschließen
Ziele der Photovoltaik-Installation
Planung und Beratung
Einen geeigneten Anbieter finden
Angebote einholen
Steuerfüchse sparen Geld
Montage und Installation
Inbetriebnahme und Qualitätssicherung
Die Anlage anmelden
Erweitern und nachrüsten
Solarpflicht in der Praxis
Die Anlage im laufenden Betrieb
Die Anlage versichern
Kontrolle im Betrieb
Wartung, Reparatur, Sicherheit
Typische Probleme im Betrieb
Garantie und Gewährleistung
Strom zu Hause managen
Eigenverbrauch und Stromlieferung an andere
Stromtarife für Solarbetreiber
Weitere Rechtsfragen
Anlagen- und Hausverkauf
Solarmodule für die Steckdose
Was ist ein Steckersolargerät?
Kosten und Nutzen
Batteriespeicher für Steckersolar
Umweltschutz und Nachhaltigkeit
Photovoltaik als Säule der Energieversorgung
Der Beitrag von Photovoltaik zum Umwelt- und Klimaschutz
Rohstoffe für Batteriespeicher und E-Auto
Entsorgung und Recycling
Solarmodule für neue Anwendungen
Anhang
Weiterführende Informationen
Adressen
Bildnachweis
[6]Über dieses Buch
Sie möchten auf Ihrem Haus eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung installieren oder tragen sich mit dem Gedanken, ein Steckersolargerät anzuschaffen? Dann haben Sie sicherlich viele Fragen, wie Sie das anpacken sollen und was dabei alles berücksichtigt werden muss. Eine Photovoltaikanlage ist kein Produkt „von der Stange“, sondern sollte immer individuell auf Ihre konkreten Wünsche und Bedürfnisse hin geplant werden. Vielleicht möchten Sie Ihr Dach möglichst voll belegen, um mit der Anlage auch eine Wärmepumpe mitzuversorgen oder später ein Elektroauto aufzuladen. Doch geht das überhaupt? Welcher Unabhängigkeitsgrad, auch Autarkie genannt, kann bei der eigenen Energieversorgung erreicht werden? Wie groß soll die Photovoltaikanlage werden, damit sie sich auch wirtschaftlich rechnet?
Familie Fuchs plant
Die vielen Fragen, die zu Beginn eines Solarstromprojekts entstehen, möchten wir mit diesem Buch beantworten. Dabei begleitet Sie Familie Fuchs durch diesen Ratgeber, die ähnliche Überlegungen anstellt wie Sie gerade: Sie will eine Photovoltaikanlage realisieren, möchte aber eine maßgeschneiderte Anlage und beschäftigt sich daher nicht nur mit der direkten Stromnutzung im eigenen Haushalt, sondern auch mit einer zukünftigen Wärmepumpe und dem Einsatz von Solarstrom für ein Elektroauto. Und auch ein passender Batteriespeicher wird für die Familie ausgewählt, um den erzeugten Sonnenstrom nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht nutzen zu können.
Wir zeigen Ihnen in diesem Buch, wie die Nutzung der Sonne zur Stromerzeugung funktioniert (→ Seite 13), und machen deutlich, wo die Grenzen der solaren Stromerzeugung sind. Sie bekommen konkrete Checklisten an die Hand, die Sie bei der Vorbereitung und Umsetzung Ihres Projekts nutzen können. Was muss ein Handwerker machen? Wie sieht eine Dokumentation aus (→Seite 174) und wo muss ich meine Photovoltaikanlage anmelden (→Seite 175)? Viele solcher Fragen kennen wir aus der täglichen Beratungspraxis.
[7]Rahmenbedingungen beachten
Die Rahmenbedingungen für die Nutzung von Sonnenenergie haben sich in letzter Zeit immer wieder stark geändert, sowohl im politischen als auch im technischen Bereich. In diesem Ratgeber finden Sie die aktuellen Rahmenbedingungen und Vergütungssätze des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) (→Seite 122), Hinweise zum Solareinsatz auf Gebäuden unter Denkmalschutz (→Seite 56) und Anforderungen zu gesetzlichen Solarpflichten (→Seite 179). Auch die steuerlichen Regelungen sind ausführlich erläutert (→Seite 137), genauso wie die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten, die es seitens Kommunen, Bundesländern und des Bundes für die Nutzung von Solarstrom gibt (→Seite 127).
Solarstrom vom Balkon
Ein eigenes, ausführliches Kapitel beschäftigt sich mit der „kleinen“ Solarnutzung, dem Einsatz von Steckersolargeräten (→Seite 205). Dabei werden ein oder zwei Solarmodule an den Balkon geschraubt oder auf das Garagendach aufgestellt. Der erzeugte Strom wird direkt in die eigene Wohnung eingespeist und reduziert so die Stromrechnung. Das klingt überzeugend – und ist es auch. Der Gesetzgeber hat dafür zuletzt viel vereinfacht und verpflichtet nun die Vermieter und Eigentümergemeinschaften, die Nutzung von Steckersolargeräten zuzulassen. Auch dazu finden Sie aktuelle Tipps, Umsetzungshinweise und Fotos von beispielhaften Anwendungen in diesem Buch.
Solarstrom gemeinsam nutzen
Mit einer Gesetzesänderung wird es nun auch einfach möglich, den erzeugten Solarstrom in einem Gebäude an Mieter oder Mitbewohner weiterzugeben (→Seite 201).
Mit den vielen Antworten, Hinweisen und Checklisten in diesem Ratgeber sind Sie gut vorbereitet, um Ihr eigenes Photovoltaikprojekt anzugehen und mit einem Installateur auf Augenhöhe sprechen zu können. Sie werden ein gutes von einem weniger guten Angebot unterscheiden können und sind mithilfe einiger genannter Links in der Lage, Eckdaten selbst nachzuprüfen.
Dieses Buch kann sicherlich nicht alle Ihre Fragen beantworten. Gerne helfen Ihnen dann die Energieberaterinnen und -berater der Verbraucherzentralen weiter. Sei es durch telefonische Auskünfte, durch Beratungsgespräche in einer unserer Beratungsstellen in Ihrer Nähe oder auch durch Onlinevorträge zu aktuellen Themen. Weitere Informationen zu unserem ausführlichen Informationsangebot erhalten Sie hier:
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Realisierung Ihrer Solaranlage.
[8]Die wichtigsten Fragen und Antworten
Jährlich beantworten wir in unseren bundesweit rund 200 Beratungsstellen Tausende von Fragen und helfen bei Schwierigkeiten und Problemen, die Verbraucherinnen und Verbraucher an uns herantragen. In Online-Veranstaltungen und auch vor Ort informieren wir zum Beispiel zu Photovoltaikanlagen und Steckersolargeräten. Aus dieser täglichen Praxis wissen wir, wie konkrete Unterstützung aussehen muss, wenn es um die Planung, Anschaffung, Installation und den Betrieb einer Photovoltaikanlage oder die Nutzung von Steckersolargeräten geht. All diese Erfahrungen sind Grundlagen des Ratgebers, der Ihnen vorliegt: Praxistipps und nützliche Hintergrundinformationen, damit Ihr Vorhaben erfolgreich gelingt.
Nutzen Sie darüber hinaus auch das stets aktuelle Online-Angebot der Verbraucherzentrale mit vielen Informationstexten, kostenlosen Onlineseminaren und vielem mehr. Und profitieren Sie von der Beratungskompetenz unserer Energieberater und -beraterinnen. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten:
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
Die Preise für Haushaltsstrom sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen – ein Ärgernis für die Familienkasse. Die Lösung: eine Solarstromanlage, die als Anlage zur Eigenversorgung installiert wird. Der Solarstrom vom Dach wird im Haus genutzt, sobald die Sonne scheint, und überschüssiger Solarstrom, der nicht im Haus verbraucht wird, fließt ins Stromnetz. Jede Kilowattstunde vom Dach spart den Kauf von Strom beim Stromversorger und reduziert Ihre Stromrechnung. Zum Vergleich: Während der Haushaltsstrom inzwischen etwa 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde kostet, erzeugt Ihre Solarstromanlage schon zu Kosten zwischen 10 bis 15 Cent den Strom.
Für verschiedene Anlagengrößen stellen wir dar, mit welchen Erlösen durch die Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) kalkuliert werden kann →Seite 123 und wie viel Unabhängigkeit mit einer Photovoltaikanlage erreichbar ist. →Seite 42
Die meisten Gebäude eignen sich gut für eine Photovoltaikanlage, und das nicht nur bei reiner Südausrichtung des Dachs mit optimaler Neigung. Entscheidend ist oft die richtige Planung, um eine wirtschaftlich lukrative Anlage zu bekommen. Der Standort und die dort vorherrschende Strahlung, die Ausrichtung und Neigung der Dachfläche, aber auch mögliche Verschattungen und die Tragfähigkeit des Dachs sind hierfür wichtige Faktoren.
Wir erläutern, wie Solarerträge abgeschätzt werden können →Seite 157 und welche Onlinewerkzeuge sich anbieten, um die Erträge Ihrer geplanten Anlage zu optimieren. Wir nennen wichtige Faktoren vom Dachzustand bis zur unterschiedlichen Ausrichtung von Modulflächen →Seite 34 – und wir zeigen auch Möglichkeiten wie die Ost-West-Ausrichtung von Modulflächen oder die Errichtung eines Carports mit einer Photovoltaikanlage als Dachfläche auf. →Seite 88
Wird eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher ausgestattet, kann Strom aus der Photovoltaikanlage nicht nur tagsüber, sondern auch am Abend und in der Nacht genutzt werden. Deshalb wird bei neuen Anlagen ein Batteriespeicher meistens gleich miteingebaut. Die Stromrechnung kann damit weiter gesenkt werden, die Unabhängigkeit steigt. Entscheidend ist die richtige Größe des Stromspeichers: Richtig dimensioniert ist eine Batterie, wenn sie den durchschnittlichen Stromverbrauch von abends bis morgens abdeckt. Zusätzlich können entsprechend ausgestattete Systeme auch bei Ausfall des Stromnetzes den gespeicherten Strom im Haus zur Verfügung stellen und damit Not- oder Ersatzstrom liefern.
Viele Fragen tauchen im Zusammenhang mit einem Batteriespeicher auf: Was kostet ein Batteriespeicher? Wie lange hält er? Was ist der Unterschied zwischen einem AC- und einem DC-Speicher und welche Vorteile bieten diese Systeme? →Seite 70
Zum Jahresende 2022 wurden die steuerlichen Regelungen zu Photovoltaikanlagen grundlegend geändert und vereinfacht. Zwei Bereiche des Steuerrechts müssen separat betrachtet werden: die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer.
Neu ist der Umsatzsteuersatz von null Prozent beim Kauf einer Photovoltaikanlage. Sie bezahlen künftig nur noch den Nettopreis ohne die sonst üblichen 19 Prozent Umsatzsteuer. Der früher notwendige Aufwand für Umsatzsteuermeldungen ist damit für private Photovoltaik-Anlagen völlig entfallen.
Von der Einkommensteuer sind Photovoltaikanlagen auf Wohngebäuden befreit. In der Steuererklärung müssen also keine Angaben zur Solaranlage mehr gemacht werden und auch keine Einkünfte daraus versteuert werden.
Trotzdem gibt es noch den ein oder anderen Steuerspartipp für Photovoltaikbetreiber. Mehr Details und Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen: → Seite 137
Ja, das ist möglich und sinnvoll. Der beste und günstigste Strom fürs Elektroauto ist der Solarstrom direkt vom eigenen Dach. Wenn das Fahrzeug tagsüber oder am Wochenende geladen wird, kann der umweltfreundliche Strom einen besonders hohen Anteil erreichen. Viele Faktoren spielen eine Rolle, damit eine hohe Solarstromquote im Elektroauto erreicht wird: eine möglichst große Photovoltaikanlage, die richtige Ladestation und wann und wie das Fahrzeug genutzt wird.
Schon lange angekündigt ist das „bidirektionale Laden“, also das Rückspeisen von Strom aus der Autobatterie zurück ins Hausstromnetz →Seite 104. Wir geben einen Ausblick, was hier in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Und wir zeigen, was heute bei der Planung der Photovoltaikanlage und der Anschaffung einer Ladestation berücksichtigt werden muss, um mit dem Elektroauto möglichst viel Solarstrom nutzen zu können. →Seite 99
Ja, das ist möglich. Strom aus Photovoltaik kann auch zur Wärmenutzung, also für Heizung und warmes Wasser, verwendet werden. Wird ein neues Haus gebaut, wird heute oftmals eine elektrische Wärmepumpe eingebaut, und auch bei der Sanierung wird immer häufiger auf eine solche Lösung gesetzt. Zwar erzeugt die Photovoltaikanlage den meisten Strom in den Sommermonaten, den höchsten Stromverbrauch hat die Wärmepumpe hingegen im Winter – doch vor allem in den Übergangszeiten kann umweltfreundlich erzeugter Solarstrom einen wesentlichen Beitrag leisten.
Auch Familie Fuchs, deren Photovoltaikprojekt uns in diesem Ratgeber immer wieder begegnet, möchte in einigen Jahren die alte Heizung durch eine moderne Wärmepumpe ersetzen. Welche Aspekte dabei wichtig sind und ob auch ein einfacher Heizstab genutzt werden kann, erläutern wir ebenfalls. → Seite 106
Mit einer Photovoltaikanlage hat man doch gegen Stromausfälle vorgesorgt, oder? Leider ist das nicht so einfach: Denn eine Photovoltaikanlage ohne Batteriespeicher muss aus Sicherheitsgründen bei Stromausfall automatisch abschalten. Für einen Not- oder Ersatzstrombetrieb ist ein Batteriespeicher notwendig, doch nicht alle Speichersysteme am Markt bieten auch diese Funktionen an.
Was genau ist Notstrom und Ersatzstrom, was ist der Unterschied? → Seite 79
Ja, auch wer kein Hausdach für eine Photovoltaikanlage besitzt, aber ein sonniges Plätzchen am Balkon oder auf der Terrasse, kann mit einem Steckersolargerät zu den Solarstromgewinnern gehören. Für wenige Hundert Euro Anschaffungskosten können auch Sie Ihre Stromrechnung dauerhaft reduzieren. Im Prinzip funktioniert das ganz einfach, aber manche Tücken stecken im Detail. Wie kann man so ein Gerät sicher befestigen und wo muss man es anmelden? Wir informieren über etliche Vereinfachungen, die eine Nutzung attraktiv machen.
Ein eigenes Kapitel in diesem Ratgeber beschreibt, was ein Steckersolargerät ist, was es kostet und was es bringt. Auch Aspekte der Wirtschaftlichkeit und rechtliche Hinweise werden gegeben, zum Beispiel, wenn das Steckersolargerät bei einer Mietwohnung eingesetzt werden soll. → Seite 205
Photovoltaikanlagen und Steckersolargeräte erzeugen jahrzehntelang sauberen Strom, produzieren im Betrieb keine Schadstoffe oder Müll und tragen so aktiv zu Umwelt- und Klimaschutz bei. Doch um wirklich „grün“ zu sein, muss diese Technik auch umweltfreundlich produziert werden, außerdem ist das Thema Recycling am Lebensende wichtig. Hier ist schon viel gelungen, aber auch noch einiges zu tun.
Das Recycling von Solarmodulen und Batterien ist heute Standard. Bei der Herstellung wird der Einsatz problematischer Stoffe zusehends reduziert und der Rohstoff- und Energieaufwand zur Herstellung wurde immer kleiner, sodass eine Solaranlage heute in kurzer Zeit eine positive Energiebilanz erreicht. → Seite 226
Photovoltaik ist eine zentrale Säule beim Umbau der weltweiten fossilen Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Gemeinsam mit der Windenergie ist die Photovoltaik entscheidend auch für die Energiewende in Deutschland. Die Technik wurde in den vergangenen Jahren konsequent weiterentwickelt, die Kosten sind deutlich gesunken, sodass eine Photovoltaikanlage inzwischen für viele Haushalte und Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen eine attraktive Option ist. Solarstrom ist unter den neuen Kraftwerken inzwischen die billigste Art, Strom zu gewinnen.
Auch Ihre neu installierte Solaranlage kann ein Baustein der Energiewende werden. Sie können damit Ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und etwas Gutes für sich und kommende Generationen tun. → Seite 221
[15]So geht Photovoltaik
Die Sonnenstrahlung als Energiequelle lässt sich auf vielfältige Weise nutzen: Schon der klassische Wintergarten ist eine passive Form der solaren Energiegewinnung. Aber erst mithilfe von Sonnenkollektoren und Solarzellen lassen sich gezielt Wärme und Strom erzeugen. Hier erfahren Sie Grundlegendes zur Stromerzeugung aus Sonnenlicht, also zur Photovoltaik.
Licht als Energiequelle
Ohne Sonne kein Solarstrom: Solarmodule erzeugen aus dem einfallenden Licht elektrische Energie, die direkt ins Haus- und Stromnetz gespeist wird. Solarmodule sind Elemente, die auf das Dach montiert werden und in denen Solarzellen arbeiten. Jede Solarzelle erzeugt ein wenig Strom. Im Solarmodul sind die Solarzellen in Reihen elektrisch miteinander verbunden und der Strom wird auf der Modulrückseite in einer Anschlussdose gebündelt. An der Anschlussdose befinden sich zwei Anschlussleitungen, eine als Plus-, eine als Minuspol. Über diese Leitungen kann der Strom, der auf dem Dach produziert wird, ins Gebäude gebracht werden. Solarmodule erkennen Sie auf Dächern an den oft bläulichen bis schwarzen größeren Flächen bis hin zum voll belegten Dach – zusammengesetzt aus vielen knapp ein bis zwei Quadratmeter großen Solarmodulen. Innerhalb der Module ist oftmals eine schachbrettartige Anordnung der Solarzellen zu sehen. Bei neueren Photovoltaikanlagen sind die Module aber immer häufiger auch durchgängig schwarz.
Wie funktioniert die Stromerzeugung?
Bestimmte Materialien (Halbleiter) haben die Eigenschaft, aus Sonnenlicht direkt Elektrizität zu erzeugen, wenn sie dafür bei der [16]Herstellung speziell präpariert werden. Diese Eigenschaft beruht auf dem photovoltaischen Effekt. Daher wird diese Technik Photovoltaik genannt (von „Photon“ für Licht und „Volt“ für elektrische Spannung). Ein solcher Halbleiterbaustein ist die Solarzelle. Die heute meistens verwendeten Solarzellen sind dunkelblaue bis schwarze dünne Scheiben aus dem Halbleitermaterial Silizium.
Bei der Sonnenwärme, auch Solarthermie genannt, wandelt ein Solarkollektor Sonnenlicht direkt in Wärme und erhitzt Wasser, gemischt mit einem Frostschutzmittel. Eine elektrische Umwälzpumpe transportiert die Energie zu einem Warmwasserspeicher im Gebäude. Von dort wird die Warmwasserversorgung oder Heizung mit der gesammelten Sonnenwärme gespeist. Ausführliche Informationen über Anlagen zur Solarwärmenutzung liefert der „Ratgeber Heizung“ der Verbraucherzentrale
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de
Wenn Licht auf eine solche Silizium-Solarzelle trifft, entsteht sofort eine elektrische Spannung. Elektrische Ladungsträger werden durch die Lichtenergie getrennt – die positiven sammeln sich am Pluspol und die negativen am Minuspol. Es entsteht ein Energiepotenzial in Form einer elektrischen Spannung. Wird nun ein elektrischer Verbraucher angeschlossen, fließt Strom, solange Sonneneinstrahlung vorhanden ist.
Aufbau einer Solarzelle. 1: Antireflexschicht, 2: negative Elektrode, 3: n-dotiertes Silizium, 4: Grenzschicht (p-n-Übergang), 5: p-dotiertes Silizium, 6: positive Elektrode
Die natürliche Sonneneinstrahlung schwankt je nach Jahreszeit und Wetter. Eine Photovoltaikanlage produziert daher bei sonnigem Wetter mehr Strom, bei wolkigem Himmel weniger. Und auch die Jahreszeiten spiegeln sich in der Stromerzeugung wider: Drei Viertel der jährlichen Sonnenenergie kommen im Sommerhalbjahr bei uns an, nur ein Viertel in den Monaten Oktober bis März. Deshalb kann im Sommer viel, im Winter weniger Solarstrom erzeugt werden. [17]Der auf dem Dach erzeugte Strom wird anschließend mit Leitungen ins Gebäude gebracht und dort von einem Wechselrichter umgeformt, damit er direkt genutzt werden kann. Dieses Gerät formt den Gleichstrom in Wechselstrom um, stellt die Spannung auf die haushaltsüblichen 230 Volt ein und enthält zudem zahlreiche Sicherheitselemente, die die korrekte Stromerzeugung überwachen.
Stromerzeugung einer 16-Kilowatt-Photovoltaikanlage (16 kW) im Jahresverlauf in Düsseldorf.
Bedingung für die Nutzung der Photovoltaik auf einem Hausdach mit der im Folgenden dargestellten Technik ist immer ein Stromanschluss des Gebäudes, an den die Anlage angeschlossen wird und in den sie gegebenenfalls überschüssigen Strom abgibt. Hauptsächlich wird der Strom jedoch im Haus selbst genutzt. Photovoltaik lässt sich aber auch ohne Stromanschluss verwenden: Neben vielen Kleingeräten wie Solar-Taschenrechner oder Parkscheinautomat können Sie zum Beispiel auch auf einem Gartenhaus oder einem abgelegenen Geräteschuppen Photovoltaikstrom nutzen. Gibt es dort keinen Stromanschluss, spricht man von einer „Photovoltaik-Inselanlage“. Allerdings benötigt eine Photovoltaik-Inselanlage eine etwas andere Technik als die im Folgenden dargestellten netzgekoppelten Photovoltaikanlagen. Bei einer netzgekoppelten Anlage muss immer ein Stromanschluss vorhanden und intakt sein, sonst [18]schaltet die Anlage aus Sicherheitsgründen vollständig ab. Wird eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher ausgestattet, kann teilweise auch bei Stromausfall Solarstrom und gespeicherter Strom aus der Batterie genutzt werden (→Seite 80).
Sonne speichern
Wird eine netzgekoppelte Solarstromanlage um einen Batteriespeicher (Akkumulator) ergänzt, kann Strom aus der Photovoltaikanlage nicht nur tagsüber, sondern auch am Abend und in der Nacht genutzt werden. Erzeugt die Photovoltaikanlage tagsüber mehr Strom, als aktuell verbraucht wird, lädt der Speicher, anstatt dass der überschüssige Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird. Besteht mehr Strombedarf, als die Photovoltaikanlage liefern kann – wie abends oder nachts –, kann durch das Entladen des Speichers zeitversetzt der selbst auf dem Dach erzeugte Strom genutzt werden.
Für Stromspeicher im Haus werden heute nahezu ausschließlich Akkus mit Lithium-Ionen-Technologie eingesetzt, die weltweit inzwischen in großen Mengen produziert werden und mit der gleichen Technik auch im Elektroauto ihren Einsatz finden.
Nein, ein Batteriespeicher ist immer so ausgelegt, dass er Strom bis zum nächsten Tag bereitstellen kann. Für die Speicherung über mehrere Monate müssen andere Techniken genutzt werden, zum Beispiel mit Wasserstoff als Speichermedium. Wasserstoff lässt sich aus Solar- oder Windstrom erzeugen und in großen Speichern oder Kavernen über Monate speichern. Beim Ausspeichern kann dann wieder Strom oder auch direkt Wärme erzeugt werden. Von einem Anbieter ist derzeit eine solche Lösung für das Eigenheim verfügbar, diese ist jedoch sehr teuer.
Anbieter von Stromspeichern
Das Angebot an Stromspeichern ist vielfältig: Zahlreiche Batteriespeicher mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften und Preisen sind am Markt erhältlich. Grundsätzlich macht es Sinn, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um ein System auszuwählen, das die eigenen Wünsche erfüllen kann und zur bestehenden Technik (zum Beispiel zu einer schon vorhandenen Photovoltaikanlage oder anderer [19]Haustechnik) technisch kompatibel ist. Auch haben Fachbetriebe mit den Produkten oft schon Erfahrung gesammelt und kennen eventuelle technische Probleme, die Zuverlässigkeit sowie die Qualität des Herstellerservice.
Die Stromspeicher am Markt unterscheiden sich in der Art des Anschlusses (AC- oder DC-Speicher) und durch die verwendete Chemie in den Batteriezellen. Beides wird im Kapitel „AC/DC-Speicher“ (→Seite 76) näher erläutert. Auch die Gehäuse und die Optik der Batteriespeicher sind je nach Anbieter sehr unterschiedlich. Es gibt sowohl Standgeräte als auch Batteriespeicher zur Wandmontage.
Zusatzfunktionen des Speichers
Bei Stromausfall des öffentlichen Netzes muss eine Photovoltaikanlage aus Sicherheitsgründen abschalten, das erfolgt völlig automatisch. Auch wenn die Photovoltaikanlage mit einem einfachen Batteriespeicher ausgestattet ist, bleibt bei Stromausfall alles dunkel. Nur wenn beim Kauf des Speichers auf eine Not- oder Ersatzstromfunktion geachtet wurde, die manche Speicherhersteller anbieten, kann im Haus weiter Strom genutzt werden, wenn das öffentliche Netz einmal ausfallen sollte. Auch hierzu finden Sie nähere Erläuterungen im Kapitel „Notstrom, Ersatzstrom und unterbrechungsfreie Stromversorgung“ (→Seite 80)
Solarstrom nutzen
Der erzeugte Solarstrom kann im Haushalt direkt genutzt werden, also über elektrische Hausgeräte, die an der Steckdose angeschlossen sind. Wenn Sie bei Sonnenschein die Kaffeemaschine einschalten, wird der nötige Strom dann nicht aus dem Stromnetz, sondern direkt vom Dach bereitgestellt. Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten, die in diesem Ratgeber aufgezeigt werden: Strom aus Photovoltaik kann zur Wärmenutzung, also für Heizung und warmes Wasser, verwendet werden oder auch zur Ladung eines Elektroautos, das damit besonders umweltfreundlich betrieben wird.
Technik mit Zukunft
Dass durch Licht Elektronen aus einem Körper austreten, hat der französische Physiker Alexandre Edmond Becquerel im Jahr 1839 erstmals beobachtet. Seither wurden Materialien und Wirkungsgrad verbessert, sodass Solarzellen heute in großem Maßstab zur Stromerzeugung genutzt werden können.
In den 1960er-Jahren wurden erstmals Satelliten mit Photovoltaikmodulen betrieben, 20 Jahre später begann der Einsatz auf Dächern. In den 1990er-Jahren ermöglichten erste Förderprogramme den Aufbau einiger Tausend Anlagen; seit dem Jahr 2000 verhalfen vor allem die Vorgaben des [20]Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) der Solartechnik in Deutschland zum Durchbruch.
Die Solarzellen in modernen Solarmodulen werden geteilt, hier ein „Halbzellenmodul“
Anzahl der Anlagen
Heute boomt die Photovoltaik weltweit, riesige Anlagen werden auf Freiflächen bei uns, noch größere in südlicheren Ländern installiert. Diese Stromerzeugung ist nicht nur umweltfreundlich, sondern bei derart großen Anlagen heute schon günstiger als die Stromerzeugung aus Kohle, Gas oder Atomkraft.
In Deutschland erzeugen inzwischen fast fünf Millionen Photovoltaikanlagen Strom aus Sonnenlicht, allein im Jahr 2024 sind fast 600.000 Anlagen neu hinzugekommen. Viele Familien installieren Photovoltaikanlagen auf ihren Ein- und Zweifamilienhäusern, auch die Dächer von Mehrfamilienhäusern und Mietsgebäuden werden mit Solarmodulen versehen. Unternehmen nutzen Dachflächen von Produktionshallen und Bürgerenergie-Genossenschaften errichten [21]Freiflächenanlagen am Stadtrand oder neben einer Eisenbahntrasse.
Auch Speicherbatterien werden inzwischen breit genutzt: Rund 1,8 Millionen Speicherbatterien waren bei kleinen Haus-Photovoltaikanlagen Ende 2024 im Einsatz, fast 600.000 kamen allein im Verlauf des Jahres 2024 neu dazu.
Heute gibt es langjährige Erfahrung mit Photovoltaikanlagen. Ein Großteil dieser Anlagen ist technisch voll in Funktion und erbringt auch Jahre nach ihrer Inbetriebnahme noch immer gute Erträge. Ertragsminderungen über die Zeit, die teilweise angesetzt werden, sind in der Praxis bei den meisten Anlagen nicht messbar. Aus heutiger Sicht kann bei einer guten technischen Qualität der Photovoltaikanlage von einer Lebensdauer von rund 30 Jahren – das gilt zumindest für die Solarmodule auf dem Dach – ausgegangen werden.
Der Deutsche Bundestag hat im EEG gesetzlich geregelt, wie der Ausbau in den kommenden Jahren beschleunigt vorangehen soll. Nachdem in Deutschland im Jahr 2021 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von rund 5,7 Gigawatt neu installiert wurden, konnte der jährliche Zubau seitdem fast verdreifacht werden:
Für 2024 lag der Zielwert bei 13 Gigawatt. Dieses Ziel wurde mit 17Gigawatt sogar übertroffen. Für 2025 ist ein Ausbau von 18 Gigawatt geplant. Ab 2026 sollen jedes Jahr 22 Gigawatt Solarleistung neu installiert werden. Das ist viermal so viel als im Jahr 2021.
In der Solarbranche wird diskutiert, woher das benötigte Material kommen soll. Außerdem werden deutlich mehr Fachkräfte benötigt, die heute noch nicht zur Verfügung stehen. Hier sind große Aktivitäten im Bereich der Aus- und Weiterbildung notwendig.
Ab 2026 sollen jährlich 22 Gigawatt Photovoltaikleistung zugebaut werden (helle Säulen). In den Jahren bis 2024 wurden die bisherigen Ausbauziele sogar übertroffen (dunkle Säulen).
Das Potenzial ist riesig: Von hundert Wohngebäuden in Deutschland war bis zum Jahresende 2020 nur auf elf Gebäuden schon eine Photovoltaikanlage montiert. Es gibt noch viele freie geeignete Dachflächen, die [22]für die Solarstromerzeugung genutzt werden können.
Verschiedene Motive lassen Menschen zu Solarstromerzeugern werden: Neben dem Klimaschutz und der wirtschaftlichen Attraktivität ist es oft auch der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit, der das Interesse an Photovoltaik weckt. Auch steigende Stromkosten spielen eine Rolle. Solarstrom wird deshalb zukünftig ein selbstverständlicher Bestandteil eines Neubaus oder einer Dachsanierung sein.
Familie Fuchs will Solarstrom
Sonja und Peter Fuchs sind verheiratet und haben zwei Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren. Sie wohnen in einem 30 Jahre alten, eigenen Einfamilienhaus mit ebenso alter Gasheizung irgendwo in einem Wohngebiet in Düsseldorf. Familie Fuchs möchte eine Photovoltaikanlage auf ihrem Haus installieren.
Die Anlagenleistungeiner Photovoltaikanlage wird üblicherweise in Kilowatt (kW) angegeben, 1 Kilowatt entspricht dabei 1.000 Watt. Bei Photovoltaikanlagen wird oft auf die Leistung der Solarmodule Bezug genommen. Für diese „installierte Leistung“ der Solarmodule wird gern der Zusatz „peak“ verwendet, abgekürzt mit einem „p“. Die Einheit lautet Kilowatt peak (kWp). Im folgenden Text wird zur besseren Lesbarkeit durchgängig auf den Zusatz „peak“ oder „p“ verzichtet.
Handelt es sich um eine Energiemenge, ist die gebräuchliche Einheit Kilowattstunden (kWh).
Besonders wichtig ist diese Unterscheidung bei Batteriespeichern. Diese haben sowohl eine Ausgangsleistung in Kilowatt (kW) als auch eine Energiespeicherkapazität in Kilowattstunden (kWh).
Eine Photovoltaikanlage erzeugt einen Jahresertragin Kilowattstunden (kWh). Auf 1 Kilowatt Anlagenleistung bezogen wird dieser als spezifischer Jahresertrag in Kilowattstunden pro Kilowatt peak (kWh/kWp) angegeben. Mit dieser Größe können unterschiedlich große Anlagen verglichen werden.
Zur Einordnung: Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern haben Leistungen zwischen 3 und 20 Kilowatt, Batteriespeicher haben in der Regel eine Speicherkapazität zwischen 5 und 20 Kilowattstunden.
Spezifische Jahreserträge können bei rund 1.000 Kilowattstunden pro Kilowatt (kWh/kW) liegen.
[23]Dürfen wir vorstellen: Familie Fuchs
Familie Fuchs wird uns in diesem Ratgeber mit ihrem Haus begleiten. An ihrem Beispiel werden wir viele Details rund um den Einsatz der Solarmodule erläutern.
Familie Fuchs fährt ein zwölf Jahre altes Auto, einen Kombi mit Dieselmotor, der in den kommenden Jahren durch ein kleineres Elektroauto ersetzt werden soll. Früher war der große Kombi wichtig, doch nachdem die Kinder inzwischen größer sind, reicht der Familie zukünftig auch ein kleinerer Wagen. Peter Fuchs fährt mit dem Bus zur Arbeit, sodass das Auto hauptsächlich von Sonja Fuchs für ihren Weg zur Arbeit, für Einkäufe und für den Transport der Kinder zu ihren Freizeitaktivitäten genutzt wird. Sonja Fuchs arbeitet halbtags rund 15 Kilometer von ihrem Haus entfernt.
[24]Familie Fuchs hat ein wenig Geld gespart und möchte ihr Haus mit einer Photovoltaikanlage ausstatten. Sonja Fuchs denkt dabei an ihre Kinder, sie möchte ihnen eine gute Zukunft ermöglichen. Peter Fuchs denkt eher an die Familienkasse. Er ärgert sich über die hohen Stromkosten in der letzten Zeit. Sein Ziel: Er möchte mindestens die Hälfte seines Strombedarfs auf dem Dach selbst erzeugen, besser wäre aus seiner Sicht ein noch größerer Anteil. Er ist technikbegeistert und möchte die Stromerzeugungsdaten betrachten und auswerten. Auch ist er motiviert, einige kleine Gewohnheiten beim Stromverbrauch umzustellen, wenn er dadurch mehr Solarstrom selbst nutzen kann. Peter Fuchs überlegt außerdem, in zwei oder drei Jahren die alte Gasheizung des Hauses gegen eine moderne und umweltfreundliche Wärmepumpe auszutauschen.
Übersetzen wir das eben Beschriebene in konkrete technische Anforderungen an die neue Photovoltaikanlage von Familie Fuchs:
Um möglichst viel Klimaschutz zu erreichen und möglichst viel Strom aus der Photovoltaikanlage zu gewinnen, sollte die Anlage möglichst groß sein. Das Dach soll also weitmöglichst mit Photovoltaikmodulen belegt werden.
Um die Stromrechnung der Familie Fuchs zu reduzieren, muss es eine Eigenverbrauchsanlage sein. Dabei wird der gewonnene Strom vom Dach zuerst weitgehend selbst verbraucht, nur die Überschüsse werden in das öffentliche Stromnetz eingespeist.
Die Photovoltaikanlage kann mit einem Stromspeicher ausgestattet werden. Dieser kann Solarstrom auch abends und in der Nacht bereitstellen.
Die Anlage soll darauf ausgelegt sein, auch eine spätere Wärmepumpenheizung mit zu versorgen.
Die Photovoltaikanlage soll in der Lage sein, eine Ladestation zum Laden eines Elektroautos zu unterstützen.
Die Anlage muss mit einem Energiemanagement ausgestattet sein, um Geräte wie Wärmepumpe oder Ladestation steuern zu können. Auch die Erzeugungsdaten werden hier erfasst und können ausgewertet werden.
Randbedingungen des Verbrauchs
Für die Planung und Auslegung der Photovoltaikanlage ist wichtig zu analysieren, welchen Energieverbrauch Familie Fuchs derzeit hat. Dafür sollten die Planenden auf diese Werte schauen:
den jährlichen Stromverbrauch in Kilowattstunden gemäß Stromrechnung,
den Verbrauch der Gasheizung für Heizwärme und Warmwasser pro Jahr,
den Dieselverbrauch des Autos pro Jahr.
Wohnfläche
140 m2
Stromverbrauch pro Jahr
4.000 kWh
Gasverbrauch pro Jahr
2.240 m3
Fahrleistung Auto pro Jahr
9.000 km
Dieselverbrauch pro Jahr
585 l
Abb. 5: Steckbrief zum Energieverbrauch der Familie Fuchs.
[25]Nutzungsmöglichkeiten ausloten
Diese Werte werden wir nutzen, um beispielhaft eine Photovoltaikanlage für Familie Fuchs auszulegen und eine Aufteilung des erzeugten Stroms auf die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten abzuschätzen. Neben der direkten Stromnutzung für Elektrogeräte und Beleuchtung im Haushalt soll zukünftig mit einer Wärmepumpe auch die Heizenergie bereitgestellt sowie an einer Ladestation ein Elektroauto betankt werden.
Damit eine Photovoltaikanlage die genannten Wünsche von Familie Fuchs erfüllen kann, müssen die Wünsche vorher genau festgelegt und die Planung und Auslegung der Photovoltaikanlage darauf abgestimmt werden. Eine Photovoltaikanlage wird daher meist an die individuellen Bedürfnisse angepasst und ist nur selten eine Standardlösung „von der Stange“.
Energiekosten einsparen
Jede Kilowattstunde Strom aus der Photovoltaikanlage vom eigenen Dach braucht nicht vom Netzbetreiber zugekauft zu werden. Damit reduziert eine Photovoltaikanlage immer die Stromrechnung. Wie hoch die Einsparung ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: von der Größe der Anlage, ihrem Standort und auch vom Stromverbrauch im Haushalt sowie von den Zeiten, in denen Elektrogeräte laufen.
Die Photovoltaikanlage muss aber erst einmal angeschafft werden. Die Kosten für Anschaffung und Betrieb können in einen Preis pro Kilowattstunde des selbst erzeugten Stroms umgerechnet werden. Bei einer typischen Photovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus liegen heute die Stromerzeugungskosten zwischen 10 und 15 Cent pro Kilowattstunde, also deutlich unter dem Bezugspreis von Strom aus dem Stromnetz, der aktuell bei 25 bis 35 Cent pro Kilowattstunde liegt und möglichweise in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird.
Die Begriffe „Eigenverbrauchsanteil“ und „Autarkiegrad“ beschreiben beide wichtige Werte bei der Solarstromerzeugung, sie haben jedoch ganz unterschiedliche Blickwinkel.
Der Eigenverbrauchsanteil betrachtet aus Sicht der Photovoltaikanlage, wie viel des gesamten erzeugten Solarstroms selbst genutzt werden kann. Je höher der Eigenverbrauchsanteil, desto mehr wird vom erzeugten Strom direkt im Haushalt verbraucht. Ein Eigenverbrauchsanteil von beispielsweise 60 Prozent bedeutet, dass über die Hälfte des erzeugten Solarstroms selbst im Haushalt verbraucht wird, 40 Prozent werden in das Stromnetz eingespeist.
Der Autarkiegrad beschreibt aus Sicht des Stromverbrauchs im Haushalt, welcher Anteil des Strombedarfs von der Solaranlage gedeckt wird. Ein hoher Autarkiegrad bedeutet also, dass viel Solarstrom genutzt und nur wenig Strom vom Stromversorger eingekauft werden muss. Bei einem Autarkiegrad von 60 Prozent kommt also über die Hälfte des im Haushalt verbrauchten Stroms aus der Photovoltaikanlage (und dem Speicher) und nur 40 Prozent müssen vom Versorger eingekauft werden.
Beide Werte werden in Prozent angegeben und meist auf ein Kalenderjahr bezogen, sie können aber auch für andere Zeiträume oder als Momentanwert bestimmt werden.
Hohe Autarkie erreichen
Bei einer typischen Photovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus mit Eigenverbrauch können über das ganze Jahr betrachtet rund 30 Prozent des Stroms aus der Solaranlage selbst verbraucht werden, mit einem typischen Batteriespeicher sind es rund 60 Prozent. Warum ist das so? Im Sommerhalbjahr wird viel Strom auf dem Dach erzeugt, aber nur wenig verbraucht, im Winter dagegen kann die Photovoltaikanlage nur wenig erzeugen, der Verbrauch ist aber höher als im Sommer. Gründe für den geringen Solarertrag im Winter sind der niedrige Sonnenstand über dem Horizont und die kurzen Tage, dadurch ist die Einstrahlung gering.
Deshalb liegt der Gedanke nahe, den Batteriespeicher sehr groß zu machen, um die Autarkie weiter zu steigern. Doch das funktioniert leider nicht: Auch mit einem sehr [27]großen Batteriespeicher ist, aufs Jahr gesehen, kein Autarkiegrad über 90 Prozent oder gar nahe 100 Prozent bei durchschnittlichem Stromverbrauch erreichbar. Aber der von Herrn Fuchs angedachte Autarkiegrad von 50 Prozent ist mit der Kombination von Photovoltaikanlage und Batteriespeicher erreichbar.
Die Tabelle (→ Abb. 6) zeigt Eigenverbrauchsquoten und Autarkiegrade für verschiedene Jahresstromverbräuche und einige Anlagenvarianten mit Photovoltaikanlage und Batteriespeicher. Mit einem Speicher kann mehr Solarstrom selbst genutzt werden. Auf unserer Aktualisierungsseite im Internet finden Sie weitere Berechnungen mit anderen Randbedingungen. Im Anhang dieses Buches finden Sie zudem einen Link zu einem Online-Solarrechner, mit dem Sie Ihre konkrete Kombination berechnen können.
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/aktuell
Umwelt- und Klimaschutz
Eine Photovoltaikanlage trägt ganz eindeutig zu Umwelt- und Klimaschutz bei, da kann Frau Fuchs ganz beruhigt sein. Jede Kilowattstunde, die auf dem Dach aus Sonnenlicht produziert wird, muss nicht in einem konventionellen Kraftwerk erzeugt werden. Im Kapitel „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ (→Seite 219) beschreiben wir, wie umweltfreundlich die Photovoltaik inzwischen ist, zum Beispiel bei der Produktion von Solarmodulen.
STROM-VERBRAUCH [kWh] im Haushalt pro Jahr
Kleine PV-Anlage (5 KW)
Große PV-Anlage (10 KW)
ohne Speicher0 kWh
kleiner Speicher 5 kWh
ohne Speicher0 kWh
großer Speicher 10 kWh
EVA
Aut.-Grad
EVA
Aut.-Grad
EVA
Aut.-Grad
EVA
Aut.-Grad





























