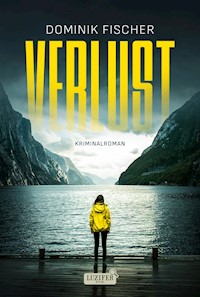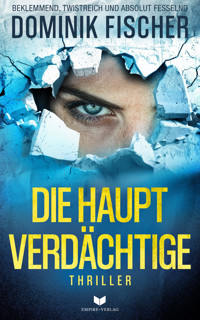19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Gesundheitsökonomie, Note: 2,3, APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft in Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract: Ausgehend von der in Expertenkreisen vielfach geteilten Meinung, dass in Zukunft das medizinisch und das finanziell Machbare zunehmend divergieren und damit Leistungsbegrenzungen in der Gesundheitsversorgung mittelfristig unumgänglich sind, stellt sich die Frage nach dem ‚Wie‘ einer Allokation knapper Gesundheitsgüter, insbesondere in Hinblick auf die Erfüllung moralischer Gerechtigkeitserwartungen und –anforderungen. Die in diesem Zusammenhang häufig genannten zentralen Begriffe Rationierung und Priorisierung beschreiben die Methoden, mit denen eine Versorgung unter Knappheit gestaltet werden kann. Die Analyse gerechtigkeitsrelevanter ethischer Denkansätze zeigt klar, dass keine dieser Theorien für die Bewältigung komplexer realer Allokationsprobleme geeignet ist, jedoch lassen sich relevante Prinzipien einer gerechten Gesundheitsversorgung identifizieren. Alles überragend stellt sich die Gleichheit als grundlegendes Element von sozialer Verteilungsgerechtigkeit heraus, verbunden mit dem Prinzip der Lebenswertindifferenz und der unbedingt einzuhaltenden Vorrangigkeit von Bedürftigkeitskriterien vor Aspekten der Effizienz, was auch die besondere Behandlung der am schlechtesten gestellten Gesellschaftsmitglieder umfasst. Hervorstechend ist die Forderung nach der expliziten Umsetzung von Leistungsbegrenzungen, die grundlegend für die gesellschaftliche Akzeptanz derselben erscheint und auf den Prinzipien der Transparenz und Konsistenz basiert. Um die für Kriterienentwicklung und –anwendung Zuständigen moralisch zu entlasten, sollten diese so weit wie möglich anonym-abstrakt auf patientenfernen Entscheidungsebenen und unter Partizipation von potentiell Betroffenen vorgenommen werden. Als elementare Hemmnisse jeglicher Rationierungsvorhaben stellt sich die Unmöglichkeit einer objektiven Quantifizierung und Grenzziehung bezüglich menschlicher Werte und Bedürfnisse dar, die für die konsistente Anwendung expliziter Rationierungskriterien oftmals erforderlich wäre, ebenso wie die ethische Verwerflichkeit und damit Nichtanwendbarkeit einer monetären Bewertung konkreten menschlichen Lebens. Daraus folgernd lässt sich festhalten, dass speziell soziale Rationierungskriterien nicht mit moralischen Gerechtigkeitsvorstellungen vereinbar sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Page 1
Page 2
Page 4
Page 5
Page 6
1 Einleitung
1.1 Thema und Fragestellung
„DieMittel, das lehrt die Ökonomie, sind immer endlich und knapp“(Welti2010, S. 379).Dies trifft auch auf die Mittel, die im System der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur Verfügung stehen, zu. Daher bringen die eröffnenden Worte prägnant die wesentliche Problematik eines Gesundheitssystems auf den Punkt, in welchem ein zunehmendes Missverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben die Mittel knapp und dadurch die Gestaltung bzw. Sicherstellung der Versorgung immer schwieriger werden lässt. Das deutsche Gesundheitssystem befindet sich in ebendieser Situation, was aufgrund der hohen individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung des besonderen Gutes Gesundheit und der enormen Anzahl an potentiell Betroffenen, ein bereits aktuelles und in Zukunft noch an Dramatik gewinnendes gesundheitsökonomisches, politisches und ethisches Problem darstellt. Als Ursachen der zunehmenden Ressourcenknappheit in der Gesundheitsversorgung werden verschiedene Aspekte auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite im System der GKV identifiziert, welche im Folgenden noch erläutert werden. Es gilt nun also Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, wie der Bedarf der Bevölkerung an Gesundheitsgütern1mit den begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen gedeckt werden kann. Als mögliche Lösungsstrategien werden in diesem Zusammenhang insbesondere die Begriffe der Priorisierung und Rationierung, neben Maßnahmen der Rationalisierung, häufig genannt und stellen in der Tat vielversprechende, aber zugleich auch in der Kritik stehende Ansätze zur Allokation knapper Ressourcen dar. Während die Aufmerksamkeit der politischen Ebene ausschließlich auf die Stabilisierung bzw. Erweiterung der Einnahmeseite gerichtet ist(vgl. Zentrale Ethikkommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin und ihren Grenzgebieten bei der Bundesärztekammer (ZEKO) 2007, S. 7)und eine Notwendigkeit zur Rationierung nicht diskutiert wird, sind sich viele Experten, unter anderem Marckmann und
1Die Begriffe Gesundheitsgüter und Gesundheitsleistungen werden in dieser Arbeit synonym verwendet und bezeichnen die Gesamtheit aller Sach- und Dienstleistungen der Gesundheitsversorgung.
Eine gerechtigkeitsorientierte Betrachtung der Allokation knapper Gesundheitsgüter im deutschen Gesundheitssystem
Page 7
Groß darüber einig, dass an einer expliziten Leistungsbegrenzung und Ressourcenreallokation im Gesundheitswesen kein Weg mehr vorbeiführt, nicht zuletzt, um die bereits nachweislich praktizierte, ethisch abzulehnende verdeckte Rationierung zu unterbinden(vgl. Marckmann 2007, S. 96; vgl. Groß 2009, S. 76f.).Auch Strech ist der Meinung, dass Rationalisierungsmaßnahmen allein nicht ausreichen werden, um die Finanzierungssituation im Gesundheitswesen dauerhaft zu stabilisieren(vgl. Strech 2011, S. 52).
Wenn begrenzte Gesundheitsgüter einem prinzipiell unbegrenzten Bedarf entgegenstehen und verteilt werden müssen stellt sich unweigerlich die Frage, wie eine solche Verteilung gestaltet werden kann, um gerechtigkeitsethischen An-forderungen zu genügen und sich auch ökonomisch und rechtlich nachvollziehbar rechtfertigen zu können. Insbesondere die Akzeptanz der Gesellschaft und der medizinischen Berufsgruppen, auf Basis einer intersubjektiven ethischen Legitimation, ist von großer Bedeutung, um die Gesundheitsversorgung unter den Bedingungen von Priorisierung und Rationierung dauerhaft umsetzen zu können und so das Gesundheitssystem auch in Zukunft bezahlbar zu halten. Die zentrale Fragestellung, mit der sich diese Arbeit daher beschäftigt ist, welche Rationierungsformen,-kriterienund grundlegenden Prinzipen für das Erreichen einer im Folgenden noch zu definierenden Gerechtigkeit in der Gesund-heitsversorgung zur Anwendung kommen sollten. Im Fokus dieser Arbeit steht die Gerechtigkeit der Allokation im moralischen Sinne, während die auf Gesetzen basierende juristische Gerechtigkeit nur flankierend betrachtet wird. Insbesondere die normativen Bestimmungen der deutschen Verfassung können jedoch, aufgrund ihrer enormen Bedeutung in diesem Kontext, nicht ganz außen vor gelassen werden. Zusätzlich zu den rechtlichen, werden auch ökonomische Aspekte in diese Arbeit mit einfließen.
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Der analytische Teil beginnt in Kapitel zwei, in welchem zunächst eine eingehende Betrachtung wesentlicher Begriffe erfolgt, die essentiell für das Verständnis und die Bearbeitung des Themas sind. So wird zum einen das Gut Gesundheit aus verschiedenen Sichtweisen betrachtet und der herausragende Wert dieses Guts für jeden Menschen sowie
Eine gerechtigkeitsorientierte Betrachtung der Allokation knapper Gesundheitsgüter im deutschen Gesundheitssystem
Page 8
die Frage eines generellen Anspruchs auf Gesundheit für jeden Menschen untersucht. Zudem wird eine für diese Arbeit gültige Arbeitsdefinition des zentralen und in vielfachen Definitionsversuchen anzutreffenden Begriffs der Rationierung festgelegt. Im Anschluss wird der gleichwohl relevante Begriff der Priorisierung sowie dessen Abgrenzungen und Überschneidungen zur Rationierung erörtert. Kapitel drei widmet sich der Entstehung von Knappheit im Gesundheitswesen und zeigt damit die grundlegenden Ursachen für das Erwachsen von Gerechtigkeitsproblemen auf. Mit dem Begriff der Gerechtigkeit an sich befasst sich Kapitel vier. Hier werden die wesentlichen ethischen Grundpositionen, als Basis von Gerechtigkeitsüberlegungen, zusammenfassend dargestellt, auf die in der Literatur bei der Entwicklung und Bewertung von Priorisierungs- und Rationierungskriterien zumeist Bezug genommen wird. Danach wird ein Zwischenfazit vorgenommen, welches die wesentlichen Aspekte der Gerechtigkeit und insbesondere die Schwierigkeit, Gerechtigkeit zu definieren und zu erreichen, zusammenfasst. Kapitel fünf befasst sich mit konzeptionellen Aspekten der Rationierung. Es werden sowohl die verschiedenen Ebenen, als auch die verschiedenen Formen der Rationierung, hinsichtlich ihrer Aufgaben und ihrer Bedeutung für eine gerechte Mittelverteilung, untersucht. Darauf folgt eine detaillierte Betrachtung der Verfahrensprinzipien, die das Grundgerüst von Priorisierungs-und Rationierungsentscheidungen bilden müssen. In Kapitel sechs werden schließlich inhaltliche Kriterien ausführlich analysiert und es wird bewertet, inwieweit sie, in Hinblick auf eine ethisch, rechtlich und gesellschaftlich konsensfähige schwerpunktsetzende Allokation knapper Gesundheitsgüter, anwendbar sind. Kapitel sieben bildet den Schluss dieser Arbeit. Hier werden die relevanten Erkenntnisse in Bezug zur Ausgangsfragestellung zusammengefasst und bewertet.
1.3 Untersuchungsmethodik und-materialien
Diese Arbeit basiert auf einer ausführlichen und systematischen Literaturrecherche. Als Informationsquellen werden insbesondere Sammelwerke und Fachartikel, die sich mit den einzelnen Aspekten der Thematik befassen, herangezogen. In Hinblick auf die Beantwortung der zentralen Fragestellung werden die wesentlichen Aspekte, Sichtweisen und Sachverhalte geschildert, ana-
Einegerechtigkeitsorientierte Betrachtung der Allokation knapper Gesundheitsgüter im deutschen Gesundheitssystem
Page 9
lysiert und bewertet, den Fokus dabei immer auf die Auswirkungen derselben auf Recht und Gerechtigkeit gerichtet. Von herausragender Bedeutung und unschätzbarem Wert sind hierbei Arbeiten von Georg Marckmann und Thomas Gutmann, die einen enormen Wissensschatz zum Thema der Rationierung zusammengetragen haben.
2 Grundlegende Betrachtungen
Um die Verteilungskriterien knapper Gesundheitsgüter genau analysieren zu können, bedarf es zu Anfang einer Betrachtung des theoretischen Hintergrundes. Zunächst muss untersucht werden, was dem Gut Gesundheit seine herausragende Bedeutung verleiht und deshalb ein hohes Maß an Vorsicht und Bedacht erforderlich ist, um alle Beteiligten und deren Ansprüche bei der Verteilung knapper Gesundheitsgüter zu berücksichtigen. Ebenfalls unerlässlich ist es, die relevanten Begrifflichkeiten zu definieren bzw. die verschiedenen und vielfältigen Definitionsversuche zu erfassen und Arbeitsdefinitionen festzulegen.
2.1 Das besondere Gut Gesundheit
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Die weite Verbreitung dieses Aphorismus gibt einen deutlichen Hinweis darauf, dass Gesundheit einen bedeutsamen Stellenwert in unser aller Leben besitzt. Gesundheit gilt als ein konditional-transzendentales Gut, d.h. sie besitzt Ermöglichungscharakter und stellt damit die Voraussetzung für die Umsetzung individueller Lebensprojekte dar(vgl. Kersting 2002, S. 42).Beeinträchtigungen dieses Gutes können schnell existenzielle Ausmaße annehmen. Das Fehlen von Ge-sundheit als transzendentalem Gut, beispielsweise neben dem Leben, der Freiheit und der Sicherheit, stellt eine gravierende Einschränkung für das Erlangen, das Schaffen bzw. die Nutzung oder Teilhabe an privaten und öffentlichen Gütern dar(vgl. Körtner 2006, S. 53).Aus diesen Merkmalen lässt sich ein objektiver und lebenslanger Bedarf nach dem Erhalt der Gesundheit ableiten und darüber hinaus, in einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive, auch ein Recht auf Ge-sundheitsversorgung und die staatliche Pflicht dafür begründen, da die Fähigkeit eines Individuums, seinen Beitrag bzw. seine Aufgabe in einer Gesellschaft
Eine gerechtigkeitsorientierte Betrachtung der Allokation knapper Gesundheitsgüter im deutschen Gesundheitssystem
Page 10
zu erfüllen, mit dessen gesundheitsabhängiger Leistungsfähigkeit korreliert(vgl. Honnefelder 2007, S. 34).Die Pflicht des Staates, für eine gesundheitliche Mindest-versorgung zu sorgen, lässt sich aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetztes (GG) ableiten und wurde vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) auch in mehreren Urteilen so bestätigt(vgl. Gutmann 2006, S. 40).Nun gibt es natürlich keine Möglichkeit direkt auf das Gut Gesundheit zuzugreifen oder Gesundheit zu verteilen. Gesundheit als solche ist nicht greifbar, jedoch gibt es Produkte und Dienstleistungen-die Gesundheitsgüter-die dazu beitragen (können), die individuelle Gesundheit zu erhalten bzw. wiederzuerlangen. Doch was bedeutet es, wenn ein Mensch gesund ist? Wann ist man im Besitz dieses Gutes? Es existieren vielfältige Definitionen von Gesundheit und egal welche man davon wählt, man kann letztlich nie objektiv festlegen, wann ein Mensch gesund ist und wann nicht. Zum einen ist das so, weil immer auch das subjektive Befinden und sozio-kulturelle Aspekte eine Rolle bei der Bewertung des Gesundheitszu-standes spielen. Vertritt man beispielsweise die biomedizinische Auffassung von Gesundheit, lediglich definiert als die Abwesenheit von Krankheit, so stellt sich die Gegenfrage, was ist Krankheit? Hier existieren landesindividuelle oder manchmal sogar krankenhausindividuelle Unterschiede. Was in einem Land als Krankheit gilt, dem wird in einem anderen Land möglicherweise kein Krankheitswert zugeschrieben und sei es nur, weil für bestimmte Laborparameter abweichende Normbereiche festgelegt sind. Nach Honecker existiert definitiv kein naturwissenschaftlich exakter Krankheitsbegriff(vgl. Honecker 1995, S. 83).Auch die Definition der Weltgesundheitsorganisation (World-Health-Organization (WHO)) die besagt:“Healthis a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absenceof disease or infirmity“(WHO 1948, S. 1),ist diesbezüglich nicht sehr konkret. Das Positive an der Definition der WHO ist, dass sie nicht nur auf das Physische reduziert. Allerdings müsste streng genommen fast jeder als krank gelten, wenn man diese Definition zu-grunde legt(vgl. Oberender et al. 2002, S. 19).Kritisch zu bemerken ist zudem, dass diese Definition zu hohe Erwartungen erzeugt und es illusionär wäre, selbst mit einer Mittelmaximierung, einen solchen Zustand für alle zu erreichen(vgl. Wallner 2007, S. 78).Grundsätzlich scheint es gar nicht notwendig, Gesundheit genau zu definieren und ebenso wenig sollte man die absolute Gesundheit für jedermann zum Ziel der Gesundheitsversorgung erklären. So ist es im Prinzip, für die mo-
Einegerechtigkeitsorientierte Betrachtung der Allokation knapper Gesundheitsgüter im deutschen Gesundheitssystem
Page 11
ralische Begründung eines Anspruchs auf die gerechte Verteilung des Gutes Gesundheit, zielführender sich darüber klar zu werden, in welcher Weise Ge-sundheit den Menschen zugutekommt. Hier kann man sich an den von Daniels beschriebenen„normal species functioning“(Daniels 2008, S. 29)orientieren. Daniels versteht darunter biologische Fähigkeiten, wie z.B. den Erwerb von Wissen, die sprachliche Kommunikation und die soziale Interaktion(vgl. ebd.).Ähnlich sieht das auch Kersting:
„Der Umfang der biologischen Basisfunktionalität definiert den für dasGesundheitswesen relevanten Krankheitsbegriff.(…)der ordnungsgemäße Zustand unserer biologischen Grundfunktionen und Grundfähigkeiten bestimmt die dem Ermöglichungscharakter des Gesundheitsgutes eingeschriebene Zielausrichtung.“(Kersting 2002, S. 48).