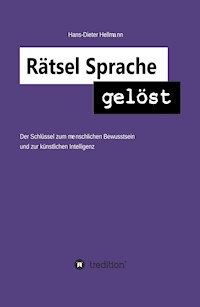
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein jahrhundertealtes Rätsel, die Entstehung und Funktionsweise der menschlichen Sprache, ist endlich gelöst worden. Ein konsequent naturwissenschaftlicher (biologischer) Ansatz hat dies ermöglicht. Dadurch können auch Fragen nach menschlichem Bewusstsein, natürlicher und künstlicher Intelligenz sowie Probleme wie "Ich-Identität" oder "freier Wille" schlüssig geklärt werden. Sowohl Bewusstsein (im Sinne von Selbstreflexion) als auch Intelligenz lassen sich nur mit Hilfe der Sprachfähigkeit feststellen und steuern. Wenn Sprache erfasst wird, werden auch damit verbundene Möglichkeiten begreifbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hellmann: Rätsel Sprache gelöst
„Ich glaube, Sprache gibt es nicht. Mir ist es bis heute nicht gelungen zu begreifen, was Sprache ist. Sprache ist für mich immer das, was in einer Situation passiert.“
Herta Müller (Literaturnobelpreis 2009) im Gespräch mit Ulrike Ackermann in der Zeitung „Die Welt“ am 23.06.2004
Hans-Dieter Hellmann
Rätsel Sprache
gelöst
Der Schlüssel zummenschlichen Bewusstseinund zur künstlichen Intelligenz
© 2020 Hans-Dieter Hellmann
Umschlaggestaltung: Annette Schukies und tredition
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40 – 44, 22359 Hamburg
ISBN:
978-3-347-00792-5 (Paperback)
978-3-347-00793-2 (Hardcover)
978-3-347-00794-9 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel: Die biologische Sprachtheorie
2. Kapitel: Sprache, der Rote Faden durch das Labyrinth
3. Kapitel: Die Sprachentwicklung bis zum Schulalter
4. Kapitel: Antriebe, Problemlösungen und Ich-Identität
5. Kapitel: Sprachentwicklung bis zur Pubertät, der Weg zum Bewusstsein
6. Kapitel: Denken und Denken lassen, natürliche versus künstliche Intelligenz
7. Kapitel: Woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir?
8. Anmerkungen
9. Literaturverzeichnis
1. Kapitel: Die biologische Sprachtheorie
In dieser Schrift wird eine biologische Sprachtheorie vorgestellt, die durch konsequente Anwendung der Methoden der vergleichenden Verhaltensforschung (Ethologie) entstanden ist und einen grundsätzlich anderen und neuen Ansatz zur Sprachuntersuchung darstellt als bisher üblich.1
Die biologische Sprachtheorie ermöglicht es, Wahrnehmungs- und Kognitionsvorgänge so zu beschreiben, dass der Zusammenhang zwischen Sprache und Denken sowie die Entwicklung von Bewusstsein im Sinne von Selbstbeobachtung oder Selbstreflexion erläutert werden kann.
Wir leben in einer sonderbaren Zeit.
Auf der einen Seite wird unsere Welt in unglaublichem Maße von technischen Entwicklungen bestimmt. Von Geräten und Abläufen, die nach rationalen, naturwissenschaftlichen Prinzipien entstanden sind und dadurch gesteuert werden. Unsere Umwelt wird so nach physikalisch-chemischen Gesichtspunkten analysiert und manipuliert. Und auch wir selbst, unsere Körper, werden von Medizinern und Biologen nach eben diesen Aspekten immer genauer untersucht und beeinflusst.
Auf der anderen Seite ist der Glaube an übernatürliche, irrationale oder metaphysische Dinge fest in unseren Gesellschaften verwurzelt. Der Glaube an besondere geistige Kräfte, die vom Materiellen unabhängig sein sollen, ist weit verbreitet.
Dieser auf den ersten Blick kaum fassbare Gegensatz hat eine einfache Ursache: Das Erleben von geistigen Leistungen, das Fühlen eines Bewusstseins und die Erfahrung einer Ich-Identität sind so gewaltig, dass es sich zwangsläufig aufdrängt, etwas Besonders, Eigenständiges müsse den geistigen Fähigkeiten des Menschen zu Grunde liegen.
Tatsächlich greift hier ein uralter Mechanismus, der schon immer Menschen in ihrem Urteil bestimmt hat. Wenn etwas nicht erklärbar ist, dann müssen eben magische, übernatürliche Mächte im Spiel sein. So kam es zum Blitze schleudernden Zeus oder Thor und die Seele ist uns halt von göttlichem Odem eingehaucht worden.
Obwohl inzwischen zahlreiche geistige Leistungen und Verhaltensweisen hirnorganischen Abläufen zugeordnet werden konnten und neurophysiologische Zusammenhänge immer besser verstanden werden, lässt es sich nicht leugnen, dass der letzte Beweis, die schlüssige und allgemein akzeptierte rationale Theorie zu dem Komplex „Denken-Bewusstsein-Sprache“ fehlt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass selbst naturwissenschaftlich gebildete, ernsthafte Menschen dem Glauben an höhere Mächte anhängen.
Es ist überfällig zusammenzufassen, was inzwischen an gesicherten Fakten zu diesem Komplex gesammelt wurde. Es geht dabei eigentlich um die uralten Fragen nach dem: Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?
Zugegeben, diese Fragen klingen ein wenig pathetisch:
Aber diese Fragen werden immer wieder aufs Neue gestellt, denn die Antworten – nein, der Glaube, Antworten darauf zu haben – bestimmen unser Handeln und unsere Meinung über die Menschen und die Welt, in der wir leben. Wie wir miteinander umgehen, ist untrennbar mit der Beantwortung dieser Fragen verbunden, – zumindest dann, wenn Menschen sich die Mühe machen, ihr Handeln und ihre Meinung über die Welt und sich selbst zu reflektieren.
Je nach der herrschenden Religion, Kultur oder Ideologie lauten die Antworten auf diese Fragen höchst unterschiedlich. Bekanntlich werden in manchen Regionen gleichzeitig die verschiedensten Meinungen dazu verbreitet. Es wird all zu oft erbittert darüber gestritten.
Diese Ebenen der Religion oder Ideologie zu berücksichtigen, kann nicht unsere Aufgabe sein. Wir halten es sogar für überflüssig und irreführend, sich mit diesen Bereichen zu beschäftigen, wenn man den Aufbau und die Funktionsweise des Menschen verstehen will. Ebenso werden wir uns nicht mit philosophischen Ansätzen auseinandersetzen, auch wenn die Eingangsfragen traditionell von diesem Fach behandelt werden. Aber wir sehen in der Arbeitsweise und den Gedankengebäuden der Philosophie keinen hilfreichen Weg.2
In dieser Schrift interessiert uns eine grundsätzlich andere Sicht:
Wir wollen die Eingangsfragen in erster Linie entsprechend der Methodik und den Ergebnissen der Naturwissenschaften beantworten. Das heißt hier, wir stellen und beantworten die Fragen vor allem aus biologischer Sicht. Damit setzen wir voraus, dass Menschen allein nach physikalischen und chemischen Prinzipien aufgebaut sind und funktionieren. Das Verhalten eines Menschen und seine Meinungen über seine Psyche sind die Folge des überaus komplexen und komplizierten Zusammenspiels von einfachen Grundbausteinen. (Damit folgen wir dem Konsens, der seit einigen Jahrzehnten in den biologischen Fächern unbestritten ist.)3
Dies ist also der Maßstab dieser Schrift und kennzeichnet gleichzeitig die grundsätzliche Aufgabenstellung: Lässt sich mit diesem Ansatz der Mensch tatsächlich erfassen oder bleiben zwangsläufig Lücken?
Die Frage nach der anscheinend besonderen und einzigartigen Natur des Menschen (nur er kann Fragen wie die eingangs gestellten formulieren) zielen auf seinen Geist, sein Denken, sein Bewusstsein und – dies wird meist völlig unterbewertet – auf seine Sprachfähigkeit. Die Sprachfähigkeit, die nur den Menschen unter allen Lebewesen auszeichnet, ist gleichzeitig das Mittel, um diese besonderen Denk- und Reflexionsmöglichkeiten beim Erwachsenen überhaupt erst zu konstatieren, zu beschreiben und dann die individuellen Beobachtungen auch an andere weiter zu geben.
Die Sprachfähigkeit stellt offensichtlich den Schlüssel zum Geist, zum Bewusstsein des Menschen dar. Erst die Sprache erlaubt es, die Fragen nach dem „Woher“, „Wer sind wir“ und dem „Wohin“ zu formulieren.
Da aber das Ziel selbst – die Bewusstseinsfähigkeit des Menschen zu erklären – hier am Anfang dieser Schrift zwangsläufig noch unklar ist, muss dieser Begriff vorweg etwas genauer beschrieben werden:
Unter Bewusstsein wird hier die Selbstbeobachtung (Selbstreflexion) verstanden. Damit ist die Beobachtung gemeint, dass anscheinend eine innere Ebene in uns existiert, auf der wir Probleme, Erlebnisse (Wahrnehmungen, Kognitionsvorgänge), kurz alles Gespeicherte, aber auch nur Vorgestelltes „in Gedanken“, was immer das an dieser Stelle noch sein mag, reflektieren.
In der Literatur gibt es je nach Lehrmeinung die unterschiedlichsten Einteilungen und Definition des Begriffs Bewusstsein. Da aber bisher eine exakte Erfassung des Phänomens aussteht, die hier erst geleistet werden soll, bleibt nichts anderes übrig, als sich dem Komplex umgangssprachlich, also vorverständlich zu nähern. Sobald wie möglich müssen dann exakte Definitionen, Beschreibungen und Begriffe an die Stelle dieser ersten Formulierungen treten.
Die Erläuterung dieses Problemkreises beinhaltet zwei Aspekte. Einmal den ganz pragmatischen: die Funktionsweise der menschlichen Sprache, des Denkens und Bewusstseins in Form eines Modells zu beschreiben.
Der zweite Aspekt entsteht dadurch, dass wir als Menschen uns selbst nur schwer wertneutral untersuchen und beschreiben können. Wir sind eingebunden in gesellschaftliche Strukturen, in überkommene Ordnungs- und Glaubenssysteme. Zwangsläufig schwingt dies mehr oder weniger deutlich in jeder Beschreibung unseres Selbst mit, denn wir sind gleichzeitig Objekt und Beschreibender dieses Objektes. So werden wir immer wieder innehalten und unsere Aussagen in dieser Hinsicht reflektieren müssen.
Der erste, pragmatische Aspekt steht natürlich im Vordergrund. Dazu soll hier eine Lösung, also eine beschreibende theoretische Erklärung für den Komplex Sprache-Denken-Bewusstsein entwickelt werden. Diese Lösung wird in Form eines Modells angeboten, das darauf ausgerichtet ist, in die Praxis umgesetzt zu werden.
Mit anderen Worten: Die einzelnen Bausteine des vorgeschlagenen Modells, der Theorie, könnten auch in einem künstlichen Gebilde zusammengesetzt werden. Dabei würden an die Stelle der natürlichen Sinnesorgane künstliche Sensoren und statt des Nervengewebes Bauteile mit Rechner- und Speicherfähigkeit treten. Wenn diese Maschine auch entsprechend der vorgeschlagenen Theorie programmiert würde, dann müsste dort die Leistung, die bisher nur dem Menschen möglich zu sein scheint – über Bewusstsein zu verfügen – beobachtbar sein.4
Dieser Ansatz versucht, akzeptierte (gesicherte) Erkenntnisse aus der Natur- und Geisteswissenschaft zu bündeln. Wobei natürlich nur solche Daten aus den Geisteswissenschaften herangezogen werden, die aus der Sicht naturwissenschaftlicher Methodik Bestand haben. Statt nur von einem Fachgebiet auszugehen, werden Materialien vor allem aus vier, teilweise recht unterschiedlichen Gebieten miteinander zu einer einheitlichen Theorie verknüpft:
Es handelt sich dabei um die allgemeine Sprachwissenschaft, Verhaltensbiologie (Ethologie), Entwicklungspsychologie und Aspekte der Künstlichen Intelligenz (Informatik/Computerwissenschaften). Natürlich müssen darüber hinaus Daten und Methoden aus der Evolutionstheorie nach Darwin, der Wissenschaftsgeschichte und anderer Fachgebiete mehr (z. B. der Neurophysiologie) berücksichtigt werden.5
Diese Aufzählung mag gewaltig klingen und ein enzyklopädisches Wissen verlangen. Doch das ist durchaus nicht erforderlich. Der rote Faden „Sprachfähigkeit“ erlaubt es, gezielt die notwendigen Materialien zu sammeln, zu bündeln und zu einem Modell zusammen zu bauen.
Vorweg ein paar Worte zum weiteren Ablauf des Unternehmens – also wie die folgenden Kapitel aufgebaut sind:
Es ist zuerst nötig im nächsten 2. Kapitel „Sprache, der Rote Faden durch das Labyrinth“ die methodischen Prinzipien, nach denen hier vorgegangen wird, genauer als bis jetzt beschrieben, zu erläutern. Das ist wichtig, weil wir versuchen, Menschen aus unterschiedlichen Bildungsgruppen anzusprechen: Naturwissenschaftler stehen geisteswissenschaftlichen Ansätzen oft etwas ratlos gegenüber und Geisteswissenschaftler haben häufig Schwierigkeiten mit naturwissenschaftlichen Ansätzen. Leider kann man den Problemkreis Bewusstsein aber nur dann verstehen, wenn man von beiden Disziplinen die Arbeitsweisen versteht. Also wird hier versucht, einem unvoreingenommen Leser etwas zu vermitteln – auf die Gefahr hin von Fall zu Fall sowohl den naturwissenschaftlich wie den geisteswissenschaftlichen Leser zu langweilen.
Vor allem geht es in diesem 2. Kapitel darum, das Handwerkszeug zu beschreiben, mit dem gearbeitet wird. Dabei wird geschildert, wie im Laufe der Evolution (Stammesgeschichte) höhere Lebewesen und Menschen entstanden. Dies muss dann zu der Persönlichkeitsentwicklung (von der Eizelle zum Erwachsenen) in Bezug gesetzt werden, denn während dieser beiden Entwicklungen sind unsere Denk- und Bewusstseinsmöglichkeiten entstanden.
Nach diesem methodischen Ansatz entsteht eine Art „Ablaufplan“. Es werden in den weiteren Kapiteln „Bausteine“ gesammelt, die in ihrem Zusammenspiel beim älteren Jugendlichen und dem erwachsenen Menschen zum Phänomen Bewusstsein führen. Der Spracherwerb und die Sprachentwicklung des Menschen ist die Richtschnur, an Hand derer Daten zusammengestellt werden. Es handelt sich um die Zeit ab dem dem ersten und zweiten Lebensjahr bis hin zur Pubertät. (3. bis 5. Kapitel)
Wir beschreiben damit die genetische und kulturelle Programmierung des Menschen und bieten so gleichzeitig die Bausteine für eine mögliche Umsetzung in Form eines künstlichen Modells des menschlichen Geistes an. Ein solches Modell des Menschen würde die hier vorgestellte Theorie überprüfbar machen, denn ein entsprechend aufgebauter, mit Sensoren ausgestatteter Rechner müsste Leistungen und Verhaltensweisen vergleichbar den menschlichen zeigen. (6. Kapitel)
Dies wird die Frage beantworten, wieweit Maschinen menschenähnliche Intelligenz/Bewusstsein zeigen können. Dabei erlauben wir uns eine Art „Gedankenexperiment“. Es dreht sich um die Frage, ob natürliche oder künstliche Geschöpfe6 eines Tages intelligenter als heutige Menschen sein könnten, beispielsweise neue Denkfähigkeiten oder Bewusstseinsebenen erreichen könnten.
Zum Schluss (im letzten 7. Kapitel) kommen wir wieder auf die Eingangsfragen zurück: Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Dabei geht es im Grunde genommen um eine sogenannte Technikfolgenabschätzung. Dies bedeutet zu beschreiben, welche gesellschaftliche Folgen eine systematische Analyse menschlicher Funktionen und ihres Nachbaus haben könnten.
2. Kapitel: Sprache, der Rote Faden durch das Labyrinth
Die Sprache des Erwachsenen ist ein überaus komplexes und kompliziertes Gebilde. Mehr als ein Jahrzehnt dauert es, bis ein Kind sie beherrscht. Dabei wird der menschliche Spracherwerb offensichtlich von unseren Erbanlagen gesteuert, weil er in allen Sprachen in ähnlichen Schritten abläuft. Da aber unsere Gene zu 99 Prozent mit denen der Menschenaffen übereinstimmen, müsste auch genetisch gesteuertes Verhalten, wie die Sprachfähigkeit, in Vorstufen bei unseren nächsten Verwandten beobachtbar sein.
Wenn Sprache der Rote Faden sein soll, der durch die verwirrende Vielfalt an Daten, Fakten, Annahmen, gesicherten und ungesicherten Beschreibungen und Theorien zum menschlichen Geist führen soll, dann stehen wir hier vor einem irritierenden Problem: Es gibt bisher keine allgemein akzeptierte Theorie, was Sprache eigentlich ist, wie sie entstanden sein könnte, wie sie funktioniert, was für ein Modell oder System dahinter stecken mag.
Und das Paradoxe an der Geschichte ist, dass wir hier Sprache benutzen, um Sprache zu beschreiben, ohne bis jetzt sagen zu können, was Sprache ist!
Ein Blick auf die Geschichte der Sprachbeschreibung fördert noch eine für diese Situation bezeichnende Geschichte zu Tage: Ende des 19. Jahrhunderts wurde eine solche Fülle an immer aber-witzigeren Sprach-Ursprungs-Theorien angeboten, dass die seinerzeit führende „Sociète de Linguistique de Paris“ 1866 in ihren Statuten beschloss, überhaupt keine Theorie über den Ursprung der Sprache mehr zur Veröffentlichung anzunehmen. Das hindert Autoren bis heute nicht, immer wieder aufs neue Arbeiten zum Ursprung der menschlichen Sprache anzubieten, die bisher allesamt unakzeptabel blieben.1
Diese kurze Beschreibung nährt einen scheinbar absurden Verdacht: Wenn es über Jahrhunderte hinweg unzähligen Forschern nicht gelang Sprache zu erklären – dann muss die Frage erlaubt sein, ob es Sprache als ein eigenständiges System überhaupt gibt. Ob nicht der bisherige Blick auf diese einzigartig scheinende Fähigkeit von Vorurteilen so gestört wird, dass eine Lösung des Problems verhindert wird. Also ein grundsätzlich anderer Ansatz gefunden werden muss.
Der Weg zur Lösung der Problematik ist erstaunlich einfach: Es müssen lediglich konsequent die über mehr als ein Jahrhundert hinweg entwickelten Arbeitsweisen der Biologie angewendet werden, denn schon ein flüchtiger Blick auf den Spracherwerb des Kindes2 zeigt, dass er durch Erbanlagen, also genetische Faktoren gesteuert wird. Damit liegt also eine materielle Basis zur Untersuchung von Sprache vor. Entsprechend greifen die Prinzipien der Naturwissenschaften. Es müssten sich also so etwas wie „Baupläne“ oder „Baugrundlagen“ für die Sprachfähigkeit finden lassen.
Der Hintergrund: Sowohl die körperlichen Strukturen als auch die sozialen und geistigen Fähigkeiten und Verhaltensweisen sind beim Menschen nicht neu entstanden, sondern bauen auf früheren Stufen unser Vorfahren und Verwandten im Tierreich auf. Diese im Verlauf der Stammesgeschichte (der Evolution) herausgebildeten Vorstufen müssten bei unseren Verwandten im Tierreich beobachtbar sein und wie in einem Zeitraffer dann in der Kindheit wieder aufgebaut werden. (Die Evolutionstheorie nach Charles Darwin und die sogenannte biogenetische Grundregel von Ernst Haeckel kommen hier zum Tragen.3)
Entsprechend muss beobachtet werden, wie sich in der frühen Kindheit die sprachlichen Fähigkeiten entwickeln; unter welchen Rahmenbedingungen sie auftreten. Und, das ist wichtig, es muss dabei berücksichtigt werden, was ein Kind schon vor der Sprachentwicklung leistet.
Dies sollte dann in Bezug zu den Leistungen unserer Verwandten im Tierreich gesetzt werden. Das heißt, es ist zu prüfen, wieweit es Vergleichbarkeiten zwischen dem Verhalten des Kleinkindes und dem der Tiere gibt. Wenn solche Ähnlichkeiten beobachtet werden, dann dürften diese die Basis unserer Sprachfähigkeit sein.
Bevor ein erster Blick auf die kindliche Entwicklung gerichtet wird, gilt es noch zwei wichtige Punkte festzuhalten:
Erstens: Nicht allein akustische Merkmale oder Signale (wir gebrauchen die beiden Ausdrücke im Zusammenhang mit Sprache als Synonyme) sondern auch Handzeichen und grafische Gebilde können als Sprachzeichen dienen und zu einer vollständigen Sprachbeherrschung führen. Die Beobachtungen bei Hörsprachgeschädigten (Taubstummen) haben das seit vielen Jahrzehnten eindeutig belegt.4
Diese Feststellung ist deshalb wichtig, weil nur so eine Vergleichbarkeit mit tierischem Verhalten möglich ist. Bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, fehlt die Fähigkeit differenzierte Laute zu produzieren, weil die dazu nötigen anatomischen Strukturen (ein entsprechender Kehlkopf) wie beim Menschen nicht vorhanden sind.
Zweitens ist es wichtig, darauf hin zu weisen, dass Kinder über Sinnesorgane verfügen müssen, um überhaupt Sprache erwerben zu können. Von Geburt an taub-blinde Menschen lernen nie Sprache.5 Dem Spracherwerb in der Kindheit geht deshalb immer eine Kognitionsentwicklung voraus. Das heißt Kinder erkennen und strukturieren ihre Umwelt mit Hilfe ihrer Sinnesorgane und den sie steuernden, verarbeitenden Nervensystemen.
Beim Blick auf diese Strukturierung fällt auf, dass Kinder schon früh, spätestens zum Ende des ersten Lebensjahres, Dinge oder Abläufe wieder erkennen, wenn nur ein Teil eines Gegenstandes wahrgenommen wird. Auch nur ein grobes Abbild – die Skizze eines Gesichtes zum Beispiel – reicht aus, um einen Menschen zu erkennen. Und natürlich werden zusätzliche Merkmale mit Personen oder Gegenständen verbunden – die Stimme eines Elternteils, ein Geruch, Farben, charakteristische Formen, Bilder und anderes mehr reichen aus, um zielgerichtete Reaktionen auszulösen, lassen also auf Erkennungsvorgänge schließen. So ist auch das sogenannte passive Sprachverständnis einzuordnen. Akustische Signale wie „Papa“, „Mama“ stehen für bestimmte bekannte, wieder erkannte, wahrgenommene Personen. Sprachliche Bitten, z. B. „Zeige deine Augen!“, werden korrekt erfüllt.
Aber auch Handzeichen, das Winken bei der Begrüßung oder beim Abschied werden mit bestimmten Situationen oder Abläufen verbunden.
Wenn unter diesem Gesichtspunkt, ohne jede theoretische Festlegung, Tiere beobachtet werden, dann kann festgestellt werden, dass Nahrung (Beute), Partner, Gefahren – kurz, alles was von Bedeutung für ein Lebewesen ist, häufig erkannt wird, auch wenn nur ein Teil statt des gesamten Objektes zu sehen ist. – Ein Geruch, eine Farbe, ein Geräusch reichen aus, um Verhalten auszulösen, als ob das gesamte Objekt zu sehen ist. Darüber hinaus – abhängig von der Lernfähigkeit der jeweiligen Spezies – können zusätzliche Merkmale erworben werden, deren Erscheinen wirkt, als ob das gesamte Objekt wahrgenommen wurde.
Viele Säugetiere – Hunde, Elefanten oder Pferde – können so akustische und andere Signale lernen, die offensichtlich für einen komplexeren Zusammenhang stehen. Und erst recht gilt dies für Menschenaffen. In den Sprachlernversuchen mit Schimpansen konnte mit Hilfe von Gesten aus der Taubstummen-Sprache und grafischer Symbole ein Verhalten beobachtet werden, das mit dem von zwei- bis dreijährigen Kindern vergleichbar ist.6
Es erhärtet sich der Verdacht, wird zur These, dass am Anfang keineswegs die Grundlage für den Erwerb irgendeines Systems gelegt wird. Alle etwas komplexer aufgebauten – also mit feineren Sinnesorganen und verarbeitenden Nervensystemen ausgestatteten – Lebewesen erfassen die unterschiedlichsten Erscheinungen und Abläufe in ihrer Umwelt. Es erkennen, begreifen, strukturieren, kategorisieren (wie immer man die Kognitionsvorgänge nennen mag) Tiere wie Menschen ihre Umwelt und reagieren auf Dinge, auch wenn nur ein Teil zu sehen ist.
Anders ausgedrückt: die Strukturierung der Umwelt scheint die primäre Fähigkeit zu sein, die dem Spracherwerb vorausgeht.
Diese These des Primats der Umwelterfassung (des Erkennen und Begreifens der Welt) lange bevor Sprachzeichen als zusätzliche Merkmale zu Begriffen oder wahrgenommenen Kategorien hinzugefügt werden, lässt sich durch einen Blick auf genau abgegrenzte Bereiche unserer wahrgenommen Welt unterstützen:
Musik und die Notensprache sind das Beispiel, das unsere These unterstützen soll.
Menschen können Musik wahrnehmen, Melodien und Instrumente an ihrem Klangablauf erkennen. Sie können selber musizieren, Musikinstrumente spielen, mit andern Menschen gemeinsam singen. Und all dies gelingt, ohne die „Sprache“ der Musik, das Notensystem, zu beherrschen.
Für einen ungeübten Laien sind Noten nichts weiter als Handlungsanweisungen um beispielsweise bestimmte Tasten auf dem Klavier in bestimmter Lautstärke, Rhythmus, Länge usw. zu betätigen. Ein Physiker könnte die Notenschrift auch durch mathematische Formeln für Schallfrequenzen ersetzen. Aber niemand käme auf die Idee, zu sagen, dass diese Punkte und Striche auf den fünf Linien Musik seien.
Allerdings kann schon ein geübter Sänger beim Blick auf ein Notenblatt den Eindruck haben, eine Melodie wahrzunehmen, er kann sie vom Blatt singen. Ein professioneller Musiker muss nicht einmal eine Tonfolge eines Notenblattes laut singen oder summen, um sie zu erkennen.7
Erst recht beherrschen Dirigenten und Komponisten diese direkte Umsetzung der schwarzen Punkte und Linien in Klänge. Ein guter Komponist benötigt kein Klavier, um Musik auf einem Notenblatt festzuhalten. Er braucht nicht einmal mehr hören zu können. Es genügt, wenn er einmal gehört hat! (Das bekannteste Beispiel dafür war Ludwig van Beethoven.)
Das Beispiel Musik und ihre Sprache kann hier in diesem Kapitel nur als erster Hinweis auf die grundsätzlich andere Sicht auf das Phänomen Sprache dienen. Im Verlauf dieser Schrift werden wir noch ausführlich darauf zurück kommen und dieses und andere ähnliche Beispiele genauer analysieren.
Entsprechend scheint auch die natürliche Sprache, also im Normalfall das akustische Merkmal, vergleichbar mit den Punkten und Linien der Notenschrift zu sein. Die Schallschwingungen der gesprochenen Sprache stehen für konkrete Sinneseindrücke, so wie die Noten auf dem Papier dies auch widerspiegeln. Bei der Notenschrift durchschauen wir diesen Zusammenhang, bei der natürlichen Sprache nicht, sondern nehmen fälschlich an, dass die Sprache etwas ganz Eigenständiges sei.
Es gibt noch ein zweites einfaches Beispiel, das auf das Primat der Umwelterfassung hinweist: Gemeint sind Kinder, die mehrsprachig aufwachsen. Also zum Beispiel Kinder, die mit der Mutter deutsch und dem Vater französisch sprechen. Wenn diese Kinder nun mit etwa drei Jahren in den Kindergarten kommen, dort natürlich deutsch sprechen und gebeten werden doch zu sagen was „Guten Tag“ auf französisch heißt, sind sie dazu nicht in der Lage, reagieren irritiert. Aber natürlich begrüßen sie ihren Vater, wenn er sie abholen kommt, mit „Bonjour!“.8
Offensichtlich wachsen die mehrsprachigen Kinder in zwei Umwelten auf: der des Vaters und der der Mutter. Die beiden unterschiedlichen Kognitionserfahrungen können noch nicht miteinander in Bezug gesetzt werden. Das sprachliche Handeln ist beim Dreijährigen immer an die jeweiligen direkten Wahrnehmungserfahrungen gebunden. Erst mit etwa fünf bis sechs Jahren können Kinder anfangen zu übersetzen (erst wenn die weitere Sprachentwicklung im 5. Kapitel untersucht wird, lassen sich die Ursachen für diese Leistungssteigerung erläutern.)
Wie das Beispiel Notenschrift ist auch die Mehrsprachigkeit beim Aufwachsen nur ein Hinweis aber kein Beweis dafür, dass Wahrnehmungsvorgänge bzw. Kognitionsabläufe die eigentliche Basis für den Spracherwerb bilden. Bevor wir daraus eine These ableiten, die verifiziert oder falsifiziert werden muss, gilt es noch einen weiteren wichtigen Punkt vorweg anzusprechen: Das Stichwort Kommunikation.
Es mag verwundern, dass dieser Komplex erst jetzt behandelt wird. Sprache wird ja nur in der Kommunikation zwischen Kind und Erwachsenem gelernt. Im sprachlichen Austausch von Meinungen und Informationen manifestiert sich Sprache. Und doch, Kommunikation und Sprache haben nur sekundär etwas miteinander zu tun.
Ebenso wie die Wahrnehmungsverarbeitung ist Kommunikation eine der Sprachfähigkeit lange vorausgehende Fähigkeit (ein stammesgeschichtlich älterer Teil). Alle Geschöpfe, die in sozialen Strukturen leben, müssen zwangsläufig untereinander Informationen austauschen, um ein funktionierendes Gruppenleben zu ermöglichen.
Sie beobachten einander. Das beginnt bei der Wahrnehmung der Körperhaltung eines Rudelmitgliedes und reicht bis hin zu akustischen Signalen, die als Nachrichten empfangen und weitergegeben werden. Diese Informationen sind für den Zusammenhalt und das Überleben einer Gruppe buchstäblich überlebenswichtig. Und Kommunikation hat natürlich noch einen gewaltigen Vorteil: Es genügt, wenn ein Gruppenmitglied einen Feind entdeckt hat, um diese Information für alle erlebbar zu machen. Wahrnehmungsvorgänge werden so multipliziert.
Entsprechend sind solche Kommunikationsformen mehrfach in der Evolutionsgeschichte parallel in verschiedenen Tiergruppen entstanden (so wie dies auch für andere Leistungsmöglichkeiten oder Organe gilt, die einen Überlebensvorteil haben.)
Der grundsätzliche Unterschied zwischen den tierischen und den menschlichen Kommunikationsmöglichkeiten liegt allein darin, dass Menschen jeder wahrgenommen Kategorie ein zusätzliches Zeichen zuordnen können, bei Tieren dies nur sehr eingeschränkt möglich ist. (Welche genetisch bestimmte Mechanismen diesem Leistungssprung beim Menschen zugrunde liegen, wird im folgenden 3. Kapitel zu klären sein.)
Der Evolutionsvorteil liegt auf der Hand, wenn über akustische oder andere Signale/Merkmale Informationen über alle Wahrnehmungen immer genauer übermittelt werden können. Mit dieser genetisch bedingten Technik versehene Lebewesen sind bei der Nahrungssuche und bei der Abwehr von Feinden deutlich im Vorteil. Zwangsläufig setzten sie sich anderen Spezies gegenüber durch. Darüber hinaus lassen sich mit dieser Fähigkeit aber auch Informationen aus der Vergangenheit für alle Gruppenmitglieder in die Gegenwart holen und die Zukunft planen. Entsprechend sind solche Geschöpfe weniger den augenblicklichen Einflüssen ausgeliefert. (Wir können diese Vorteile hier nur kurz skizzieren, das muss im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch genauer überprüft, analysiert und diskutiert werden.)
Zusammengefasst lautet die These, die in den folgenden Kapiteln überprüft werden muss:
Menschen wie Tiere erfassen ihre Umwelt, erkennen Dinge oder Abläufe, strukturieren und bilden Kategorien (Merkmalskom binationen)9.
Es muss aber nicht die gesamte Kategorie vollständig wahrgenommen werden, es reicht in vielen Fällen, wenn einzelne Merkmale erkannt werden. Es können darüber hinaus zusätzliche Merkmale erlernt werden, deren Wahrnehmung so wirkt, als sei der gesamte Komplex erkannt worden.
Tiere können nur partiell zusätzliche Zeichen hinzufügen.
Menschen sind in der Lage, jedem wahrgenommenen Zusammenhang ein weiteres Merkmal10 zuzuordnen. Allein auf dieser minimalen zusätzlichen Fähigkeit beruht die Überlegenheit des Menschen und baut seine Sprachfähigkeit auf.





























