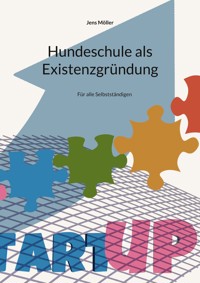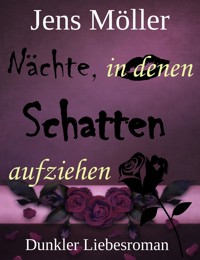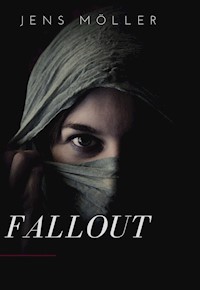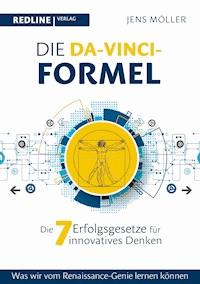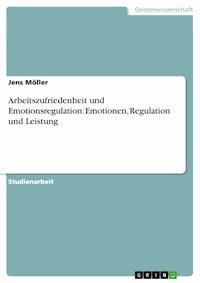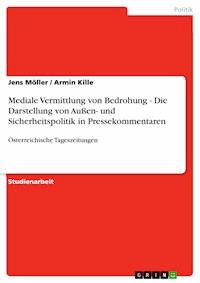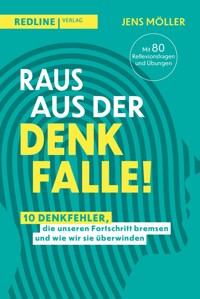
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Klarer denken. Besser entscheiden. Innovativer handeln. Klimakrise, digitaler Wandel und gesellschaftliche Konflikte – wir erleben eine Zeit, in der sich unser Leben rasant verändert und wir die Weichen für unsere Zukunft stellen müssen. Doch statt mutige Entscheidungen zu treffen und neue Wege einzuschlagen, verharren wir immer wieder in alten Denkmustern und blockieren damit unseren eigenen Fortschritt. In Raus aus der Denkfalle! zeigt Innovationsexperte Jens Möller wie uns unbewusste Denk- und Fortschrittsfallen – vom »Vogel-Strauß-Effekt« bis zum »Gesetz der Trivialität« – ausbremsen und wie wir sie überwinden können. Mit überraschenden Beispielen, neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und seinem praxisnahen PUSH-Modell liefert er Impulse, die zum Umdenken und Handeln motivieren. Für mehr Klarheit, Innovationskraft und echte Veränderung. Ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die nicht länger abwarten, sondern die Zukunft aktiv gestalten wollen – im Alltag, im Beruf und in unserer Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
REDLINE VERLAG
JENS MÖLLER
RAUS AUS DER
DENKFALLE!
10 DENKFEHLER,
die unseren Fortschritt bremsen und wie wir sie überwinden
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2025
© 2025 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Christiane Otto
Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt
Umschlagabbildung: shutterstock/hlodesigner365
Satz: Daniel Förster
eBook: ePUBoo.com
ISBN druck 978-3-69046-004-0
ISBN ebook (EPUB, Mobi) 978-3-96267-090-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für Max
Habe immer den Mut, deinen Weg zu finden und zu gehen.
Inhalt
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin, und keiner ginge mal nachsehen, wo man hinkäme, wenn man hinginge.1
Kurt Marti
Vorwort
Als ich die ersten Probekapitel von Jens Möllers Buch Raus aus der Denkfalle! las, saß ich gerade an einem Ort, der sich die Zukunft extragroß auf die Fahnen geschrieben hatte: Ich war zur Innovationskonferenz SXSW ins texanische Austin gereist. Hier werden Jahr für Jahr die neuesten Digitaltrends und Disruptionen vorgestellt und diskutiert – zwischen glamourösen Filmpremieren und coolen Musik-Acts. Ein guter und inspirierender Ort.
Doch irgendwas fühlte sich damals, im Frühjahr 2025, komisch an. Donald Trump war wenige Wochen vorher zum zweiten Mal als US-Präsident vereidigt worden. Das Land war gespalten wie nie zuvor. Diversität und Inklusion waren per Staatsdekret »out«, und Elon Musk legte gerade seine diamantenbesetzte Kettensäge an Institutionen wie die NASA, USAID und generell den Forschungssektor. Und trotzdem fiel auf der SXSW-Konferenz – einem insgesamt sehr liberalen, inklusiven Ort, an dem Fortschritt und Forschung gefeiert werden – kaum ein politisches Wort. Kein Protest, keine Debatten, keine Solidaritätsbekundungen mit den Forscherinnen und Forschern, die nach dem Wunsch von Donald Trump plötzlich nicht mehr zu Klimawandel oder Geschlechtergerechtigkeit forschen sollten. Es fühlte sich an, als würde die gesamte Konferenz kollektiv den Kopf in den Sand stecken.
Nun ist es so, dass man auf so einer Veranstaltung auch viel in Schlangen steht oder sitzend darauf warten muss, dass irgendwas Innovatives losgeht. Und so fand ich Zeit, das zu lesen, was ich mit der Bitte um Feedback in meiner Mailbox gefunden hatte: die ersten Kapitel dieses Buches. Und siehe da – gleich die erste Denk- und Fortschrittsfalle, die Jens Möller sich vorknöpfte, war der »Vogel-Strauß-Effekt«. Auch die anderen beiden Kapitel, die er mir damals schickte, interessierten mich sofort. Denn ich mag es, über Denkfehler und kognitive Verzerrungen zu lesen – ein bisschen immer in der Hoffnung, ihnen dadurch ein Schnippchen zu schlagen. Auch wenn ich natürlich weiß, dass man vielen Denkfehlern auch dann noch erliegt, wenn man von ihnen weiß. Aber ich finde es auch einfach interessant, dass wir Menschen – so unterschiedlich wir sonst auch sein mögen – oft so berechenbar in haargenau dieselben Fallen tappen.
Umso mehr freue ich mich, dass aus den Probekapiteln, die ich damals auf der SXSW las, nun ein komplettes Buch geworden ist. Denn wir können es gut gebrauchen! Unsere Gegenwart ist durchdrungen von Widersprüchen: Während Algorithmen und Biotechnologie Quantensprünge versprechen, bremsen Skepsis, Perfektionismus oder reine Gewohnheit den dringend nötigen Aufbruch. Jens Möller zeigt, dass hinter dieser Trägheit keine böse Absicht steckt, sondern wiederkehrende kognitive Verzerrungen, die unser Handeln subtil steuern. Er seziert zehn solcher »Denk- und Fortschrittsfallen« – vom erwähnten Vogel-Strauß-Effekt über den Nirwana-Trugschluss bis zum Tocqueville-Effekt – und ordnet sie jeweils in Geschichte, Psychologie und aktuelle Beispiele ein.
Besonders reizvoll finde ich, dass sich Theorie hier nicht in akademischen Fußnoten erschöpft. Jedes Kapitel mündet in das sogenannte PUSH-Modell: Vier aufeinander aufbauende Schritte übersetzen wissenschaftliche Erkenntnisse in alltagstaugliche Übungen. Ob es darum geht, eigene Vermeidungsmuster offenzulegen oder den »Fluch des Wissens« im Team zu entlarven. Die Leserinnen und Leser bekommen ein Werkzeug, das sich unmittelbar erproben lässt.
Wer in Unternehmen, in der Verwaltung oder wie ich als Selbstständiger mit Veränderungs- und Innovationsprozessen ringt, wird den praxisnahen Ansatz schätzen. Gleichzeitig spannt das Buch auch größere Bögen: Es verknüpft klassische Studien der Verhaltensökonomie mit aktuellen Beispielen aus Politik, Tech-Branche und Klimadebatte. So macht Jens Möller etwa deutlich, wie der Naive Realismus Desinformation in sozialen Medien befeuert und Debatten vergiftet. Spätestens hier wird klar, warum dieses Buch mehr ist als ein weiterer Business-Ratgeber: Es ist ein Beitrag zur gesellschaftlichen Resilienz im KI-Zeitalter.
Gleichzeitig verzichtet der Autor auf den belehrenden Tonfall, dem viele Sachbücher und Management-Traktate erliegen; er bleibt neugierig, manchmal selbstkritisch und stellt die Leserinnen und Leser als Mitdenkende ins Zentrum. Natürlich kann kein Buch alle Zukunftsfragen lösen. Doch Raus aus der Denkfalle! liefert einen klar strukturierten Kompass, um mentale Blockaden zu erkennen und konkrete erste Schritte einzuleiten. Wer sich auf das Experiment einlässt, wird seine eigenen Denkmuster nicht nur besser verstehen, sondern auch die Dynamiken in Teams, Organisationen und Gesellschaft schärfer wahrnehmen.
Meiner Ansicht nach ist das Buch damit kein weiterer Ratgeber, der nach kurzer Lektüre im Regal verschwindet. Vielmehr kann Raus aus der Denkfalle! als ein kompaktes Nachschlagewerk für klareres Denken und mutigeres Handeln dienen. Als Leitfaden, der dabei hilft, in komplexen Zeiten Orientierung zu behalten und Fortschritt aktiv zu gestalten.
Wie gerne würde ich das Buch all denen zu lesen geben, die damals bei meinem SXSW-Besuch Anfang 2025 den Kopf in den Sand steckten und so taten, als sei alles in bester Ordnung. Dafür fehlt nur noch eine englische Übersetzung – und eine Zeitmaschine.
Christoph Koch, Berlin im Juli 2025
1Eine Reise zurück in die Zukunft
Wir Menschen sind Innovations- und Veränderungsgiganten. Glauben Sie nicht? Dann möchte ich Sie zu einem Gedankenexperiment einladen. Stellen Sie sich vor, das Zeitreisen wäre erfunden worden und wir reisen rund 1,8 Millionen Jahre2 zurück in die Vergangenheit nach Afrika. Dort treffen wir in der Savanne auf die ersten Exemplare des Frühmenschen Homo erectus (dt. der aufrechte Mensch). Der Homo erectus ähnelte uns bereits in seinen Körpermaßen und Proportionen und gilt als Vorläufer des heutigen Menschen. Er lebte in Gemeinschaften, baute Werkzeuge, ging auf die Jagd und zähmte das Feuer.
Angenommen, es gelänge uns wie durch ein Wunder, dem Homo erectus verständlich zu machen, dass sich aus ihm einmal ein Geschöpf namens Homo sapiens (dt. der vernunftbegabte Mensch) entwickeln wird. Ein Wesen, das Symphonien schreibt, das Weltall erobert, Heilmittel gegen fast alle Krankheiten entwickelt und menschenähnliche Roboter baut. Vermutlich würde er lauthals lachen oder erschrocken davonlaufen. Der ferne Blick in die unfassbar erfolgreiche Entwicklungsgeschichte und innovative Zukunft des Menschen würde sein ohnehin noch kaum ausgeprägtes Vorstellungsvermögen komplett sprengen.
Dabei spielt gerade dieser Homo erectus in der Evolutionsgeschichte des modernen Menschen eine ganz bedeutende Rolle. Forscher glauben, dass er der erste unserer frühen Vorfahren war, der Afrika verließ und sich in der Folgezeit – sozusagen als erster »Weltbürger« – über weite Teile Europas und Asiens ausbreitete. Pioniergeist, Flexibilität, Veränderungswillen und Anpassungsfähigkeit als Schlüssel des menschlichen Fortschritts scheinen also schon seit langer, langer Zeit tief in unserer DNA verankert zu sein.
Dann ist es ja gut – wirklich?
Wunderbar, alles gut. Dann brauchen wir uns heute im Hier und Jetzt ja keine Sorgen mehr zu machen. Tatsächlich? Leider nein. Die ganze Wahrheit ist wie immer deutlich komplexer und widersprüchlicher. Denn auch das genaue Gegenteil trifft zu. Wir Menschen sind notorische Zukunftsbremser. Um das zu erkennen, genügt ein Blick in unsere heutige Zeit. Der Klimawandel, die Digitalisierung, weltweite Konflikte und Kriege, alternde Gesellschaften sowie der wachsende Einfluss künstlicher Intelligenz (KI) erfordern von uns einen gewaltigen Veränderungswillen. Doch was wir erleben, ist oft das genaue Gegenteil: Stillstand oder sogar die Sehnsucht nach einer Rückkehr in die »guten alten Zeiten«. Daran ändern auch anderslautende politische Statements, die besten privaten Absichten oder Modewörter wie »Agilität« und »Transformation« in Unternehmensbroschüren nicht viel. Wir rufen zwar gerne nach großen Veränderungen, möchten sie in Wirklichkeit aber gar nicht haben.
Auch das hat ganz viel mit unseren Vorfahren zu tun. Natürlich ist die Geschichte des Menschen eine Geschichte unglaublicher Entwicklungssprünge, Innovationen und Errungenschaften. Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch, dass sich diese tiefgreifenden Entwicklungen bis vor Kurzem noch über unglaublich lange Zeiträume erstreckten. Im Leben der Frühmenschen gab es oft über Tausende von Generationen kaum größere Veränderungen. Bis es unseren frühen Urahnen beispielsweise gelang, aus dem steinernen Faustkeil das nachschärfbare Keilmesser mit nur einer schneidenden Kante zu entwickeln, dauerte es fast 1,7 Millionen Jahre. Auch von den ersten heute nachweisbaren Symbolen der Menschheit3 bis zur Entwicklung der ersten Schrift durch die Sumerer in Mesopotamien vergingen immerhin rund 115 000 Jahre.4 Diese und viele weitere Beispiele machen eines deutlich: Die revolutionären Fortschritte unserer Vorfahren waren bei genauerer Betrachtung keine Entwicklungssprünge, sondern »Entwicklungsmarathons«.
Aus alt wird neu – nur unser Gehirn macht nicht mit
All das änderte sich grundlegend erst vor rund 500 Jahren mit dem Beginn der europäischen Renaissance, einer Zeit der Wiederentdeckung und Weiterentwicklung antiken Wissens. Während dieser einflussreichen Epoche ebneten unzählige großartige Erfinder, Entdecker und Erneuerer wie Johannes Gutenberg, Leonardo da Vinci, Christopher Columbus und Martin Luther den Weg in die heutige Moderne. Die Explosion des Wissens und der menschlichen Erfindungen, die zu dieser Zeit entfesselt und später durch vier große industrielle Revolutionen weiter verstärkt wurde5, hält bis heute an. Allein im Jahr 2022 wurden weltweit knapp 3,5 Millionen neue Patente angemeldet; die Menge der weltweit generierten digitalen Datenmenge, ein Indikator für den geistigen Reichtum einer Zivilisation, lag im selben Jahr bei knapp 105 Zettabyte.* Zum Vergleich: Im Jahr 2010 lag diese Datenmenge weltweit gerade einmal bei 2 Zettabyte.6 Unser Gefühl, dass sich die Welt um uns herum immer schneller wandelt und entwickelt, täuscht also nicht. Wir befinden uns inmitten eines Zeitalters exponentiellen Fortschritts, das unsere Veränderungsbereitschaft jeden Tag aufs Neue auf die Probe stellt.
Das große Problem dieser menschheitsgeschichtlich noch sehr jungen Entwicklungen ist, dass die Evolution unseres Gehirns mit all diesen rapiden Veränderungen nicht wirklich Schritt halten konnte. Obwohl die Vermutung naheliegt, dass sich mit der Moderne auch unser Gehirn grundlegend verändert hat, ist das nicht der Fall. Stattdessen verläuft die Entwicklung unseres Gehirns seit vielen Millionen Jahren nach dem Prinzip »Auf alt setz’ neu«. Nach dem Zwiebelprinzip wurden im Laufe der Evolution bereits bestehende, uralte Hirnregionen einfach immer wieder mit neuen Schichten überzogen. So thront unser Mittelhirn buchstäblich auf unserem alten Rautenhirn, und über diese beiden Systeme wurde unser Vorderhirn gestülpt. Das Rautenhirn, die älteste Hirnregion, entwickelte sich bereits vor über 550 Millionen Jahren. Es ist für lebenswichtige Funktionen wie die Atmung, den Herzschlag und die Reflexe verantwortlich, die für einen Tyrannosaurus Rex genauso wichtig waren, wie sie es heute für uns Menschen sind. Die darauffolgende Schicht des Mittelhirns koordiniert unsere Sinnesorgane wie Augen und Ohren und steuert unsere motorischen Aktivitäten. Das Vorderhirn, die neueste Entwicklung, ist für Aufgaben wie das Sprechen, Entscheiden und komplexes Denken verantwortlich, steht meist aber unter starkem Einfluss der älteren Hirnregionen.
Genau dieser starke Einfluss ist der Grund, warum wir Menschen die einzige Spezies sind, die so intelligent ist, wohlüberlegte Pläne für die Zukunft zu entwickeln – aber auch so dumm, diese immer wieder für ein kurzfristiges Wohlgefühl über Bord zu werfen. Wir alle kennen das aus unserem Privat- und Berufsleben nur zu gut: Ich möchte mich gesünder ernähren, aber einmal zu McDonald᾽s geht noch. Ich muss mehr Sport machen, aber erst schaue ich mir noch die neue Serie auf Netflix an. Das Weiterbildungsprogramm an den Wochenenden brächte mich beruflich sicher weiter, aber das kann ich auch noch nächstes Jahr machen. Obwohl wir wissen, was gut für uns ist, handeln wir oft nach dem genauen Gegenteil.
All das passiert, weil Programme unseres »Steinzeit-Gehirns« die Planungsprozesse unseres »Neuzeit-Gehirns« torpedieren. Unseren Vorfahren, die als Jäger und Sammler durch die Landschaft zogen und saisonale Lager aufschlugen, war das Hier und Jetzt sehr viel wichtiger als die Zukunft. Vereinfacht formuliert ging es für sie nur darum, immer wieder den Tag zu überleben. Habe ich genug zu essen? Wie schütze ich mich vor wilden Tieren? Wo ist die nächste Wasserquelle? Wann kommt der Winter? Alles, was bei der Beantwortung dieser und anderer Fragen Sicherheit und Stabilität garantierte, war gut, alles Neue und zu viel Veränderung eher schlecht. Vertrautes, von dem keine Gefahr ausging, war unseren Urahnen lieber als Fremdes, das womöglich lebensbedrohlich war. Genau diese Denkweise hat sich bis heute auch in vielen bekannten Sprichwörtern manifestiert. Wohl jeder kennt das Sprichwort »Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach«.
Superhelden mit gewissen Schwächen
Die genannten Beispiele zeigen, dass es den lange propagierten Homo oeconomicus(dt. der ökonomische Mensch) – der stets vernünftig und zu seinem besten Nutzen entscheidet – nicht gibt. Auch unsere subjektive Vorstellung, rational und objektiv zu sein, entspricht leider nur selten der Wahrheit. Die Evolution hat uns zwar mit den kognitiven Superkräften ausgestattet, rational sein zu können, die fehlerfreie Anwendung dieser Kräfte konnte sie jedoch nicht sicherstellen. Viel zu oft werden unsere Gedanken, Entscheidungen und Handlungen durch Gefühle, Stimmungen, Vorurteile und Irrtümer bestimmt, die so unbewusst ablaufen, dass sie uns gar nicht auffallen. Denn so fähig unser Gehirn zu innovativen Höchstleistungen ist, so anfällig ist es leider auch für Aberglauben, äußere Einflüsse und grobe Fehleinschätzungen.
Das Problem: Viele dieser Denkfallen – die uns alle gleichermaßen betreffen – sind gewaltige Fortschrittsbremsen. Sie sind dafür verantwortlich, dass wir dringend erforderliche Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik immer wieder zerreden, verschleppen oder in eine falsche Richtung lenken. Diese kurzsichtigen Verhaltensweisen können wir uns nicht mehr leisten. Wir leben schon lange in keinem beschaulichen Steinzeitdorf mehr, sondern in einer hochkomplexen und vernetzten Welt mit großen globalen Herausforderungen wie der Klimakrise, wachsenden geopolitischen Spannungen oder der zunehmenden Verbreitung von Desinformation.
Die gute Nachricht: Wir können diese Herausforderungen bewältigen. Gelingen wird uns das paradoxerweise aber nur, wenn wir als Menschen ein besseres Verständnis unserer kognitiven Schwächen entwickeln. Bislang haben wir uns leider viel zu wenig mit ihnen auseinandergesetzt. Dadurch haben wir sie und ihre oftmals negativen Auswirkungen als Normalzustand akzeptiert. Das muss sich ändern. Aus diesem Grund lenke ich in meinem Buch den Fokus auf genau diese kognitiven Verzerrungen, Effekte und Denkfallen