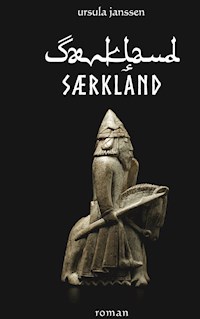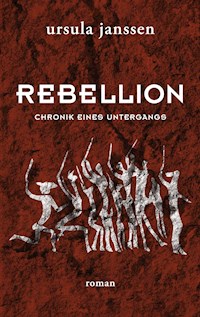
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Bronzezeit im Süden der Iberischen Halbinsel, um 1.550 v. Chr.: Das Leben ist hart für die Bauern, die im Herrschaftsbereich von Iltir ihre Fronarbeit verrichten müssen. In der streng hierarchisch geregelten Gesellschaft hat jeder seinen festen Platz; Widerspruch ist nicht vorgesehen und wird streng bestraft. Der Priesterkönig und sein General sind weit entfernt von den Nöten des Volkes. Doch einige Angehörige der Bauern- und Handwerkerklassen beginnen, ihre Lebensumstände zu hinterfragen, begehren auf, und werden in eine Situation getrieben, in der es kein Zurück mehr gibt. REBELLION beruht auf den archäologischen Befunden der El Argar Kultur in Südspanien und ihrem jähen Ende. Von den Frauen und Männern, die zu diesem Ende beigetragen haben könnten, erzählt dieser Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
All den Menschen gewidmet, die unter der
Herrschaft selbsternannter „Priesterkönige“
und brutaler Generäle zu leiden haben,
die hungern, weil korrupte Regimes
die Ressourcen des Landes allein
für sich beanspruchen. Denn,
wie schon dieses frühe
Beispiel aus der
Geschichte
zeigt:
Unrechtsregime sind nicht ewig.
„Überall nämlich entsteht der Aufruhr wegen der Ungleichheit [...]. Das Verlangen nach Gleichheit ist es nämlich immer und durchgängig, das zu Aufständen treibt.“
- Aristoteles
"Um zu sein, muß der Mensch revoltieren, doch muß seine Revolte die Grenzen wahren, die sie in sich selbst findet und wo die Menschen, wenn sie sich zusammenschließen, zu sein beginnen."
- Albert Camus
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Nachwort
Personenregister
Rezepte aus Iltir
Quellen und weiterführende Literatur
Zu guter Letzt
Vorwort
Zu Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten die belgischen Brüder und Bergwerksingeneure Henri und Louis Siret im südspanischen El Argar eine bronzezeitliche Siedlung, die in Europa ihresgleichen suchte. Schnell wurde klar, dass es sich um eine eigenständige Kultur mit weiteren Fundorten handelte, die ihre Entdecker nach dem ersten Fundort „El-Argar-Kultur“ tauften. Die Ausgrabungen weiterer Stätten, mittlerweile unter der Federführung der Autonomen Universität Barcelona, dauern bis heute an.
Dieser Roman beruht auf den archäologischen Befunden der El-Argar-Kultur in Südspanien. Diese bronzezeitliche, schriftlose Zivilisation, die etwa seit 2.200 v. Chr. bestand, wird oft als „der erste Staat Westeuropas“ oder auch als das „Troja des Westens“ bezeichnet. Sie zeichnete sich durch eine starke Zentralisierung und eine ungewöhnliche Standardisierung ihrer materiellen Kultur aus: schlichte Formen, keine Verzierungen, so gut wie keine figürlichen Darstellungen. Die Ausgräber fanden Hinweise auf eine starre Hierarchie innerhalb der Gesellschaft, auf Mangelernährung, Gewalt und Unterdrückung, sowie auf die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, insbesondere die systematische Abholzung von Wäldern, die zu einer immer weiteren Verknappung führte. Um 1.550 vor unserer Zeitrechnung, kurz nach dem Zeitpunkt des weit entfernten, aber dennoch für den gesamtem Mittelmeerraum folgenschweren Ausbruchs des Thera-Vulkans auf Santorin, findet die El-Argar-Kultur ihr jähes Ende. Von diesem Ende und den Frauen und Männern, die dazu beigetragen haben könnten, möchte ich berichten. Die Geschichte hat mich, als ich zum ersten Mal darüber las, sogleich in ihren Bann gezogen und ich habe mir ausgemalt, wie es damals gewesen sein mag.
Natürlich ist dies ein Roman mit fiktiven Charakteren. Dennoch habe ich versucht, so viel der archäologischen Befunde wie möglich mit hinein fließen zu lassen. Am Ende dieses Buchs findet sich ein Anhang, in dem ich auf die einzelnen Aspekte eingehe und aufkläre, wo die Wissenschaft aufhört und die Fiktion anfängt.
Die Parallelen zu bestehenden Problemen der Menschheit verstehen sich, glaube ich, von selbst.
Mein besonderer Dank gilt nicht nur – wie immer – meiner Familie, die sich klaglos in meine Geschichten hineinziehen lässt und mir mit Kommentaren, Korrekturen und Anregungen zur Seite steht, sondern auch dem Archäologen und Erforscher der El-Argar-Kultur, Dr. Roberto Risch von der Autonomen Universität in Barcelona, der mich mit wertvollen Literaturhinweisen und Anmerkungen unterstützt hat.
Martina Franca, 30. Dezember 2020
1
Im Süden der Iberischen Halbinsel, um 1.550 vor unserer Zeitrechnung
Die Sonne brannte von einem tiefblauen, wolkenlosen Himmel auf die staubige Straße hinab, die durch die Stadt hinauf zur Zitadelle führte. Es hatte schon seit Monaten so gut wie nicht mehr geregnet. Der aufgerissene Lehmboden war glühend heiß, aber Tumaran spürte die Hitze unter seinen nackten, ledrigen Fußsohlen kaum. Den schweren Sack mit Linsen, den er auf seinen knochigen Schultern die Anhöhe hinauf schleppte, spürte er dafür umso mehr; er lastete schließlich schon seit Stunden auf ihm. Um den Kopf hatte er sich ein Tuch geschlungen, das ihn ein wenig vor der Sonne schützte. Durstig war er auch; bald jedoch hatte er sein Ziel erreicht, dann würde er endlich etwas Wasser aus dem großen Wasserreservoir, das auf halbem Weg in die Oberstadt lag, schöpfen und trinken können, vorausgesetzt die Wachen dort fanden keinen Grund, ihn davonzujagen. Die Wächter am unteren Stadttor waren schon nicht allzu freundlich gewesen, obwohl er, Tumaran, ja nur seine Pflicht tat und seine Linsenernte ablieferte. Viel war es nicht gewesen in diesem Jahr. Linsen brauchten schließlich nicht viel Wasser, aber etwas mehr Regen wäre doch nötig gewesen. Dennoch hatte die ganze Familie die letzten Tage damit zugebracht, die geernteten Linsenbüsche mit Holzschlegeln zu dreschen und die Linsen anschließend im heißen Wind von der Spreu zu trennen, denn jede einzelne der Hülsenfrüchte war von ihrer eigenen kleinen Schote umgeben. Den jüngeren Kindern fiel die Aufgabe zu, die Spreu nach vereinzelt übrig gebliebenen Linsen zu durchforsten – die Hülsenfrucht war kostbar und die Wächter würden die Spreu womöglich untersuchen, um sicherzustellen, dass Tumaran und seine Familie auch sorgfältig gearbeitet hatten. Leider durften sie die kostbaren Linsen nicht behalten, sondern mussten sie in der Stadt vor dem Tor zum Palast, der sich ganz oben auf dem steilen Hügel befand, abliefern. Der Palastbezirk von Wilusipami – so nannten die Adeligen ihre Residenzstadt, obwohl sie von den Bauern einfach nur als Iltir, „die Stadt“, bezeichnet wurde – war für die Angehörigen von Tumarans Klasse tabu, ihn als Bauer zu betreten unter Androhung der Todesstrafe verboten. Die einzige Ausnahme war ein jährlich vom Herrscher bestimmter Vertreter der Bauernkaste, der an einigen wenigen offiziellen Versammlungen im Palast teilzunehmen hatte.
Ihre gesamte Ernte, seien es Hülsenfrüchte oder Gerste, mussten die Bauern in der Stadt abgeben, dafür bekamen sie im Gegenzug die von der Palastverwaltung festgelegten Rationen für ihre Familien zugeteilt. Linsen oder Kichererbsen waren seit geraumer Zeit nur noch selten darunter, zu Festtagen vielleicht, normalerweise gab es für die Bauern nur Gerstenmehl, das ausschließlich von Müllern in der Stadt gemahlen werden durfte und das sie zu Brei verkochten oder zu Fladenbroten buken. Nur die Eicheln, die sie in den wenigen verbliebenen Wäldern sammelten, durften sie behalten. Auch heute würde Tumaran im Gegenzug für seinen großen Sack Linsen nichts als eine magere Ration Gerstenmehl erhalten, vielleicht sogar gemahlen aus seiner eigenen Ernte, die er und seine Familie erst vor zwei Monaten mühsam in Iltir abgeliefert hatten. Der Weg von Tumarans Dorf und den ihm zugeteilten Feldern in die Stadt war weit und mühselig; schon mit geringer Last dauerte er mehrere Stunden, mit den schweren Gerstensäcken war es mindestens eine halbe Tagesreise, und sie mussten mehrfach hin- und herreisen, um die gesamte Ernte in die Stadt zu schaffen. Tumarans Bruder Beles, der nicht nur der Ältere, sondern auch der Wagemutigere der beiden war, hatte in diesem Jahr heimlich einen Teil seiner Linsenernte einbehalten und unter dem Fußboden seiner Lehmhütte versteckt, aber er, Tumaran, traute sich das nicht. Er hatte gesehen, was mit Bauern geschah, die dabei ertappt worden waren, dass sie einen Teil ihrer Ernte unterschlagen hatten. Die Strafen dienten der Abschreckung und nach Tumarans Dafürhalten erfüllten sie diesen Zweck gut. In Gedanken daran schauderte er leicht, blieb einen Augenblick stehen, um den Sack mit den Linsen auf seinen Schultern zurecht zu rücken und ein paar lästige Fliegen, die sich an den Schweißperlen auf seiner Stirn zu laben versuchten, zu verscheuchen, und setzte dann seinen Aufstieg fort. Die eng aneinander geschmiegten, schmucklosen Häuser mit ihren steinernen Fundamenten und hellbraunen Aufbauten aus Lehm unter ihren zu allerlei Tätigkeiten genutzten Flachdächern wurden stetig größer, je mehr er sich der über der Stadt thronenden Zitadelle näherte. Hier lebten die Menschen der Handwerkerklassen: je angesehener ihr Handwerk, desto näher standen ihre Häuser am Palastbezirk. Dementsprechend lebten die Waffen- und Silberschmiede der Zitadelle am nächsten.
„Die Linsen zu verstecken ist ganz einfach“, hatte Beles ihm erklärt. „Ich hebe einfach eine weitere kleine Grube in der Hütte aus und sage, dass es ein Grab ist, dass uns wieder ein Kind verstorben ist. Die Wächter werden schon nicht mitzählen!“
Verstorbene Kinder wurden traditionell im Haus der Familie unter dem Fussboden bestattet. Auch im Haus von Tumaran und seiner Frau Lortikis befanden sich schon mehrere wieder mit Lehm verputzte Gruben im Fußboden. Jetzt war sie wieder schwanger.
„Besser ein falsches Grab im Haus als noch ein echtes, denn das wird es geben, wenn wir das ganze Jahr wieder nichts als Gerste und Eicheln haben“, hatte Beles hinzugefügt.
„Pass du nur auf, dass wir stattdessen nicht bald dich im Feld begraben müssen!“, hatte Tumaran erwidert und den Kopf über so viel verwegenen Ungehorsam geschüttelt.
Mittlerweile musste er schon im Bezirk der Silberschmiede angelangt sein; höher lebten nur noch die Wächter – die wahrscheinlich unbeliebteste Klasse, sowohl nach Meinung der Bauern als auch die der Handwerker – und natürlich, ganz zuoberst, die adelige Herrschaftsschicht selber. Den Priesterkönig, Tattis war sein Name, hatte Tumaran nur ein einziges Mal aus weiter Entfernung gesehen und er hatte sich schnell aus dem Staub gemacht, um den vielen Wachen mit ihren in der Sonne glitzernden bronzenen Waffen nicht in die Quere zu kommen. Die Wächter trugen Stabdolche, eine Art Hellebarde mit jeweils einer scharfen, doppelseitigen Klinge, die quer am Ende einer langen Stange befestigt war, sowie spitze Bronzedolche und Kurzschwerter. Es wurde gemunkelt, dass ein Angehöriger der untersten Klassen die Waffen nur berühren musste, um sofort daran zu sterben; auf jeden Fall waren ihre Waffen sehr mächtig. Metall war nämlich noch so eine Sache, die Bauern nicht besitzen durften. Ihre Werkzeuge bestanden aus Stein, Knochen und Holz. Die Sicheln und Sensen zum Beispiel, mit denen sie die Gerste abernteten, bestanden aus einer Reihe kleiner Steinklingen, die in einen halbmondförmigen Rahmen aus gebranntem Ton eingelassen waren, der wiederum an einem Holzschaft befestigt war. Da der zur Herstellung von Klingen erforderliche Stein – Flint – von weit her kam und schwer zu beschaffen war, die kleinen Klingen bei der Ernte zudem schnell abstumpften, mussten die Bauer dieselben Flintsplitter immer und immer wieder neu in Form schlagen, bis ihre Sicheln Reihen aus kleinen scharfen Zähnchen glichen. Metallwerkzeuge waren den Handwerkern vorenthalten, Waffen gar dem Adel und den Wächtern. Schon während seines Aufstiegs konnte Tumaran die glänzenden Hellebarden der Palastwache ausmachen. Das von ihnen bewachte Tor des Palastbezirks war sein Ziel.
Endlich stand Tumaran vor dem streng bewachten Zugang; die Zunge klebte ihm am Gaumen. Er versuchte zu schlucken und wandte sich dann an einen der Wächter: „Ich bringe meinen Tribut für diesen Sommer, Herr, Linsen, von den Feldern im Osten.“
„Das ist alles?“
„Ja, Herr, das Jahr war schlecht, es hat nicht geregnet, die Dürre, ihr wisst...“
„Wo ist der Rest?“
„Es gibt keinen Rest; das ist alles, was meine Familie und ich geerntet haben.“
„Name und Ort?“
„Tumaran, Sohn des Lakobor, meine Felder liegen an der Biegung des alten Flussbetts im Osten, unterhalb des Eichenhügels.“ Er scharrte mit seinen bloßen Füßen im staubigen Boden und hielt dabei den Blick gesenkt. Dabei sah er die neu wirkenden Bastsandalen des Wächters. Bauern gingen barfuß.
„Gut“, sagte der Wächter endlich. „Wir werden dein Haus und deine Felder überprüfen.“
„Der Boden ist karg und wir haben gerade erst mehr Wald gerodet, um demnächst mehr anbauen zu können. Aber die andauernde Trockenheit...“
„Genug, Bauer! Es wird sich alles zum Besten wenden, dank unseres geliebten Herrschers Tattis, der täglich zum Wettergott betet und mit Sicherheit sein Gehör findet. Stell den Sack in die Nische dort drüben, geh zu dem Palastverwalter dort in der hellen Tunika, nenne ihm deinen Namen und Ort, lass dir den dir zustehenden Sack Mehl geben und mach, dass du davonkommst!“
Tumaran gehorchte nur allzu gern und begab sich anschließend auf dem schnellsten Wege zum großen Wasserreservoir. Dafür, dass die heiße Jahreszeit erst ihren Höhepunkt überschritten hatte, wies das enorme ovale Becken aus gestampftem Lehm, aus dem ganz Iltir versorgt wurde, erschreckend wenig Wasser auf. Es war bereits zu zwei Dritteln leer, doch die Trockenzeit würde mindestens noch einen Monat, wenn nicht länger, dauern. Bei ihm im Dorf sah es ähnlich aus. Die spärlichen kleinen Flüsse, die im Winter und Frühling die Landschaft durchflossen, waren längst versiegt. Jetzt mussten sie mit dem Wasser auskommen, das sie in ihren eigenen kleinen Zisternen gesammelt hatten. Die Zisterne von Iltir war ganz anders: groß und vollkommen glatt lagen die schrägen Wände des halb vollen Wasserbeckens über der glitzernden Wasseroberfläche. Tumaran musste die Rampe mehrere Meter hinuntersteigen, um sich am Rande des Wassers hinzuhocken und mit seiner einfachen, unverzierten Keramikschale Wasser zu schöpfen. Das abgestandene, leicht muffig riechende Wasser stillte seinen Durst. Dann wickelte er noch das Tuch ab, das er als Sonnenschutz auf dem Kopf trug, benetzte es mit dem kühlenden Nass, band es sich wieder um den Kopf und genoss die Erfrischung, die es ihm brachte. Rasch knotete er die Tonschale wieder in den Zipfel seiner Tunika, nahm den viel zu leichten Sack mit Gerstenmehl auf und folgte dem Pfad, der von hier aus den Hügel hinunter zur Stadt hinausführte. Am Stadttor wandte er den Blick von der Richtstätte und den dort ausgestellten Verurteilten ab, so wie er es bereits bei seiner Ankunft getan hatte. Zu schrecklich war ihm ihr Anblick. Sie mochten tot sein oder noch leben; so genau wollte Tumaran das gar nicht wissen, aber der Geruch des Todes, der ihm in die Nase stieg, sprach eine deutliche Sprache. „Opfer an die Götter“ war die offizielle Bezeichnung der hier Gerichteten, aber ihre Opfer waren nicht freiwillig. Er ging schneller und machte, dass er nach Hause zu seiner Familie kam.
Gut drei Stunden später war Tumaran wieder in seinem Dorf angekommen. Er war sehr schnell gegangen, beinahe gelaufen, da seine Last leicht gewesen war. Kurz vor der Ankunft in seinem Dorf hatte er die örtliche Garnison passieren müssen, die von ihrer erhöhten Hügellage aus den jetzt fast ausgetrockneten Flusslauf, die Straße und die umgebenden Dörfer kontrollierte. Die Wachen fragten alle Bauern, die auf der Straße unterwegs waren, nach dem Ziel ihres Wegs. Manchmal musste Tumaran seine Ernte nur bis zur Garnison bringen, manchmal wurde er eben in die Stadt zum Palasttor geschickt. Die Entscheidungen der Verwaltung zu hinterfragen stand ihm nicht zu. Vielleicht waren die Speicher der Garnison einfach schon voll oder diejenigen des Palastes eben leer, wer wusste das schon?
Tumarans Frau Lortikis mahlte vor ihrer Hütte Eicheln zu Mehl, um damit die Gerstenvorräte zu strecken. Ihre beiden noch jungen Kinder, der ernste Lakobor, der nach seinem verstorbenen Großvater benannt war, und die kleine Nesaiun spielten mit ein paar Murmeln aus getrocknetem Lehm. Lortikis war nun schon zum fünften Mal schwanger; immerhin hatten zwei ihrer Kinder bis jetzt überlebt. Inteber, die Frau von Tumarans Bruder Beles, war bisher weniger glücklich gewesen. Von den Alten erinnerte sich niemand daran, dass jemals so viele der Kinder so früh nach der Geburt verstorben waren, aber ebensowenig konnten sie sich an derart viele Dürrejahre hintereinander erinnern.
Lortikis verbarg nur mühsam ihre Erleichterung, als sie Tumaran bei dessen Rückkehr erblickte. Der regelmäßige Gang nach Iltir war zwar beinahe Routine, aber dennoch mit gewissen Risiken verbunden. Gerade letzte Woche erst war die Nachbarin Animkei reichlich verspätet, mit gebrochener Nase, zwei fehlenden Schneidezähnen und stark humpelnd in das Dorf zurückgekehrt, als sie anstatt ihres kränkelnden Mannes, der die Reise eigentlich hätte antreten sollen, einen Sack Linsen nach Iltir gebracht hatte. Beles hatte bei ihrem Anblick angefangen, laut die gewaltverliebten Wachen und den gierigen Herrscher in seinem Palast zu verfluchen, und Tumaran hatte ihn nur mit Mühe davon abhalten können, seine Tiraden so lange zu wiederholen, bis er in echten Problemen steckte: „Verdammte Wache, dieses verfluchte Regime! Ich mache das nicht mehr mit! Was macht sie so erhaben, dass die uns derart behandeln dürfen? Wenn das so weitergeht, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als uns zu wehren! Nur noch Gewalt kann uns retten, sage ich!“
Tumaran hatte ihm einen kräftigen Stoß mit dem Ellenbogen versetzt, während die Umstehenden sich hastig und mit möglichst unbeteiligten Gesichtern von ihm entfernt hatten. Glücklicherweise hatte keiner der Wächter oder ihrer Spione von dem Vorfall Wind bekommen, sonst wäre Beles jetzt kaum mehr bei seiner Frau. Die Strafen für Widerspenstigkeit reichten von Prügelstrafen über Halbierung der ohnehin schon mageren Rationen bis hin zu Verbannung in eine noch abgelegenere Kolonie oder gar zum Tod, wessen man sich am Stadttor von Iltir immer wieder versichern konnte. Das Strafmaß für einzelne Vergehen war schwer abzuschätzen, was vermutlich zusätzlich abschreckend wirken sollte.
Lortikis ging auf Tumaran zu und umarmte ihn herzlich. Sie war etwas kleiner als er, hager und sehnig, so wie alle im Dorf. Trotz des entbehrungsreichen Lebens, das sie führten, lächelte sie oft. Ihr Lächeln glitt jedoch in Enttäuschung ab, als sie den Sack mit Gerstenmehl sah.
„Das ist alles?“, fragte sie.
„Das ist es. Und sie haben sogar angekündigt, im Haus nach versteckten Linsen suchen zu wollen. Du wirst den Brei mit mehr Eicheln strecken müssen.“
Seufzend machte sie sich wieder an die Arbeit, während Tumaran den Sack mit dem kostbaren Mehl an einem Ring in der Decke aufhängte, so dass die Ratten ihn nicht erreichen konnten. Müde stillte er erst seinen Durst mit Wasser, dann ließ er sich auf die Matte vor ihrer kleinen Hütte fallen und beobachtete seine Frau beim Mahlen des Eichelmehls. Sie benutzte dabei fast die gleichen Mahlsteine wie die Müllerinnen in der Stadt für die Gerste, aber den Bauern war das Mahlen von Getreide streng untersagt. Ihre kleineren Mahlsteine waren ausschließlich für Eicheln bestimmt. Lortikis zerdrückte die zuvor geschälten, zwei Tage lang gewässerten und dann wieder getrockneten Eicheln zunächst grob mit dem Reibstein auf dem flachen unteren Mahlstein und zermahlte die Stücke dann zu Mehl, indem sie den oberen Reibstein mit beiden Händen immer wieder kraftvoll über den Mahlstein rieb, wobei sie auf den Knien hockend den ganzen Körper vor- und zurück bewegte, um die nötige Kraft aufzubringen. Je größer ihr Bauch wurde, desto anstrengender wurde diese harte Arbeit, und ihr Rücken schmerzte zunehmend. In der Ferne, am Horizont, hinter der Garnison, konnte Tumaran in der tief liegenden Sonne den Hügel und die Burg von Iltir ausmachen. Vielleicht hatte Beles doch nicht so Unrecht, dachte er in solchen Momenten, so kann es nicht ewig weitergehen, doch er verwarft den Gedanken gleich wieder erschrocken. So war es doch schon immer gewesen, oder nicht? Das war eben die Ordnung der Welt, wie sie von den Göttern aufgestellt worden war, was konnte oder durfte ein einfacher Bauer wie er schon ändern?
„Ich werde morgen früh losgehen, um Kaninchenfallen aufzustellen“, unterbrach Lortikis seine Gedanken, während sie eine besonders hartnäckige Fliege verscheuchte. „Wir brauchen dringend mal wieder Fleisch. Frische Kräuter finde ich schon seit Wochen nicht mehr. Aber das ein oder andere Kaninchen wird sich im Wald hoffentlich noch auftreiben lassen.“
Tumaran nickte müde. „Ja, morgen, gut. Tu das!“ Kaninchen waren die einzigen Tiere, die die Bauern jagen und essen durften. Rotes Fleisch war den höheren Klassen vorbehalten. Aber um Kaninchen scherten sie sich nicht. Bei so vielen hungrigen Mäulern blieb Kaninchenfleisch dennoch eine rare Delikatesse, viel mehr noch als Linsen. Dabei hatten sie ein bisschen Abwechslung in der Ernährung dringend nötig. Tumaran würde gleich morgen wieder zum Frondienst eingezogen werden. Da die Nahrung niemals reichte und die Böden der ehemals bewaldeten Hügellandschaft schnell auslaugten, musste immer mehr Wald gerodet werden. Auch diese Aufgabe wurde den Bauern zugeteilt. So gab es immer weniger Eicheln in der Nähe des Dorfs, und auch die Kaninchen wurden rarer. Lortikis musste lange gelaufen sein, um den beachtlichen Haufen an Eicheln zu sammeln, den sie jetzt verarbeitete. Auch verbrauchte das Einweichen der Eicheln, das notwendig war, um sie essbar zu machen, viel kostbares Wasser.
Bei der Feldarbeit mussten alle mithelfen: Männer, Frauen und Kinder. Bei der Waldrodung oder dem Bau von Wasserreservoirs immerhin waren schwangere Frauen und junge Mütter jedoch ausgenommen, so dass sie die Zeit zum Sammeln, Jagen und Fallenstellen nutzen und so die karge Kost für ihre Familien aufbessern konnten. Ihnen war zwar aufgefallen, dass die Böden immer trockener wurden, je mehr Wald sie rodeten, aber sie sprachen es nicht laut aus – was konnten sie schon tun?
Kurz vor Sonnenuntergang nahm die Familie gemeinsam ihr abendliches Mahl ein: ein einfacher Brei aus Gersten- und Eichelmehl, gewürzt mit etwas Salz und einigen getrockneten Wildkräutern, die Lortikis im Frühsommer gesammelt und getrocknet hatte. Kein Festmahl zwar, aber es machte einigermaßen satt. Die untergehende Sonne glühte heute Abend ungewöhnlich rot; der Abendhimmel schien in Flammen zu stehen. Lortikis überlegte, ob das prächtige Farbenspiel am Himmel ein Omen darstellte, das mit der diesjährigen Dürre zusammenhing. Nur der Herrscher in seinem Palast hatte Zugang zum Wettergott, dessen Namen die einfachen Leute nicht einmal aussprachen, und konnte in Kontakt mit ihm treten. Ob er wusste, was vor sich ging? Als Bäuerin zog sie ohnehin die lebenspendende Fruchtbarkeitsgöttin Kubba dem herrschenden Wettergott vor.
Schon bald nach dem Essen, nachdem das Feuer sowohl im Hof als auch am Himmel verloschen war, legte sich die ganze Familie müde auf den Matten, die auf dem gestampften Lehmboden in ihrer Hütte ausgelegt dafür ausgelegt wurden, zum Schlafen nieder. Die beiden Kinder waren schnell eingeschlafen. Tumaran und Lortikis hielten sich noch an den von der Arbeit rissigen Händen und träumten heimlich – jeder für sich – von einem besseren Leben.
2
Zur gleichen Zeit legte sich auch Niosena schlafen, allerdings lag ihre Schlafmatte aus Bastfasern auf einer leicht erhöhten Bettstatt des kleinen Zimmers oberhalb ihrer Töpferwerkstatt im Handwerkerviertel von Iltir. Natürlich war es nicht wirklich ihre Töpferwerkstatt; wie alles in der Stadt gehörte sie dem Palast und war ihr nur zugeteilt worden. An diesem Tag hätte sie dem Bauern Tumaran auf seinem anstrengenden Weg zum Palastbezirk begegnet sein können, wenn sie denn nur aus der Tür ihrer Werkstatt herausgetreten wäre. Aber sie hatte diszipliniert an der vor ihr stehenden Töpferscheibe gearbeitet, um ihr tägliches Soll an Gefäßen zu erfüllen. Sie arbeitete routiniert und präzise: wunderschöne, gleichmäßig geformte, aber völlig unverzierte Töpfe, Becher und Kelche; ihre hochstieligen und dünnwandigen Tonkelche waren die schönsten in ganz Iltir und schafften es sogar bis an die Tafel des Palastes. Jetzt hatte sie die noch ungebrannten Formen zum Trocknen in den Hinterhof gestellt und die bereits getrockneten vom Vortag in die Brennerei gebracht; dann hatte sie den Ton für den nächsten Tag vorbereitet, ihn mit fein zerstoßenem Glimmerschiefer gemischt und so anschließend ausgiebig unter Einsatz ihres gesamten Körpergewichts geknetet. Das war stets der anstrengendste Teil ihrer Arbeit. Als ihr Mann Akerunin noch gelebt hatte, war er es meist gewesen, der den Großteil der Tonvorbereitung übernommen hatte, während sie die ungebrannten Gefäße in die Brennerei brachte;. Seit seinem Tod Anfang des vergangenen Jahres allerdings war Niosena nun alleine für die Werkstatt verantwortlich.
Dennoch war sie froh, wieder in diesen Teil der Stadt zurückgekehrt zu sein und ihrem Beruf als Töpferin wieder nachgehen zu dürfen. Fast ein Jahr lang hatte sie zur Strafe für ihre und Akerunins Aufsässigkeit ganz unten im Viertel als Müllerin arbeiten müssen. Die Müllerinnen und Müller arbeiteten mit kleinen Mahlsteinen, vor denen sie knieten und auf denen sie mit je einem Reibstein die Gerste vor sich zerrieben. Immer noch schmerzten Niosenas Rücken und Knie von dieser Zeit, denn es war eine harte und auf Dauer schmerzhafte Arbeit. Daher wurde sie auch gerne als Strafe für aufmüpfige Handwerker eingesetzt. Die Fertigkeiten der Leinweber, Bäcker, Schlachter, Gerber, Töpfer, Waffenschmiede oder gar Silberschmiede waren zu kostbar, um diese zu verbannen oder womöglich sogar zu töten, auf diese Weise aber fing man zwei Kaninchen in einer Falle: die Handwerker muckten nicht auf und die Gerste wurde gemahlen. Immerhin musste das gesamte Getreide des Landes in Iltir vermahlen werden, auch dasjenige, das als Ration den Bauern zurückgegeben wurde. Natürlich gab es auch Müllerfamilien, die ausschließlich diesem Beruf nachgingen. Sie gehörten zwar zur Klasse der Handwerker und standen somit über den Bauern, waren aber innerhalb ihres Standes ganz unten angesiedelt, sogar noch unter den Gerbern, was sich auch in ihrem Wohnort am Fuße des Handwerkerviertels bemerkbar machte, gleich an der Stadtmauer, wo die Luft am stickigsten war und wo nur selten ein frisches Lüftchen wehte, das die mehlgeschwängerte Luft fortgetrieben hätte. Die Angehörigen der Müllerfamilien waren leicht an ihrem gebeugten und humpelnden Gang zu erkennen, auch wenn sie sich den weißen Staub aus den Haaren gekämmt hatten. Die Gerber dagegen konnte man leicht am Geruch erkennen und die Weber an den Rillen an ihren Schneidezähnen, die mit der Zeit entstanden, weil sie die Fäden bei der Arbeit immer wieder mit den Zähnen festhielten. Wahrscheinlich, dachte Niosena, war sie für andere ebensogut auf den ersten Blick als Töpferin auszumachen.
Ihre Strafe war sicher hart gewesen, aber im Vergleich zu ihrem Mann hatte sie es ja nicht so schlimm getroffen. Eigentlich hätte Akerunin nicht getötet werden sollen, er war schließlich ein guter und sorgfältiger Töpfer. Aber General Agallu von der Wache hatte seinen Dolch nicht zurückhalten können oder wollen. Anschließend hatte Agallu behauptet, er habe sich verteidigen müssen und der Tod Akerunins sei im Eifer eines ausbrechenden Gerangels geschehen. Natürlich hatte sich niemand getraut, ihm zu widersprechen. Und so war Akerunin im benachbarten Haus seines älteren Bruders unter dem Fußboden, so wie es Brauch war, zusammen mit einigen seiner schönsten Keramikgefäßen in einem enormen Tonkrug bestattet worden und Niosena war ein Jahr zu den Müllerinnen geschickt worden. Kinder hatten sie noch keine gehabt.