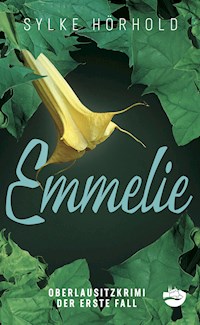4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bei einer Flutkatastrophe gibt ein Erdrutsch am Kirchberg ein altes, längst stillgelegtes Grab zwei Wachsleichen frei. Ein Unrecht aus den letzten Kriegstagen tritt ans Licht, als sich herausstellt, dass eine davon gewaltsam ums Leben kam und nachträglich in das Grab gelegt wurde. Bei den nachfolgenden Ermittlungen verdichten sich die Erkenntnisse, dass nicht nur die Schwiegerfamilie des Arztes Dr. Paul Eisler und deren Freunde in diesen Todesfall verwickelt sein müssen, sondern die Leiche auch in Verbindung mit der Fabrikantenfamilie Böhme steht, die Paul und seine Frau, die Rechtsanwältin Julia, ein jeder auf seinem Fachgebiet, betreuen. Je näher Paul und Julia, gemeinsam mit ihrem Freund, dem Ortschronisten Charlie, der Lösung des Rätsels kommen, umso ärger werden die Widerstände in ihren Familien und im Dorf, bis sogar Pauls Ruf als Arzt auf dem Spiel steht. Er muss alles auf eine Karte setzen, um sich selbst und seine Familie zu retten.
Bisherige Veröffentlichungen:
Emmelie - der erste Fall: Band 1
Hexenbrennen - der zweite Fall: Band 2
Recht wie Wasser - der dritte Fall: Band 3
Was dir den Atem nimmt - der vierte Fall: Band 4
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil Eins
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Teil Zwei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Teil Drei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Epilog
Danksagung
Mehr von Sylke Hörhold:
„Recht wie Wasser“ - der dritte Fall
Oberlausitzkrimi
Sylke Hörhold
Dr. Frank Stübner (1954-2017) gewidmet, hochgeschätzter Bücherfreund und Verleger
Es soll aber das Recht offenbart werden wie Wasser
und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom.
Amos 5,24
Prolog
Offensichtlich war er tot.
Gestrandet inmitten wütend tosender Wasserfluten, die das alte Haus mehr und mehr auseinander nahmen. Sein regloser Körper hing rücklings auf einem Trümmerhaufen einstiger Büromöbel. Die blutverschmierten Augenlider waren geschlossen. Neben seinem Kopf saß der rostrote Kater und versuchte sich das Fell trocken zu lecken. Ab und zu sandte das Tier einen wissenden Blick zu ihm hinauf. Dieser Punkt bloßer Existenz, an dem sich Alwin nun wiederfand, lag weit über der Höhe der Zimmerdecke, so als sei die gläsern geworden bei seinem Übergang. Lichtvoll klar war es hier, durchscheinend. Eine nie gekannte Leichtigkeit durchflutete ihn. Pures Sein. Es war, als könne Alwin nun weiter und tiefer schauen als jemals zuvor in seinem irdischen Dasein. Was ihn inmitten dieser Sintflut da unten in das verlassene Büro seiner Anwältin geführt hatte, erschloss sich ihm jedoch nicht. Er wünschte, es wäre ihm vollends gleichgültig und bedeutungslos - das, was ihn noch hier band. Tiefes Sehnen zog ihn weiter in dieses liebevolle Annehmen, dieses süß klingende andere Sein, das sich ihm hier an dieser Schwelle offenbarte. Er war voll kindlichem Erstaunen. Und vertrauensvoll wie ein Kind wollte er diesem sanften Ziehen weiter nachgegeben, folgen und weitergehen, wohin auch immer. Wäre da nicht dieses Band, das ihn hier fesselte, Ketten der Erinnerung. Kaum fassbar und doch so quälend bindend.
Er spürte eine Präsenz bei sich. Dorothea. Seine liebste Doro. Sie war es. Er wusste es und es beglückte ihn zutiefst, sie hier in dieser lichtvollen Gegenwart zu wissen. Wie schwer war ihr Ringen mit dem Tod gewesen damals. Ohne Christa hätte er das damals kaum durchgestanden. Hier und jetzt jedoch schwand aller Schmerz, löste sich diese Kette einer dunklen Erinnerung in freudige Gewissheit auf. Alles in ihm zog ihn dahin, wo Doro auf ihn wartete. Was war es nur, das ihn hier noch an diesen Ort band? Warum ging es nicht weiter dahin, wo das Licht auf ihn wartete, der Friede, die bedingungslose Liebe? -
Höllenheiß fuhr die Erkenntnis in ihm auf, rüttelten die Ketten seiner Erinnerung.
Etwas geschah, veränderte sich schlagartig, so als sei ein Licht am Verlöschen. Der Kater machte einen Buckel und fauchte die Fensterfront an. Ein Grollen inmitten der rauschenden Fluten und dann ein Schlag, der das alte Umgebindehaus wie unter einem Todesstoß in seinen Grundfesten erzittern ließ. Alwin spürte, wie es ihn wider Willen zurück in seinen Körper stieß. Es war hier noch etwas, das seiner harrte. Hier war Axel.
Teil Eins
„Die Leitstelle, guten Tag. Sie sprechen mit Bruno Werner.“ Bruno legte sein berühmtes Timbre in seine Baritonstimme, die angeblich so beruhigend wirken sollte. Bestimmt war es wieder ein aufgeregter Anrufer wegen der Regenflut, die das Oberlausitzer Bergland seit den Nachmittagsstunden heimsuchte. Doch die ältliche Frauenstimme meldete einen Einbruch.
„In Finkendörfel“, wiederholte Bruno sicherheitshalber und sah auf die aktuellen Meldungen. Da war doch vorhin eben etwas gewesen.
„In Finkendörfel ist die Kaltbachbrücke gebrochen“, bestätigte seine Kollegin gegenüber, die seine Worte gehört hatte. „Da ist Land unter. Im Moment kommt man da höchstens mit einem Hubschrauber hin.“ Bruno nickte ihr zu zum Zeichen, dass er verstanden hatte. Sie widmete sich achselzuckend wieder ihrem Anrufer.
„Bei den Nachbarn. Julia Eisler und Trude Hölzel und … Am Kirchberg Eins“, fuhr die Anruferin währenddessen atemlos fort. „Die sind alle zum Schuleintritt. Ich kann niemanden erreichen.“ Ihre Stimme bekam etwas Verzweifeltes. Bruno glaubte sogar ein Schluchzen zu vernehmen. „Bitte, beruhigen Sie sich erst einmal“, sagte er deshalb besonders sonor. „Was genau ist denn passiert? –Wir haben hier Meldungen wegen Überflutungen in Finkendörfel.“
„Alles ist überschwemmt“, wurde ihm bestätigt. „Die Dorfstraße ist ein einziger Strom. Da schwimmt alles Mögliche. Wir kommen nicht rüber zu Trude.“ Die Frau schluckte ihre Tränen runter, bevor sie fortfuhr. „Das Wasser hat die Glasfront von Julias Büro eingedrückt und da ist der Einbrecher rein. Wir haben ihn beide gesehen …“
„Wir?“, unterbrach Bruno sanft den Redefluss.
„Meta und ich, also das ist meine Schwester. Wir wohnen doch gegenüber von denen. Wir haben ihn genau gesehen. So ein großer Kerl im dunklen Anorak und die Kapuze über den Kopf.“
„Befindet sich der Einbrecher denn noch im Haus Ihrer Nachbarn?“
„Nein, nein. Der ist schon wieder abgehauen in Richtung Park. Bestimmt hat der was bei der Julia geklaut. Die ist Anwältin. Da liegen doch wichtige Dokumente. Oder auch Computer …“
Bruno war sich da nicht so sicher. Er glaubte, dass solche Gelegenheitseinbrecher eher auf Geld aus waren. „Bitte unternehmen Sie nichts auf eigene Faust“, sagte er und wechselte einen Blick mit seiner Kollegin, die die Augen rollte. „Bleiben Sie im Haus, so es sicher ist. Alle Einsatzkräfte sind momentan durch die Flut gebunden.“
„Na, was denken Sie denn“, rief die Frau. „Hier ist eben der halbe Friedhofshang in das Haus gerutscht. Es ist ganz furchtbar. Und das Wasser steigt und steigt.“
„Sind Sie in Sicherheit? - Sagen Sie mir doch bitte noch einmal Ihren Namen, Frau …?“
„Heller, Friedegard Heller – aber um mich geht es doch gar nicht. Unser Haus steht hoch genug. Wir wohnen am Viebig. Es geht um das Haus gegenüber, von der Hölzel Trude und ihrer Familie. Wenn die wüssten, was mit ihrem schönen Häuschen passiert!“ Jetzt hörte er sie wirklich schluchzen. „Alles geht hier den Bach runter!“
„Beruhigen Sie sich, Frau Heller“, sagte Bruno. „Bleiben Sie mit Ihrer Schwester im Haus und unternehmen Sie nichts auf eigene Gefahr. – Sind denn noch andere Nachbarn zu erreichen?“
Brunos Stimme zeigte erste Wirkung. Die Anruferin schnäuzte sich erst und fuhr dann wesentlich gefasster fort. „Nein. Die sind alle drinnen. Wir sind hier halt meist so ältere Modelle wie ich. Julia und Paul sind da die Ausnahme. Wer kann, ist bei der Brücke unten mit anpacken. Da hat es einen Container angeschwemmt.“ Wieder ließ sie ein Schnauben innehalten.
Bruno nutzte die Gelegenheit, zu erwähnen, dass das Technische Hilfswerk informiert sei und mit schwerer Technik anrücken würde. Wichtig sei nun die Ruhe zu bewahren und abzuwarten, bis die Fluten zurückweichen. „Bleiben Sie mit Ihrer Schwester im Haus, Frau Heller“, wiederholte er. „Ich gebe Ihre Meldung weiter. Vielleicht können Sie es übernehmen, die Familie zu informieren?“
„Da hört doch keiner!“, empörte sich die Anruferin. „Wahrscheinlich haben die ihre Handys ausgeschaltet. Die sind in Herrnhut zum Schuleintritt der Nichte, soviel ich weiß. Und Meta, also meine Schwester, die wollte doch unbedingt noch Trudes Katzen retten, bis dann der Hang abrutschte und das ganze Haus …. - Was ist das? - Oh, mein Gott … Meta! Was macht dieses närrische Weib …?“ Die Verbindung brach ab.
„Unternehmen Sie nichts, was Sie und Ihre Schwester in Gefahr bringt“, mahnte Bruno noch einmal in die stumme Leitung. Er versuchte, den Ruf wieder aufzubauen, doch vergebens. Seine Kollegin schüttelte den Kopf, als sie sein besorgtes Gesicht sah. „Keine Chance im Moment, nach Finkendörfel durchzukommen“, sagte sie.
„Wer weiß, ob das wirklich ein Einbrecher war, den die beiden alten Mädels da beobachtet haben“, brummte Bruno unzufrieden. „Vielleicht war es ja nur ein besorgter Nachbar, der auch die Katze retten wollte, oder so was. – Aber ich gebe die Meldung natürlich weiter. Immerhin ist die Geschädigte Anwältin.“
„Und die wissen noch gar nicht, dass ihr Haus hinüber ist?“
Bruno schüttelte den Kopf.
„Die armen Schweine!“
2.
Sie hatten die Nebelscheinwerfer angemacht. Blickdichte Regenschwaden ließen nur wenige Meter Sicht zu. Gerade noch rechtzeitig brachte Georg seinen Wagen hinter dem von Paul zum Stehen. Sie sahen, wie er durch die geöffnete Scheibe der Fahrertür mit einem Mann diskutierte, der sich ihnen gestikulierend in den Weg gestellt hatte. Dann lenkte Paul um. Er hielt kurz neben ihnen. Georg ließ die Scheibe herunter. Sofort sprühte Regen herein. „Das Pließnitztal ist gesperrt“, rief Paul zu seinem Schwiegervater rüber. „Überschwemmung. Wir müssen über die Zittauer zurück.“
„Alles klar.“ Die Scheibe surrte hoch. „Na, ob unsere Herrnhuter da noch gut durchgekommen sind?“
„Sind sie“ verkündete Eddie vom Rücksitz aus. „Schwagerherz hat eben die Nachricht geschickt, dass wir hier nicht mehr durchkommen werden. – Immer auf der Höhe, unser Johannes. Ich staune ja, dass er sich tatsächlich auf so etwas Unsägliches wie eine SMS einlassen konnte.“
„Sei nicht so ätzend, Eddie“, maßregelte ihn Julia, die neben ihm saß. „Du ärgerst dich doch nur über Baras Handyverbot bei der Kaffeetafel.“
Ihr Bruder schnaubte verächtlich statt einer Antwort und fuhr dann fort, seine unzähligen Netzwerknachrichten zu verfolgen, bevor die Strenge des Herrnhuter Teils seiner Familie ihn wieder davon abhalten würde. Julia dagegen genoss die Nichterreichbarkeit, so wie die einsetzende Stille im Auto. Ihr war heute melancholisch zumute. Das mochte am düsteren Dauerregen liegen, eher jedoch an der nahenden Geburt, oder daran, dass ihr Mutter Milla heute bereits den ganzen Tag damit in den Ohren lag, sich endlich in Bautzen eine Wohnung zu suchen, damit genug Platz sei für das Baby und Paul und sie. Vor allem, damit sie nach der ersehnten Geburt ihres Kindes näher unter Mutter Millas Fuchtel sein würden, argwöhnte Julia. Und wie es Millas Art war, hatte sie natürlich schon einige Optionen für sie erwogen oder gar beschlossen. Allein die Vehemenz, mit der Milla darauf bestanden hatte, bei Paul und EllaMa mit im Auto fahren, zeigte Julia, dass ihnen für den Rest des Schuleintritts ihrer Nichte keine ruhige Minute mehr erlaubt sein würde vor lauter mütterlicher Besorgnis. Normalerweise vermochte es Milla ihre jüngste Tochter damit in helle Wut zu versetzen. Doch dazu fehlte Julia heute entschieden die Energie. Es war, als würden diese unaufhörlichen Wasserströme allen Widerstand und Trotz in ihr aufweichen und davon schwemmen; als luden sie Julia ein, in ihren Wassern zu treiben. Seit gestern Abend regnete es unterbrochen. Mit jeder Stunde wurde es heftiger. Baby regte sich. Julia legte schützend die Hände über ihren Bauch.
„Der reinste Weltuntergang da draußen“, ließ sich Trude plötzlich vernehmen. Sie, die sonst so lebhaft war und immer für eine Feier und gutes Essen in froher Runde zu haben, hatte sich die ganze Schuleintrittsfeier über mürrisch und schweigsam gezeigt, was ihr bereits eine ernste Verstimmung mit EllaMa eingebracht hatte.
Vater Georg zögerte deshalb, bevor er sich räusperte. „Das aus dem Munde unserer lieben Regentrude?“, scherzte er dann etwas bemüht. „Du predigst uns doch sonst immer, es gäbe kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung.“
Trude richtete sich auf und drückte den Gurt von ihrer Bluse weg. „Das ist doch kein normaler Regen hier“, schimpfte sie dann. „Geradezu widernatürlich ist das. In Russland brennt die Erde und wir ersaufen hier mitten im Sommer!“
„Na, na mein Trudchen!“
„Außerdem wirst du doch nicht etwa unseren Festtagszwirn hier als angemessen bezeichnen für diese Sintflut da draußen!“
Trudes Ausbruch ließ Eddie von seinem Display aufschauen. Er wechselte einen bedeutsamen Blick mit Julia. „Herrnhut liegt auf dem Berge“, beruhigte Julia. Sie beugte sich zu Trude vor, soweit es ihr Babybauch zuließ. „Da sind wir sicher.“
„Und gleich gibt es da ordentlich was zu futtern“, ergänzte Eddie mit ungespielter Begeisterung. „Baras Schwiegersippe kann vielleicht Kuchen backen, was Trude? Das entschädigt doch für alles, oder?“ Wie zum Beweis schaltete er in vorauseilenden Gehorsam sein Handy stumm und steckte es in seine Jackettasche.
„Da wären wir“, sagte Georg, während er den Wagen auf den Hof des Gemeindezentrums chauffierte. Paul war schon vor ihnen eingetroffen. Sie sahen Milla und EllaMa in seltener Eintracht unter einem Regenschirm über den Hof zur Glastür schreiten. Paul hielt Trude die Tür auf und half ihr heraus. Er mied den Blickkontakt zu Julia. Doch an seinen roten Ohren konnte Julia erkennen, dass ihr Mann bis auf das Höchste gereizt war.
„Oh, Mutter!“ entfuhr es Julia, während sie Trude und Paul hinterher blickte.
„Sei nur nicht so streng mit ihr“, sagte Vater Georg und drehte sich halb zu ihr um. „Sie meint es nur gut.“
„Mutter Milla meint es immer nur gut, wie wir alle wissen. Nicht wahr, Schwesterchen?“ Schadenfroh feixend schob sich Eddie aus dem Auto, warf die Wanderjacke über sein Jackett und rannte den anderen hinterher.
„Ich habe ihr aber schon hundertmal gesagt, dass wir weiter in Finkendörfel wohnen werden“, erwiderte Julia derweil trotzig. „Es ist unsere gemeinsame Entscheidung. Wir wollen bei EllaMa und Trude bleiben. Sie wünschen sich das übrigens auch, auch wenn sie uns gewiss nicht bedrängen würden. Ende des Jahres ist dann auch Trude über die Achtzig. “ Sie schnallte sich ab.
„Warte, ich helfe dir!“
„Papa! Ich bin schwanger und nicht behindert.“
„Ich weiß, ich weiß“, seufzte er gutmütig. „Deswegen kannst du dich ruhig auch ab und zu verwöhnen lassen, Liebes. Oder habt ihr Frauen von heute das völlig verlernt?“ Vater Georg schien fest entschlossen, sich seine Feierlaune weder von Trudes Verdrießlichkeit noch von seiner störrischen Tochter verderben zu lassen. Summend löste er auch seinen Gurt und machte sich ans Aussteigen.
Julia betrachtete ihren Vater liebevoll dabei. Er war wieder stattlicher geworden seit seinem Geburtstag im Mai. Seine Bewegungen wirkten schwerfällig und er schnaufte, als er sich aus dem Autositz hochstemmte. Damit war Vater Georg weit entfernt von der schlanken Fitness seiner agilen Frau Ludmilla, in deren gestrenge Sport-Diät-Programme sie ihn nur zu gern mit einbezogen hätte. Georg Veit hatte sich jedoch auf diesem Feld auch in Vierzig Ehejahren als erstaunlich einfallsreich in seinem Widerstand gezeigt und seine Gattin war nahe daran, an dieser Front zu kapitulieren. Zumal sich nun gerade wieder eine neue Arena für ihren nimmermüden mütterlichen Einsatz für ihre Familie auftat: Tochter Julia erwartete ihr zweites Kind, Kindsvater und Lieblingsschwiegersohn Paul, der gerade aus Amerika wieder zurück in Deutschland eingetroffen war, hatte noch keine feste Arbeitsstelle und überhaupt war die derzeitige Behausung der jungen Familie in Finkendörfel in Millas Augen einfach inakzeptabel.
„Es wird halt wirklich ganz schön eng in dem alten Weberhäuschen, wenn euer Murkel dann da ist“, sagte Vater diplomatisch, als er den Regebogenschirm über Julia aufspannte und ihr aus dem Wagen half.
„Wir haben da zu viert mit EllaMa und Trude gelebt bis Eddie kam, wie du dich sicher erinnerst“, protestierte Julia. Sie hakte sich bei ihm unter.
„Das waren aber andere Zeiten, Julia. Ihr braucht wenigstens ein Arbeitszimmer, wenn nicht zwei.“
„Wieso denn zwei?“
„Was, wenn Paul wieder wissenschaftlich arbeitet?“
Julia spürte, wie ihr das Herz eng wurde bei diesen Worten. „Das steht die nächsten Jahre nicht zur Debatte, wie du weißt.“ Paul hatte eine Unterlassungserklärung unterschreiben müssen. Sie alle konnten nur ahnen, was das für ihn bedeutete. Er sprach nicht darüber. Niemand wagte zu fragen. Wann immer die Sprache auf Pauls Forschungsarbeit in Boston kam, wollte keiner mehr ein Wort über den riesigen rosa Elefanten verlieren, der dann im Raum stand.
„Montag fängt Paul erst einmal bei Dr. Köhler in der Praxis an“, sagte Julia schließlich tapfer. „Er macht die Vertretung für die nächsten Wochen.“
„Ein Anfang, gewiss“, gab ihr Vater zu. „Die Abfindung vom Institut war ja auch entsprechend großzügig.“ Prüfend sah er sie von der Seite an. „Aber ehrlich: kannst du dir unseren Paul als Landarzt vorstellen?“
„Wieso denn nicht? Paul war Jahrgangsbester, Forschungsstipendiat, Professors Liebling …“
Vater Georg winkte ab. „Paul ist ein Tüftler, Julia. Ein Forscher. Er ist Naturwissenschaftler.“
Sie hatten den gläsernen Eingangsbereich des Gemeindezentrums erreicht. Julia löste sich von ihrem Vater. „Er ist in erste Linie Arzt“, erwiderte sie fest. „Und das wird er euch allen beweisen. Du weißt, was Paul für ein Streber ist.“ Sie schaffte es sogar darüber zu lachen. „Bei uns zu Hause sieht es aus wie in einer Studentenbude. Überall Fachbücher und Ärztliche Magazine, Notizzettel und Tabellen.“
Georg versuchte das Lächeln seiner Tochter zu erwidern, doch seine Augen blieben ernst. „Eine Studentenbude – eben. Ihr seid aber beide Ende Dreißig, Liebes. Baby kommt bald. Eine Bude ist da nicht geeignet. Ihr habt schon einmal ein Kind verloren.“
Julia schossen die Tränen in die Augen. „Hör auf!“, zischte sie wutentbrannt. Dann stürmte sie hinein.
3.
Wie hypnotisiert starrte sie durch den Regen auf das Dorf hinunter. Die Knie waren ihr weich geworden. Gabriele lehnt sich an einen der alten Parkbäume. Ihr zitterten die Finger, als sie die Wahlwiederholung zum gefühlt hundertsten Mal tippte. Diesmal nahm ihr Mann an.
„Axel“, rief sie. „Na, endlich!“
Sie glaubte, allen Schrecken und Frust auf einmal hinaus sprudeln zu müssen. „Wo steckst du denn? Ich versuche seit einer guten Stunde einen von euch zu erreichen. – Du glaubst gar nicht, was hier los ist: Das Wasser staut sich hoch bis zum Markt und hier ist gerade der halbe Friedhofshang in das Haus unserer Anwältin gerauscht. Ein richtiger Erdrutsch.“
„Und? Sind die noch drin, oder was?“ Er hatte getrunken. Seine Sprache verriet ihn. Ihr Entsetzen von eben wich der vertrauten Wut. „Ich habe keine Ahnung“, erwiderte sie. „Aber dein Vater soll vorhin dorthin sein, sagt Christa.“ Die Frau ihres Schwiegervaters war völlig außer sich gewesen deswegen. Es musste zuvor einen furchtbaren Krach gegeben haben. Selbst Charlotte hatten Tränen in den Augen gestanden. Keine der Frauen hatte ihr sagen wollen, was diesmal der Auslöser für Alwins gefürchteter Wutattacken gewesen war. Wieder einmal war Gabriele außen vor, so als sei sie ein überflüssiges Anhängsel der Böhmes, das man wohlwollend duldete, aber nicht so wichtig nehmen durfte. „Was, wenn es ihn da unten mit erwischt hat?“, fragte sie dennoch. „Das Haus sieht ganz schief aus. Wie verschoben.“
„Wenn schon“, knurrte Axel. „Der Alte kann von mir aus vor die Hunde gehen.“
„Es ist nicht nur das“, fuhr Gabriele fort. „Das Hochwasser hat die Maschinenhalle geflutet. Die Sandsäcke halten nicht. Ich erreiche einfach niemanden, der zur Hand geht …“
„Weißt du was, Gabi? Das geht mir alles glatt am Arsch vorbei!“ Axel spuckte diese Worte in sein Telefon. „Was geht mich das jetzt noch an? Schließlich hat mich dieser Saftsack gerade frisch enterbt.“
„Axel! Du kannst doch jetzt nicht …“
„Ach, lasst mich doch einfach in Ruhe!“ Er drückte die Verbindung aus.
Erbittert blickte Gabriele auf ihr verstummtes Telefon hinunter. Sie wusste, dass jeder weitere Versuch zwecklos sein würde, Axel zu erreichen. Noch einmal drückte sie die Wahlwiederholung für ihren Schwager Berthold. Auch der schien seit dem Streit heute Mittag wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Befürchtung wurde prompt bestätigt: Der Teilnehmer sei im Moment nicht erreichbar. Es sah dem ehrgeizigen Berthold gar nicht ähnlich, sich an einem Samstagnachmittag und angesichts einer derartigen Flutkatastrophe ins Private zu verkriechen. Was war nur los mit den Böhmes? Gabriele steckte ihr Telefon in die Wetterjacke. Ihre Firma ging ihnen doch sonst über alles, sinnierte sie weiter über ihre Schwiegerfamilie. Nur heute war offensichtlich etwas eingetreten, dass ihnen wichtiger war als die millionenteure neue Maschinenhalle, die gerade abzusaufen drohte. Alwin wüsste jetzt Rat. Niemals würde er zulassen, dass seine geliebte Damastweberei hier einfach so den Bach hinunter ging. Nächstes Jahr würde das große Firmenjubiläum gefeiert werden, das Alwin schon liebevoll vorbereitete. Sogar eine Broschüre der hundertjährigen Firmengeschichte wollte er dazu veröffentlichen. Von allen Familienmitgliedern war Gabriele bisher noch nie Zielscheibe von Alwins unkontrollierten Zornausbrüchen geworden. Sie ging ihm nicht aus dem Weg, wie seine Söhne es taten. Eigentlich mochte sie ihn sogar ein wenig. Er hatte so etwas in seiner Art, wie es Axel hatte, als sie sich in ihn verliebt hatte. Etwas, das bei Axel mehr und mehr im Suff unterging. Ihr alter Groll erwachte wieder. Sie straffte sich. Vielleicht war Alwin noch unten bei dem eingedrückten Haus am Fuße des Kirchberges, durch das das Wasser floss, wie durch eine bebaute Brücke. Entschlossen klappte Gabriele ihren Regenschirm auf und stakte den aufgeweichten Parkweg hinunter in das überflutete Dorf.
4.
„Du hast es echt drauf, Opa! – Wegen so ein paar Holzscheiten zu ersaufen!“ Heinrich sah, dass Charlie noch am ganzen Körper am ganzen Körper zitterte, während er seinem Großvater das Badehandtuch zum Abtrocknen reichte. Oswald vergrub sein Gesicht erst im Frottee, bevor seine weißen Bartstoppeln wieder daraus auftauchten und er sie mit widerspenstigen Blicken maß. „Was wisst denn ihr schon! Könnt ja alles kaufen. Ist euch ja alles nichts mehr wert, was anderer Leute harte Arbeit geschaffen hat.“
„Ist gut jetzt, Vater!“, mischte sich Heinrich unwirsch ein. Auch er spürte noch in sich den Schrecken der Rettungsaktion nachbeben. Vielleicht stimmte Hannas Verdacht und Vater wurde wirklich langsam senil auf seine alten Tage. „Der Junge hat völlig recht, Vater: Das war ausgemachter Wahnsinn. Wirst du denn jetzt vollkommen närrisch? – Da habt ihr gerade erst den Pfarrer aus seinem gefluteten Haus gerettet und der halbe Kirchberg ist ins Dorf gerutscht, da musst du deinem Holzhaufen hinterher springen!“
Oswald wollte gerade zu einer wütenden Widerrede ansetzen, als er stutzte. „Der Kirchberg?“
„Ja. Wir sind vorsichtshalber über den Bornhain rübergekommen.“ Heinrich griff nach seiner Schiebermütze, die er auf dem Wannenrand abgelegt hatte. „Ich muss jetzt los. Siggi wird schon warten. Den Schneeschieber werden sie ja wohl nun endlich drangeschraubt haben.“
„Mit dem Schneeschieber willst du die Flut bezwingen?“, höhnte Oswald und begann sich seinen Kopf trocken zu rubbeln.
„Du hast keine Ahnung, Vater!“, erwiderte Heinrich ärgerlich. „Was denkst du, was da alles so angeschossen kommt, wo früher mal unsere Straße war. Und jetzt fließen da ja auch noch deine Holzscheite mit herum.“ Er schob sich die Mütze über den fast kahlen Schädel und ging an Charlie vorbei auf den Flur hinaus. „Pass gut auf Opa auf, Karl“, flüsterte er ihm zu.
„Ich komme mit“, sagte Charlie. „Ich will nach Thieme sehen. Der war völlig von der Rolle vorhin.“
„Wisst ihr schon, wo ihr den Pfarrer unterbringt?“, fragte Heinrich.
„Thieme bleibt bei mir“, rief Oswald aus dem Badezimmer heraus. „Damit das klar ist!“
„Von mir aus.“ Heinrich zuckte mit den Schultern. „Es ist schließlich dein Haus. Und wenn du denkst, der Pfarrer verkraftet deinen kunterbunten Kinderzoo hier...!“
Jetzt war auch Charlie wütend. Heinrich sah es daran, dass die Ohren seines Jüngsten aufglühten. „Schon gut, Karl“, wollte er ihn beschwichtigen, „sollte nur ein Scherz sein.“ Doch Charlie schob sich mit einem Schnauben an ihm vorbei hinaus.
Auf dem Hof der einstigen Faktorei herrschte das regen Treiben eines Marktplatzes. Von überall her kamen Leute herbei. Sie trugen Kisten, schleppten Säcke und Schaufeln herbei. Das Tor zur einstigen Scheune stand weit offen. Dort schraubten einige Männer von Charlies Kommune, wie er seine arbeitsfreudigen Sommergäste nannte, den Pfeilschneepflug an Siggis hochbeinige Zugmaschine. Ein anderer sortierte die Bergsteigerausrüstung, mit der sie vorhin erst den Pfarrer, dann Oswald Braun aus ihrer misslichen Lage gerettet hatten. Die Leute waren emsig und angeregt. Bei allem Eifer, aller Hilfsbereitschaft lag Begeisterung in der Luft über die Heldentaten der Stunde. Ein Abenteuereffekt der Katastrophe, der es schon immer vermocht hatte, auch das Beste in den Menschen zu aktivieren. Noch nie hatte es so eine traute Zusammenarbeit zwischen den linksalternativen Kommune Mitgliedern aus Charlies Sommercamp mit den eher biederen Finkendörflern gegeben. Heinrich legte seinem Sohn die Hand auf die Schulter. „Fleißig, fleißig“, sagte er bewusst anerkennend.
Charlie schüttelte die Hand seines Vaters ab. „Was dachtest denn du?“
Unter dem Schutz der Regenplane eines der Baugerüste machten sie die kugelige Gestalt des Pfarrers aus. Thieme saß auf seinem Koffer und schaute trübsinnig vor sich hin. Jeder im Dorf wusste, wie glücklich Thieme gewesen war, als er in seinem Ruhestand das Pfarrhaus weiter nutzen durfte, weil der neue Pfarrer in Eckertswalde wohnte, zu deren Gemeinde Finkendörfel mittlerweile gehörte. Die Flut hatte ihm sein Zuhause entrissen. Es war fraglich, ob das alte Pfarrhaus bei den Schäden noch einmal bewohnbar sein würde. „Sie waren ja bestens vorbereitet“, meinte Heinrich mitfühlend, als sie bei Thieme ankamen. Er wies auf den Koffer. Thieme erhob sich ächzend und reichte dem Steinmetz die Hand. „Tja. Dank Ihres Sohnes, mein lieber Braun, bin ich nun gerettet aus den Fluten mit meinen paar Habseligkeiten.“ Er blickte Charlie dankbar an durch die runden Gläser seiner Brille. „Und was den Koffer betrifft: Ja, der ist bei uns immer gepackt gewesen. Bei meiner Mutter schon. Bombenkind, wissen Sie?“ Vater und Sohn nickten in seltener Eintracht. „Wir sind dem Feuersturm von Dresden entkommen“, fuhr Thieme fort. „So klein ich auch war, das vergisst man nie. Ist wie eingefressen solche Erinnerung. Der Rest ist Familienlegende.“ Wieder blickte er trübe in die Regenströme. „Doch nun ist es das Wasser, nicht das Feuer, nicht wahr? Gott steh uns bei!“
„Wir holen dann noch die Kirchenbücher raus“, versicherte Charlie, um ihn aufzumuntern. „Wir retten, was wir retten können. Platz ist hier genug. Opa sagt, Sie können bei ihm wohnen.“
Heinrich spürte erneut, wie mit Angst durchsetzter Ärger in ihm aufstieg. „Du bist genauso verrückt wie dein Großvater: wegen so ein paar alten Schwarten riskierst du Leib und Leben! Muss das denn sein? Muss das jetzt sein? Das Wasser geht auch wieder mal weg.“
„Ihr Vater hat Recht, Charlie …, ich meine Karl. Mein lieber Karl. Wir sollten vielleicht …“
„Diese Kirchenbücher sind unsere Geschichte“, unterbrach Charlie bestimmt. „Wir holen die da raus. Wir sichern uns schon ab, keine Sorge!“ Damit stapfte er durch den Regen zur Scheune hinüber.
„Sag das mal deiner Mutter“, seufzte Heinrich, der ihm reumütig hinterher sah. Thieme legte ihm seine Hand auf den Arm. „Ich bete für Sie.“
„Tun Sie das, Herr Pfarrer“, erwiderte Heinrich mit wenig Überzeugung. „Tun Sie das.“
5.
Angst lähmte sie. Sie machte Friedegard so schwach, dass sie sich an das Gartentor klammerte, während ihr das Wasser über den Rand ihrer kurzen Gartenstiefel schwappte. Tiefe namenlose Furcht, die ihr ganzes Sein umfasste, jeden Gedanken umklammert hielt und ihren Willen erstickte, so dass sie um Atem ringen musste. Ohnmächtig ausgeliefert an etwas unmenschlich Stärkeres, Größeres, Unberechenbares. Das Entsetzen längst vergangener Kindertage, als Meta noch die Verschickung in die Anstalt drohte und Schlimmeres, wie man damals munkelte; als die Dorfjugend ihre Schwester noch jagte und plagte und sie stille halten mussten, als sie beide allein in ihrer Angst blieben. Immerhin hatte Meta endlich aufgehört, von einem Mörder zu schreien.
Der Klammergriff der Lähmung entließ Friedegard nur langsam. Irgendwann ging jeder Panik die Puste aus. Friedegrad atmete etwas auf. Die Glieder waren ihr noch weich wie Pappe im Regen. Zittrig schob sie sich das durchnässte Haar aus dem Gesicht und schaute über das strudelnde Wasser zu ihrer kleinwüchsigen Schwester hinüber. Wimmernd umklammert Meta die letzte verbliebene Granitsäule des Lattenzaunes, der vor der Flut EllaMas hübschen Vorgarten umgeben hatte. Die Flutwelle von eben hatte ein großes Loch in das Erdreich gerissen. Dahinter türmte sich der Erdrutsch vom Kirchberg. Die Schlammlawine hatte den Anbau getroffen, wo jetzt die jungen Leute wohnten. Trudes Katzenasyl im Schuppen war nur noch ein Trümmerhaufen im Lehmgebirge. Die Katzen waren allesamt verschwunden. Ihr feinerer Sinn für Unheil hatte sie wohl noch rechtzeitig gewarnt und sie hatten sich in Sicherheit gebracht. Das würde Trude trösten, wenn sie nach Hause zurückkehrte. Doch wie mochte es dem verwöhnten Perserkater Raki ergangen sein, der als einziger Katzenzögling ins Haus durfte. Wegen ihm hatte sich Meta auf diese waghalsige Rettungsaktion eingelassen, die sie beide nun in diese schreckliche Situation gebracht hatte. Noch immer keine Spur von den Bewohnern des geschunden Hauses. Es war überhaupt keine Menschenseele zu sehen. Bei den Mirtschinks drüben wackelte die Gardine. Kurz hob Friedegard die Hand, um sie sogleich wieder entmutigt sinken zu lassen. Das würde nur die alte Erika sein, die ging schon seit Jahren nicht mehr aus dem Haus. „Friedel“, flehte Meta derweil von der anderen Seite des Stromes, der einstmals ihre Dorfstraße gewesen war. „Wir müssen Raki retten.“
„Ach, lass doch dieses Katervieh“, murmelte Friedegard. Doch Metas Ruf ließ die Furcht weiter weichen. Mit grimmiger Entschlossenheit rüttelte Friedegard erneut an dem widerspenstigen Gartentor. Ein Ast blockierte das Scharnier. Mit aller Kraft zog und zerrte Friedegard daran. Warum nur gehorchten ihr die alten Knochen nicht mehr so wie früher. Wasser schwappte ihr weiter in die Gummistiefel und ließ sie endgültig volllaufen. Sie musste sich beeilen. Immer höher strudelte der Strom auf der Straße, der vom Oberdorf heruntergeschossen kam und sich mit denen von den Berghängen vereinigte. Eine Papiertonne schwemmte heran und donnerte gegen den Zaun. Ihr Inhalt flößte mit ihr. Papierfetzen verfingen sich im Zaun und am großen Rhododendron gegenüber.
„Friedel! Ich kann nicht mehr …“
„Ich komme, Kleine! Ich bin gleich bei dir!“ Mit aller Kraft, die Friedegard aufzubringen vermochte zerrte sie an dem Ast. „Herrgott!“ Das Grünholz bog sich und brach, so dass sie den Widerhaken des Astes durch die Gitterstäbe fädeln konnte. Sie öffnete das Gatter so weit, dass sie sich hindurchzwängen konnte. Einer ihrer Gummistiefel blieb hängen und wurde ihr vom Strom weggerissen. Sie kam ins Wanken. Mit Mühe hielt sich Friedegard am Tor fest und sah ihrem davon schwimmenden Stiefel nach. Ein totes Schaf trieb hinterdrein. Kinderspielzeug und Bauholz waren seine Begleiter. Friedegard spürte Steine und Asphaltreste unter ihrem nackten Fuß. Die überflutete Straße kam ihr so breit vor wie der Ozean. Sie schüttelte die neue Verzweiflung ab und rettet sich in Wut. „Wenn doch nur eine Menschenseele zur Stelle wäre, wenn man mal Hilfe braucht!“ Sie spähte die Dorfstraße auf und ab. Es gab nur Wasser und Trümmer und ihre Schwester, die sich vor Trudes zerstörtem Haus an den Pfosten klammerte. Hinter dem Rhododendron bei Julias Büro wippte ein Regenschirm. „Trude!“, schrie Friedegard aus Leibeskräften. „Paul? Seid ihr das?“
Der Regenschirm verharrte. Dann wackelte er hinter dem Busch auf und ab und zappelte sich seinen Weg hinter dem Busch hervor, bis schließlich eine schlanke Frauengestalt im sportlichen Dress über die Barriere von angeschwemmten Schutt kletterte, wobei sie den Schirm eher zum Balancehalten, denn als Regenschutz benutzte.
„Julia?“ Nein, das konnte nicht sein, die hatte doch jetzt ihren dicken Babybauch, schoss es Friedegard ein.
„Keine Julia“, bestätigte die Gestalt unter dem Regenschirm prompt, als sie einigermaßen festen Stand gefunden hatte. „Ich bin’s nur. Die Böhme Gabi.“
Friedegard schirmte ihre Augen vom Regen ab und spähte über den Strom. „Frau Böhme! – Was machen Sie denn hier?“
„Ich suche unsere Männer“, schrie Gabi Böhme herüber. „Die Weberei ist überflutet. Das staut sich bis sonst wohin. Seit Mittag sind alle verschwunden.“ Sie machte eine wegwerfende Bewegung. „Ich dachte, ich finde wenigstens meinen Schwiegervater hier. Und dann rutsch da der halbe Kirchberg in das Haus! Es ist ein einziges Trümmerfeld.“
„Eine Katastrophe“, bestätigte Friedegard lauthals. „Doch Sie schickt der Himmel!“
„Da ist noch eine Katze drin.“ Gabi wies mit dem Regenschirm gen Trudes geschundenes Umgebindehäuschen.
„Raki!“, schrie Meta von der Zaunsäule herüber. „Wir müssen Raki retten!“
„Die saß da ganz ruhig auf dem ganzen Chaos drinnen“, beruhigte Gabi, die Meta erst jetzt entdeckte. „Ich hab‘ mich aber nicht rein getraut.“
„Bloß nicht!“, protestierte Friedegard. „Das Haus kann jeden Moment einstürzen.“
Meta machte eine aufgeregte Armbewegung zu ihrer Schwester herüber. „Raki!“
„Lass doch endlich dieses Katervieh“, wiegelte Friedegard ärgerlich ab. „Du machst, dass du hier rüberkommst! - Frau Böhme: Könnten Sie meiner Schwester zurück über die Straße helfen?“
„Aber sicher.“ Sofort klappte Gabi ihren Schirm zusammen, den sie nun wie einen Stock benutzte. Dann watete sie vorsichtig in die Strömung hinein und zu Meta hinüber. „Kommen Sie, nehmen Sie meine Hand.“ Meta gehorchte ihr erst nach langem Zögern. Das Wasser reichte der kleinwüchsigen Frau bereits bis über die Hüfte. Doch Gabi hielt sie fest unter einer Achsel und an der Hand, während sich Meta mit ihrer freien Hand auf den Schirm stützen konnte. „Ganz vorsichtig, Schritt für Schritt.“
„Achtung!“, rief Friedegard. „Da kommt was!“
Es war zu spät. Von den Hölzern, die da plötzlich daher kreuzten, traf eines das ungleich große Paar mitten auf der Straße. Sie strauchelten. Einen Augenblick geriet Meta unter Wasser. Mit kräftiger Hand hatte Gabi sie wieder in aufrecht und triefend an ihrer Seite. Metas Brille saß schief auf ihrer knolligen Nase. Sie japste nach Luft. Der Schirm schwamm mit den Hölzern davon in Richtung Niederdorf.
„Sind Sie in Ordnung, Frau Böhme?“, fragte Friedegard besorgt.
„Jaja.“ Gabi wischte sich ihr regennasses Gesicht an der Schulter ab. „Wir kommen.“
Meta jedoch war in Schockstarre. Nachdem sie ihre Brille gerichtet hatte, verschränkte sie die Arme vor der Brust, zog einen dicken Fluntsch und war entschlossen, sich keinen Zentimeter weiter zu bewegen. Weder sanftes Ziehen noch gute und weniger gute Worte vermochten die kleine Frau zum Weitergehen zu bewegen. So standen sie wie angepflockt inmitten der Fluten, während Friedegards Verzweiflung wieder wuchs. Angstvoll studierte sie das Treibgut. Trotz des unsicheren Bodens unter ihrem nackten Fuß zog sie bereits in Erwägung, sich selbst bis zur Straßenmitte vorzuwagen, um mit anzupacken und Meta irgendwie hier herüberzuzerren.
„Tragen wird mir dann doch zu schwer, Frau Heller“, bekannte Gabi gerade. „Aber ich glaube, da kommt jemand, der uns helfen kann.“ Sie streckte ihren Arm in Richtung Dorfmitte. Friedegard wandte sich um. Tuckernd bahnte sich da unter einer gigantischen Dieselwolke ein alter Traktor seinen Weg durch den Wasserstrom. Man hatte einen Schneepflug vor die antiquierte Zugmaschine gespannt, die damit mühelos durch das Treibgut kreuzte.
Vor dem zugeschobenen Haus am Fuße des Kirchbergs brachten die Männer ihr Gefährt zum Stehen. „Guck dir das an, Heinrich“, rief der eine. „Da hol mich doch …!“
„Das Weberhäusel von den Hölzels“, stellte der andere fest. Er machte sich ans Absteigen. „Steht schon seit einer Ewigkeit hier. Und nun das. – Verdammt!“, schimpfte er als er im strömenden Wasser zum Stehen kam. „Ich hab denen schon lange gesagt, dass sich die Nässe an der Friedhofsmauer staut. Das musste ja mal passieren, wenn es ein paar Tropfen mehr regnet.“
„Sind schon ein bissel mehr als ein paar Tropfen“, meinte sein Kamerad versöhnlich.
Friedegard rieb sich das Wasser aus den Augen. Dann erkannte sie die beiden Männer. Der lange Heinrich Braun, der jetzt bei Picker-Herschel den Steinmetzbetrieb führte und Pursche Siggi, der ehemalige LPG Chef. Eine seltsame Allianz hatte die Flut da geschmiedet, wie sie fand. Die Familien waren seit Generationen sich alles andere als grün. Den genauen Grund des Zwistes kannte keiner mehr so genau. Heute jedoch zogen sie gemeinsam los, um gegen die Fluten zu kämpfen. Friedegard wollte sie rufen, doch ihr versagte die Stimme. Mittlerweile hatten die Männer jedoch die beiden Gestrandeten inmitten des Flutstromes ausgemacht. „He, ihr beiden“, scherzte Siggi. „Ihr sucht wohl eine Mitfahrgelegenheit?“
Der lange Heinrich stapfte durch das Wasser zu den beiden Frauen mitten auf der Straße. „Ist noch jemand im Haus?“
„Nein“, sagte Gabi. Sie sah zu Friedegard hinüber. „Die sind alle beim Schuleintritt“, ergänzte die prompt und winkte resigniert ab.
Siggi kratzte sich den Schädel. „Das wird eine schöne Bescherung, wenn die heimkommen.“ Dann watete auch er hinüber zu dem ungleichen Paar, das zum Monument erstarrt und aneinander geklammert, als gelte es das Leben, inmitten der Strömung verharrte. „Und was plantscht ihr hier mitten im Wasser?“
„Der Mörder ist im Haus“, erklärte Meta finster. „Wir müssen Raki retten.“
„Ah, ja!“ Die Männer sahen Gabi fragend an.
„Sie meint den Kater. Der ist noch drin. Ich habe ihn gesehen. Er sitzt aber ganz friedlich da und schaut nur.“
„Wir müssen Raki retten!“, beharrte Meta.
„Katzen haben neun Leben“, tröstete Siggi die kleine Frau, die ihre bockige Haltung noch um keinen Zentimeter verändert hatte. „Es wäre Wahnsinn, wegen des Katzenviehs da in das Haus zu gehen. Die Bude bricht ja bald zusammen.“
Heinrich betrachtete abschätzend das schwer getroffene Umgebindehaus. „Vielleicht auch nicht“, sagte er dann. „Das muss man abwarten, wenn das Wasser weg ist. So eine Blockstube kann man wieder richten. – Aber jetzt wollen wir ihr erst mal sehen, wie wir euch zwei Hübschen ins Trockene bringen.“
Gabi war froh, die Verantwortung für die störrische Meta an die Männer abgeben zu können. „Haben Sie irgendeinen von unseren Männern gesehen?“, fragte sie, als sie sich schon zum Gehen wandte.
„Axel?“
Gabi winkte ab. „Axel, Alwin, Berthold – egal wen. Sie sind alle verschwunden seit Mittag.“ Man hörte ihren Ärger in der Stimme. „Uns säuft so langsam, aber sicher die Maschinenhalle ab.“
„Sieht dem alten Böhme aber nicht ähnlich, seine Weberei im Stich zu lassen bei so einer Katastrophe“, bemerkte Heinrich stirnrunzelnd.
„Eben! Ich habe ein paar von unseren Leuten ran holen können, doch die meisten haben mit der Sicherung ihrer Grundstücke zu tun. Und die anderen kommen nicht mehr durch, weil die Straßen gesperrt sind.“ Die Männer schauten betroffen, da sie ihre grollende Verzweiflung spürten.
„Weiter oben im Dorf ist die Strömung noch ärger, weil es da so eng und steil ist“, warnten sie. „Das Wasser schießt von allen Seiten rein. Es hat das halbe Pfarrhaus unterspült.“
„Aber über den alten Kirchsteig könntest du rüberkommen, wenn du ins Oberdorf willst.“
„Danke.“ Gabi nestelte schon nach ihrem Telefon, doch dann hielt sie inne. „Da ist er ja!“
Über das Trümmerfeld am Fuße der Murre kletterte Barfuß und in hochgekrempelten Jeans ein schlanker, hoch aufgeschossener Mann in ihre Richtung. Sein offener Anorak schlug wie die Flügel eines Raben um ihn herum. „Berthold! Na endlich. Warum gehst du nicht an dein verflixtes Telefon!“ Dann erst sahen sie sein blasses, Dreck verschmiertes Gesicht. „Hast wohl ein Moorbad genommen“, witzelte Siggi. Er erntete einen wütenden Blick.
„Was ist denn los?“, rief Friedegard besorgt von der anderen Straßenseite herüber.
„Verstärkung ist da!“, verkündete Siggi und zeigte mit dem Daumen auf den schlammigen Neuankömmling. „Wir bringen dir dein Schäfchen hier gleich ins Trockene.“
6.
Mit Tränen in den Augen war Julia an ihm vorbei gestürmt. Paul sah seinen Schwiegervater fragend an, als der wesentlich gemesseneren Schrittes Julia hinterher in den geräumigen Vorraum des Gemeindezentrums trat. „Das ist vielleicht eine trübe Stimmung heute bei uns“, versuchte Georg zunächst abzulenken, doch er sah an Pauls Gesicht, dass er sich damit nicht abwimmeln lassen würde. „Ich war ungeschickt“, gab er zu. „Habe euren kleinen Stevie erwähnt.“
„Oh!“ Paul nickte. „Immer noch ein Minenfeld“, sagte er. Er nahm seine Brille ab und betrachtete sie mit gesenkten Augen, damit Vater Georg nicht den Schmerz in seinen Augen sah. Fast Vier Jahre war es jetzt her, dass sie ihr Söhnchen plötzlich im Kindbett verloren hatten. Noch immer stieg die Trauer unvermutet auf wie ein launischer Geysir. Wenn sie in sich zusammenfiel in der Erkenntnis der Unwiderbringlichkeit, hinterließ sie in ihm eine tiefe Leere. Nun kam noch die Angst dazu.
„Es tut mir leid“, beteuerte Georg, der sich aus seinem Mantel schälte. „Uns geht es doch genau wie euch darum, dass euer Kind beste Bedingungen hat, wenn es auf die Welt kommt. Es sind nur noch ein paar Wochen und bei unseren beiden lieben Alten geht es nun mal recht beengt zu.“
Paul verkniff sich die schon zu oft zitierte Bemerkung, dass auch seine Schwiegerfamilie mit zwei Kindern im Hause von Julias Großmutter und ihrer Trude gelebt hatten. „Ich hänge an diesem Haus“, sagte er stattdessen ruhig. „Es ist mir wichtig dort zu sein, gerade jetzt nach den Jahren in Boston. Ein festes Stück Heimat. Und schließlich ist es unser beider Vaterhaus, von Julia und von mir.“
Erstaunt sah Georg seinen Schwiegersohn an. „So emotional kenne ich dich ja gar nicht.“
„Ist das emotional, ja?“ Auch Paul knöpfte sich seinen Trenchcoat auf. Dann putze er sorgfältig seine Brille. „Lasst es uns dort einfach erst einmal versuchen. In aller Ruhe. Ein Umzug ist das letzte, was wir jetzt gebrauchen können.“
„Wir helfen euch natürlich!“
„Montag fange ich bei Köhler in der Praxis an. Da habe ich überhaupt keinen Nerv für irgendwelche Umsiedlungsprojekte.“
„Meinetwegen“, gab sich Vater Georg geschlagen. „Du bist so still und so stur wie dein Vater. – Aber nun komm, hänge deinen Mantel auf. Drinnen singen sie schon.“
Als Julia wenig später den Saal betrat, fand sie die Gesellschaft zu Adeles Schuleintritt überwiegend einträchtig bei gigantischen Kuchenbergen an den Tischen sitzend. Vater, Barbara und Eddie hatten sich für die fröhlichere Gesellschaft der Herrnhuter Familie entschieden. Dort saß auch Ella-Ma und bewunderte gebührend die Zuckertüte ihrer Ur-Enkelin. Trude dagegen stand abseits an der Fensterfront und sah in die graue Regenwand hinaus, als suche sie dort nach Orakeln der drohenden Apokalypse. An einem Ende der Tafel erblickte Julia den Rücken ihrer Mutter über den Tisch gebeugt und dahinter auf der anderen Seite das verschlossene Gesicht ihres Mannes. Pauls Ohren glühten schon wieder vor unterdrücktem Zorn. Sie konnte sich denken, dass Mutter Milla die Ursache dafür war. Entschieden schritt Julia auf die Beiden zu. „Liebe Güte, ich bin am Verdursten“, unterbrach sie die einseitige Diskussion am Tisch. „Paul, bist du so lieb und besorgst mir eine Apfelschorle, oder so etwas?“
Paul erhob sich sofort. Wortlos ging er zum Getränketisch hinüber. Mit einem theatralischen Prusten setzte sich Julia auf seinen Platz und sah ihre Mutter kampflustig an. Milla lehnte sich langsam zurück. In ihrer Miene spiegelte sich eher Enttäuschung als Ärger. „Bin ich also wieder mal die Böse?“
„Lass ihm einfach Zeit, Mama.“
„Paul muss doch auch mal an morgen denken“, mahnte Milla. „Die Vertretung bei Köhler geht maximal sechs Wochen. Ich habe ihm lediglich nahegelegt, sich um Barbaras Stelle in Bautzen zu bemühen. Sie wechselt nach Zittau an die Klinik wegen Adele.“
„Zeit, Mama! Das ist alles, worum wir dich bitten.“
Milla schnappte nach Luft. „Du tust gerade so, als könnte ich die euch geben!“ Sie wies auf Julias Bauch. „Hier ist jemand, der euch einfach keine lange Zeit mehr geben kann. Der Termin ist in neun Wochen!“
„Ich weiß, Mama.“ Julia faltete fromm ihre Hände über dem Tisch im Versuch, nicht weiter zur Eskalation beizutragen, die sich bereits in Mutter Millas Mienenspiel ankündigte.
Paul stellte ein Glas Schorle vor Julia hin. „Ich gehe mal rüber zu Trude“, verkündete er. „Sie sieht so traurig aus.“
Milla sah ihm mit dem Bedauern einer Katze nach, deren gefiederte Beute gerade auf und davon fliegt. „Sag mal, haben die beiden sich gestritten?“, fragte sie dann. „Ella-Ma hat ihre Trude hier noch keines Blickes gewürdigt. Es sieht deiner Großmutter gar nicht ähnlich, eingeschnappt zu sein.“
„Trude macht sich schon seit heute früh Sorgen wegen des Wetters“, erklärte Julia lahm. „Das nervt Oma offensichtlich.“
„Wetter!“ Milla schürzte missbilligend ihre Oberlippe. „Was sind denn das für neue Schrullen?“
Ihre Tochter zuckte mit den Achseln und nippte an ihrem Glas. Einen Moment schwiegen sie beide. Julia gab sich jedoch nicht eine Sekunde der Illusion hin, sie sei bereits aus dem Schussfeld der mütterlich besorgten Kritik. Milla nahm sich gerade die Zeit vom Kaffee nachzugießen, bevor sie sich eines ihrer nächsten Lieblingsthemen vornahm. „Ich habe gehört, du hast jetzt endlich eine Hebamme gefunden?“, begann sie im neutralen Ton.
„Ariane“, bestätigte Julia. „Sie ist erst hierhergezogen. Da hatte sie noch freie Kapazitäten.“
„Ariane? Klingt mir eher nach einer Rakete“, mäkelte Milla.
„Sie ist Hebamme, Mama.“
„Wenn sie neu hier ist, hat sie ja wohl kaum Referenzen oder Empfehlungen vorzuweisen. Du hättest dich eben rechtzeitig um eine richtige Hebamme kümmern sollen.“
Als Julia die Augen verdrehte, schob Milla nach: „Wo hat sie überhaupt ihre Praxis? Ich hoffe doch, sie arbeitet mit den hiesigen Frauenärzten zusammen.“
„Sie wohnt bei Charlie in der Kommune. Dort richtet sie sich jetzt ihre Praxis ein“, sagte Julia betont lässig und nahm sich ein Stück Kuchen vom Teller. „Charlie baut den alten Faktorenhof aus bei seinem Großvater.“ Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, wie Milla bei der Erwähnung Charlies zusammenzuckte.
„Karl-Ludgers Villa Kunterbunt ist ja wohl kaum der richtige Ort, um für werdende Mütter zu sorgen.“ Mutter war einer der wenigen Menschen, die darauf bestanden, den armen Charlie auch gegen seinen Willen mit seinem vollständigen Taufnamen anzusprechen. „Du wirst dich und dein Kind doch nicht irgendwelchen linksalternativen Spinnern anvertrauen, Julia!“
Julia biss resigniert in ihren Streuselkuchen. Eine Diskussion über Lebensformen jenseits konservativer Mütterlicher Vorstellungen hatte sich bei Milla noch nie als fruchtbringend erwiesen.
„Ariane ist eine staatlich examinierte und sehr engagierte Hebamme“, sagte Julia, als sie endlich heruntergeschluckt hatte. „Sie arbeitet ab September auch als Beleghebamme in Ebersbach.“ Julia lächelte gewinnend. Dann griff sie über den Tisch nach der Hand ihrer Mutter, als Milla gerade mit einem skeptischen Gesichtsausdruck ihre Kaffeetasse ansetzte.
„Ariane würde dir gefallen, Mama. Und so ein Kräutlein hier und da zur Unterstützung hat noch nie jemanden geschadet.“
„Ja, aber …“
„Ich fahre mit Trude nach Finkendörfel zurück“, ließ sich Paul plötzlich neben ihnen vernehmen. „Ihr geht es nicht so gut.“ Julias Hand fuhr zurück in ihren Schoß, während sie zu Paul aufsah.
„Könnt ihr nicht noch bis nach dem Abendbrot warten?“ Milla stellte klappernd die Kaffeetasse ab. „Bara wird sehr enttäuscht sein. Und Adele erst! Sie ist doch dein Patenkind.“
„Ja. Sie sind beide sehr unzufrieden mit mir“, bestätigte Paul. „Trude findet aber keine Ruhe hier. Wir haben uns schon verabschiedet.“
Julia stellte fest, dass auch sie sich um etwas betrogen fühlte. Adeles Schuleintritt hatte ein fröhliches Fest für ihre Nichte werden sollen. Am Tisch der Familien Veit und Eisler jedoch herrschte eher die Stimmung einer Begräbnisfeier. „Ich bleibe noch“, sagte sie. „Damit wir nicht allesamt ins Gerede kommen.“
Paul nickte. „Gut so. Halte die Stellung und iss für Drei! Du weißt, was Ariane gesagt hat.“ Aufmunternd klopfte er ihr zum Abschied auf die Schulter und sah dabei unendlich traurig aus. Für einen Augenblick war Julia versucht, mit ihnen zu fahren, nur um bei ihm zu sein. Wenn sie nur ergründen könnte, was ihren Mann seit seiner Rückkehr aus Boston so niederdrückte. Es stand wie eine Nebelwand zwischen ihnen und ihrem Glück.
„Oma und ich können ja dann bei den Eltern mitfahren“, schlug sie stattdessen vor.
„Denke daran, dein Handy wieder einzuschalten, wenn unsere Bara ihre strengen Vorschriften nachher etwas lockert.“ Er rang sich ein Lächeln ab. Dann ging er mit raschen Schritten zur Tür, den Autoschlüssel schon in der Hand. Trude trottete ohne einen Gruß hinter ihm her, gefangen in ihren eigenen düsteren Vorahnungen.
Kaum, dass sie verschwunden waren, nestelte Julia in ihrer Handtasche nach ihrem Handy und schaltete es an. Das Piepen der Anmeldung alarmierte Barbara, die eben neben ihnen aufgetaucht war. „Kannst du denn nicht einmal paar Stunden ohne dieses Ding sein!“, tadelte sie ihre Schwester. Gehorsam schalte Julia das Telefon wieder aus und steckte es in ihre Tasche.
„Trude ist so komisch“, fuhr Bara mit einem Seufzen fort, als sie sich zu ihnen setzte. „Ich habe Oma noch nie so ärgerlich wegen ihrer Trude erlebt. Weißt du, was da los ist zwischen den Beiden?“ Als Julia sich ahnungslos gab, wandte sich Bara an ihre Mutter. „Hattest du gewusst, dass Omas Mutter das Gutshaus schon vor dem Krieg an die Brauns verkauft hat? Um die Schule für Oma und ihre Schwester zu bezahlen.“
„So?“ Milla zog die Augenbrauen hoch. „Das hat mich nie interessiert.“
„Wie kommt ihr denn jetzt ausgerechnet darauf?“, fragte Julia, die heilfroh über diesen Themenwechsel war.
„Papa erzählte es eben, als er mit Oma darüber stritt, dass es für euch vielleicht ein gutes Zuhause abgäbe, Schwesterherz. Er erwägt, es zurückzukaufen.“
Julia prustete. „Diese Ruine? Was sollen wir denn bitte mit diesem riesigen, alten Kasten? Es kostet ein Vermögen, so eine Bude zu erhalten, geschweige denn ein schönes Zuhause aus diesen rauchenden Trümmern zu machen.“
„Du übertreibst mal wieder maßlos! Dort raucht seit einem halben Jahrhundert nichts mehr.“
„Eben“, setzte Julia entschieden nach. „Selbst der alte Braun überlässt Charlie lieber seinen Faktorenhof und nicht das Schlössl. Die Brauns sind nun wirklich keine Armen.“
„Ich werde nie begreifen, was diesen alten Zausel dazu getrieben hat“, bemerkte Mutter Milla angewidert. „Und dass er da mitten unter diesen Spinnern lebt!“
„Mama!“, riefen Julia und Bara wie aus einem Munde.
„Wer weiß das schon!“, gab Milla unbeeindruckt zurück. „Die machen da vielleicht eine Sekte auf, oder handeln mit Drogen, oder so etwas. Abgesehen davon finde ich, euer Vater hat gar nicht so Unrecht: wir könnten doch versuchen, das Eigentum eurer Vorväter zurückzubekommen.“
„Oma sagt, sie werde nie wieder ihren Fuß da über die Schwelle setzen“, erzählte Bara mit leichtem Grusel in ihrer Stimme. „Für sie sei der Ort für immer vergiftet.“
Ausnahmsweise blieb Milla auf diese Aussage eine Antwort schuldig. Sie schüttete sich erneut Kaffee nach. „Jaja, der Krieg“, sagte sie dann lapidar. „Nehmt euch noch vom Kuchen, Kinder!“
7.
Vorsichtig lenkte Paul den Wagen über den asphaltierten Radweg am Waldrand entlang. Seit der letzten Straßensperrung, die ihnen nur diesen Weg über den Eckertsberg nach Finkendörfel ließ, hatten sie kein Wort mehr gesprochen. Trude umklammerte mit ihren Händen die Seiten des Beifahrersitzes. Ihre Augen waren starr nach vorn gerichtet. Der Scheibenwischer lief auf Hochtouren, ohne dass es eine Chance gab, den Wasserfilm länger als eine Zehntelsekunde von der Scheibe fernzuhalten. Dann bogen sie um die Kurve und das Tal von Finkendörfel lag vor ihnen. Paul brachte den Wagen zum Stehen. Wie auf Kommando stiegen sie beide aus. Sie achteten nicht auf den Regen, der sie im nu durchnässte. Zu groß war ihre Bestürzung über den fremdartigen Anblick, der sich ihnen bot. „Das ist der Untergang“, entfuhr es Trude. Paul legte den Arm um ihre Schulter. Über seine Brillengläser rann das Wasser, doch er sah auch so, dass das Wasser bis zum Marktplatz zurückstaute. Im Niederdorf war Land unter, eine fremdartige Seenlandschaft in der der Kirchberg mit dem Park auf seiner Seite wie eine bewaldete Insel aufragte. „Wie es aussieht, steht auch unser Haus unter Wasser“, sagte Paul. Trude packte seine Hand. „Raki ist noch da drin! – Der arme Kerl!“
„Bestimmt hat er sich in Sicherheit gebracht“, beruhigte Paul. „Wie die anderen Katzen auch. Du sagst doch immer, die Tiere haben ihren siebten Sinn.“
„Aber Raki hasst das Wasser. Er ist als kleiner Kater beinahe mal ersoffen. Was muss er für eine Angst haben jetzt.“ Sie wandte sich zum Auto um. „Ich muss zu meinem Kater!“
Paul folgte ihr. Während Trude entschlossen ihren Gurt anlegte, putzte er noch nachdenklich seine Brille. „Am besten wir fahren weiter in Richtung Eckerstwalde und dann über den Viebig ins Dorf runter“, überlegte er laut. „Bei der Heller Friedegard wird ja wohl jemand da sein. Vielleicht können wir uns dort auch ein paar alte Sachen borgen und Stiefel, oder so etwas.“
„Egal“, rief Trude. „Ich hole meinen Kater notfalls auch in Filzlatschen aus den Fluten!“
„Das wirst du auf jeden Fall sein lassen. Es sind Leute schon bei weniger Wasser ertrunken. Die Katerrettung überlässt du gefälligst mir.“
Trude setzte ein störrisches Gesicht auf. „Nu, fahr endlich!“
Sie gelangten ohne weitere Barrieren bis zu dem Hof der Hellers, der ihrem Haus gegenüber lag. Die Kirchturmuhr schlug die fünfte Stunde. Paul parkte den Wagen auf dem Hof. Mittlerweile schien der Regen etwas nachzulassen. Auch hier rann das Wasser in breiter, schlammiger Flut über die Hofzufahrt durch den Vorgarten runter zur Dorfstraße. Sie folgten dem Wasserstrom mit energischen Schritten um das Haupthaus herum. Der Anblick ihres zerstörten Zuhauses und des reißenden Schlammstromes, der sich daran vorbeiwälzte, ließ sie vor Entsetzen erstarren. „Das gibt es doch nicht!“ entfuhr es Paul. Trude brach in Tränen aus. „Hundertfünzig Jahre! Hundertfünfzig Jahre steht unser Haus hier! Und jetzt schiebt es uns den halben Friedhof ins Haus. “ Sofort wollte sie sich in die Fluten stürzen, um Raki zu retten. Paul hatte alle Mühe, sie zurückzuhalten.
„Trude! Paul! Na, Gott sei Dank, seid ihr da!“, rief Friedegard vom Fenster aus. Hinter ihr erschien der wirre Haarschopf ihrer Schwester, die ihnen begeistert zuwinkte.
„Raki!“, schrie Trude durch den Regen hinauf. „Ist Raki bei euch?“ Sie stemmte die knochigen Hände in die Hüfte. „Ich will zu meinem Kater!“ Die Haare klebten ihr um das Gesicht. Alles an Trude war wilde Entschlossenheit. Paul packte sie vorsichtshalber am Arm und zog sie an sich heran.
„Raki ist in Sicherheit“, versicherte Friedegard derweil. „Die Böhme Gabi hat ihn auf den Trümmern sitzen sehen bei Julia im Büro.“
„Wer?“
„Bei Julia?“
„Da ist der Mörder!“, schrie Meta aufgeregt dazwischen.
„Ach, so ein Unsinn! Kommt erst mal rein. Ich mache euch auf.“ Der Fensterflügel wurde energisch geschlossen. Paul führte die widerstrebende Trude am Haus entlang wieder zurück auf den Hof. Sie wurden schon erwartet. Kaum waren sie im Haus, sprudelten die Schwestern alle Unheilverkündigungen auf einmal heraus. „Der Einbrecher ist natürlich längst über alle Berge“, bekam Paul gerade noch mit, der es bald aufgab, dem Strom schnatternder Neuigkeiten zu folgen. „Der Mörder war das“, behauptete Meta. Sie hatte eine gewichtige Miene aufgesetzt und tätschelte Pauls Arm, während der versuchte aus dem Sommermantel zu schlüpfen.
„Ach, hör doch endlich auf, Kleine! Was redest du nur immer für ein Zeug.“ Friedegard warf ihrer Schwester einen tadelnden Blick zu. „Bitte kommt herein. Ihr armen Seelen! Hier habt ihr ein paar trockene Schlappen.“
„Raki passt noch auf auf euer Haus.“, fuhr Meta unbeeindruckt fort. „Wenn der Mörder wiederkommt. - Und mich haben sie mit dem Schneepflug gerettet!“
In Decken gehüllt und mit einem Pott starkem Kaffee in der Hand saßen sie dann in der Küche der Schwestern und versuchten Ordnung in die Berichte zu bekommen.
„Den Einbruch habe ich schon gemeldet“, erzählte Friedegard.