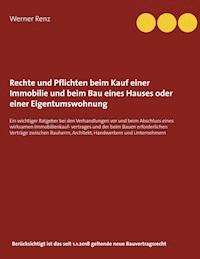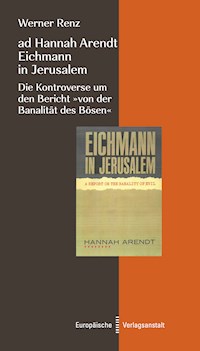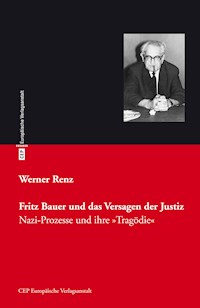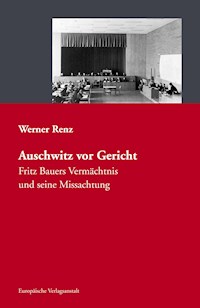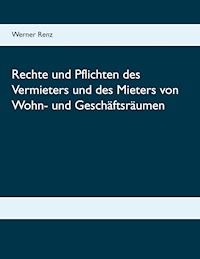
Rechte und Pflichten des Vermieters und des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen E-Book
Werner Renz
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Vermieter und Mieter von Wohnräumen oder auch Geschäftsräumen finden im Ratgeber Antwort auf alle Fragen, die bei den Vertragsverhandlungen, beim Vertragsabschluss und während der Mietzeit oder deren Ende auftauchen. Zu Beispiel: Wer muss einen etwa tätig gewesenen Makler bezahlen, und wieviel? Welche Miete oder Kaution darf festrgelegt werden, und was ist beim Ausfüllen eines Formularvertrages zu beachten? Welche Regelungen über Schönheitsreparaturen sind nach den neuesten Urteilen des Bundesgerichtshofes rechtswirksam? Was passiert in den vielen Fällen, in denen danach in vor 2015 abgeschlossenen Mietvertägen die Übertragung der Pflicht zur Durchführung von Schönheitsreparaturen auf den Mieter unwirksam ist? Welche Modernisierungsmaßnahmen kann der Vermieter durchführen, wie steht es mit der Duldungspflicht des Mieters und welche Auswirkungen auf die Miete sind zulässig? Wie steht es mit dem Recht zur Untervermietung, was bei Geschäftsräumen wichtig sein kann? Wichtig sind auch Fragen bei der Kündigung: Braucht man keinen Grund, und bei welchen vermieteten Wohnräumen kann nur bei Vorliegen von den Gerichten anerkannten Gründen gekündigt werden? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass der Mieter ein Widerspruchsrecht gegen eine Kündigung hat? Außerdem gibt es Muster für die heute zulässigen Mietanpassungsklauseln, Bestimmungen über Schönheitsreparaturen, Kleinreparaturen, Mieterhöhungserklärungen und Kündigungsschreiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Einführung
A. Das Recht und sein Inhaber
1-6
I. Recht und Verpflichtung
1-2
II. Inhaber und Träger von Rechten und Pflichten
3-6
B. Grundlage der Rechte und Pflichten im Privatrecht
7-36
I. Rechtsverhältnis – Rechtsgeschäft – Vertrag - Vorvertrag
7-10
II. Vornahme, Form und Schranken eines Rechtsgeschäfts
11-23
III. Weitere rechtliche Begriffe
24-36
1. Anspruch und Forderung
24-25
2. Erfüllung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
26
3. Verjährung, deren Hemmung oder Neubeginn
27-29
4. Die Verwirkung
30
5. Verschulden und Mitverschulden
31
6. Verzug
32
7. Auftrag und Vollmacht
33-34
8. Eigentum und Besitz
35-36
1. Kapitel: Das Rechtsverhältnis "Miete"
A. Die verschiedenen Mietverhältnisse
37-64
I. Miete, Pacht, Leihe
37-39
II. Die Art der verschiedenen Räume
40-42
III. Die Arten von Geschäfts- und Wohnraummietverhältnissen
43-54
1. Das Dauerschuldverhältnis
43-45
2. Hauptmietverhältnis und Untermietverhältnis
46-49
3. Geschäftsraummietverhältnis und Wohnraummietverhältnis
50-53
4. Die für Raummietverhältnisse geltenden Vorschriften
54
IV. Die einzelnen Mietverhältnisse je nach Art der Wohnräume
55-64
B. Das Zustandekommen eines Mietvertrages
65-90
I. Pflicht und Recht zur Vermietung von Räumen
65-67
II. Die Anbahnung des Vertragsschlusses
68-73
III. Der Abschluss eines Mietvertrages
74-86
IV. Zahlungspflichten von Vermieter oder Mieter an Vermitler
87-89
1. Die Voraussetzungen für eine Zahlungsverpflichtung an einen Makler oder Wohnungsvermittler
87a-87c
2. Die Zahlungspflicht des Auftraggebers beim Nachweis oder der Vermittlung reiner Geschäftsräume
88a
3. Zahlungspflicht eines Vermieters im Falle der Beauftragung eines Wohnungsvermittlers
88b
4. Die Zahlungspflicht eines Mietinteressenten im Falle der Beauftragung eines Wohnungsvermittlers
89--89e
V. Zahlungspflichten des Mieters an den Vermieter oder Dritte bei Vertragsabschluss
90
C. Wechsel von Vermieter und Mieter während der Mietzeit
91-102
I. Der Wechsel des Vermieters
91-97
1. Tod des Vermieters
91
2. Übergang des Eigentums an den Mieträumen
92-95
3. Auflösung eines Hauptmietverhältnisses
96
4. Eintritt des Vermieters durch Vertrag oder Umwandlung
97
II. Der Wechsel des Mieters
98-102
1. Tod eines Mieters
98-100
2. Mieterwechsel durch eine Vereinbarung
101
3. Änderung der Identität einer Geschäftsraummieters
102
2. Kapitel: Die Pflichten von Vermieter und Mieter während der Mietzeit
A. Hauptpflichten des Vermieters
103-115
I. Die Pflicht zur Gewährung des Gebrauchs der Mieträume
103-111
1. Der gebrauchsfähige Zustand der Räume
104-108
2. Sonstiges Zubehör der Mieträume
109
3. Zugänge, Zufahrt usw.
110
4. Beweislast für die ordnungsgemäße Übergabe
111
II. Die Pflicht zur Erhaltung der Gebrauchsfähigkeit
112-115
1. Die Erhaltungspflicht des Vermieters
112
2. Wegfall der Erhaltungspflicht und deren Übergang auf den Mieter
113-115
B. Nebenpflichten des Vermieters
116-135
I. Die Pflicht zu Nebenleistungen
116-117
II. Die Pflicht zur Abwehr von Schäden und Störungen
118-119
1. Die Verkehrssicherungspflicht des Vermieters
118
2. Die Pflicht zur Abwendung von Störungen
119
III. Die Pflicht zur Tragung der Lasten des Grundstücks
120-123
IV. Die Abrechnung des Vermieters über Nebenleistungen und Betriebskosten
124-130
V. Die Pflicht zum Schadenersatz
131-135
C. Hauptpflichten des Mieters
136-158
I. Die Miete
136-148
1. Die verschiedenen Arten von Mieten
136-139
2. Die Vereinbarung der Miete
140-141
3. Mietpreisbremse und Mietendeckel
142-144
4. Die Fälligkeit der Miete
145-146
5. Dauer und Wegfall der Mietzahlungspflicht
147-148
II. Die Kosten für Nebenleistungen und die Betriebskosten
149-158
1. Die Kosten für Nebenleistungen
149-151
2. Betriebskosten und andere Lasten
152-153
3. Die Festlegung der Betriebskosten im Mietvertrag und deren Fälligkeit
154-156
4. Dauer und Wegfall der Betriebskosten
157
5. Verzug des Mieters mit der Betriebskostenzahlung
158
D. Weitere Pflichten des Mieters
159-191
I. Die Leistung einer Sicherheit
159-165
II. Die Pflicht zur Zahlung außerordentlicher Nebenentgelte
166-169
1. Die Vertragstrafe
166
2. Der verlorene oder abwohnbare Baukostenzuschuss
167
3. Die Mietvorauszahlung
168
4. Das Mietdarlehen
169
III. Obhutpflicht und Benutzungspflicht des Mieters
170-173
1. Die Abwendung von Schäden
170
2. Die Beweislast für die Erfüllung der Obhutpflicht
171
3. Die Pflicht zu Anzeige von Schäden und Gefahren
172
4. Die Pflicht zur Benutzung der Mieträume
173
IV. Die Erhaltungspflicht des Mieters
174-182
1. Die Pflicht des Mieters zur Erhaltung der Mieträume
174
2. Die Kleinreparaturen
175
3. Die Schönheitsreparaturen
176-181
4. Sonstige Instandhaltungen
182
V. Duldungspflichten des Mieters
183-187
1. Die Pflicht zur Duldung erforderlicher Erhaltungsmaß nahmen
183
2. Die Pflicht zur Duldung durchzuführender Modernisierungsmaßnahmen
184-186
3. Betreten der Mieträume durch den Vermieter oder Dritte
187
VI. Die Pflicht zum Schadenersatz
188-191
3. Kapitel: Die Rechte von Vermieter und Mieter und die Änderung der Miete während der Mietzeit
A. Die Rechte des Vermieters während der Mietzeit
192-194
1. Das Vermieterpfandrecht
192
2. Das Recht des Vermieters zur Aufrechnung
193
3. Das Recht zur Durchführung baulicher Veränderungen
194
B. Die Rechte des Mieters während der Mietzeit
195-228
I. Recht zur Benutzung und zum Gebrauch der Mieträume
195-205
1. Der Gebrauch nach dem Mietzweck
195
2. Umfang und Grenzen des Gebrauchsrechtes
196-203
3. Die Herstellung barrierefreier Mieträume
204-205
II. Recht des Mieters zur Überlassung von Räumen an Dritte
206-210
1. Die Überlassung zum unselbständigen Gebrauch
206
2. Die Überlassung zum selbständigen Gebrauch
207-210
III. Rechte des Mieters beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften und bei Mängeln an der Mietsache
211-221
1. Die „Zugesicherte Eigenschaft“ und der „Mangel“
211-215
2. Entstehung und Ausschluss der Gewährleistungsrechte
216-217
3. Die einzelnen Gewährleistungsrechte des Mieters
218-221
Das Recht zur Minderung
218
Das Recht zum Schadenersatz wegen Nichterfüllung
219
Das Verlangen zur Beseitigung der Mängel
220
Das Recht zur Ersatzvornahme auf Vermieters Kosten
221
IV. Weitere Rechte des Mieters
222-228
1. Der Ersatz im Auftrag des Vermieters gemachter Aufwendungen
222
2. Der Ersatz ohne Auftrag des Vermieters gemachter Aufwendungen
223-225
3. Das Recht des Mieters zur Aufrechnung
226
4. Das Vorkaufsrecht des Mieters
227-228
C. Die Änderung der Miete und Betriebskosten für Wohnräume während der Mietzeit
229-258
I. Die Änderung der Wohnungsmiete durch eine Vereinbarung
229-230
II. Die Änderung der Wohnungsmiete nach einer schon im Mietvertrag getroffenen Bestimmung
231-332
1. Die Vereinbarung einer Staffelmiete im Mietvertrag über Wohnräume
231
2. Die Vereinbarung eine Indexmiete im Mietvertrag über Wohnräume
232
III. Die Änderung der Miete für preisgebundene Wohnräume auf Verlangen des Vermieters
233
IV. Die Änderung der Miete für preisfreie Wohnräume auf Verlangen des Vermieters
234-254
1. Die Erhöhung der Miete auf die ortsübliche Miete
236-247
2. Die Mieterhöhung wegen Modernisierungsmaßnahmen
248-254
V. Die Änderung der Betriebskosten beim Wohnraummietvertrag
255-258
D. Die Änderung der Miete und Betriebskosten für Geschäftsräume während der Mietzeit
259-263
I. Die Änderung der Geschäftsraummiete durch Vereinbarung
259-260
II. Die Änderung der Geschäftsraummiete nach einer schon im Mietvertrag getroffenen Bestimmung
261-262
III. Die Änderung der Betriebskosten beim Geschäftsraummietverhältnis
263
4. Kapitel: Die Beendigung des Mietverhältnisses
A. Die verschiedenen Beendigungsgründe
264-273
I. Die Beendigung des Mietverhältnisses durch Zeitablauf
265
II. Die Beendigung des Mietverhältnisses durch Vereinbarung zwischen Vermieter und Mieter während der Mietdauer
266-269
III. Beendigung des Mietverhältnisses durch einseitige Erklärung des Vermieters oder Mieters
270-273
B. Die Kündigung eines Mietverhältnisses
274-282
I. Der Begriff „Kündigung“
274
II. Die verschiedenen Kündigungsfristen und -arten
275-279
III. Form, Inhalt und Begründung einer Kündigung
280-282
C. Die Kündigungsrechte beim Geschäftsraummietverhältnis
283-310
I. Die ordentliche Kündigung von Geschäftsräumen
283-289
II. Die außerordentliche befristete Kündigung von Geschäftsräumen
290-297
III. Die fristlose Kündigung von Geschäftsräumen
298-308
IV. Die Verlängerungsoption
309-310
D. Die Kündigungsrechte des Mieters von Wohnräumen
311-321
I. Die ordentliche Kündigung des Mieters von Wohnräumen
311
II. Die außerordentliche befristeten Kündigung des Mieters von Wohnräumen
312-317
III. Die fristlose Kündigung des Mieters von Wohnräumen
318-321
E. Die Kündigungsrechte des Vermieters von Wohnräumen
322-354
I. Die ordentliche Kündigung des Vermieters von Wohnräumen
322-339
1. Die ordentliche Kündigung von Wohnräumen ohne Kündigungsschutz
323-325
2. Die Kündigung von Nebenräumen und Grundstücksteilen
326
3. Die ordentliche Kündigung von Wohnräumen mit Kündigungsschutz
327-336
4. Vorgetäuschte, nachträglich entstandene und weggefallene Kündigungsgründe bzw. berechtigte Interessen
337-339
5. Die ordentliche Kündigung einer Werkwohnung
340-341
6. Tabelle zur ordentlichen Kündigung des Vermieters
342
II. Die außerordentliche befristete Kündigung des Vermieters von Wohnräumen
343-347
III. Die fristlose Kündigung des Vermieters von Wohnräumen
348-353
1. Die fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzuges in bestimmter Höhe
348-349
2. Die fristlose Kündigung wegen schleppender Mietzahlung
350
3. Die fristlose Kündigung wegen eine erheblichen vertragswidriger Gebrauchs oder einer Gefährdung der Mietsache
351
4. Die fristlose Kündigung wegen unzumutbarem Mietverhältnis
352
5. Die erforderliche Abmahnung
353
IV. Vereinbarungen über die Kündigungsrechte des Wohn raum vermieters
354
F. Das Widerspruchsrecht des Mieters von Wohnräumen
355-362
1. Der Widerspruch des Mieters gegen eine Kündigung
355-356
2. Die unzumutbare Härte
357
3. Form und Frist des Widerspruchs
358-359
4. Die Folgen des begründeten Widerspruchs
360-362
5. Kapitel: Rechte und Pflichten nach Beendigung des Mietverhältnisses
A. Die Pflicht zur Rückgabe der Mieträume
363-377
I. Die Rückgabepflicht des Mieters
363-373
1. Ende des Mietverhältnisses und Zeitpunkt der Rückgabe
363-364
2. Der Umfang der Rückgabeverpflichtung
365-371
3. Die Pflicht zur Übergabe
372
4 Die Folgen, wenn der Mieter die Rückgabepflicht nicht oder schlecht erfüllt
373
II. Die Rückgabeverpflichtung eines Dritten
374-377
1. Die Rückgabepflicht des Dritten bzw. Untermieters
374
2. Der Schutz des Dritten vor einem Herausgabeanspruch des Vermieters
375-376
3. Die Folgen, wenn der Dritte die Rückgabepflicht nicht oder schlecht erfüllt
377
B. Rechte und Pflichten zwischen Ende des Mietverhältnisses und Rückgabe und danach
378-390
I. Die Widerspruchspflicht von Vermieter und Mieter
378-381
II. Weiterlaufende Pflichten der Mietparteien
382-388
III. Die Pflicht des Vermieters zur Rückgabe einer Kaution
389
IV. Sonstige Ansprüche des Vermieters und des Mieters
390
C. Die Verjährung der Ansprüche von Vermieter und Mieter
391-394
I. Ansprüche des Vermieters mit 3 –jähriger Verjährungsfrist
391
II. Ansprüche des Vermieters mit 6 –monatiger Verjährungsfrist
392
III. Ansprüche des Mieters mit 3 –jähriger Verjährungsfrist
393
IV. Ansprüche des Mieters mit 6 –monatiger Verjährungsfrist
394
6. Kapitel: Wichtiges bei der Verwendung von Formularmietverträgen
A. Fehler bei der Verwendung von Formularmietverträgen
395-398
I. Unausgefüllte oder falsch ausgefüllte Stellen
396
II. Gefährliche Änderungen und Ergänzungen im Text des Vertragsformulars
397-398
B. Bestimmungen über Mietparteien, Mieträume, deren Zustand und über Entgelte
399-416
I. Die Vertragsparteien
399-401
II. Die Beschreibung der Mieträume
402-405
III. Die Festlegung von Höhe und Fälligkeit der Miete
406-412
IV. Bestimmungen über die Betriebskosten
413-415
V. Bestimmungen über Nebenentgelte, insbesondere Kaution
416
C. Bestimmungen über Mietdauer, Mietzweck, Gebrauchsrecht und Erhaltungspflicht
417-445
I. Die Bestimmung der Dauer des Mietverhältnisses
417-419
II. Bestimmungen über die Beendigung des Mietverhältnisses, insbesondere zu den Kündigungsrechten
420-430
III. Bestimmungen über Mietzweck, über den Gebrauch der Mieträume und deren Überlassung an Dritte
431-437
IV. Bestimmungen zu Erhaltungspflichten des Mieters
438-445
1. Bestimmungen zu Kleinreparaturen
438-439
2. Bestimmungen zu Schönheitsreparaturen
440-443
3. Weitere Instandhaltungspflichten des Mieters
444
4. Bestimmungen für den Ausschluss oder die Beschränkung Gewährleistungsrechten des Geschäftsraummieters wegen Mängel
445
D. Bestimmungen über sonstige Rechte und Pflichten
446-453
1. Bestimmungen über das Vermieterpfandrecht
446
2. Bestimmungen über Betretungsrechte des Vermieters
447
3. Bestimmungen über Ausbaurechte und bauliche Veränderungen
448
4. Bestimmungen über ein Aufrechnungsverbot des Mieters
450
5. Bestimmungen über die Beheizung der Mieträume
451
6. Bestimmungen für den Fall des Todesfall des Mieters
452-453
7. Bestimmungen über die Rückgabe der Mieträume
454
E. Allgemeine Bestimmungen
455-459
1. Bestimmungen über gegenseitige Bevollmächtigungen
455
2. Bestimmungen über Ergänzungen und Änderungen des Vertrages
456
3. Sogenannte „salvatorische“ (= rettende) Klauseln
457-458
4. Bestimmungen über die Hausordnung
459
F. Verschiedene Interessen und Risken von Vermieter und Mieter von Geschäftsräumen
460-472
I. Interessen und Risiken des Vermieters von Geschäftsräumen
460-467
II. Interessen und Risken des Mieters von Geschäftsräumen
468-472
7. Kapitel: Die Durchsetzung der Rechte und Pflich ten von Vermieter und Mieter und die dadurch entstehen den Kosten
A. Die Geltendmachung der Ansprüche von Vermieter und Mieter
473-497
I. Außergerichtliche Regelungsmöglichkeiten
473-474
II. Die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen
475-481
1. Das gerichtliche Mahnverfahren
475
2. Das streitige Verfahren
476-480
3. Das Vollstreckungsverfahren
481
III. Die Zuständigkeit der Gerichte in Mietstreitigkeiten
482-487
1. Die Zivil- und Vollstreckungsabteilung beim Amtsgericht
482
2. Zivil- und Handelskammer beim Landgericht
483-484
3. Der Zivilsenat beim Oberlandesgericht
485
4. Der Zivilsenat beim Bundesgerichtshof
486
5. Die Zuständigkeit bei der Zwangsvollstreckung
487
IV. Die Vertretung durch Rechtsanwälte in Mietstreitigkeiten
488
V. Die Räumungsklage zwischen Vermieter und Mieter
489-497
1. Die am Prozess beteiligten Personen
489
2. Der Beginn des Verfahrens
490
3. Der Verhandlungstermin
491
4. Die Beweisaufnahme
492
5. Der während des Verfahrens mögliche Vergleich
493a
6. Die einstweilige Verfügung während des Verfahrens
493b
7. Das Urteil
494-496
8. Die Dauer des Verfahrens
497
B. Die Zwangsvollstreckung
498-506
1. Der vollstreckbare Schuldtitel
498
2. Die einzelnen Vollstreckungsmaßnahmen
499-503
3. Vollstreckungsschutz für den Räumungsschuldner
504
4. Letzte Hilfe von der Gemeinde
505-506
C. Die Kosten in Mietangelegenheiten
507-519
I. Die Gebühren
507-512
II. Die Auslagen
513-515
III. Berechnungsbeispiele für Gerichts- und Anwaltskosten
516
IV. Die Kostentragungspflicht
517
V. Die Rechtschutzversicherung
518
VI. Die Prozesskostenhilfe
519
Register
Abkürzungsverzeichnis
Abs.
:Absatz
AG
:Aktiengesellschaft
BetrKV
:Betriebskostenverordnung
BGB
:Bürgerliches Gesetzbuch in der seit 1.1.2002 geltenden Fassung
BGH
:Bundesgerichtshof
BV (II BV)
:II. Verordnung über wohnwirtschaftliche Berechnungen
EnEV
:Energiesparverordnung
f. - ff.
:folgende Zahl - folgende Zahlen
GbR
:Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GdWE
:Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
GKG
:Gerichtskostengesetz
GmbH
:Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVG
:Gerichtsverfahrensgesetz
GvKostG
:Gerichtsvollzieherkostengesetz
HKV
:Heizkostenverordnung
InsO
:Insolvenzordnung (frühere Konkursordnung)
LBO
:Landesbauordnung eines Landes
MietAnpG
:Mietrechtsanpassungsgesetz
MietNovG
:Mietrechtsnovellierungsgesetz
OHG
:Offene Handelsgesellschaft
Rn
:Randnummer
RVG
:Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
S.
:Satz
StGB
:Strafgesetzbuch
WBVG
:Wohnungs- und Betreuungsvertragsgesetz
WEG
:Wohnungseigentumsgesetz
WoBindG
Wohnungsbindungsgesetz
WoFlV
:Wohnungsflächenverordnung
WoVermRG
:Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung
ZPO
:Zivilprozessordnung
ZVG
:Zwangsversteigerungsgesetz
§- §§
:Paragraph - Paragraphen
Wenn im Text auf Paragraphen (§§) ohne Angabe eines Gesetztes hingewiesen wird, handelt es sich um Paragraphen des BGB.
EINFÜHRUNG
Die gesetzlichen Vorschriften für Mietverträge über alle Arten von Räumen stehen hauptsächlich im 2. Buch des BGB im Titel "Mietvertrag" unter den §§ 535 – 578. Welche besonderen Schutzvorschriften für Wohnraummietverhältnisse gelten, finden Sie unter Rn 54. Ein kleiner Teil dieser Vorschriften gilt auch für Geschäftsraummietverhältnisse (§ 578 Abs. 2).
Zunächst sollen einige rechtliche Begriffe erklärt werden:
A. Das "Recht" und sein Inhaber
I. Recht und Verpflichtung
1
Unter einem „Recht“ versteht man eine Befugnis, die unsere Rechtsordnung für den Berechtigten vorsieht. Je nach seinem Inhalt gibt es 3 Arten:
Das Recht, von einem anderen ein
Tun oder Unterlassen zu verlangen:
der sogenannte „Anspruch“ (
Rn 24
).
Das Recht
etwas zu tun:
das sogenannte „Gestaltungsrecht“, z. B. das Kündigungsrecht.
Das
absolute
Recht: das sogenannte „dingliche Recht“, das an einer Sache (
Rn 6
) besteht und gegen jeden Dritten wirkt, z. B. das Eigentumsrecht. Das Gegenteil vom absoluten Recht ist das
relative
Recht. Dieses steht dem Inhaber (= Gläubiger) nur gegenüber einer oder mehreren bestimmten Personen (= Schuldnern) zu.
2
Dem einzelnen Recht ist im Privatrecht in der Regel eine Pflicht zugeordnet, die von der Rechtsordnung dem Verpflichteten auferlegt wird. Diese gesetzliche Pflicht ist von der „sittlichen“ Pflicht zu unterscheiden, die nach der sich laufend ändernden Moralauffassung besteht und nicht eingeklagt werden kann, z. B. die Pflicht zur Grabpflege.
II. Inhaber und Träger von Rechten und Pflichten
3
Ein Recht kann auch mehreren Personen gemeinsam als Gesamtgläubiger zustehen. Mehrere Personen können eine Pflicht gemeinsam als Gesamtschuldner schulden, wobei aber Jede Person zur ganzen Leistung gegenüber dem Gläubiger verpflichtet ist, der sie aber nur einmal verlangen kann.
4
Verbraucher (§ 13) ist eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem privaten Zweck abschließt, also in der Regel der Wohnraummieter.
5
Unternehmer (§ 14) dagegen ist eine natürliche oder juristische Person, die beim Abschluss eines Rechtsgeschäftes eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit ausübt, also oft der Geschäftsraummieter.
6
Sachen sind körperliche Gegenstände, die im Raum abgegrenzt werden können (§§ 90 ff.). Sie können nicht Inhaber von Rechten und Pflichten sein. Dagegen können an Sachen absolute Rechte bestehen, z. B. der Besitz (§§ 854 ff.), das Eigentum (§ 903), oder auch relative Rechte, z. B. ein Miet- oder Pachtrecht. Es gibt unbewegliche und bewegliche Sachen:
a. Unbebaute oder bebaute Grundstücke einschließlich aller mit dem Grund und Boden fest verbundener Bestandteile, z. B. Pflanzen, Mauern, Bauteile, insbesondere auf dem Grundstück errichtete Gebäude einschließlich der darin befindlichen Räume oder Wohnungen, ausgenommen die unter b. aufgeführten unbeweglichen Sachen, nämlich
b. Wohnungseigentum und Teileigentum nach dem WEG.
(2) Bewegliche Sachen sind alle Sachen, die weder Grundstücke noch mit diesen fest verbundene Bestandteile sind. Keine Sachen sind Tiere (§ 90 a), auf die aber die für Sachen geltenden Vorschriften anzuwenden sind.
B. Grundlagen der Rechte und Pflichten im Privatrecht
I. Rechtsverhältnis - Rechtsgeschäft - Vertrag
7
8
Das Rechtsgeschäft besteht aus einer oder mehreren Willenserklärungen (§§ 116 ff.). Unter einer Willenserklärung versteht man ein menschliches Handeln, mit dem der Handelnde eine Rechtswirkung erzielen will.
Es gibt „ausdrückliche“ und sogenannte „stillschweigende“ Willenserklärungen, denn auch durch ein „Schweigen“ oder ein sogenanntes „schlüssiges (konkludentes) Verhalten“ kann ein Mensch den Willen äußern, eine Rechtswirkung erzielen zu wollen. Schlüssiges Verhalten spielt oft beim Abschluss eines Vertrages mit einem Makler eine Rolle (Rn 87 ff.).
Es gibt einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte. Das erstere besteht aus einer Willenserklärung, z. B. Bevollmächtigung, Anfechtung, oder die Kündigung. Das mehrseitige Rechtsgeschäft besteht aus mehreren von mindestens 2 Personen erklärten Willenserklärungen, z. B. der Vertrag .
9
Ein Vertrag (§§ 145 ff.) kommt dann zustande, wenn eine Vertragspartei einer anderen ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages macht, und die andere Vertragspartei dieses Angebot ohne Einschränkung annimmt, also durch Angebot und Annahme. Dabei ist es gleichgültig, von welcher Person die Initiative, also das Angebot ausgeht. Wird das Angebot der Person A an die Person B von der letzteren nicht ohne Einschränkung angenommen, gilt das Angebot als abgelehnt, verbunden mit einem neuen Angebot (§ 150), das die Person A annehmen oder ablehnen kann.
Nach dem Grundsatz „Pacta sunt servanda“ (= Verträge sind zu halten) sind die Parteien an einen einmal abgeschlossenen rechtswirksamen Vertrag gebunden, ausgenommen
(1) sie haben ein Rücktrittsrecht (§§ 346 ff.) oder uneingeschränktes Rückgaberecht vereinbart; oder
(2) die den Vertrag schließende Partei ist ein Verbraucher (Rn 4), dem in fast allen Fällen ein gesetzliches Widerrufsrecht von 2 Wochen zusteht, wenn er mit einem Unternehmer (Rn 5) außerhalb von Geschäftsräumen des Unternehmers (Haustürgeschäft) oder ausschließlich durch Fernkommunikationsmittel (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Internet, E-Mails, TV oder Radio) im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems einen Vertrag über eine entgeltliche Leistung abgeschlossen hat; oder, was selten vorkommt,
(3) dass sich die Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind (= Störung der Geschäftsgrundlage) geändert haben (§ 313). Siehe dazu z B. im Falle der Covid-19-Pandemie die Rn 260 und 307.
10
Ein Vorvertrag kommt zustande, wenn sich 2 Parteien verpflichten, einen bestimmten Vertrag abzuschließen, weil z. B. der beabsichtigte Vertrag aus irgendwelchen Gründen noch nicht abgeschlossen werden kann, oder wenn sich in einem Vorvertrag nur eine der Parteien binden will. Soll keine der Parteien gebunden sein, ist nur eine „Absichtserklärung“ gegeben.
II. Vornahme, Form und Schranken eines Rechtsgeschäfts
1. Die Vornahme eines Rechtsgeschäftes
11
Eine rechtsfähige Person (Rn 3) kann ein Rechtsgeschäft selbst vornehmen, wenn sie – wie in der Regel - voll geschäftsfähig ist. Nicht voll geschäftsfähig ist eine beschränkt geschäftsfähige oder gar geschäftsunfähige Person.
Geschäftsunfähig ist ein noch nicht 7 Jahre alter Mensch oder einer, der sich „in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist“ (§ 104). Er kann nur durch seinen (gesetzlichen) Vertreter. Beschränkt geschäftsfähig sind Minderjährige zwischen 7 und 18 Jahren (§ 106). Sie benötigen für die meisten Rechtsgeschäfte die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.
2. Gesetzliche Formen eines Rechtsgeschäfts
Ein Rechtsgeschäft darf in der Regel "formlos" vorgenommen werden, d.h. die mündliche Erklärung ist also rechtsgültig. Für bestimmte Rechtsgeschäfte hat der Gesetzgeber aber „Formen“ vorgeschrieben:
12
Die (gesetzliche) Schriftform (§ 126) wird für bestimmte Erklärungen verlangt, z. B. für die Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses (Rn 275), oder für bestimmte Verträge, z. B. einen über 1 Jahr dauernden Zeitmietvertrag (Rn 76 f.). Die Erklärung muss dann vom Aussteller oder ein Vertrag muss auf einem Schriftstück eigenhändig durch Namensunterschrift beider Vertragspartner unterzeichnet sein. Ungültig ist ein also die Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses durch Telefax oder der oben genannte Zeitmietvertrag, wenn er nur z. B. im Wege eines Schriftwechsels vereinbart wird.
Zum Unterschied zwischen der beschriebenen gesetzlichen und einer nur vereinbarten Schriftform siehe Rn 16.
13
Bei der öffentlichen Beglaubigung (§ 129) wird die Erklärung schriftlich abgegeben und unterschrieben. Der Notar beglaubigt die Unterschrift und bestätigt also nur, dass die Unterschrift vom Unterzeichnenden stammt.
14
Bei der notariellen oder gerichtlichen Beurkundung (§ 128; § 8 ff. Beurkundungsgesetz) geben der oder die Erklärenden ihre Erklärungen gegenüber dem Notar oder Gericht ab. Dieser bzw. dieses fertigt darüber eine Niederschrift an, die von ihm vorgelesen, von dem oder den Erklärenden genehmigt, sowie von diesen und vom Notar bzw. Gericht unterschrieben wird.
15a
Bei der elektronische Form (§ 126 a) handelt es sich um einen Sonderfall der gesetzlichen Schriftform, bei welcher der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen muss. Zertifizierungsdienstanbieter finden Sie unter www.regtp.de. Diese Form ersetzt die gesetzliche Schriftform (Rn 12), wenn sich aus dem Gesetz nicht etwas anderes ergibt.
15b
Bei der Textform (§ 126 b) muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere Art zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneter Weise (Papier, CD-Rom, Email, Fax) abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Unterschrift oder in anderer Weise erkennbar gemacht werden.
16
Von einer vereinbarten Form (§ 127) für ein Rechtsgeschäft spricht man, wenn z. B. Vertragsparteien miteinander vereinbaren, dass eine der oben genannten gesetzlichen Formen erforderlich sein soll, z. B. die Schriftform für einen Vertrag, für eine Änderung oder Ergänzung eines solchen oder für eine Kündigung. Bei der so vereinbarten Schriftform reicht aber im Gegensatz zur gesetzlichen Schriftform (Rn 12) für die Übermittlung der Erklärungen auch Email, Telefax, oder bei einem Vertrag auch ein Schriftwechsel.
3. Allgemeine Schranken eines Rechtsgeschäfts
17
Unwirksam ist ein Rechtsgeschäft, wenn es gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen „zwingende Vorschriften“ verstößt (§ 134). Letztere sind vom Gesetzgeber festgelegte Bestimmungen, die durch eine oder mehrere Vertragsparteien weder geändert noch umgangen werden dürfen, die also nur der Gesetzgeber selbst ändern kann.
Beispiel: In einem Mietvertrag wird eine Bestimmung vereinbart, mit der eine zum Schutz des Wohnraummieters bestehende Vorschrift umgangen oder ausgeschlossen wird, z. B. wird für den Vermieter eine kürzere als vom Gesetz zugelassene Kündigungsfrist (Rn 354) vereinbart.
Darunter fällt auch, wenn bei einem Rechtsgeschäft eine gesetzlich vorgeschriebene oder auch nur vereinbarte Form (Rn 12 ff.) nicht eingehalten wird (§ 125), wenn z. B. der Wohnungsvermieter oder –mieter nur mündlich, durch Telefax oder ein Email kündigt.
Verstößt nur ein Teil eines Rechtsgeschäfts gegen ein gesetzliches Verbot, also z. B. nur eine Bestimmung eines Vertrages, dann ist das ganze Rechtsgeschäft unwirksam, ausgenommen es ist anzunehmen, dass das Geschäft auch ohne den unwirksamen Teil vorgenommen worden wäre (§ 139). Letzteres wird bei Mietverträgen in der Regel angenommen, wenn nur einzelne Bestimmungen unwirksam sind, z. B. Vertragsklauseln, die gegen Vorschriften über vorformulierte Bestimmungen (Rn 20 ff.) verstoßen.
18
Unwirksam ist ein Rechtsgeschäft auch, wenn es gegen die guten Sitten, d. h. gegen das Rechtsgefühl aller "Billig- und Gerechtdenkenden" verstößt (§ 138). Darunter fällt der „Wucher“, der angenommen wird, wenn jemand „unter Ausbeutung einer Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche einer Person“ sich für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu seiner Leistung steht. Zum Missverhältnis zwischen Mietzins und dem Gebrauchswert von Räumen siehe Rn 139.
19
Unwirksam ist auch eine Willenserklärung, wenn sie vom Erklärenden rechtswirksam angefochten worden ist.
Zulässig ist die Anfechtung einer Willenserklärung, wenn sich der Erklärende bei der Abgabe der Willenserklärung geirrt hat (§ 119), oder wenn er durch eine Drohung oder durch eine eine arglistige Täuschung zu einer Willenserklärung veranlasst worden ist § 123).
Für eine Anfechtung sind Fristen zu beachteten. Die Anfechtung wegen Irrtums muss unverzüglich nach Entdeckung des Irrtums erklärt werden (§ 121), was eine Überlegungsfrist (ca. 1 Woche) zulässt, auch zur Einholung eines rechtskundigen Rats. Die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung oder Drohung muss innerhalb eines Jahres ab Entdeckung der Täuschung oder Wegfall der Drohung (§ 124) erklärt werden.
Im Falle einer rechtzeitigen Anfechtung einer Willenserklärung verliert beim zweiseitigen Rechtsgeschäft, z. B. bei einem Vertrag, in der Regel das ganze Rechtsgeschäft seine Rechtswirksamkeit.
Vorformulierte Bestimmungen (=Klauseln) und individuelle Vereinbarungen:
20
Zum Schutz vor einer unangemessenen Benachteiligung eines Vertragspartners gibt es im BGB Vorschriften für vorformulierte Vertragsbedingungen bestimmter Vertragstypen, zu denen insbesondere auch Mietverträge und Maklerverträge (§§ 305 ff.) gehören. Diese auch „Klauseln“ genannten in mehreren Verträgen verwendeten Bestimmungen fallen unter diese Beschränkungen. Es ist gleichgültig, ob die Vertragsbestimmungen geschrieben oder gedruckt verwendet werden. Darunter fallen also insbesondere auch alle Vertragsformulare, die käuflich erworben, im Internet heruntergeladen oder von einem Formularbuch abgeschrieben werden, oder von einem Notar, von Unternehmern oder auch Privatpersonen für mehrere Geschäfte verwendet werden.
Solche Bestimmungen bzw. Klauseln sind:
21
(1) Überraschungsklauseln und mehrdeutige Klauseln (§ 305 c): Erstere sind Bestimmungen, die z. B. in einem systematischen Zusammenhang stehen, wo sie der andere Vertragspartner nicht erwartet, oder die nach dem Erscheinungsbild des Vertrages so ungewöhnlich sind, dass man mit einer solchen Bestimmung nicht rechnen muss, z. B. die Bestimmung „Zur Sicherung der Ansprüche des Vermieters gegen den Mieter tritt dieser sein Lohn- oder Gehaltsansprüche (oder seine Kundenforderungen) an den Vermieter ab“.
Ihren unzulässigen Überraschungseffekt verliert eine Klausel nicht dadurch, dass sie etwa in fetter Schrift gedruckt oder hervorgehoben wird. Andererseits muss eine Klausel auch für eine nicht juristisch vorgebildete Vertragspartei klar und verständlich sein, der Vertragspartner muss also „ohne fremde Hilfe möglichst klar und einfach seine Rechte so feststellen können, dass er nicht von deren Durchsetzung abgehalten wird“. Unwirksam sind deshalb Klauseln wie „soweit gesetzlich zulässig“ oder „soweit es die Rechtssprechung erlaubt“.
Zweifel an der Auslegung einer Klausel, gehen zu Lasten des Verwenders.
22
(2) Unangemessen benachteiligende Klauseln sind Bestimmungen, die den Vertragspartner des Verwenders unangemessen benachteiligen (§§ 307 - 309), und mit denen der Verwender oft versucht, eine nach dem Gesetz ihn selbst treffende Verpflichtung dem Vertragspartner aufzubürden. In Mietverträgen finden Sie hauptsächlich bei den Instandhaltungspflichten des Mieters solche unwirksamen Klauseln.
Soweit eine vorformulierte Bestimmung oder Klausel gegen diese Vorschriften verstößt, ist immer nur die betreffende Klausel unwirksam, nicht der ganze Vertrag. Die meisten der unter Rn 21 + 22 genannten Beschränkungen gelten bei der Verwendung solcher vorformulierten Bestimmungen auch gegenüber einem Unternehmer (§ 310).
23
Nicht unter die unter Rn 21 + 22 genannten Beschränkungen fallen individuell vereinbarte Klauseln, also Bestimmungen, die zwischen den Vertragsparteien individuell ausgehandelt werden (§ 305 b). Die Anforderungen an das „Aushandeln“ sind heutzutage schwer zu erfüllen. Denn individuell ausgehandelt ist eine Bestimmung nicht schon dann, wenn der Verwender der Bestimmung den Vertragsgegner über den Inhalt und die Bedeutung der Klausel im Einzelnen belehrt hat, oder wenn die Mitteilung von Änderungswünschen abgeboten wird. Der Verwender der Klausel muss ernstlich bereit sein, die Klausel zur Disposition zu stellen und dem Partner, also z. B. dem Mieter die reelle Möglichkeit einzuräumen, seine eigenen Interessen zu wahren und die Ausgestaltung der Klausel zu beeinflussen. Es reicht also nicht aus, wenn im Vertragstext zu Streichungen, Änderungen oder Einfügungen aufgefordert oder etwa dass bestätigt wird, man habe ausgiebig und ernsthaft verhandelt.
Eine individuell getroffene Absprache geht einer rechtswirksamen anderslautenden vorformulierten Bestimmung immer vor.
III. Weitere rechtliche Begriffe
1. Anspruch und Forderung
24
Aus einem Rechtsverhältnis kann einer Person gegen eine andere eine Leistung zustehen. Man nennt das einen Anspruch (Rn 1 Ziffer 1). Wenn Geld verlangt werden kann, nennt man den Anspruch eine Forderung.
25
Die meisten Ansprüche können durch einen Vertrag vom Inhaber an eine andere Person abgetreten werden (§ 398). Durch diesen „Abtretungsvertrag“ geht der Anspruch bzw. die Forderung auf die andere Person über.
2. Erfüllung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
26
Ein Anspruch oder eine Forderung erlischt u. a. durch Erfüllung (§§ 362 ff.) oder Aufrechnung (§§ 387 ff). „Erfüllung“ bedeutet, dass die geschuldete gleichartige Leistung bewirkt wird, eine Geldforderung also bezahlt wird. „Aufrechnung“ bedeutet, dass eine Geldforderung durch eine Verrechnung ausgeglichen wird, also durch eine Erklärung einer Person gegenüber der anderen.
Wenn die gegenüberstehenden Ansprüche nicht gleichartig sind, ist eine Aufrechnung nicht möglich. Dann kann ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273) bestehen. Beispiele dazu finden Sie unter Rn 129, 162, 220 und 473.
Nicht zulässig ist eine Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht, wenn diese nach einer gesetzlichen Vorschrift (Rn 364) oder nach einer vertraglichen Vereinbarung ausgeschlossen sind. Zur Zulässigkeit einer Aufrechnung bei Mietverhältnissen siehe Rn 193 + 226.
3. Verjährung, deren Hemmung oder Neubeginn
27
Nur Ansprüche (§ 194) können verjähren. Das bedeutet, dass der Verpflichtete die Erfüllung eines Anspruchs des Berechtigten nach Ablauf der Verjährungsfrist ablehnen kann (§ 222). Die Frist beträgt je nach Art des Anspruchs zwischen 6 Monaten (z. B. § 548) und 30 Jahren (§§ 197 ff.). Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt heute 3 Jahre (§ 195).
Zur Verjährung der in den folgenden Kapiteln beschriebenen Ansprüche siehe im 5. Kapitel unter Rn 391 ff.
Die Verjährung kann gehemmt werden oder sogar neu beginnen:
28
Unter einer Hemmung der Verjährung (§ 209) versteht man, wenn ein bestimmter Zeitraum in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet wird, oder wenn die Verjährungsfrist erst später als vorgesehen abläuft, z. B.:
Solange der Gläubiger dem Schuldner die Forderung stundet (§ 205),
solange Gläubiger und Schuldner über einen Anspruch verhandeln (§ 203), wobei jeder Meinungsaustausch ausreicht, wenn nicht sofort und eindeutig jeder Ersatz abgelehnt wird,
solange zwischen Gläubiger und Schuldner ein Güteverfahren oder ein gerichtliches Mahn-, Klage- oder Beweissicherungsverfahren schwebt,
oder solange zwischen Gläubiger und Schuldner ein enges persönliches Rechtsverhältnis besteht, z. B. eine Ehe, ein Verhältnis zwischen Eltern – Kind, Vormund - Mündel, Betreuer - Betreuter, Pfleger – Pflegling .
29
Ein Neubeginn der Verjährungsfrist (§ 212) bedeutet, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Verjährungsfrist wieder ganz neu von Anfang an zu laufen beginnt, z. B. wenn der Schuldner seine Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger anerkennt, oder wenn eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird.
4. Die Verwirkung
30
Die Verwirkung bedeutet, dass der Inhaber eines Rechtes oder eines an und für sich noch nicht verjährten Anspruchs sein Recht bzw. seinen Anspruch nicht mehr geltend machen darf. Voraussetzung ist, dass einerseits der Inhaber sein Recht bzw. seinen Anspruch sehr lange Zeit nicht geltend macht undandererseits der Verpflichtete sich nach dem gesamten Verhalten des Berechtigten darauf einrichten durfte und sich auch darauf eingerichtet hat, dass der Berechtigte von ihm nichts mehr verlangen will.
5. Verschulden und Mitverschulden
31
Unter einem Verschulden versteht man ein rechtswidriges vorwerfbares Verhalten einer zurechnungsfähigen natürlichen Person. Es kann
vorsätzlich, d. h. „mit Wissen und Wollen“, oder
fahrlässig geschehen, d. h. „unter Außerachtlassung der zwischen Personen im Verkehr erforderlichen Sorgfalt“, wobei noch zwischen einfacher (leichter) und grober (schwerer) Fahrlässigkeit unterschieden wird.
Eine schuldhafte Handlung führt in der Regel zu einer Schadenersatzverpflichtung (§ 276, § 823). Hat bei der Entstehung des Schadens auch ein Verschulden des Geschädigten mitgewirkt, hängt die Verpflichtung des Schädigers oder der Umfang des zu ersetzenden Schadens vom Gewicht dieses Mitverschulden ab (§ 254). Bei gleichgewichtigem Verschulden von Schädiger und Geschädigtem wird der Schaden also geteilt.
6. Verzug
32
Erfüllt ein Schuldner eine fällige Verpflichtung, z. B. den Anspruch eines Gläubigers nicht rechtzeitigund geschieht das auch durch ein Verschulden, kommt er in folgenden Fällen in „Verzug“:
Verzug tritt ein tritt ein, wenn für die Leistung des Schuldners eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist (§ 286 Abs. 2), wenn z. B. die Miete am 3. Werktag des Monats fällig ist (
Rn 145
f.) oder die Mieträume am Tag nach Beendigung des Mietverhältnisses zu räumen sind (
Rn 363
f.);
Hat ein für die Leistung von Gütern oder für eine Dienstleistung zahlungspflichtiger Schuldner eine Rechnung erhalten (§ 286 Abs. 3), z. B. für eine Warenlieferung oder Handwerkerleistung, kommt er 30 Tage nach Zugang einer prüffähigen Rechnung in Verzug. Ist der Schuldner ein Verbraucher (
Rn 4
), also z. B. ein Wohnraummieter), tritt der Verzug aber nur ein, wenn er auf diese Folge in der Rechnung hingewiesen worden ist;
Außerdem kommt ein Verpflichteter in Verzug, wenn er auf eine außergerichtliche oder gerichtliche Mahnung oder Klage nicht leistet. (§ 286 Abs. 1). Dabei reicht aber
eine
außergerichtliche Mahnung aus.
Ein verschuldeter Verzug des Schuldners wird z. B. im Falle einer falschen Beratung durch einen Rechtsanwalt oder den Mieterschutzverein angenommen, oder wenn er kein Geld hat. Denn es gilt der Grundsatz „Geld hat man zu haben“. Kein Verschulden ist dagegen z. B. gegeben, wenn der Mieter z. B. nicht sicher weiß, an wen er zahlen muss.
Der in Verzug geratene Schuldner ist verpflichtet, einen dem Gläubiger durch den Verzug entstandenen Schaden zu ersetzten. Schuldet er eine Geldsumme, ist diese auch zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt, wenn der Schuldner Verbraucher (Rn 4) ist, mindestens 5 % über dem Basiszinssatz (§ 288). Dieser betrug am 01.09.2000 noch 4,26 %, am 01.01.2018 noch minus 0,88 %. Die jeweiligen Basiszinssätze finden Sie z. B. im Internet.
Ist der Schuldner nicht Verbraucher, beträgt der Zinssatz mindestens 9 % über dem Basiszinssatz. Entsteht dem Gläubiger ein höherer Zinsschaden, muss dieser bezahlt werden.
Außerdem kann der Gläubiger einer Geldforderung vom Nichtverbraucher im Falle eines Verzuges eine Pauschale von 40 € verlangen (§ 288).
7. Auftrag und Vollmacht
33
Eine Person kann einer anderen den Auftrag erteilen, für ihn ein Geschäft zu besorgen (§ 662 ff.). Der Auftrag betrifft also das Innenverhältnis.
34
Ebenso kann eine Person einer anderen eine Vollmacht erteilen. Der Bevollmächtigte kann dann im Namen des Vollmachtgebers einem Dritten gegenüber eine Erklärung abgeben, die für und gegen den Vollmachtgeber (§ 164) wirkt. Die Vollmacht betrifft also das Außenverhältnis.
Zur gegenseitigen Bevollmächtigung mehrerer Mieter siehe auch Rn 455.
8. Eigentum und Besitz
Eigentum und Besitz sind sogenannte "dingliche" Rechte, die einer Person an einer Sache zustehen (Rn 1 Ziffer 3).
35
Eigentum bedeutet, dass der Eigentümer mit einer Sache „nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen“ (§ 903).
36
Der Begriff Besitz wird in der Bevölkerung meist für das Eigentumsrecht benutzt. Jemand nennt sich "Besitzer" seines Hauses und meint "Eigentümer". Unsere Rechtsordnung versteht unter dem dinglichen Recht "Besitz" aber etwas anderes, nämlich die "tatsächliche Sachherrschaft einer Person über eine Sache" (§ 854). Der in seiner Wohnung lebende Mieter ist also „Besitzer“ der ihm nicht gehörenden Wohnung.
1. KAPITEL
Das Rechtsverhältnis „Miete“
A. Die verschiedenen Mietverhältnisse
I. Miete, Pacht, Leihe
37
Grundlage eines Mietverhältnisses ist ein Vertrag, in dem
eine natürliche oder juristische Person (Rn 3)
einer anderen natürlichen oder juristischen Person
eine bewegliche oder unbeweglichen Sache (Rn 6)
gegen ein Entgelt
zum Gebrauch überlässt (§ 535).
Bei der unbeweglichen Sache geht es hier um Räume verschiedener Art.
38
Wird die Sache unentgeltlich zum Gebrauch überlassen, handelt es sich nicht um Miete, sondern um Leihe (§ 598).
39
Werden nicht nur Sachen sondern Sachen und Rechte und diese nicht nur zum Gebrauch, sondern auch zur Ziehung von Früchten (§ 99) gegen ein Entgelt überlassen, spricht man von Pacht (§ 581). Bei den „Früchten“ handelt es sich um die zu gewinnenden Gelderträge., bei der Pacht eines landwirtschaftlichen Grundstücks außerdem auch um die Bodenfrüchte.
II. Die Art der vermieteten Räume
1. Die Geschäftsräume:
40
Zu diesen zählen Räume, die entweder zu geschäftlichen Zwecken (Büroräume, Praxisräume), oder zu gewerblichen Zwecken (Ladenräume, Werkstatträume, Lagerräume, Fabrikgebäude), oder zu sonstigen Zwecken (Vereinsräume, Veranstaltungsräume, Garagen) genutzt werden.
Bei der Vermietung von Geschäftsräumen kann die Miete frei vereinbart werden, siehe dazu Rn 140. Außerdem ist der Vermieter bei der Auswahl des Mieters frei.
Wenn Wohnräume Gegenstand eines Geschäftsraummietverhältnisses sind, siehe Rn 50 und 52.
2. Die Wohnräume:
Das sind alle Räume, die zum Wohnen, Schlafen, Essen und Kochen vorgesehen sind. Auch Nebenräume, z. B. Bad, Flur, Abstellräume, Kellerräume gehören dazu. Man unterscheidet im Mietrecht zwischen preisgebundenen und preisfreien Wohnräumen:
41
Preisgebundene Wohnräume sind solche, bei denen der Vermieter diese nur an bestimmte Mieter vermieten darf und auch die Höhe des vom Mieter zu zahlenden Entgelts vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, nämlich bei
(1) Sozialwohnungen: Sie sind seit 1948 mit bestimmten öffentlichen Mitteln geschaffen worden und dürfen nur an Personen mit geringem Einkommen vermietet werden.
(2) Bedienstetenwohnungen: Zu deren Bau gewährte der Staat ein Darlehen und erhielt dafür vom Vermieter ein Belegungsrecht eingeräumt.
Öffentlich geförderte Wohnungen: Das sind nicht zu den Sozialwohnungen gehörende Wohnungen, die auch öffentlich gefördert werden und nur an Personen vermietet werden dürfen, die höchstens 40 % mehr als die für Sozialwohnungen vorgesehenen Personen an Einkommen haben. Die Vermietung darf nur erfolgen, wenn dadurch eine Sozialwohnung frei wird.
(3) Öffentlich geförderte Wohnungen im Saarland sind nur preisgebunden, wenn die Preisbindung zwischen dem Vermieter und der fördernden Stelle vereinbart worden ist.
42
Preisfreie Räume sind alle nicht unter Rn 41 fallenden Wohnräume. Der Vermieter ist hier bei der Aussuche des Mieters fei. Auch bei der Vereinbarung der Miete ist er weitgehend frei (Rn 140 ff.).
III. Die Arten von Geschäfts- und Wohnraummietverhältnissen
Mietverhältnisse über Räume unterscheiden sich nach Dauer, Rechtstellung des Vermieters und nach Nutzungszweck:
1. Das Dauerschuldverhältnis
Weil die Leistungen der Vertragspartner beim Mietverhältnis auf eine gewisse Dauer ausgetauscht werden, nennt man das Mietverhältnis ein Dauerschuldverhältnis. Je nach Dauer gibt es Mietverhältnisse auf unbestimmte Zeit oder Mietverhältnisse auf bestimmte Zeit.
43
Beim Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit vereinbaren Vermieter und Mieter im Mietvertrag, dass das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit laufen soll, oder sie vereinbaren über die Mietdauer einfach nichts. Wohnraummietverhältnisse laufen heute meistens auf unbestimmte Zeit.
Wenn in einem auf unbestimmte Zeit laufenden Mietvertrag eine Partei oder beide für eine bestimmte Zeit auf ihr Kündigungsrecht verzichten, handelt es sich trotzdem um ein Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit. Dann endet das Mietverhältnis nach Ablauf der Zeit des Kündigungsverzichts nicht sondern läuft auf unbestimmte Zeit weiter. Zur Zulässigkeit eines Kündigungsverzichts durch eine Partei beim Geschäftsraummietverhältnis siehe Rn 287 f. und beim Wohnraummietverhältnis Rn 311d.
Zum automatischen Anschluss eines Mietverhältnisses auf unbestimmte Zeit an ein bereits beendetes Mietverhältnis siehe Rn 378 ff..
44
Das Mietverhältnis auf eine bestimmte Zeit wird „Zeitmietverhältnis“ oder „Zeitmietvertrag“ genannt. Hier vereinbaren die Mietparteien eine bestimmte Mietdauer, was bei Geschäftsraummietverhältnissen üblich und immer zulässig ist. Bei Wohnraummietverhältnissen der unter Rn 55 – 58 beschriebenen Arten ist die Vereinbarung eines Zeitmietvertrages ebenfalls immer zulässig, während bei den unter Rn 60 – 63 beschriebenen Wohnraummietverhältnissen das nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (§ 575), nämlich dann, wenn der Vermieter nach Ablauf der zu vereinbarenden Dauer
die Räume für sich, seine Familienangehörige oder Angehörige seines Haushalts nutzen will, oder
in zulässigerweise die Räume beseitigen oder wesentlich verändern oder instandsetzen will, und diese Maßnahmen bei einer Fortsetzung des Mietverhältnisses erheblich erschwert würden, oder
die Räume an einen Arbeitnehmer vermieten will.
Nur bei dem unter
Rn 57
beschriebenen Mietverhältnis darf ein Zeitmietvertrag auch dann geschlossen werden, wenn der Vermieter die Räume nach Ablauf der Mietzeit für ihm obliegende oder ihm übertragene öffentliche Aufgaben nutzen will.
Abgesehen davon, dass die Vereinbarung eines auf eine feste Mietzeit von mehr als 1 Jahr laufenden Mietverhältnisses der gesetzlichen Schriftform (Rn 12, 76 f.) bedarf, muss der Wohnraumvermieter den oben genannten Grund für die Befristung dem Mieter bei Abschluss des Mietvertrages schriftlich mitteilen. Geschieht die schriftliche Mitteilung nicht, läuft der Mietvertrag auf unbestimmte Zeit. Das gleiche gilt bei einer ohne einen der oben genannten Gründe vereinbarten Befristung. Am besten ist es deshalb, den Befristungsgrund in den schriftlichen Mietvertrag aufzunehmen.
Ist rechtswirksamer Zeitmietvertrag geschlossen, kann der Mieter frühestens 4 Monate vor dem Ablauf der festgelegten Mietzeit der Mieter beim Vermieter anfragen, ob der Befristungsgrund noch besteht. Tritt der Grund erst später als vorgesehen ein, kann der Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um einen entsprechenden Zeitraum verlangen. Fällt der Befristungsgrund ganz weg, kann der Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses auf unbestimmte Zeit verlangen.
Wenn Vermieter und Mieter nur erreichen wollen, dass ihr Mietverhältnis auf bestimmte Zeit nicht ordentlich gekündigt werden kann, können sie einen Kündigungsverzicht vereinbaren. Siehe dazu Rn 287 f. und 311d.
Während der in einem Zeitmietvertrag bestimmten Zeit können weder Vermieter noch Mieter ordentlich kündigen, lediglich eine außerordentliche Kündigung ist bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen möglich. Das wesentliche beim reinen Zeitmietvertrag ist, dass er nach Ablauf der bestimmten Zeit automatisch endet, ohne dass er gekündigt werden müsste.
Zu einer möglichen Fortsetzung eines auf eine bestimmte Mietdauer festgelegten Mietverhältnisses nach Ablauf der Mietzeit siehe Rn 378.
Beim Mietverhältnis auf bestimmte Zeit kann auch vereinbart sein, dass es nach Ablauf der bestimmten Zeit nicht automatisch endet, sondern auf eine weitere bestimmte oder unbestimmte Zeit weiterlaufen soll.
Für die Beendigung eines solcher Mietverhältnisse gilt während der festen Mietzeit das unter Rn 44 ausgeführte, für die daran anschließende unbestimmte Zeit das unter Rn 43 beschriebene.
45
Ein Mietverhältnis mit Verlängerungsoption wird manchmal in Geschäftsraummiet- oder Pachtverträgen vereinbart. Hier wird der Mieter berechtigt, eine Verlängerung des Mietverhältnisses über eine vereinbarte bestimmte Zeit hinaus zu verlangen. Dazu siehe Rn 309.
2. Hauptmietverhältnis und Untermietverhältnis
Bei Mietverhältnissen kann es ein Hauptmietverhältnis und ein Untermietverhältnis geben:
46
Das Mietverhältnis zwischen Vermieter und Mieter ist ein Hauptmietverhältnis, wenn der Vermieter das Recht zur Vermietung nicht von einer anderen Person ableitet, wenn er also z. B. Eigentümer der Mieträume ist.
47
Rechte und Pflichten aus dem Hauptmietvertrag bestehen immer nur zwischen dem Vermieter und dem Mieter. Zwischen dem Mieter (Untervermieter) und dem Untermieter bestehen nur Rechte und Pflichten aus dem Untermietvertrag. Keine vertraglichen Rechte und Pflichten bestehen dagegen zwischen dem Vermieter und dem Untermieter.
Beispiele: Der Untermieter schuldet die Miete nur dem Mieter, also seinem Vermieter; - der Vermieter kann nur seinem Mieter kündigen, nicht dagegen dem Untermieter.
48
Endet ein Hauptmietverhältnis, also das Mietverhältnis zwischen Vermieter und Mieter, hat das auf die Rechte und Pflichten zwischen Untervermieter und Untermieter keinen direkten Einfluss, ausgenommen bei der unter Rn 49 genannten gewerblichen Zwischenvermietung. Welche Rechte und Pflichten dann zwischen Vermieter und dem Untermieter seines Mieters entstehen, und wie sich ein Mieterschutz auswirkt, wenn dem Untermieter Wohnräume überlassen werden, finden Sie unter Rn 96 und 374 ff..
49
Einen Mieter, der die von ihm gemieteten Räume im Einverständnis des Vermieters im Ganzen weitervermietet, nennt man auch Zwischenvermieter. „Gewerblicher“ Zwischenvermieter ist der Mieter, der die Mieträume im eigenen Interesse oder in Gewinnabsicht weitervermietet. Dabei muss der Gewinn nicht in einem Vermögenswert bestehen, z. B. reicht allein die Möglichkeit aus, einem Arbeitnehmer Wohnräume vermieten zu können.
3. Geschäftsraummietverhältnis und Wohnraummietverhältnis
50
Ein Geschäftsraummietverhältnis ist gegeben, wenn einer natürlichen oder juristischen Person (Rn 3) Räume vermietet werden, die diese ausschließlich zu anderen Zwecken als zum Wohnen nutzten (Rn 40). Es ist also ein Geschäftsraummietverhältnis, wenn der Mieter, z. B. eine Gemeinde oder ein Unternehmer die gemieteten Räume einem Dritten, z. B. Flüchtlingen oder Arbeitnehmern zur Nutzung als Wohnräume weitervermietet . Siehe dazu auch oben Rn 49.
Sind die vermietete Räume und die mit diesen verbundenen Rechte geeignet, Gebrauchsvorteile und Früchte herzugeben, z. B. eine bestehende Gaststätte oder ein schon bestehender Gewerbebetrieb, ist ein Pachtverhältnis (Rn 39) gegeben. Im Rahmen eines solchen werden in der Regel bewegliche Sachen als sogenanntes „Inventar“ mitverpachtet.
51
Bei einem Wohnraummietverhältnis überlässt der Vermieter einer oder mehreren natürlichen Personen als Mieter Räume für die Führung eines eigenen privaten Haushalts, also zum Wohnen, Schlafen, Essen, Kochen. Auch Nebenräume, z. B. Bad, Flur, Abstellräume, Kellerräume gehören dazu. Näheres zu den Räumen und zu den verschiedenen Arten von Wohnraummietverhältnissen siehe Rn 55 ff..
52
Ist die Nutzungsart gleichwertig, kommt es auf den sich aus dem Vertrag ergebenden Willen der Parteien an, z. B. auf die Regelungen über Kündigung, Kaution, Kleinreparaturen, Umsatzsteuer, auf die Flächenverteilung zwischen Wohn- und Geschäftsräumen. Kann kein Übergewicht zur geschäftlichen Nutzung festgestellt werden, gilt das Mietverhältnis als Wohnraummietverhältnis.
Klarheit besteht, wenn über die verschiedenen Räume getrennte Verträge abgeschlossen werden, z. B. ein Mietvertrag über die Wohnung und ein getrennter Mietvertrag über die Garage.
Die rechtliche Eigenschaft des Mietvertrages ist wichtig für die Frage, welche Vorschriften für das Mietverhältnis anzuwenden ist, z. B. über die Kündigung. Siehe dazu Rn 283 ff., oder bei der Frage des Übergangs des Mietverhältnisses im Todesfall Rn 99 ff..
53
Ein besonderes Mietverhältnis gibt es beim „Betreuten Wohnen“ und beim „Wohnen in Heimen“. Hier überlässt ein Unternehmer einem Verbraucher Wohnräume und verpflichtet sich, Pflege- und Betreuungsleistungen zu erbringen oder erbringen zu lassen. Die Regelung der gegenseitigen Verpflichtungen kann in einem oder verschiedenen voneinander abhängigen Verträgen erfolgen, die schriftlich (Rn 12 und § 6 WBVG) abgeschlossen werden und in der Regel auf unbestimmte Zeit (§ 4 WBVG) laufen müssen. Darunter fallen inzwischen auch Heimverträge (§ 17 WBVG). Für die Kündigung aller solcher Verträge gelten die §§ 11 und 12 WBVG.
4. Die für Raummietverhältnisse geltenden Vorschriften
Für Mietverhältnisse über alle Räume gelten zunächst die §§ 535 bis 548, also sowohl für Geschäftsräume als auch Wohnräume. Für letztere gelten auch die weiteren Vorschriften der §§ 549 bis 577a, in denen je nachdem um welche Art von Wohnräumen (Rn 55 ff.) es sich handelt auch besondere Schutzvorschriften enthalten sind, insbesondere zum Schutz vor Kündigungen. Ein Teil der zuletzt genannten §§ gelten auch für Geschäftsraummietverhältnisse (§ 578 Abs. 2).
Die §§ 549 bis 577a enthalten Bestimmungen
54
(1) über die Form eines des Mietvertrages (Rn 75 ff.), Wechsel der Vertragsparteien (Rn 91 ff.), Zurückbehaltungsrecht (Rn 129, 162), Fälligkeit der Miete (Rn 145 f), Betriebskosten (Rn 149 ff.), Kaution (Rn 161 ff.), Vertragsstrafeversprechen (Rn 166), Duldung von Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen (Rn 183 ff.), Pfandrecht (Rn 192), Aufrechnungsrecht (Rn 193, 226), Barrierefreiheit (Rn 204), Untervermietung (Rn 207 ff.) Wegnahmerecht des Mieters (Rn 366) und das Abwendungsrecht des Vermieters (Rn 367).
(2) über die Form einer Kündigung (Rn 280).
(3) über die fristlose Kündigung (Rn 318 ff., 348 ff.).
(4) über Schadenersatz bei verspäteter Rückgabe (Rn 387).
(5) über den Kündigungsschutz (Rn 323f.).
(6) über die Miethöhe bei Vertragsabschluss (Rn 140 ff.).
(7) über die Mieterhöhung während der Mietzeit (Rn 229 f.)
(8) über die Änderung der Betriebskosten während der Mietzeit (Rn 255).
(9) über den Zeitmietvertrag (Rn 44).
(10)über das Widerspruchsrecht des Mieters gegen eine ordentliche Kündigung (Rn 355 ff.) und zur Hinweispflicht es Vermieters auf dieses in seiner Kündigung (Rn 281).
(11)über die Bildung von Wohnungseigentum (Rn 332, 335).
Die vorgenannten Vorschriften für Wohnraummietverhältnisse gelten in ganz Deutschland. Die Vorschriften Nr. (5) bis (7) können von einer Landesregierung für ein Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt eingeschränkt werden (Rn 142, 245, 334). Welche dieser Regelungen für die einzelnen Arten von Wohnraummietverhältnissen gelten, finden Sie nachstehend unter Rn 55 ff.
IV. Die einzelnen Mietverhältnisse je nach Art der Wohnräume
1 Mietverhältnisse über Wohnräume, die nur zum „vorübergehenden Gebrauch“ vermietetet werden
55
Hier werden Wohnräume bei Vertragsabschluss auf eine kürzere absehbare Zeit vermietet, z. B. an Feriengästen, Saisonarbeiter, Hotelgäste. Die Dauer soll nur ausnahmsweise über 1 Jahr dauern.
Für diese Mietverhältnisse sind nur die unter Rn 54 Ziffern (1) bis (4) genannten Bestimmungen anzuwenden. Nicht anzuwenden sind also die unter (5) bis (11) genannten Bestimmungen. Es besteht also z. B. kein Kündigungsschutz. Zum Genehmigungsvorbehalt der Gemeinde oder einem Verbot bei der Vermietung von Ferienwohnungen siehe Rn 66.
2. Mietverhältnisse über innerhalb der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung befindliche Wohnräume
56
Das sind Wohnräume, die Teil einer vom Vermieter bewohnten Wohnung, also keine abgeschlossene Wohnung sind und vom Vermieter ganz oder überwiegend möbliert sind und nur einer alleinstehenden Person zum alleinigen Bewohnen überlassen werden (§ 549 Abs. 2 Nr. 2).
Beispiel: Der Vermieter überlässt einem alleinstehenden Mieter ein oder zwei von ihm überwiegend möblierte Zimmer seiner Wohnung.
Für Mietverhältnisse über diese Wohnräume sind nur die unter Rn 54 Ziffern (1) bis (4) genannten Bestimmungen anzuwenden. Nicht anzuwenden sind also die Vorschriften über Mieterhöhung, Mietpreisbremse oder Kündigungsschutz.
3. Mietverhältnisse zur Weitervermietung von Wohnräumen an Personen mit dringendem Wohnbedarf:
57
Das sind Wohnräume, die Sozialträger oder nach dem am 1.1.2019 in Kraft getretenen MietAnpG auch private Personen als Zwischenvermieter (Rn 49) an Personen mit dringendem Wohnbedarf vermieten.
Für Mietverhältnisse über diese Wohnräume sind die unter Rn 54 Ziffern (1) bis (5), (7), (9) und (11) genannten Bestimmungen anzuwenden. Nicht anzuwenden sind die Vorschriften über Mieterhöhung und Mietpreisbremse. Es besteht dagegen Kündigungsschutz.
4. Mietverhältnisse über Wohnräume in Studenten- oder Jugendwohnheimen (§ 549 Abs. 3):
58
Darunter fallen an Studenten oder Jugendlichen vermietete Wohnräume, die vom Vermieter nach einem an den Belangen der Studenten orientierten Konzept und in der Regel auch befristet vermietet werden. Andere an Studenten vermietete Räume, also z. B. die zu den unter Rn 56 beschriebenen Wohnräumen gehörende Einzelzimmer, fallen nicht unter Rn 58.
Für Mietverhältnisse über diese Wohnräume sind nur die unter Rn 54 Ziffern (1) bis (4) und (10) genannten Bestimmungen anzuwenden. Nicht anzuwenden sind die unter (6) bis () und (11) genannten Bestimmungen. Der Vermieter benötigt für eine Kündigung also kein „berechtigtes Interesse“(Rn 327), der Student hat aber ein Widerspruchsrecht wegen unzumutbarer Härte (Rn 355 ff.).
5. Mietverhältnisse über Wohnungen mit vollem Kündigungsschutz
59
Für alle nicht unter Rn 55 – 58 fallenden Wohnraummietverhältnisse, also die meisten Mietwohnungen und Mieträume, die ein Vermieter einem von ihm ausgesuchten Mieter vermietet, gelten alle der unter Rn 54 genannten Schutzbestimmungen, insbesondere auch für den Kündigungsschutz.