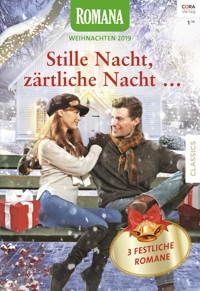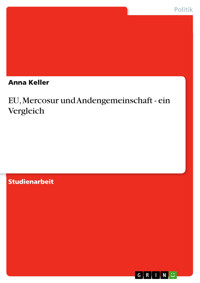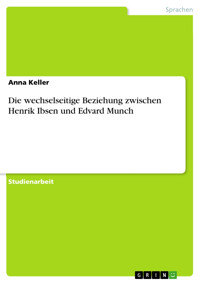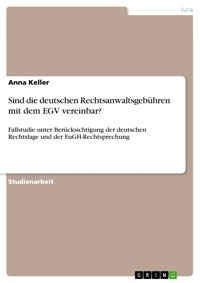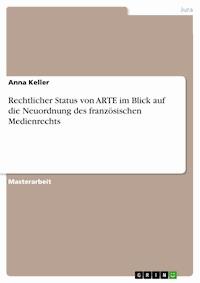
Rechtlicher Status von ARTE im Blick auf die Neuordnung des französischen Medienrechts E-Book
Anna Keller
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Jura - Medienrecht, Multimediarecht, Urheberrecht, Note: 1,5, Freie Universität Berlin (Europäisches Zentrum für Staatswissenschaften und Staatspraxis, Berlin), Sprache: Deutsch, Abstract: Der deutsch-französische Fernsehkulturkanal ARTE ging im Mai 1992 als erster und bisher einziger binationaler Sender Europas auf Sendung. Bei seiner rechtlichen Gestaltung wurden unter dem Dach einer gemeinsamen europäischen Trägergesellschaft das französische zentralistische und das deutsche föderale Rundfunksystem miteinander verbunden. Ziel dieser Masterarbeit ist es, die komplizierte Rechtsgestalt von ARTE mit Blick auf die Neuordnung des französischen Medienrechts im Jahr 2000 aufzuzeigen. Im Zuge dieser Reform sollte der französische Teil von ARTE nach dem Willen der französischen Regierung in eine Holding eingegliedert und dem französischen Staat unterstellt werden, was aufgrund des Widerstands der deutschen Seite und der Straßburger ARTE-Zentrale letztlich nicht gelang. Die Arbeit zeigt, dass dies der vertraglich garantierten Unabhängigkeit des Senders widersprochen hätte. Im ersten Teil der Arbeit werden die Unterschiede zwischen dem französischen und dem deutschen Rundfunksystem untersucht, soweit sie sich in der rechtlichen Gestalt des Senders niedergeschlagen haben. Im zweiten Teil geht es um die Entstehungsgeschichte des Senders. Im dritten Teil wird die komplizierte Rechtsgestalt von ARTE aufgezeigt. Der Europäische Kulturkanal fußt auf einem völkerrechtlichen Rahmenvertrag, der einen Tag vor der offiziellen deutschen Wiedervereinigung, am 2.10.1990, zwischen den elf „alten“ deutschen Bundesländern und Frankreich geschlossen wurde. Der Abschluss dieses völkerrechtlichen Rahmenvertrags war ungewöhnlich. Damit wurde die spätere Gründung von ARTE in groben Zügen von politischer Seite abgesichert. Weil schon früh politischer Konsens über Straßburg als dem Sitz des Senders herrschte, war dies notwendig, da ansonsten ausschließlich französisches Recht für den Sender gegolten hätte, das in personeller, finanzieller und inhaltlich-redaktioneller Hinsicht einen erheblich weiteren Einfluss des Staates auf den Rundfunk zulässt als das deutsche Rundfunkrecht. Die Bestrebungen des französischen Gesetzgebers, den französischen Teil von ARTE anlässlich der Neuordnung des französischen Medienrechts im Jahr 2000 in die Staatsholding "France Télévision" einzugliedern, werden analysiert. Die Arbeit endet mit einer Bewertung dieses turbulenten, bisher erfolglosen Versuchs. Im Anhang der Arbeit finden sich die Verträge, auf denen der Fernsehsender ARTE fußt, sowie ein Organigramm zu seiner komplexen Rechtsgestalt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Anna Keller
Rechtlicher Status von ARTE im Blick auf die Neuordnung des
Vorgelegtam:
-Institut für Völkerrecht, Europarecht und ausländisches öffentliches Recht, Freie Universität Berlin
-Droit public, Centre Marc Bloch de Berlin/ Université Panthéon Sorbonne
Bewertung der Arbeit:1,5 (sehr gut)
Page 4
Anhangsverzeichnis
Anhang I: Völkerrechtlicher Rahmenvertrag vom 2.10.1990 zwischen den deutschen
Anhang II: Gesellschaftsvertrag der ARTE Deutschland TV GmbH vom 13.3.1991 (Stand: 20.6.2001)
Anhang III: Statut von ARTE France S.A. vom Januar 2001
Anhang IV: Gründungsvertrag der ARTE GEIE vom 30.4.1991 (Stand: 17.10.2001)
Organigramm von ARTE
Page 1
A. Hintergrund
Der geschickt gewählte Name ARTE - „arte“ bedeutet auf Spanisch „Kunst“- ist selbst ein Kunstprodukt. Denn ARTE steht für „Association Relative à la Télévision Européenne“, eine Bezeichnung, die man im ARTE-Gründungsvertrag vom 30.4.1991 festlegte, damit dabei die Abkürzung ARTE herauskam.1Ende Mai diesen Jahres hat der Europäische Fernsehkulturkanal ARTE sein 10jähriges Sendejubiläum gefeiert. Die Gründung von ARTE war ein medienpolitisches und medienrechtliches Novum: ARTE ist der erste und bisher einzige europäische binationale Sender. Bei seiner Gründung wurden das französische zentralistische und das deutsche föderale Rundfunksystem verbunden. Später hat ARTE auch Assoziierungsverträge und Kooperationsvereinbarungen mit Rundfunksendern aus Belgien, der Schweiz, Spanien, Finnland, Polen, den Niederlanden und Österreich geschlossen. Als nunmehr europäischer Fernsehkulturkanal ist ARTE daher auch ein europäisches Kooperationsmodell. Es fragt sich deshalb, ob der für ARTE gefundene Rechtsrahmen modellhaft für andere Projekte auf europäischer Ebene sein könnte.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die komplizierte Rechtsgestalt von ARTE mit Blick auf die Neuordnung des französischen Medienrechts aufzuzeigen. Im Zuge dieser Neuordnung sollte der französische Teil von ARTE im letzten Jahr in eine Holding eingegliedert und dem französischen Staat unterstellt werden. Aufgrund des Widerstands der deutschen Seite und der Straßburger ARTE-Zentrale gelang dies letztlich nicht: Die Änderungen des Gesetzes von 1986 über die Kommunikationsfreiheit durch das Gesetz vom 1.8.2000 (nachfolgend Rundfunkgesetz von 2000) haben den rechtlichen Status von ARTE nicht berührt. Schon anhand der Verhandlungen um die Rechtsgestalt von ARTE läßt sich jedoch aufzeigen, wie es zu diesem Versuch der französischen Seite kommen konnte. In dieser Arbeit soll geklärt werden, ob dieser Eingliederungsversuch rechtlich möglich war oder ob er den rechtlichen Grundlagen des Senders widersprach. Außerdem soll untersucht werden, ob es eine Wiederholungsgefahr für einen erneuten Versuch drastischer Einflußnahme durch den französischen Staat auf ARTE gibt.
Soweit zum Verständnis der rechtlichen Organisation und der Schwierigkeiten im Entstehungsprozeß von ARTE erforderlich, wird im ersten Teil der Arbeit auf die generellen
1Vgl. Art. 3 des ARTE-Gründungsvertrags im Anhang IV und Schwarzkopf, Arte - Der deutsch-französische Kulturkanal und seine Perspektive als europäisches Programm, Media Perspektiven 5/1992, S. 290 (298).
Page 2
Unterschiede zwischen dem französischen und dem deutschen Rundfunksystem eingegangen. Im zweiten Teil geht es um die Entstehungsgeschichte des Senders einschließlich der in beiden Ländern für die Gründung maßgeblichen Motive. Im dritten Teil wird die Rechtsgestalt von ARTE aufgezeigt, um im Anschluß auf die neuere Entwicklung und die Turbulenzen um die rechtliche Organisation von ARTE einzugehen. Die Arbeit endet mit einem abschließenden Ausblick und einer Bewertung der jüngsten Ereignisse.
I. Das deutsche und das französische Rundfunksystem
Der öffentliche Rundfunk in Deutschland und Frankreich fußt auf sehr unterschiedlichen Traditionen.
1. Verfassungsrechtliche Unterschiede
In Deutschland besteht nach Art. 5 I S.2 Grundgesetz (GG) Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk (Rundfunkfreiheit). Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hat die Rundfunkfreiheit der freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung zu dienen.2Aufgrund der Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus hat das BVerfG deshalb aus dem objektiv- und dem subjektiv-rechtlichen Gehalt der Rundfunkfreiheit das auch in der Literatur einhellig anerkannteGebot der Staatsfreiheit des Rundfunksentwickelt, wonach der Rundfunk weder unmittelbar noch mittelbar unter staatlichem Einfluß stehen darf, sondern unabhängig vom Staat organisiert sein soll.3
Im föderalen Deutschland sind die Gesetzgebungskompetenzen bezüglich des Rundfunks zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Nach Art. 73 Nr. 7 GG hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für „das Postwesen und die Telekommunikation“, wozu nach dem ersten Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 19614der sendetechnische Bereich des Rundfunks gehört.5Nach Art. 30, 70 I GG gehört der Rundfunk jedoch ansonsten zur Kompetenz der Länder.6Die Organisation des Rundfunks erfolgt seit der Besatzungszeit nach Ländergrenzen.7Eine Ausnahme wird nur für den Auslandsrundfunk
2BVerfGE 57, S. 295 (320); 73, S. 118 (152); 83, S. 238 (295); 90, S. 60 (87).
3Vgl. etwa BVerfGE 73, S. 118 (182f) sowie BVerfGE 83, S. 238 (323f).
4Mit dem ersten Rundfunkurteil erklärte das BVerfG am 28.2.1961 auf Klage einiger Landesregierungen hin die von Bundeskanzler Adenauer gegründete „Deutschland-Fernseh-GmbH“ für verfassungswidrig, da die Länder
und nicht der Bund für die Regelung von Organisations- und Programmfragen des Rundfunks zuständig seien.4
5Vgl. das erste Rundfunkurteil, BVerfGE 12, S. 205 und S. 237f.
6Vgl. das erste Rundfunkurteil, BVerfGE 12, S. 205 (248f).
7Zu den unterschiedlichen Rundfunkanstalten in den einzelnen Zonen siehe Ricker/ Schiwy, Rundfunkverfassungsrecht, S. 22 ff.
Page 3
der Deutschen Welle anerkannt, für die mit Rücksicht auf die Zuständigkeit für auswärtige Angelegenheiten der Bund regelungsbefugt ist.8
Da in Deutschland nach der Rechtsprechung des BVerfG die für die Gewährleistung der RundfunkfreiheitwesentlichenFragen vom parlamentarischen Gesetzgeber bestimmt werden müssen,9sind Rechtsgrundlage für den Rundfunk die Landesrundfunkgesetze bzw. bei landesübergreifenden Rundfunkanstalten Staatsverträge zwischen den betroffenen Ländern.10Die Abschlußkompetenz der Länder für solche Staatsverträge wurde vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in einem Erst-Recht-Schluß aus Art. 32 III hergeleitet. Danach sind die Länder ermächtigt, völkerrechtliche Verträge mit dem Ausland abzuschließen, weshalb sie erst recht untereinander einen Staatsvertrag schließen dürfen, dessen Geltungsbereich sich nur auf ihr Gebiet erstreckt.11Gemeinsame Regelungen für alle öffentlichen Rundfunkanstalten finden sich außerdem imRundfunk-, Rundfunkgebühren-undRundfunkfinanzierungsstaatsvertrag.Fragen der internen Organisation und Arbeitsweise regeln die Rundfunkanstalten aufgrund der Rundfunkfreiheit selbst durch den Erlaß von Satzungen.12Daneben darf die Exekutive in Deutschland im Vergleich zu Frankreich im Bereich des Rundfunks nur in einem geringen Umfang Recht setzen.13
Die französische Verfassung von 1958 enthält anders als die deutsche weder eine ausdrückliche Bestimmung zur Rundfunkfreiheit noch zur Meinungsfreiheit. Vielmehr wird die Rundfunkfreiheit, die als Unterfall der Meinungsfreiheit angesehen wird, nach der Rechtsprechung des Conseil Constitutionnel aus Art. 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 abgeleitet, deren Anwendbarkeit aus ihrer Erwähnung in der Präambel der französischen Verfassung folgt.14Außerdem bestimmt Art. 1 I der Loi no2000-719 du 1eraoût (französisches Rundfunkgesetz von 2000)15: „La communication audiovisuelle est libre.“ Das französische Verständnis der Rundfunkfreiheit divergiert jedoch erheblich von dem deutschen. In Frankreich besteht aufgrund einer langen Tradition noch immer eine große
8Vgl. Ricker/ Schiwy, S. 150 und S. 224 sowie Herrmann, Rundfunkrecht, § 6 Rn. 24 mwN.
9Zur Wesentlichkeitsrechtsprechung grundlegend BVerfGE 57, S. 295 (321).
10Vgl. Holznagel, Rundfunkrecht in Europa, S. 196f.
11Vgl. BVerwGE 22, S. 299 (307) anläßlich der Klage des Bayrischen Rundfunks gegen den 30%-Anteil des ZDF an der Fernsehgebühr.
12Vgl. statt aller Holznagel, Rundfunkrecht in Europa, S. 196.
13Zu diesem Ergebnis gelangt aufgrund Rechtsvergleichung auch Holznagel, Rundfunkrecht in Europa, S. 195.
14Vgl. Entscheidung des Conseil Constitutionnel vom 30.1.1968, Journal Officiel vom 1.2.1968, S. 1196; sowie Turpin, ZUM 1988, S. 101 und S. 118 sowie Holznagel, Rundfunkrecht in Europa, S. 105 mwN.
15Loi n°2000-719 du 1eraoût 2000 modifiant la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Page 4
Nähe zwischen dem Staat und dem öffentlichen Rundfunk.16Der öffentliche Rundfunk ist in Frankreich als „servicepublic“organisiert,17auf den die französische Regierung trotz ihres schrittweisen Rückzugs noch immer bedeutende Einflußmöglichkeiten hat.18Bis zum ersten Rundfunkgesetz von 198219bestand in Frankreich ein staatliches Rundfunkmonopol.20Es war die sozialistische Regierung unter Präsident François Mitterand, die den Fernsehsektor zu Beginn der achtziger Jahre schrittweise dereguliert und für die Beteiligung von privaten Veranstaltern geöffnet hat.21In Frankreich besteht wie auch in Deutschland seit dem Jahr 1984 einduales Rundfunksystemvon privaten und öffentlichen Anbietern.22Die französische Verfassung schreibt ebenfalls vor, daß grundlegende Fragen des Rundfunkrechts durch den Gesetzgeber per Parlamentsgesetz geregelt werden müssen.23Das Parlament ist diesem Ausgestaltungsauftrag zuletzt nachgekommen durch die Verabschiedung des Rundfunkgesetzes von 2000. Neben der Legislative hat in Frankreich allerdings auch die Regierung wichtige Befugnisse im Bereich des öffentlichen Rundfunks. Sie trifft allgemeine Entscheidungen für den gesamten Bereich der audiovisuellen Kommunikation, indem sie Verordnungen (décrets) erläßt.24Als Dekret ergehen seit dem Rundfunkgesetz von 198225an die öffentlichen Rundfunksender unter anderem die sog. Pflichtenhefte (cahiersdes charges),in denen Pflichten und Aufgaben insbesondere bezüglich der Programmgestaltung festgelegt sind.26
2. Institutionelle Unterschiede
In Deutschland wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgrund desGebots der Staatsfreiheit des Rundfunks27durch rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts mit Recht
16Vgl. Hoffmann-Riem, Regulating Media, S. 160; sowie Meise, Zur Situation des französischen Fernsehens, Media Perspektiven 1992, S. 236ff.
17Vgl. Art. 43.11 des französischen Rundfunkgesetzes von 2000 und siehe Hoffmann-Riem, Regulating Media, S. 164.
18Hoffmann-Riem, Regulating Media, S. 163.
19Loi no82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
20Artikel 1 des Rundfunkgesetzes von 1982 erklärte die audiovisuelle Kommunikation erstmals für frei. Siehe dazu Holznagel, Rundfunkrecht in Europa, S. 38ff.
21Zu den einzelnen Deregulierungsphasen in Frankreich seit 1981 siehe Meise, Zur Situation des französischen Fernsehens. Das duale System im Spannungsfeld zwischen Staat und Markt, Media Perspektiven 1992, S. 236ff; zu der Zeit davor siehe Hoffmann-Riem, Regulating Media, S. 160.
22Vgl. Holznagel, Rundfunkrecht in Europa, S. 29.
23Das folgt aus Artikel 34 der französischen Verfassung i.V.m. der Rechtsprechung des Conseil Constitutionnel, vgl. Holznagel, Rundfunkrecht in Europa, S. 107 und S. 196 mit näheren Angaben.
24Vgl. Dérieux, Droit de la communication, S. 167.
25Die cahiers des charges wurden durch Art. 32 des Rundfunkgesetzes von 1982 eingeführt.
26Ermächtigungsgrundlage dafür ist zur Zeit Art. 48 I des Rundfunkgesetzes von 2000.
27Siehe dazu oben Seite 2 (Verfassungsrechtliche Unterschiede).
Page 5
zurSelbstverwaltungveranstaltet.28Lediglich die ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands) besteht in der „rechtlich sehr lockeren“ Form einer Arbeitsgemeinschaft.29Die in ihr zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten wurden jedoch ihrerseits durch die Landesrundfunkgesetze bzw. im Fall der landesübergreifenden Rundfunkanstalten - wie im übrigen auch das ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen)30- durch Staatsvertrag zwischen den betroffenen Ländern errichtet.31Nach der Rechtsprechung des BVerfG muß der Gesetzgeber im Bereich des Rundfunks durch eine positive Ordnung sicherstellen, daß „alle in Betracht kommenden gesellschaftlich relevanten Kräfte und Gruppen im Gesamtprogramm zu Wort kommen können“, um ein Mindestmaß an inhaltlicher Ausgewogenheit zu gewährleisten.32Zur Verwirklichung haben sich die Länder bzw. der Bund im Fall der Deutschen Welle für einbinnenpluralistisches Ordnungsmodellim Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entschieden. Die Rundfunkgesetze bzw. Staatsverträge der Länder sehen für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten drei Organe vor:33
(1) denIntendanten,der den Sender nach innen leitet und nach außen gegenüber Dritten vertritt, wobei er an die Entscheidungen des Rundfunks- und des Verwaltungsrats gebunden ist,
(2) denRundfunkrat(bzw. beim ZDF denFernsehrat),der als pluralistisch besetztes und weisungsfreies Gremium nach den Landesrundfunkgesetzen unter anderem die Programmrichtlinien aufstellt und nach der Rechtsprechung des BVerfG die Aufgabe hat, „treuhänderisch“ bzw. als „Sachwalter“ der Interessen der Allgemeinheit dafür zu sorgen, daß die bestehende Meinungsvielfalt möglichst breit und vollständig durch den Rundfunk wiedergegeben wird34sowie
(3) denVerwaltungsrat,dessen vom Rundfunkrat gewählte Mitglieder die Geschäftstätigkeit des Intendanten überwachen und in diesem Bereich auch über Entscheidungs- und Zustimmungsbefugnisse verfügen.
28Vgl. statt aller Holznagel, Rundfunkrecht in Europa, S. 201, der auf S. 123 und 175 darauf hinweist, dass das Deutschlandradio am 17.6.93 per Staatsvertrag alsKörperschaftdes öffentlichen Rechts gegründet wurde, was jedoch im Hinblick auf Staatsferne und Selbstverwaltung keinen Unterschied macht.
29So Ricker/ Schiwy, Rundfunkverfassungsrecht, S. 28.
30Das ZDF wurde am 6.6.1961 von den Regierungschefs der Länder per Staatsvertrag errichtet, was nach BverwGE 22, S. 299 (307) im Erst-Recht-Schluß aus Art. 32 III GG möglich war (siehe schon oben Seite 3).
31Vgl. Holznagel, Rundfunkrecht in Europa, S. 196 sowie Ricker/ Schiwy, Rundfunkverfassungsrecht, S. 38.
32Vgl. BVerfGE 57, S. 295 (320 u. 325f); 73, S. 118 (152f); 83, S. 238 (332ff).
33Vgl. zum Folgenden Ricker/ Schiwy, S. 275ff.
34Vgl. BVerfGE 60, S. 53 (65f); 83, S. 238 (332ff).
Page 6
Im zentralistischen Frankreich ist der Rundfunk auf nationaler Ebene organisiert und vor allem in Paris konzentriert. Die öffentlichen Rundfunkveranstalter sind in Frankreich als privatrechtliche Aktiengesellschaften (societés anonymes, S.A.) mit dem Staat als Alleinaktionär organisiert,35weshalb sie auch „sociétésnationales de programmes“genannt werden.36Seit Beginn der achtziger Jahre hat die französische Regierung ihre Regelungskompetenzen bezüglich des Rundfunks in beschränktem, wenn auch zunehmendem Maße auf neu geschaffene Aufsichts- und Genehmigungsbehörden übertragen.37Im Jahr 1982 führte sie zunächst die „HauteAutorité de la communication audiovisuelle“(HACA) als eine regierungsunabhängige Aufsichtsinstanz ein, die eine Position zwischen dem Staat und den Rundfunksendern einnahm.38Mit dem Mediengesetz von 1986 wurde die Haute Autorité dann durch die Commission Nationale de la Communication et des Libertés (CNCL) als Rundfunkaufsichtsbehörde ersetzt, der im Vergleich zur Haute Autorité mehr Aufgaben übertragen wurden.39Nachfolgeorganisation der CNCL wiederum ist seit 1989 der„Conseil Supérieur de l`Audiovisuel“(CSA). Er besteht aus neun hauptberuflichen Mitgliedern, die durch Dekret vom französischen Präsidenten ernannt werden. Drei der Mitglieder, darunter den Präsidenten des CSA, bestimmt der französische Präsident selbst, drei weitere bestimmt der Präsident des Senats und drei der Präsident der Nationalversammlung.40Aufgabe des CSA ist es nach Art. 1 des Rundfunkgesetzes von 2000 unter anderem, die Ausübung der Rundfunkfreiheit, die Qualität und Vielseitigkeit der Programme sowie die Unabhängigkeit und die Unparteilichkeit des öffentlichen Rundfunks zu gewährleisten. Nach Art. 13 I hat der CSA auch den Pluralismus innerhalb der Programme sicherzustellen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der CSA sowohl gegenüber dem öffentlichen als auch gegenüber dem privaten Rundfunk diverse Kompetenzen, Kontroll- und auch Sanktionsrechte.41Die der (Rechts-undFach-) Aufsicht des CSA42unterstehenden nationalen Programmgesellschaften haben in Frankreich folgende Organe:
(1) einen dem deutschen Intendanten43vergleichbarenPräsidenten,der den Sender nach innen leitet und nach außen gegenüber Dritten vertritt und
35Vgl. Art. 47 des französischen Rundfunkgesetzes von 2000.
36Vgl. z.B. Art. 44 III des französischen Rundfunkgesetzes von 2000.
37Vgl. Hoffmann-Riem, Regulating Media, S. 163ff.
38Vgl. Dérieux, Droit de la communication, S. 173.
39Siehe zu den Details Hoffmann-Riem, Regulation Media, S. 164 und S. 170ff.
40Vgl. Art. 4 des französischen Rundfunkgesetzes von 2000.
41Vgl. Art. 4 bis 20.3 des Rundfunkgesetzes von 2000 und Hoffmann-Riem, Regulating Media, S. 179.
42Vgl. Art. 4 bis 20.3 des französischen Rundfunkgesetzes von 2000.
Page 7
(2) einen eigenen Verwaltungsrat (conseild`administration).Diesem einem Aufsichtsrat nachempfundenem acht- bis zwölfköpfigen Gremium gehören neben dem Präsidenten des Senders von der Assemblée Nationale und vom Sénat bestimmte Parlamentarier, vom Staat per Dekret ernannte Vertreter, vom CSA benannte Personen und vom Personal gewählte Vertreter an.44
3. Französischer Staatseinfluß versus deutscher Parteieneinfluß
Der staatliche Einfluß auf den öffentlichen Rundfunk ist in Frankreich wesentlich stärker als in Deutschland., wie sich schon aus der Stellung des Staats als Alleinaktionär der staatlichen Programmgesellschaften ergibt.45In Deutschland ist dem Staat aufgrund des Grundsatzes der Staatsferne hingegen jede Beherrschung oder Einflußnahme des Rundfunks verboten; die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verwalten sich selbst und sind auch wirtschaftlich unabhängig vom Staat organisiert. Die deutschen Landesregierungen verfügen daher neben den Rundfunkräten allenfalls über einebegrenzte Rechtsaufsichtüber die öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten,46während in Frankreich der CSA eine Fach-undRechtsaufsicht über die nationalen Programmgesellschaften ausübt.47Außerdem legen in Frankreich die vom Premierminister per Dekret festgelegten „cahiersdes charges“einzelne Programmpflichten der nationalen Programmgesellschaften fest,48während das Gebot der Staatsferne dem Staat in Deutschland auch jede unmittelbare oder mittelbare Einwirkung auf die Programmgestaltung untersagt(Programmautonomieder Rundfunkanstalten).49Schließlich verfügt der Staat in Frankreich im Wege von Personalentscheidungen über einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die öffentlichen Rundfunksender: Die Hälfte der Vertreter, die in den senderinternen Verwaltungsräten (conseilsd`administrations)der staatlichen Programmgesellschaften sitzen, werden von der Regierung bzw. vom Parlament bestimmt.50In den deutschen Rundfunkanstalten hingegen werden die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Intendant senderintern von den pluralistisch besetzten Rundfunkräten gewählt.51In den Rundfunkräten sitzen 30 bis 75 ehrenamtliche, gewählte Vertreter der Kirchen, der Gewerkschaften und auch der politischen Parteien.52Gerade im
43Vgl. oben Seite X.
44Vgl. Art. 47.1, 47.2 und 47.3 des französischen Rundfunkgesetzes von 2000.
45Vgl. Art. 47.1 des Mediengesetzes von 2000.
46So BVerfGE 12, S. 205 (261); 73, 118 (183); vgl. im einzelnen dazu Hesse, Rundfunkrecht, S. 69.
47Vgl. oben Seite 2
48Vgl. Art. 48 I des französischen Rundfunkgesetzes von 2000; siehe oben Seite 4.
49BVerfGE 83, S. 238 (323); 90, S. 60 (87).
50Vgl. Art. 47.1 und 47.2 des französischen Rundfunkgesetzes von 2000.
51Vgl. Seite 5 und Ricker/ Schiwy, Rundfunkverfassungsrecht, S. 176