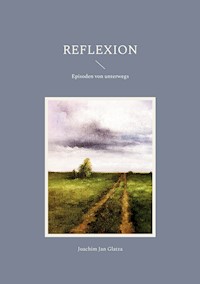
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Sprache: Deutsch
Der Autor schildert die Reflexion seines Lebensweges von 1945 bis heute, beginnend mit dörflichen Jungengeschichten, Fröhlichkeit, Bedrücktheit und Spaß am Kindsein in einer schwierigen Zeit. Bei ungünstigen Bedingungen und dem Auf Und Ab der Gefühle und Ereignisse versuchte er als Kind seinen Weg zu finden. Das setzt sich im Jugend- und Erwachsenenalter weiter fort und charakterisiert Zeiten mit bewegenden Momenten und dem Drang nach Leben wollen. Freud und Leid waren begleitend, und ein ständiger Kampf zu überstehen. Psychische Probleme, Krankheit, erlebter Missbrauch, Schicksale, schmerzhafte Erlebnisse hatten ihre Spuren hinterlassen. Er konnte sie erkennen und seine Lebensorientierung finden. Eine Nahtoderfahrung motivierte ihn, sich von Ballast zu befreien und eine Odyssee zu beenden. Dazu gehören Verschiebung von Werten und Versöhnung mit der Vergangenheit. Den enger gewordenen krankheitsbedingten Spielraum vermag er nun optimistisch zu nutzen. Er hat Freude am Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Pritzwalk, 1945, es fing so harmlos an...
Schönhagen, 7 Jahre meiner Kindheit.
Umzug nach Pritzwalk.
Mein Motorrad „Java 350“ und neue Ziele.
Studium in Potsdam.
Arbeit im Kinderheim und der Volkssolidarität.
… ab in den Süden, leben auf Ibiza.
Zurück nach Potsdam.
Ende einer Odyssee, ein neuer Anfang.
Epilog
Prolog
Als Kind glaubte ich, dass ich noch viel Zeit für mich haben würde. Damals empfand ich alt zu sein schon mit 40 Jahren, und jenseits der 50 schien mir alles vorbei zu sein. Die Menschen um mich herum spiegelten für mich dieses Bild genauso wieder. Ich erlebte, wie sich das Leben nach und nach änderte und habe vieles nicht vergessen.
Meine Startbedingungen als Nachkriegskind, waren nicht gerade rosig, und auch die späteren Gegebenheiten machten es mir nicht einfach, alles zu meistern.
Neben traurigen, schwierigen und bedrückende Zeiten gab es heitere mit Frohsinn, Spaß und Freude.
Auf diese kommt es mir an und sind mir besonders wichtig.
Nun bin ich schon 77 Jahre alt, habe mich von vielen meiner früheren Vorstellungen und Ansichten verabschiedet und stelle fest, dass ich mit meinem manchmal „aus der Reihe tanzen“ eine Eigenschaft habe, die mich auch heute noch antreibt.
Über manches, was ich erlebte, denke ich inzwischen anders. Ich konnte loslassen, neue Inhalte finden und für sie kämpfen.
Die gelebten Jahre sind meine eigene Geschichte, die ich annehme wie sie war und mich in der Nachbetrachtung stolz macht.
Ich habe sie aufgeschrieben, wie sie mir in Erinnerung ist, für mich, meine Familie und Freunde und wer sonst noch dabei sein möchte.
„Es fing so harmlos an“ ... Pritzwalk
15.4.1945
...ist der Titel einer Komödie der UFA von 1944 mit Theo Lingen.
Die Menschen wollten nach Jahren des Krieges endlich einmal Zerstreuung und Ablenkung von dieser schrecklichen Zeit. Nach fast 8 Monaten Spielzeit kam dieser Film auch in der Prignitzer Kleinstadt Pritzwalk an. Viele Einwohner der Stadt und der umliegenden Dörfer freuten sich auf dieses Erlebnis.
Im Gebäude des Bahnhofes befand sich eines der auch von Soldaten begehrten Stadtkinos.
Der 15.April 1945 war ein trüber und frischer Sonntag und viele Besucher waren froh, eine der begehrten Eintrittskarten ergattert zu haben.
Plötzlich, Mitten im Film wurde das gesamte Gebäude von mehreren nahen Explosionen erschüttert. Die Fenster zerbarsten und Wände fiel in sich zusammen, Feuer brach aus und die Explosionen setzten sich fort.
In Angst und Panik stürzten die Kinobesucher, die es noch schafften, aus dem zusammenfallenden Bahnhofsgebäude, sie waren entsetzt und liefen um ihr Leben.
Sie konnten sich diese Katastrophe zunächst nicht erklären.
Dann erfuhr man, dass auf dem Abstellgleis des Bahnhofes verborgen eine gefährliche Fracht stand, mehrere voll beladene Züge mit Munition, einige davon mit den von Hitlers V1 und V2 Raketen. Sie kamen von Peenemünde, Hitlers Raketenschmiede, und sollten in den Harz verlagert werden.
Ein sowjetischer Aufklärungsflieger musste davon Kenntnis gehabt haben und beschoss diesen Zug, so dass er Feuer fing und explodierte. Die Sprengkraft hatte so eine Gewalt, dass viele Häuser in der Nähe zerstört wurden. Ein großer Bereich wurde schwer und total verwüstet, das Bahnhofsgelände ein großer Krater.
Pritzwalk, bisher von solchen Zerstörungen des Krieges verschont geblieben, erlebte nun auch diese Seite.
Die Museumsfabrik der Stadt bewahrt heute dazu viele Zeitdokumente und Erinnerungen, die Betroffene niedergeschrieben haben.
Auf dem Dach des Hauses eines Schulfreundes befand sich noch Jahre danach ein zwei Meter langes Stück Eisenbahnschiene. Das war im ehemaligen Kreisgericht und über einen Kilometer entfernt. Viele Trümmer sind wie Geschosse weit verstreut worden.
Über 350 Menschen verloren ihr Leben bei dieser Katastrophe.
Pritzwalk hatte damals fast achttausend Einwohner und über dreitausend Flüchtlinge, aus Polen, der Ukraine, Sinti und Roma, Zivilfranzosen, Deutsche aus Berlin und Potsdam, die vor den Bomben dorthin geflüchtet waren und sich hier sicherer fühlten. Dabei erlebten sie ein Inferno, das niemand für möglich gehalten hatte.
Der Bahnhof wurde wieder aufgebaut, ein Gedenkpark für die Opfer angelegt und Filmdokumente zu den Hintergründen und dem Geschehen veröffentlicht.
Jährlich wird an dieses Leid und die Katastrophe erinnert. 2015, 70 Jahre nach diesem Grauen war ein besonderes Gedenken. In den „Pritzwalker Heimatblätter“ Heft 16, wird auch über diese schlimme Zeit eindrucksvoll berichtet.
Auch eine junge hübsche Frau aus dem Nachbardorf Schönhagen sah sich damals diesen Film an.
Plötzlich erlebte sie, wie das Gebäude bebte, wie es in sich zusammenfiel und brannte. Sie rannte hinaus und um ihr Leben. Die Flucht aus diesem Inferno gelang ihr.
mit furchtbarer Angst wollte sie nur noch nach Hause.
Fünf Kilometer im Dunkel durch die brennende Stadt, dann noch die Landstraße, das konnte sie nicht mehr.
Sie wusste auch nicht mehr, wo sie bis zum Morgen Schutz gesucht hatte.
Traumatisiert und blutverschmiert kam sie am Vormittag bei ihren Großeltern an, die schon in großer Sorge waren. Sie hatten die Detonationen gehört und inzwischen auch die furchtbare Nachricht, was geschehen war. Ihr Sorgenkind war endlich da, und das war erst einmal die Hauptsache.
Wenn sie das nicht mehr geschafft hätte, wäre auch ein erst drei Monate altes Leben beendet worden, das sie in sich trug. Es war mein Leben, das in die Welt unter dramatischen Umständen hinein wuchs.
In späteren Jahren, wenn sie mir ergreifend von diesem Tag erzählte, bekam ich manchmal das Gefühl, dabei gewesen zu sein. Sie traf sich mit Menschen, die ihn auch erlebt hatten. Erst kürzlich erfuhr ich, dass sich eine inzwischen 91- jährige an meine Mutter erinnerte.
Sie blieb in Schönhagen wohnen und wusste, dass Mutter dem Inferno in Pritzwalk entkommen konnte.
Sie kannten sich.
Bei dieser Katastrophe hatte meine Mutter vielleicht auch einen Menschen verloren, den sie sehr liebte.
War es jemand, den ich später hätte kennen lernen sollen? Ich getraute mich nie zu fragen. Insgeheim denke ich noch heute, ob es vielleicht mein Vater gewesen sein könnte, den es ja für mich nie gab. Das blieb ihr Geheimnis, so gerne ich es auch gewusst hätte.
Mit den Jahren bekam sie Abstand zu diesem Ereignis, vergessen konnte sie es nie. Vielleicht erinnerten sie auch einige sichtbaren Narben am Hals an Verletzungen von damals. Mit einem Tuch oder Samtband verdeckte sie diese. Sie fand sie verunstaltend und wollte Fragen dazu nicht mehr beantworten. Erst später war mir die Tiefe ihres Traumas bewusst, mit dem auch ich aufgewachsen bin. Damit entstand bei mir das erste.
Schönhagen
1945-1953
Mit Beendigung des Krieges bin ich in ein Prignitzer Landleben mit Abenteuern und Bauernhof hineingeboren worden.
Schönhagen, ein damals rückständiges Dorf in der Prignitz, nicht weit von der Kreisstadt Pritzwalk, war mein erstes Zuhause.
Meine Familie waren Mutter, Großmutter Katharina und Großvater Gustav, die eigentlich meine Urgroßeltern waren. Das verstand ich damals nicht. Ein Vater war nicht da für mich. Ich bin wohl damit klar gekommen, was sollte ich auch anderes tun. Außerdem wusste ich ja nicht, wie es anders gewesen sein könnte. Vielleicht hatte man deshalb als Kind sowohl Spaß und Freude als auch traurige Momente einfach so hingenommen. Es hieß, alles wird wieder gut! Das wurde mehr als nur eine Redewendung für mich, eine Lebensphilosophie, an die ich mich später und bis heute erinnere.
Da waren um mich herum noch Hund und Katz, Kuh und Schwein, auch Federvieh wie Hühner, Gänse, Enten, Ratten und Mäuse. In der Nachbarschaft wieherten Pferde, blökten Schafe und meckerten Ziegen, es gab immer irgendwelche tierischen Laute, die gehörten einfach dazu. Fast alle Schimpfwörter liefen hier als Tiere herum. Dazu kamen die Geräusche der wenigen Leute, die ringsum wohnten. Manche lebten in ebensolchen kleinen Hütten wie wir. Oft waren es Fachwerkhäuser, die auf einem Sockel von Feldsteinen errichtet worden waren. Die Männer konnten eigentlich alle, wenn sie sich ausstreckten, in die Dachrinne greifen, so niedrig war unsere Behausung. Dieser Ort wurde früher auch gerne für die vorübergehende Aufbewahrung eines Schlüssels genutzt.
Das Dorf Schönhagen hatte seinen Namen aus der historischen Absicht, was man daraus machen wollte.
Heute ist es tatsächlich ein schöner Ort.
Hier fing für mich alles an, mit täglich einem Löffel voll Lebertran, der meine Knochen stabiler werden ließ.
Wer das durchsteht, geht schon gestärkt durchs Leben!
Kirche, Schmiede, Pferdefuß
Weiter entfernt, die Dorfstraße entlang und drumherum, gab es aber größere Häuser, mit Vorgarten und sogar Stufen. Wir wohnten in der Nähe des alten Gutshauses, mit Hof, Ställen mit Pferden, Kühen und Schweinen. In der Mitte des Hofes der immer dampfende Misthaufen.
Großvater Gustav betreute insbesondere den Pferdestall.
Er wurde als bester Pferdeflüsterer geschätzt.
Man sah ihm seine Passion an, wenn er mal stolz umher ritt. Schönhagen schien mir, wenn ich es aus heutiger Sicht betrachte, damals noch sehr verschlafen und rückständig zu sein. Das hatte aber einen besonderen Reiz für mich.
Über die oft staubige Dorfstraße, an kleinen Häusern rechts und links vorbei, sah man unsere Dorfkirche.
Sie stand etwas erhöht auf einem Hügel und war mit ihrer Feldsteinmauer schon damals beeindruckend.
Hineingegangen war ich nie, ich glaube, auch sonst selten jemand von uns. Es war eine evangelische Kirche und unsere Familie war katholisch. Diese Unterscheidung war mir schon damals fragwürdig.
Die wichtigste Aufgabe des Kirchturms bestand darin, zur richtigen Zeit die Glocke kräftig zu läuten.
Erst sehr früh zur Weckzeit, dann zum Arbeitsbeginn, zur Mittagszeit, Vesper und zum Feierabend.
Bis auf den Feldern musste sie zu hören sein. Für besondere Anlässe wurde auch länger geläutet, wie zur Messe, Hochzeit, Beerdigung, und bei kirchlichen Feiertagen. Da wurde gebimmelt, was das Zeug hielt.
Ich bekam nie heraus, wer denn diese Aufgabe beherrschte und dachte, dass sie sehr schwer gewesen sein musste. Als ich mal danach fragte, sagte man mir: der Küster macht es.
Ich wurde durch diese Aussage auch nicht viel schlauer.
Wichtig war es aber, dass die Kirchturmuhr immer zur vollen Stunde schlug. Vielleicht auch zwischendurch viertel- und halbstündlich. Da wussten dann alle kilometerweit, was die Uhr geschlagen hatte.
Armbanduhren hatte ja kaum jemand, und Taschenuhren, die es wohl in fast jeder Familie gab, waren den meisten zu schade für die Arbeit.
Nicht weit von der Kirche stand die Dorfschmiede und dort war immer etwas los. Großvater brachte auch unsere beiden Ackerpferde dorthin, wenn sie neue Hufeisen brauchten. Es waren starke Tiere mit breiten Hufen und kräftigem Körperbau. Nicht wie die, auf denen manchmal einer saß und gemütlich ritt. Ich kam gerne mit und guckte zu, wie die alten Eisen entfernt und wieder wie neu hergerichtet wurden. Die Schmiede war so schon interessant für mich! An der Wand stand eine Art offener Ofen mit Kamin. Darüber loderte ein großes Feuer aus Glut. Sehr warm wurde mir, wenn ich davor stand, und so blieb ich vorsichtshalber in sicherer Entfernung und beobachtete. Ich sah, dass der Schmied auch größere Kohlestückchen mit hinein legte, und gespaltenes knorriges Holz. Da gab es so viele Werkzeuge, wie ich es noch nie gesehen hatte. Sogar einen Amboss und einen so großen Hammer, den ich mit meinen fünf oder sechs Jahren nicht einmal anheben konnte. Draußen war im Mauerwerk eine eiserne Halterungen für das Pferd, das dort angebunden wurde.
Die meisten Tiere wurden dabei unruhig.
Mit Streicheln am Kopf und leisen Worten wurden sie ruhiger. Eine Handvoll Hafer vors Maul gereicht, machte es perfekt. Einen Fuß des Pferdes hob Großvater hoch und der Schmied machte sich an die Arbeit.
Das alte Hufeisen wurden dem Pferd dann vorsichtig am angewinkelten Fuß abgeschlagen und das freiliegende Horn gleich mit einem eigenartig gekrümmten Schälmesser gekürzt und abgerundet. Dazwischen gab es immer wieder beruhigende Worte für das Pferd. Opa achtete immer sehr darauf. Es musste dann ein neues oder das zuvor umgeschmiedete Hufeisen angepasst werden. Hatte es die richtige Form, dann wurden die in der Schmiedeglut erhitzten Nägel in die Löcher der Hufe hineingeschlagen. Es qualmte und roch merkwürdig.
Damit saßen sie erst mal wieder fest und Großvater zog mit den reparierten Pferden weiter. Es war ungeheuer spannend für mich.
Einmal lief ich während dieser Arbeiten neugierig um ein Pferd herum, es erschrak. In seiner gestressten Verfassung schlug es aus und mir gegen den Kopf. Ich flog ein Stück nach hinten, blutete mächtig und schrie.
Großes Drama entstand, aber ich hatte Glück, der Fuß des Pferdes war noch nicht beschlagen und es hatte nur leicht zu getreten. Als Trophäe habe ich heute eine markante Aufschlagstelle.
Wenn die Pferde dann mit den neuen Hufen eine kleine Laufrunde machten, beobachteten Opa und der Schmied, wie sie liefen. War alles in Ordnung, gab es frisches Wasser im Eimer wieder eine Handvoll Getreidekörner aus der Hand, und es ging zurück in den Stall. Bald hinter der Schmiede führte nach rechts leicht aufwärts der Wirtschaftsweg bis zur Pritzwalker Chaussee. Zu beiden Seiten des Weges gab es wohl Schönhagens größte Ackerflächen. Die kleine Poststelle stand gleich am Anfang des Zugangs. Man konnte dort seine Post hinbringen, abholen und telefonieren. Tante Helga arbeitete anfangs dort, später im Pritzwalker Postamt in einem Betrieb mit Telefonstation.
Unsere Mühle verschwand, sie stand den linken Weg abwärts an der Dömnitz. Krummer Weg wurde er auch genannt, weil er im Bogen dorthin führte. Die Rinder kamen über diesen auch zur Koppel, und an unserer Schönhagener Mühle, oder das, was noch von ihr übrig geblieben war, vorbei. Das gesamte Gestell wurde nach dem Krieg bis auf die Grundmauern abgebaut, verpackt und als Reparation in die Sowjetunion befördert.
Ob sie überhaupt nochmal Korn gemahlen hatte, bezweifelten viele.
Inzwischen wurde sie historisch nachgebaut.
Damals wohnte mein Opa Franz, Mutters Vater, vorübergehend dort. Er half bei der Demontage.
Manchmal erschien es mir, als wenn Opa mit den Russen sprach und übersetzte. Gern schaute ich zu mussten, musste aber immer bald verschwinden. Die Baustelle war zu gefährlich. Schönhagen hatte nun seine eigene Getreideverarbeitung verloren und alle fuhren nun zum Mahlen des Korns jetzt nach Pritzwalk. Der Weg dorthin war länger und umständlicher. Dort freute man sich bestimmt, weil es dann für sie mehr zu tun gab.
Ging ich den Weg Schönhagener Mühle weiter, machte ich einen großen Bogen um das Dorf herum und kam von der anderen Seite über die Brücke zu unserer Badeanstalt und gleich nach Hause. Es gab auch einen Weg um die andere Hälfte des Dorfes herum, Richtung Pritzwalk. Über die nächste Brücke, an der Kathfelder Mühle vorbei, ging es einen Feldwege ins Dorf hinein.
Alle Schönhagener mussten nun zum Korn mahlen dorthin. Das war eine längere Strecke durch die Felder.
Zu Fuß konnte man zurück querfeldein zum Dorf laufen.
Für mich war es immer eine abenteuerliche Abkürzung durch sumpfiges Gelände der Dömnitz mit Gestrüpp und verfallenen Holzschuppen. Gefunden hatte ich darin nie etwas Brauchbares, außer Frösche und Mäuse. Mutter verbot mir diesen Weg. Viel zu weit abgelegen war es und selten kam dort mal jemand vorbei.
Meine Mutter war für mich die schönste Frau der Welt, Gerda, groß, mit schönen blonden Haaren, und sportlich. Sie war oft fröhlich und lachte gerne.
Zupacken konnte sie bei der schweren Feldarbeit auch.
Die meisten Leute mochten ihre Art, grüßten sie von weitem, winkten und waren gerne mit ihr zusammen.
Ihre Fröhlichkeit war ansteckend, und wenn sie mal nach Pritzwalk tanzen gegangen war, konnte sie das auch mal auf dem Tisch.
Im Dorfkrug, bei irgendeiner Feier, beobachtete ich es einmal. Einige der verbissenen Dorfweiber, die fanden das verderblich und geiferten über sie. Das kam auch bei anderen Anlässen vor. Wir mussten vieles alleine bewältigen, traurigen Phasen hatte sie auch. Diese waren für mich ebenso ansteckend. Sie saß dann in einer Ecke und schluchzte vor sich hin, oder wir umarmten uns dabei gleichermaßen traurig, bis wir uns sagten, nun geht es aber wieder weiter. Ihre fröhlichen Momente waren mir viel lieber, ich bekam dann ebensolche.
Großmutter Katharina und Großvater Gustav waren schon vor Jahren aus dem Gebiet des heutigen Polens gekommen. Sie hatten ihr Gehöft bei Stettin verlassen. Es war vor 1905, denn ihr Sohn Franz wurde in dem Jahr in Rostock geboren. Viele Jahre lebten sie in dem Dorf Giesenslage in der Altmark, zogen 1931 in das kleine Lütgendorf, bis sie es 1939 wieder verließen und im nahen Schönhagen, der „Ostprignitz“, sesshaft wurden. Zu dieser Zeit kamen Landarbeiter aus östlichen Ländern, um als Tagelöhner zu arbeiten. Es waren meistens Flüchtlinge, die hier ihre neue Existenz tatkräftig aufbauten. Der damalige Besitzer des Hofes baute für sie einfache Häuser. Eine dieser Wohnstätten war für uns, mit Garten und einem kleinen Stück Land und Stallungen für das Vieh.
Hier wollten sie leben und arbeiten.
Großmutter, eine kleine schmächtige gebürtige Polin, sang oft Lieder ihrer Heimat vor sich hin, konnte aber auch ebenso beeindruckend polnisch fluchen wenn etwas schief ging oder ihre Geduld am Ende war. Zum Beispiel „Schwein oder Schweinehund“ (s'abaka,swinia pies) und „leck mich am Hintern“ (pocatuj mnie dupe) übersetzte mir Mutter. Nach solchen Flüchen bekreuzigte sich Großmutter Katharina sofort. Sie hatte immer ein Kopftuch auf, ob bei der Arbeit oder im Hause oder unterwegs. Alles, was sie anhatte, war dunkel, der Rock, ein Kleid, das sie nur selten trug und die Schürzen, alles in dunklen Farben. Ein paar weiße Punkte auf dem Kopftuch und einer Bluse waren das Höchste an Farbgestaltung. An ihre Haarfarbe kann ich mich nicht mehr erinnern, es war bestimmt schon grau.
Bei anderen Frauen erging es mir ähnlich, sie trugen immer Kopftücher und hatten welche zum wechseln. Ich erinnere mich, dass Großmutter ein runzliges, schmales Gesicht und flinke Augen hatte, die einfach alles sahen.
Ich erkannte an ihrem Blick wenn sie fündig wurde.
Wenn sie aber lächelte, sah es für mich herzlich aus.
Schallend lachen konnte sie nicht, ich hatte es bei ihr nie erlebt. In Erinnerung habe ich, dass sie ihre schwarze Kette mit Kreuz wohl täglich in den Händen hielt, und in Pausen die Perlen mit leisen Gebeten abtastete. Es war ihr Rosenkranz. Sie war streng katholisch, ging sogar bei Wind und Wetter in die Stadt zur einzigen katholischen Kirche nach Pritzwalk, „Sankt Anna“, der für mich später folgenreiche Ort. Das waren drei Kilometer Feldweg hin und drei Kilometer zurück. Anschließend musste sie sofort wieder auf den Hof, bekreuzigte sich und ging an ihre Arbeit. Eine Kuh, zwei Schweine, eine Schar Gänse, Hühner und Enten erwarteten sie immer, von früh bis spät. Ich glaube, sie hatte nie frei, vielleicht mal eine Pause, ein paar andächtige Stunden, sonst nichts.
Bei der Betreuung unserer Hühner half ich gerne. Die Großeltern hatten auf dem Hof ihren gut gesicherten Hühnerschuppen mit einem Auslauf für Küken. Ein Marder veranstaltete darin schon mal eine mörderische Nacht. Danach hatte Großvater alles noch mehr gesichert, Fallen aufgestellt und Bretter ausgetauscht.
Auch einen Fuchs sah Großvater zu früher Stunde auf dem Dach wie er einenWeg zu den Hühnern suchte.
Wenn ich die Schuppentür öffnete, flatterte gackernd unser Hühnervolk auf den Hof, um ihrer wichtigsten Beschäftigung nachzugehen, fressen. Sie waren dabei unermüdlich und es dauerte lange, wenn sie satt waren.
Ein anschließendes Sandbad bei Sonnenschein folgte.
Hob ich etwas auf, was auf dem Hof herum lag, kamen sie angerannt. Unter den Brettern oder Steinen fanden sie immer kleine Insekten. Tausendfüßler und Asseln und mochten sie aber nicht, sie schmeckten und rochen unangenehm. Hühner haben feine Sinne dafür.
Beim Warnlaut des Hahnes oder dem Ruf des Habichts rannten sie fluchtartig in ihr Häuschen. Ich machte manchmal so eine Übung mit ihnen. Der Habichtruf gelang mir immer. Der Hahn war dann auch aufgeregt, und sie rannten fluchtartig in den Hühnerstall.
Hinderlich war es, wenn zwei gleichzeitig durch die Luke hindurch wollten. Sie steckten für einen kurzzeitigen Augenblick fest, wie lustig!
Großvater Gustav hatte auch immer zu tun, auf dem Acker, in der Scheune oder den LPG Stallungen, wie sie nun hießen. Ich verstand damals noch nicht was da vorging, und warum einige Bauern ihre Äcker und Höfe abgeben mussten. Das begriff ich erst Jahre danach.
Seine Liebe zu Pferden blieb, wie schon zuvor auf dem Gutshof. Er hatte immer seine rustikale Bauernkleidung an, in Grau und Braun, und eine Jacke mit vielen Taschen. Dort drinnen waren seine Utensilien, die er brauchte. Für die Feldarbeit hatte ihm Großmutter immer ein Vesperpaket mitgegeben. Belegte Scheiben aus selbstgebackenem Brot, immer mit unserer eigenen Butter bestrichen. Dazu gab es Speck oder Schinken, auch mal einem Stück Wurst. In seinen Tornister, ähnlich einem Lederrucksack, wurde alles verpackt, und der Muckefuck immer in seine Feldflasche, die er noch vom Krieg hatte, gefüllt. Wenn ich ihn mal dazu befragte, wollte er aber nie darüber reden.
Manchmal, wenn er in der Nähe war, brachte ihm Großmutter sein Essen aufs Feld, in einem Behälter aus Aluminium, wohl auch noch aus Soldatenzeiten. Sie hatte für ihn Suppe oder auch mal Kartoffel mit fettem Fleisch hineingetan. Fett war wichtig!
Unser kleines Stück Land musste ja auch bearbeitet werden. Es war sogar für mich überschaubar, lag nicht weit von unserem Haus und grenzte an die Dömnitz hinter der Badeanstalt. Der Fluss plätscherte durch Pritzwalk und dann an uns vorbei in Richtung Elbe.
Die Schönhagener Straße begrenzte dieses Stück Acker an der anderen Seite an einer kleinen Brücke.
Der fortsetzende Weg führte hinauf zum Krähenwald.
Großvater nahm mich auch oft mit, und erklärte mir die Geheimnisse von Ackerbau und Tierzucht. Eigentlich machte ich es sehr gerne, denn es war spannend und ich lernte tatsächlich einiges. An freie Zeit für sich selbst, kann ich mich bei Großvater ebenfalls nicht erinnern, lediglich, wenn er nach getaner Arbeit mit seinen Mitstreitern irgendetwas trinken gegangen war, meistens in den Dorfkrug. Kornbrand war üblich, auch die Schräglage, die anschließend jeder von ihnen hatte.
Wenn sich Großvater fein machte, entweder für die Andacht in der Pritzwalker Kirche oder zu irgendeiner Feier, hatte er seine eigene Zeremonie. Mit Sorgfalt und Akribie, die man von ihm eigentlich nicht erwartete, richtete er aufwendig sein Heiligtum, den „Kaiser Wilhelm Schnauzbart“.
„Die Polakin“ war Großmutter. Sie wurde so von einigen genannt. Kenntnisse über Nahrungsmittel, die in der Natur zu finden sind. Kräuter und Knospen sammelte sie, Pilze welche die andere Frauen des Dorfes nie mitnahmen und ihr daher Unheimliches andichteten.
Großmutter freute sich, wenn sie einen Hexenring fand, Pilze, die im Kreis wachsen. Es ist ein natürlicher Wachstumsvorgang am Rande des Myzels. Wenn ich dabei war, zeigte sie mir es und buddelte mit ihren Fingern in der Erde. Ein Aberglaube besagt, dass es Versammlungsorte von Hexen sind und man erkranken kann, wenn man die Pilze von diesem Ort aß. Einige Pilze, wie Hallimasch waren in rohem Zustand giftig, nach dem Erhitzen genießbar, wusste Großmutter.
Einige Frauen äußerten immer irgendeinen Argwohn über sie und tuschelten abwertend über die „Polakin“.
Bei einigen Dorfbewohnern waren Zugezogene nicht beliebt, die dann auch noch merkwürdige Gewohnheiten hatte. Alles Fremde war ihnen suspekt und bedrohlich.
Eine Frau aus der Nachbarschaft schimpfte Großmutter eine Hexe. Als sie einmal im Draht vergitterten Kükenauslauf war, kam diese Nachbarin und attackierte sie mit einem Stock durch den Maschendraht, fluchte und beschimpfte sie. Da wurde Großmutter doch einmal wütend, kam aus dem Gatter, schnappte sich die Forke und ging auf das zeternde Weib zu. Das flüchtete, bekam aber doch Großmutters Waffe im Hintern zu spüren.
Ein Arzt musste kommen. Danach war anscheinend Ruhe eingekehrt und Großmutter vertraute sich wieder mit leisen Worten ihrem Rosenkranz an.
Auf die Pilze bezogen, erfuhr ich später, dass sie biochemisch auch wie Insekten aufgebaut sind. Beide enthalten einen Zucker, aus dem Chitin gebildet wird und der ihr Körpergerüst stabilisiert. Dieses ist schwer verdaulich. Daher tat Großmutter wohl immer eine Priese Natron in das Essen, um die Pilze verdaulicher zu machen, ohne dass sie aber diese Zusammenhänge kannte. Das hilft tatsächlich und ist in der Küche, und als Gesundheitsmittel noch heute bekannt.
Großmutters Essen war meistens lecker. An ihre grüne Suppe kann ich mich gut erinnern. Von den Brennnesselpflanzen schnitt sie die zarten Spitzen ab und hatte dabei manchmal nicht einmal Handschuhe an.
Ich wollte ihr dabei helfen, verbrannte mir aber immer die Finger. Außerdem war mir diese Pflanze suspekt, seit dem ich mich einmal beim großen Geschäft hineingesetzt hatte. Großmutter hackte ihre Ernte in kleine Stücke, und fügte sie in die schon vorbereitete heiße Brühe. Meistens war diese vom Schwein.
Gebratene Zwiebel und Speckwürfel kamen hinzu und was noch vorhanden war und ihrer Meinung nach hineinpasste. Ich staunte immer wie erfinderisch sie dabei war. Mit Gewürzen, einem Schuss Sahne oder einem Löffel Butter war die Suppe fertig und lecker.
Später probierte ich es nach meiner freien Rezeptur aus und es gelang. Wie Spinat hatte ich Brennnessel angerichtet und sie waren wieder schmackhaft. Das Problem ist inzwischen nur, ausreichend Brennnessel ernten zu können, die nicht chemisch belastet sind.
Sie sind auch eine Ernährungsgrundlage vieler Schmetterlingslarven. Auch für den Menschen sind Brennnessel gesund. Sie haben wichtige Mineralien, die der Körper gut verstoffwechseln kann. In Kapselform sind sie eine sinnvolle Nahrungsergänzung.
Unsere Küken, Hühnern, Enten oder Gänsen, bekamen gehackte Brennnessel mit verschiedenen Beimengungen.
Zusammenknetet, dann waren die Nesseln entschärft.
Die Tiere fraßen immer alles auf. Nur Bella verzog sich bei Brennesselgeruch. Sie hatte zuvor eine schmerzhafte Erfahrung gemacht. Brennende und juckende Pickel auf der Nase waren lehrreich. Von der Dorfstraße aus zweigten nach rechts und links festgefahrene sandige Wege ab. Ich musste kennenlernen, wohin sie führten und ob es spannend wäre, sie auch mal zu verlassen.
Der eine führte am alten Gutshof und dem großen Misthaufen vorbei über den Hof, und dahinter wohnten wir, an einer schon leicht bewachsenen Schuttkippe.
Zweimal in der Woche kamen auch bei uns Wagen vorbei, mal der Fleischer oder Bäcker mit dem Pferdefuhrwerk, später auch ein mobiler Konsum mit Auto. Bei ihnen kaufte man einiges, was man sich sonst aus Pritzwalk hätte holen müssen. Unsere mobilen Verkaufsläden wurden immer lautstark mit einer tüchtig geschüttelten Handglocke angemeldet. Sie kamen meistens am gleichen Wochentag, mal früher oder später.
Man musste daher auf die Glocke hören, um nichts zu verpassen. Großmutter kaufte aber nicht oft ein, wir hatten ausreichend Lebensmittel. Sparsam, wie sie war, achtete sie als unsere Verwalterin darauf, dass es nicht unnütz ausgegeben wurde. Es war wohl auch knapp.
Taufe mit Schinken, Speck und Wurst.
Für meine Großeltern schien es unerträglich gewesen zu sein, dass ich noch nicht getauft worden war. Unehelich geboren und ein Kriegskind, das waren Sünde und Schande, um nach damaliger katholischer Moralvorstellung nicht taufberechtigt zu sein. Meine Großeltern hatten hier eine andere und überzeugten den Gottesdiener einer entfernten katholischen Dorfpfarrei.
Daran kann ich mich aber nicht erinnern, musste es doch schnell und in aller Stille vonstatten gehen. Vor allem für Großmutter Katharina war die Welt dann wieder in Ordnung. Danach hatten wir etwas weniger Schinken, Speck und Würste in der Räucherkammer hängen.
Wahrscheinlich war es damals ohnehin üblich, bei allem, was vermeintlich als sündhaft galt, oder einen Makel hatte, eine Art Ablasszahlung zu leisten, wie früher. Leinenstoffen verwebt. Daher stammten bestimmt einige meiner selbstgefertigten Sachen. Ich fand es bemerkenswert, wie Großmutter an dem interessanten Spinnrad saß und den Zwirn spann. Ich durfte es nur einmal probieren. Es war Schafwolle, die sich etwas fettig anfühlte. Weil ich alles schon beim ersten Versuch verheddert hatte, wurde sie ein wenig ungehalten. Ich durfte dann nur noch zusehen und die Wolle zum verspinnen zwirbeln. Meine Hände wurden dabei noch fettiger, wie ich dachte, es war aber das Wachs der Wolle, erklärte mir Großmutter. Wenn sie die Schafwolle zum Spinnen auf den Boden der Stube ablegte, roch es bei uns nach Schafstall. Die Wolle wurde zuvor schon gereinigt und ausgelüftet, aber das reichte noch nicht. Es musste später fortgesetzt werden. Mutter verzog sich, sie mochte diesen Geruch nicht. Mir war es egal, ich hatte Schafstallerfahrung und blökte zwischendurch.
Ich war dörflich angezogen, ganz einfache Sachen, wie die der meisten Kinder auch. Tante Martha nähte mir Hosen, kurze und lange, Großmutter kümmerte sich um Leibchen, Strümpfe und Strumpfhalter. Diese Kombination war für Mädchen und Jungs üblich. Ich fand sie schrecklich. Ständig musste ich die langen Strümpfe richten und mit Knöpfen oder kleinen flachen Steinen am Strumpfband festklemmen. Meine Strümpfe hatten oft Löcher und daher ein interessantes Stopfdesign. Ich brauchte sie meistens nur an kühlen Tagen tragen. Großmutter hatte auch Garn gesponnen, mal aus der Wolle unserer Schafe, aber auch aus Flachs. Der wurde hier angebaut und irgendwo zu Später erfuhr ich, dass auf den Wiesen hinter dem alten Friedhof die gewebten Leinenstoffe von der Sonne gebleicht wurden. Bleichwiesen sagte man dazu, und ich wunderte mich als Kind, wer dort seine weiße Wäsche verstreut hatte.
Holzpantinen und eine Lederhose mit tollen Hosenträgern bekam ich von Großvater. Er schnitzte auch Formen aus Holz, bis sie an den Füßen passten.
Auf die vordere Hälfte, wo der Fuß hinein gesteckt wurde, nagelte er zurecht geschnittene Lederteile, und somit hatte ich meine Holzpantinen. Mit denen knickte ich aber oft um. Für Matsch und Regen waren sie gut, aber nicht für schnell laufen und im Winter ging es gar nicht, ich rutschte ständig aus wenn es glatt war. Zum schlittern über glatte Bahnen waren sie aber gut.
Ich bewunderte Großvater was er alles aus Holz machte.
Kellen und Quirle, auch Hocker waren von ihm im Haus in Gebrauch. Fasziniert war ich davon, wie er eine kleine Tanne schnitt und ein Stück daraus entnahm. An einem Ende stutzte er von dem ausgewähltem Teil die nach außen wachsenden Zweige und schälte die Rinde sorgsam ab. Etwas geglättet und poliert, und der Quirl war fertig. Ich weiß heute noch, wie man es macht.
An der Dömnitz standen viele Weiden. Wenn der Sommer vorbei war und die Weidenruten richtig waren, wie Großvater sagte, holte er sich lange Triebe. Er weichte sie manchmal im Regenfass ein, so blieben sie biegsam. Dann flechtete er daraus verschiedene Körbe.
Einer war für Brennholz in der Küche, der andere für Großmutters Pilze, und das Sammeln von getrocknete Kuhfladen. Die größeren nannte man Kiepen, ich passte bequem hinein. Es muss eine anstrengende Arbeit gewesen sein, Großvaters Hände brauchten öfter Pausen.
Er besorgte mir auch Stiefel für den Winter aus Filz und Gummi. Die Füße mussten mit Lappen umwickelt und geschickt in die Stiefel gesteckt werden, sonst rieb man sie sich wund. Großvater wies mich in die Kunst des Gebrauchs von Fußlappen ein. Ich konnte mir diesen Vorgang täglich bei ihm abschauen.
Mutter besorgte mir eine Jacke und Unterwäsche, alles in weißem Leinen und unangenehm rau. So richtig kuschelig war sie nicht, wie die damals üblichen Nachthemden ebenso. Ich glaube alle trugen welche und sahen nach heutigen Gepflogenheiten seltsam aus, insbesondere Großvater. Über den Wickel für seinen Kaiser-Wilhelm-Bart wunderte ich mich nicht mehr.
Unsere „großen Geschäfte“ in den langen Unterhosen erforderten Geschicklichkeit. Sie hatten hinten einen größeren Schlitz, der während des Gebrauchs sorgsam auseinander gezogen wurde. Wehe, man war dabei zu unbeholfen! So landete das Geschäft auch mal aus Versehen in eine Unterhosenhälfte. Das bemerkte ich meistens erst, wenn ich meine Hose hochgezogen hatte.





























