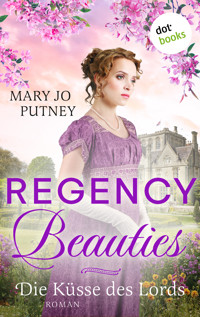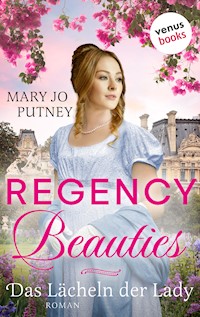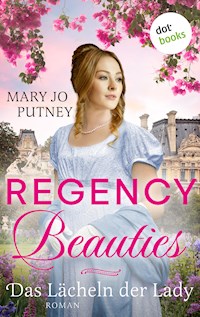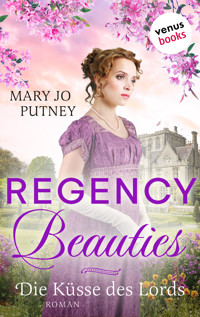
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency Beauties
- Sprache: Deutsch
Kann sie ihm widerstehen? Der historische Liebesroman »Regency Beauties – Die Küsse des Lords« von Mary Jo Putney als eBook bei venusbooks. Sie hat einen großen Wunsch – aber ist sie bereit, dafür alles zu riskieren? Die junge Pastorentochter Clare kann nicht länger mit ansehen, wie ihre Gemeinde unter Hunger leidet. Also nimmt sie allen Mut zusammen, um den berühmt-berüchtigten »Teufelsgrafen« um Hilfe zu bitten. Tatsächlich scheint der attraktive, aber für seinen Zynismus bekannte Lord Aberdare bereit zu sein, das Dorf zu retten – wenn Clare sich auf ein riskantes Spiel einlässt: Sie soll drei Monate mit ihm unter einem Dach verbringen und ihm jeden Tag einen Kuss schenken … Obwohl die junge Frau weiß, dass dies ihren Ruf zerstören kann, willigt sie ein. Und sie ist sicher, dass sie willensstark genug ist, ihre Tugend zu bewahren. Doch vom ersten Tag an spürt sie, dass die glühenden Blicke des Lords tief in ihr ein Feuer wecken … »Ein außerordentlicher Liebesroman von einer außergewöhnlichen Autorin« Romantic Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das historische Romantik-Highlight »Regency Beauties – Die Küsse des Lords« der international erfolgreichen New-York-Times-Bestsellerautorin Mary Jo Putney. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie hat einen großen Wunsch – aber ist sie bereit, dafür alles zu riskieren? Die junge Pastorentochter Clare kann nicht länger mit ansehen, wie ihre Gemeinde unter Hunger leidet. Also nimmt sie allen Mut zusammen, um den berühmt-berüchtigten »Teufelsgrafen« um Hilfe zu bitten. Tatsächlich scheint der attraktive, aber für seinen Zynismus bekannte Lord Aberdare bereit zu sein, das Dorf zu retten – wenn Clare sich auf ein riskantes Spiel einlässt: Sie soll drei Monate mit ihm unter einem Dach verbringen und ihm jeden Tag einen Kuss schenken … Obwohl die junge Frau weiß, dass dies ihren Ruf zerstören kann, willigt sie ein. Und sie ist sicher, dass sie willensstark genug ist, ihre Tugend zu bewahren. Doch vom ersten Tag an spürt sie, dass die glühenden Blicke des Lords tief in ihr ein Feuer wecken …
»Ein außerordentlicher Liebesroman von einer außergewöhnlichen Autorin« Romantic Times
Über die Autorin:
Mary Jo Putney wurde in New York geboren und schloss an der Syracuse University die Studiengänge English Literature und Industrial Design ab. Nach ihrem Studium übernahm sie Designarbeiten in Kalifornien und England, bis es sie schließlich nach Baltimore zog, und sie mit dem Schreiben begann. Mit ihren Büchern gelang es ihr, alle Bestsellerlisten in den USA zu erklimmen, unter anderem die der New York Times, des Wall Street Journals, der USAToday, und der Publishers Weekly.
Die Website der Autorin: maryjoputney.com/
Mary Jo Putney veröffentlichte bei venusbooks außerdem den folgenden Roman: »Regency Beauties – Das Lächeln der Lady«
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »Thunder and Roses« bei Topaz Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Ein Spiel um Macht und Träume« bei Lübbe.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe Mary Jo Putney, 1993
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 by Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2022 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-96898-196-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie werden in diesem Roman möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen begegnen, die wir heute als unzeitgemäß und diskriminierend empfinden, unter anderem dem Begriff »Zigeuner«.
»Zigeuner« ist die direkte Übersetzung des im englischen Originaltext verwendeten Begriffs »Gypsy«, und es ist nicht möglich, dieses Wort in Titel und Text durch die heute gebräuchlichen Eigenbezeichnungen »Sinti und/oder Roma« zu ersetzen, weil sie inhaltlich nicht passen würden. Zur Handlungszeit im frühen 19. Jahrhundert war »Zigeuner« die gängige Fremdbezeichnung für die Sinti und Roma, wobei dieser Begriff seit dem 18. Jahrhundert vielerorts mit einem zunehmenden stigmatisierenden Rassismus verbunden war. Die Sinti und Roma lehnen die Bezeichnung »Zigeuner« daher heute zu Recht ab.
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt und von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Mary Jo Putney hat keinen Roman im Sinne der völkisch rassifizierten Nazi-Nomenklatur geschrieben, sondern verwendet Begrifflichkeiten so, wie sie aus ihrer Sicht zu der Zeit, in der ihr Roman spielt, verwendet wurden; Klischees werden hier bewusst als Stilmittel verwendet. Keinesfalls geht es in diesem fiktionalen Text aber um rassistische Zuschreibungen oder die Verdichtung eines aggressiven Feindbildes.
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Regency Beauties – Die Küsse des Lords« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Mary Jo Putney
Regency Beauties – Die Küsse des Lords
Roman
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
venusbooks
Für Marianna und Karen, zwei meiner Lieblingsfrauen
Prolog
Wales, 1791
Winterliche Nebelschwaden hüllten sie ein, als sie die Mauer erklommen, die das Anwesen umgab. In der geisterhaften Landschaft war kein einziges menschliches Wesen zu sehen, und niemand bemerkte die Eindringlinge, als sie von der Mauer sprangen und über das sorgfältig gepflegte Grundstück gingen.
»Wollen wir hier Hühner stehlen, Mama?« fragte Nikki leise.
Seine Mutter Marta schüttelte den Kopf. »Nein. Wir haben hier etwas anderes zu tun. Etwas Wichtigeres.«
Die Anstrengung des Sprechens löste einen Hustenanfall aus, und sie krümmte sich, als die Krämpfe ihren Körper schüttelten. Besorgt und ängstlich berührte Nikki ihren Arm. Seit sie unter Hecken schliefen, war der Husten noch schlimmer geworden, und sie hatten wenig zu essen. Er hoffte, sie würden bald zu der Kumpania der Roma zurückkehren, wo es Nahrung, warme Feuer und Freunde gab.
Sie richtete sich, blaß, aber entschlossen, wieder auf, und sie setzten ihren Weg fort. Die einzige Farbe in der winterlichen Landschaft war das leuchtende Purpur ihres Kleides.
Endlich traten sie unter den Bäumen hervor auf eine Rasenfläche, die ein ausgedehntes Steingebäude umgab. Ehrfürchtig staunend sagte Nikki: »Lebt hier ein wichtiger Lord?«
»Aye. Sieh es dir gut an, denn eines Tages wird es dir gehören.«
Der Junge starrte das Haus an, während ihn eine seltsame Mischung von Emotionen durchströmte. Überraschung, Aufregung, Zweifel, schließlich Verachtung. »Die Roma leben nicht in Häusern, die den Himmel töten.«
»Aber du bist Didikois, Halbblut. Es ist nur recht, daß du in solchen Gebäuden wohnst.«
Schockiert drehte er sich zu ihr um. »Nein! Ich bin Tacho rat, reines Blut, kein Gadscho.«
»Dein Blut ist für Rom und Gadscho gut.« Sie seufzte, und ihr schönes Gesicht verriet ihre Erschöpfung. »Auch wenn du bei den Roma aufgewachsen bist, liegt deine Zukunft bei den Gadsche.«
Er wollte protestieren, doch sie brachte ihn mit einer raschen Handbewegung zum Schweigen, als das Geräusch von Hufschlag ertönte. Sie zogen sich schnell ins Gebüsch zurück und beobachteten, wie zwei Reiter die Auffahrt heraufkamen und ihre Pferde vor dem Haus zügelten. Der größere der beiden sprang vom Pferd und stieg mit energischen Schritten die breiten Steinstufen hinauf, während sein Pferd der Obhut seines Gefährten überlassen war.
»Schöne Pferde«, flüsterte Nikki neidisch.
»Ja. Das muß der Earl of Aberdare sein«, murmelte Marta. »Er sieht genauso aus, wie Kenrick ihn beschrieben hat.«
Sie warteten, bis der große Mann im Haus verschwunden war und der Stallbursche die Pferde fortgeführt hatte. Dann winkte Marta Nikki zu, und sie eilten über den Rasen und die Treppe hinauf. Der polierte Messing-Türklopfer stellte einen Drachen dar. Nikki hätte ihn gerne angefaßt, aber er war für ihn zu weit oben angebracht.
Statt zu klopfen, packte seine Mutter den Türknauf. Er ließ sich mühelos drehen, und sie traten ein. Nikki riß die Augen auf, als er die Halle mit dem Marmorboden sah, die groß genug war, um einer ganzen Kumpania Unterkunft zu gewähren.
Der einzige Mensch, der zu sehen war, trug die aufwendige Livree eines Lakaien. Bei ihrem Anblick keuchte er entsetzt auf und machte ein Gesicht, das Nikki zum Lachen reizte. »Zigeuner!« stieß er empört hervor, griff sofort nach einem Klingelzug und zog daran. »Raus mit euch, sofort! Wenn ihr nicht in fünf Minuten vom Grundstück seid, dann kriegt ihr es mit dem Gesetz zu tun!«
Marta nahm Nikkis Hand. »Wir möchten den Earl sprechen. Ich habe etwas, das ihm gehört.«
»Willst du mir weismachen, du hättest ihm etwas gestohlen?« höhnte der Lakai. »So nah kannst du ihm nie gekommen sein! Und nun verschwindet!«
»Nein! Ich muß zu ihm.«
»Ganz bestimmt nicht«, knurrte der Lakai, wobei er sich schon auf sie zu bewegte.
Marta wartete ab, bis er nah genug herangekommen war, dann stob sie zur Seite. Der Diener fluchte und versuchte vergeblich, sie zu packen. Im gleichen Augenblick kamen drei weitere Diener herbei, die von der Klingel alarmiert worden waren.
Ihren zornigen Blick fest auf die Männer gerichtet, stieß Marta die übliche Drohung hervor. »Ich muß zum Earl! Mein Fluch wird jeden treffen, der versucht, mich aufzuhalten.«
Die Diener erstarrten in der Bewegung. Nikki hätte fast laut aufgelacht. Wie leicht konnte sie die Gadsche einschüchtern, und dabei war sie nur eine Frau! Nikki war stolz auf sie. Nur ein Rom konnte allein mit Worten eine solche Macht ausüben!
Die Hand seiner Mutter umschloß seine fester, während sie sich langsam von den Dienern wegbewegten. Bevor die Männer noch ihre Furcht abschütteln konnten, dröhnte plötzlich eine tiefe Stimme durch die Halle. »Was zum Teufel ist hier los?«
Der Earl, groß und ausgesprochen arrogant, schritt über den Marmorboden. »Zigeuner«, sagte er verächtlich. »Wer hat diese dreckigen Kreaturen hereingelassen?«
Marta sagte ohne Umschweife: »Ich habe Ihnen Ihren Enkel gebracht, Lord Aberdare. Kenricks Sohn – den einzigen Enkel, den Sie jemals haben werden.«
Todesstille lag über der Halle. Der schockierte Blick des Earls glitt zu Nikki. »Wenn Sie mir nicht glauben ...«, hob Marta an.
Nach einem Augenblick hatte der Earl seine Fassung wiedererrungen und antwortete: »Oh, ich bin gewillt zu glauben, daß dieser abstoßende Bengel Kenricks ist – seine Vaterschaft ist ja nicht zu übersehen.« Er warf Marta den brünstigen, gierigen Blick zu, mit dem Gadsche-Männer so oft Frauen der Roma ansahen. »Ich verstehe durchaus, warum mein Sohn sich mit dir vergnügt hat, aber ein Zigeunerbastard interessiert mich nicht.«
»Mein Sohn ist kein Bastard.« Marta griff in ihr Mieder und zog zwei schmutzige, gefaltete Blätter heraus. »Da ihr Gadsche ja soviel Wert auf Papiere legt, habe ich die Beweise behalten – meine Heiratsurkunde und den Eintrag von Nikkis Geburt.«
Lord Aberdare sah ungeduldig in die Dokumente und versteifte sich plötzlich. »Mein Sohn hat dich geheiratet?«
»O ja, das hat er«, sagte sie stolz. »Sowohl in einer Gadscho-Kirche als auch auf Roma-Art. Und Sie sollten sich darüber freuen, alter Mann, denn nun haben Sie einen Erben. Da Ihre Söhne tot sind, werden Sie keinen anderen mehr bekommen.«
Heftig antwortete der Earl: »Also gut. Wieviel willst du für ihn? Reichen fünfzig Pfund?«
Einen Sekundenbruchteil sah Nikki den Zorn in den Augen seiner Mutter aufflackern, doch dann stahl sich etwas Gerissenes in ihre Miene. »Hundert Goldguineas.«
Der Lord zog einen Schlüssel aus seinem Rock und reichte ihn dem ältesten seiner Diener. »Hol das Geld aus meiner Kassette.«
Nikki lachte laut. Auf Romani sagte er: »Mama, das war wirklich ein toller Plan. Du hast nicht nur den dummen, alten Gadscho überzeugt, daß ich von seinem Blut bin, sondern bringst ihn auch noch dazu, uns Gold zu geben. Wir können ein Jahr lang herrlich leben. Wenn ich heute nacht weglaufe – wo treffen wir uns? Vielleicht an der großen Eiche, an der wir über die Mauer gekommen sind?«
Marta schüttelte den Kopf und antwortete in derselben Sprache. »Du wirst nicht weglaufen, Nikki. Der Gadscho ist wirklich dein Großvater, und dies hier nun dein neues Zuhause.« Sie fuhr ihm kurz durch sein Haar, und Nikki glaubte einen Augenblick, sie würde noch etwas hinzufügen. Schließlich konnte sie nicht ernsthaft meinen, was sie gerade gesagt hatte.
Der Diener kam zurück und gab Marta eine lederne Börse, in der es klingelte. Nachdem sie den Inhalt fachmännisch geprüft hatte, raffte sie ihren Überrock und steckte die Börse in ihren Unterrock. Nikki war entsetzt – bemerkten die Gadsche denn nicht, daß seine Mutter sie verunreinigt hatte, sie zu Marhime gemacht hatte, indem sie in ihrer Anwesenheit ihren Rock gehoben hatte? Die Männer schienen jedoch von der Beleidigung nichts zu merken.
Marta warf Nikki einen letzten, eindringlichen Blick zu. »Behandeln Sie ihn gut, alter Mann, oder mein Fluch wird Sie noch über den Tod hinaus verfolgen. Möge ich heute nacht noch sterben, wenn es nicht so ist!«
Sie drehte sich um und ging mit schwingenden Röcken über den polierten Marmor. Ein Dienstbote öffnete ihr die Tür. Sie neigte den Kopf wie eine Prinzessin und trat hinaus.
Mit plötzlichem Schrecken erkannte Nikki, daß seine Mutter es ernst gemeint hatte – sie ließ ihn tatsächlich hier bei den Gadsche zurück. Schreiend lief er hinter ihr her. »Mama! Mama!«
Bevor er sie erreichen konnte, fiel die Tür vor seiner Nase zu, und er war im Haus gefangen. Als er den Türknauf greifen wollte, packte ihn ein Lakai um die Taille. Nikki rammte ihm das Knie in den Magen und fuhr mit den Fingernägeln durch das bleiche Gadscho-Gesicht. Der Mann brüllte, und andere eilten ihm zur Hilfe.
Mit wirbelnden Fäusten und Füßen versuchte Nikki sich zu wehren. »Ich bin ein Rom! Ich bleibe nicht in diesem scheußlichen Haus!« gellte er.
Der Earl runzelte die Stirn. Wie abstoßend diese unverhüllte und heftige Gefühlsäußerung doch war! Ein solches Verhalten würde man aus dieser Brut herausprügeln müssen, genau wie jede andere Spur von Zigeunerblut. Auch Kenrick war ungezähmt gewesen – verzogen von seiner labilen Mutter, die ihn abgöttisch geliebt hatte. Die Nachricht vom Tod ihres Sohnes hatten den Schlaganfall ausgelöst, der sie zu einem lebenden Leichnam gemacht hatte.
Barsch gab der Earl Befehle. »Bringt den Jungen ins Kinderzimmer und wascht ihn anständig. Verbrennt diese Lumpen und zieht ihm etwas Passenderes an.«
Es bedurfte zweier Männer, um den Jungen zu bändigen. Er kreischte immer noch nach seiner Mutter und schlug heftig um sich, als sie ihn die Treppe hinaufschleppten.
Verbittert blickte der Earl noch einmal in die Dokumente, die bezeugten, daß der dunkelhäutige kleine Heidenbengel tatsächlich sein einziger, lebender Nachkomme war. Nicholas Kenrick Davies laut Geburtsurkunde. Es gab ohnehin kaum einen Zweifel. Abgesehen von seiner dunklen Haut- und Haarfarbe war die Ähnlichkeit des Jungen mit Kenrick als Kind verblüffend.
Aber lieber Gott, ein Zigeuner! Ein dunkler, schwarzäugiger, fremdaussehender Zigeuner! Sieben Jahre alt und im gleichen Maße geschickt im Lügen und Stehlen, wie ihm die Grundlagen des zivilisierten Lebens abgingen. Nichtsdestoweniger war diese zerlumpte, dreckige Kreatur der Erbe von Aberdare.
Es hatte eine Zeit gegeben, als der Earl um einen Erben gebetet hatte, doch nicht einmal im Traum wäre er auf die Idee gekommen, daß seine Gebete auf diese Art erhört werden würden. Selbst wenn seine invalide Frau starb und er wieder heiraten konnte, würden seine Nachkommen in der Rangfolge erst nach diesem Zigeunerbastard kommen.
Seine Finger krampften sich um die Papiere. Vielleicht konnte man dennoch etwas unternehmen, wenn er wieder heiratete und weitere Söhne bekam. Doch bis es soweit war, mußte er das Beste aus diesem Jungen herausholen. Reverend Morgan, der Methodistenprediger im Dorf, konnte Nicholas Lesen, Benehmen und die anderen Grundvoraussetzungen beibringen, die notwendig waren, um ihn auf eine Schule schicken zu können.
Der Earl machte auf dem Absatz kehrt und begab sich in sein Arbeitszimmer, wo er heftig die Tür zuschlug, um nicht mehr die herzzerreißenden Schreie nach »Mama! Mama!« hören zu müssen, die durch die Korridore von Aberdare hallten.
Kapitel 1
Wales, März 1814
Man nannte ihn den Teufelsgrafen oder manchmal Old Nicki. Man munkelte hinter vorgehaltener Hand, daß er die junge Frau seines Großvaters verführt, das Herz des alten Mannes gebrochen und seine eigene Braut ins Grab getrieben hatte. Man munkelte, er könnte alles erreichen.
Und nur dieses letzte Gerücht interessierte Clare Morgan, als ihr Blick dem Mann folgte, der auf seinem Hengst durch das Tal stürmte, als wären alle Dämonen der Hölle hinter ihm her. Nicholas Davies, der Zigeunergraf von Aberdare, war nach vier Jahren Abwesenheit endlich nach Hause gekommen. Vielleicht blieb er ja, aber es war genausogut möglich, daß er morgen schon wieder fort sein würde. Clare mußte also rasch handeln.
Dennoch blieb sie noch eine Weile stehen, um ihn zu beobachten. Sie stand verborgen in einem kleinen Wäldchen, so daß er sie unmöglich entdecken konnte. Er ritt ohne Sattel, wie um mit seinem fast magischen Talent im Umgang mit Pferden zu prahlen. Er war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, nur das Tuch um seinen Hals war scharlachrot. Aus dieser Entfernung konnte sie sein Gesicht nicht erkennen, und sie fragte sich unwillkürlich, ob er sich verändert hatte. Dann kam sie zu dem Schluß, daß die Frage nicht ›ob‹ lauten mußte, sondern ›wie sehr‹. Was auch immer die Wahrheit über die schrecklichen Ereignisse war, die ihn von hier fortgetrieben hatten – es mußte einschneidend gewesen sein.
Würde er sich an sie erinnern? Vermutlich nicht. Er hatte sie nur wenige Male gesehen, und damals war sie noch ein Kind gewesen. Zudem war er zu der Zeit nicht nur der Viscount Tregar gewesen, sondern auch noch vier Jahre älter als sie, und Kinder kümmern sich selten um Jüngere.
Umgekehrt war das nicht der Fall.
Als sie sich auf den Rückweg zum Dorf von Penreith machte, ging sie noch einmal ihre Bitten und die Argumente durch, die sie sich zurechtgelegt hatte. Sie mußte den Teufelsgrafen um jeden Preis überreden, ihr zu helfen. Niemand anderer konnte etwas bewirken.
Während er auf seinem Hengst über die Besitzung stürmte, konnte sich Nicholas wenigstens ein paar kurze Minuten lang in dem rauschartigen Hochgefühl verlieren, das die halsbrecherische Geschwindigkeit in ihm erzeugte. Doch die Realität holte ihn wieder ein, als er sein Pferd zügelte und es in Richtung Haus wendete.
In den Jahren, die er auf dem Kontinent verbracht hatte, hatte er oft von Aberdare geträumt – hin- und hergerissen zwischen Sehnsucht und der Angst, was er wohl dort vorfinden würde. Die vierundzwanzig Stunden, die er nun wieder daheim war, hatten bewiesen, daß seine Ängste berechtigt gewesen waren. Er war ein Narr gewesen, zu glauben, daß vier Jahre die Vergangenheit auslöschen konnten. Jedes Zimmer des Hauses, jeder Hektar des Tals weckte Erinnerungen. Sicher waren glückliche darunter, doch sie wurden von frischeren Erinnerungen überlagert, die alles zu beflecken schienen, was er einst geliebt hatte. Es kam ihm vor, als hätte der alte Earl, bevor er starb, in einem Anfall von Zorn einen Fluch über das Tal gelegt, so daß sein verhaßter Enkel dort niemals glücklich werden konnte.
Nicholas trat zum Fenster seines Zimmers und blickte hinaus. Das Tal war so wunderschön wie immer – wild in den höheren Lagen, tiefer unten üppig bebaut und bepflanzt. Der Frühling zeigte das erste zarte Grün. Bald würden die Narzissen blühen. Als Kind hatte er den Gärtnern geholfen, die Zwiebeln unter die Bäume zu pflanzen, wobei er sich meistens von Kopf bis Fuß mit Schlamm besudelt hatte. Sein Großvater hatte darin einen weiteren Beweis für die niedere Herkunft seines Enkels gesehen.
Er hob den Blick zu dem verfallenen Schloß, das sich oberhalb des Tals befand. Jahrhundertelang waren diese gewaltigen Mauern sowohl Festung als auch Heim für die Davies-Familie gewesen. Als die Zeiten friedlicher wurden, hatte Nicholas’ Ururgroßvater schließlich das Anwesen hier unten gebaut, das für eine der reichsten Familien Britanniens angemessener gewesen war.
Ein Vorteil dieses Hauses war die große Anzahl an Schlafzimmern. Nicholas war am Tag zuvor besonders dankbar dafür gewesen. Er hätte niemals auch nur in Betracht gezogen, Großvaters Zimmerflucht zu benutzen. Doch als er seine eigenen Räume betrat, zogen sich seine Eingeweide heftig zusammen, denn er konnte sein Bett nicht ansehen, ohne sich Caroline darin vorzustellen, wie sie ihn mit ihrem nackten, üppigen Körper lockte. So hatte er sich also augenblicklich in ein Gästezimmer zurückgezogen, das anonym wie ein Hotelzimmer war.
Doch selbst dort hatte er, geplagt von Alpträumen und Erinnerungen, ausgesprochen schlecht geschlafen. Am Morgen hatte er schließlich den Entschluß gefaßt, jede Verbindung mit Aberdare abzubrechen. Er konnte hier niemals seinen Frieden finden, genausowenig wie es ihm in den vier Jahren seiner rastlosen Reisen gelungen war.
Ob es überhaupt möglich war, das Erbe zu verkaufen? Er würde seinen Rechtsanwalt befragen müssen. Doch allein der Gedanke daran, das Haus zu verkaufen, verursachte ein qualvolles Gefühl der Leere in ihm. Es würde sein, als schnitte man ihm einen Arm ab – doch wenn ein Glied entzündet war, hatte man keine andere Wahl.
Außerdem würde es ihm eine gewisse Genugtuung verschaffen, das Anwesen zu verkaufen. Wo immer sein heuchlerischer Großvater jetzt war, ganz sicher würde er darüber das unirdische Äquivalent eines Herzschlags bekommen, und der Gedanke heiterte Nicholas auf.
Plötzlich drehte er sich um, verließ sein Zimmer und ging die Treppe zur Bibliothek hinunter. Wie er den Rest seines Lebens gestalten sollte, war ein zu bedrückendes Thema, als daß er nun darüber nachdenken wollte, aber er wußte wenigstens, wie er die nächsten paar Stunden verbringen konnte. Mit ein bißchen Anstrengung und einer Menge Brandy würde er sie nämlich gänzlich auslöschen können.
Clare war noch nie im Haus gewesen. Es war so großartig, wie sie es erwartet hatte, doch ziemlich düster, und der größte Teil der Möbel war noch unter Tüchern verborgen. Da es jahrelang leergestanden hatte, wirkte es auch jetzt noch verlassen und seelenlos. Williams, der Butler, sah genauso düster aus. Er hatte Clare erst beim Earl ankündigen wollen, doch er war ebenfalls im Dorf aufgewachsen, und so konnte sie ihn überreden, sie sofort zu ihm zu bringen. Er führte sie einen langen Flur entlang, dann öffnete er schließlich die Tür zur Bibliothek. »Miss Clare Morgan möchte Sie sprechen, Mylord. Sie sagt, es ist dringend.«
Clare nahm ihren ganzen Mut zusammen und ging an Williams vorbei in die Bibliothek hinein. Sie wollte dem Earl keine Zeit geben, sie wegzuschicken. Wenn sie ihr Anliegen heute nicht vorbrachte, würde sie keine zweite Chance erhalten.
Der Earl stand am Fenster und starrte auf das Tal hinaus. Sein Rock hing über einem Stuhl, und seine hemdsärmelige Lässigkeit schien das Bild des Lebemanns, für den er allgemein gehalten wurde, bestätigen zu wollen. Seltsam, daß er schon damals Old Nick genannt worden war – er konnte jetzt gerade erst dreißig sein.
Als sich die Tür hinter Williams schloß, wandte der Earl sich um. Sein drohender Blick richtete sich direkt auf Clare. Obwohl er nicht ungewöhnlich groß war, strahlte er Macht aus. Sie konnte sich noch daran erinnern, daß er in einem Alter, in dem die meisten Jungen sich noch ungelenk bewegten, bereits absolute Körperbeherrschung besessen hatte.
Oberflächlich betrachtet, schien er sich nicht viel verändert zu haben. Wenn überhaupt, sah er noch besser aus als vor vier Jahren. Sie hätte nie gedacht, daß so etwas möglich sein konnte. Doch dann erkannte sie schließlich, daß er in der Tat nicht mehr derselbe war – sie sah es in seinen Augen. Früher war darin ein lustiges Funkeln, ein Lachen zu entdecken gewesen, das andere immer angesteckt hatte. Nun waren seine Augen undurchdringlich und wie poliert. Die Duelle, die ungeheuerlichen Affären und die öffentlichen Skandale hatten ihre Spuren hinterlassen.
Während sie noch zögerte, weil sie nicht wußte, ob sie zuerst reden sollte, nahm er ihr die Entscheidung ab. »Sind Sie mit Reverend Thomas Morgan verwandt?« fragte er.
»Ich bin seine Tochter. Ich bin Lehrerin in Penreith.«
Sein gelangweilter Blick musterte sie flüchtig. »Ja, stimmt, manchmal hatte er ein schmuddeliges Gör im Schlepptau.«
»Ich war nicht halb so schmuddelig wie Sie«, gab sie empört zurück.
»Wahrscheinlich nicht«, stimmte er mit einem schwachen Lächeln in den Augen zu. »Ich war das schwarze Schaf. Wenn Ihr Vater während der Schulstunden ein Beispiel für das richtige Benehmen geben wollte, dann bezog er sich oft auf Sie. Ich verabscheute Sie, ohne Sie zu kennen.«
Es tat ihr weh, obwohl sie wußte, daß es nicht so gemeint war. In der Hoffnung, daß es ihn ärgern würde, antwortete Clare zuckersüß: »Zu mir hat er immer gesagt, Sie seien der klügste Junge, dem er je etwas beigebracht hatte, und daß Sie trotz Ihrer aufgesetzten Wildheit ein gutes Herz hätten.«
»Ja, schön wär’s gewesen«, sagte der Earl, während seine vorübergehend gelöste Stimmung wieder verschwand. »Als Tochter eines Geistlichen wollen Sie bestimmt Geld für irgendeine langweilige gute Sache. In Zukunft wenden Sie sich direkt an meinen Verwalter, statt mich damit zu belästigen. Guten Tag, Miss Morgan.«
Mit diesen Worten wollte er sich gerade abwenden, als Clare ihn aufhielt. »Was ich mit Ihnen besprechen möchte, ist keine Angelegenheit für den Verwalter«, sagte sie rasch.
Sein Mund verzog sich. »Aber Sie wollen tatsächlich etwas von mir, nicht wahr? Wie jeder.«
Er schlenderte zu einer Anrichte voller Karaffen und füllte das Glas, das er in der Hand gehalten hatte. »Nun, was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. ›Adel verpflichtet‹ war die Domäne meines Großvaters. Bitte seien Sie so freundlich, zu verschwinden, solange wir noch höflich miteinander umgehen.«
Mit Unbehagen erkannte sie, daß er schon eine Menge getrunken hatte und offenbar nicht daran dachte, jetzt damit aufzuhören. Nun, sie hatte ihre Erfahrung mit Betrunkenen und konnte mit ihnen durchaus fertig werden. »Lord Aberdare, die Leute in Penreith leiden, und Sie sind der einzige Mann, der daran etwas ändern könnte. Es wird Sie wenig Zeit oder Geld kosten ...«
»Es kümmert mich nicht, wie wenig es kostet«, erwiderte er heftig. »Ich will mit dem Dorf oder den Leuten, die dort wohnen, nichts zu tun haben. Ist das klar? Und jetzt verschwinden Sie endlich!«
Clare spürte, wie ihr Dickkopf Oberhand gewann. »Ich bitte nicht um Ihre Hilfe, Mylord, ich verlange sie!« fuhr sie ihn an. »Kann ich es Ihnen jetzt erklären, oder soll ich warten, bis Sie wieder nüchtern sind?«
Er blickte sie verwundert an. »Wenn hier irgend jemand betrunken ist, dann scheinen eher Sie es zu sein. Wenn Sie glauben, die Tatsache, daß Sie eine Frau sind, würde Sie vor Gewaltanwendung schützen, dann haben Sie sich geirrt. Gehen Sie jetzt freiwillig, oder muß ich Sie hinaustragen?« Schon kam er zielstrebig auf sie zu. Das weiße offene Hemd betonte die einschüchternde Breite seiner Schultern.
Dennoch widerstand Clare dem Impuls, zurückzuweichen, griff in die Tasche ihres Umhangs und zog das kleine Buch heraus, das ihre einzige Hoffnung bedeutete. Sie schlug die erste Seite auf und hielt ihm das Buch entgegen, so daß er die Handschrift darin sehen konnte. »Erinnern Sie sich daran?«
Die Widmung war schlicht.
Reverend Morgan – ich hoffe, ich kann eines Tages ein wenig von dem wiedergutmachen, das Sie für mich getan haben. Herzlichst, Ihr Nicholas Davies.
Die krakelige Schrift des Schuljungen ließ den Earl wie vom Donner gerührt stehenbleiben. Er blickte frostig vom Buch zu Clare. »Sie spielen, um zu gewinnen, nicht wahr? Leider haben Sie die falschen Karten ausgespielt. Wenn ich mich verpflichtet fühle, dann nur Ihrem Vater gegenüber. Wenn er mich um einen Gefallen bitten möchte, dann sollte er selbst kommen.«
»Das kann er nicht«, sagte sie knapp. »Er ist vor zwei Jahren gestorben.«
Nach einem unbehaglichen Schweigen sprach der Earl wieder. »Mein Beileid, Miss Morgan. Ihr Vater war vermutlich der einzige wirklich gute Mensch, den ich je kennengelernt habe.«
»Ihr Großvater war auch ein guter Mensch. Er hat sehr viel für die Leute in Penreith getan. Die Stiftung für die Armen, die Kapelle ...«
Bevor Clare noch weitere Beispiele der Barmherzigkeit des letzten Earls aufzählen konnte, unterbrach Nicholas sie. »Verschonen Sie mich damit. Ich weiß, daß mein Großvater wirklich nur allzu gern für das niedere Volk moralische Exempel statuierte, aber für mich ist das nicht besonders anziehend.«
»Wenigstens hat er seine Verantwortung ernst genommen«, gab sie zurück. »Sie haben noch nichts für die Besitzung oder das Dorf getan, seit Sie es geerbt haben.«
»Ein Rekord, den zu halten ich mich sehr bemühen werde.« Er trank sein Glas aus und stellte es resolut ab. »Weder das gute Beispiel Ihres Vaters noch das Moralisieren des alten Earls haben es geschafft, aus mir einen Gentleman zu machen. Mich interessiert nichts und niemand, und so gefällt es mir.«
Sie starrte ihn schockiert an. »Wie können Sie so etwas sagen? Niemand kann wirklich so gefühllos sein.«
»Ach, Miss Morgan, Ihre Unschuld ist rührend.« Er lehnte sich gegen die Tischkante und verschränkte die Arme vor seiner breiten Brust. Er wirkte genauso diabolisch, wie sein Spitzname es nahelegte. »Sie gehen besser, bevor ich noch mehr von Ihren Illusionen zerstöre.«
»Ist es Ihnen egal, daß es Ihren Nachbarn schlechtgeht?«
»Kurz und bündig: Ja. Die Bibel behauptet, die Armen werden immer mit uns sein, und wenn Jesus das schon nicht ändern konnte, wie soll ich es dann tun?« Er lächelte sie spöttisch an. »Mit Ausnahme Ihres Vaters habe ich noch nie jemanden von auffälliger Mildtätigkeit getroffen, der nicht irgendwelche niederen Motive hatte. Die meisten, die so offen ihre Großzügigkeit zur Schau stellen, wollen damit die Dankbarkeit Ihrer Untergebenen einheimsen und sonnen sich in ihrer Selbstherrlichkeit. Wenigstens bin ich in meiner Selbstsüchtigkeit kein Heuchler.«
»Die Beweggründe dürften ziemlich unwichtig sein, solange jemand etwas Gutes tut. Somit ist ein Heuchler immerhin noch ein nützlicher Mensch, was man von Ihnen nicht behaupten kann«, sagte sie trocken. »Aber wie Sie wollen. Da milde Gaben nicht Ihr Fall sind, was interessiert Sie dann? Wenn es Geld ist, das Ihr Herz wärmt – in Penreith können Sie Gewinn machen.«
Er schüttelte den Kopf. »Tut mir leid. Geld kümmert mich auch nicht besonders. Ich habe jetzt schon mehr, als ich ausgeben kann.«
»Schön für Sie«, murmelte sie. Am liebsten hätte sie kehrtgemacht und wäre gegangen, aber damit hätte sie eine Niederlage eingestehen müssen, und das hatte sie noch nie gut gekonnt. Es mußte eine Möglichkeit geben, zu ihm durchzudringen. »Wie kann ich Ihren Entschluß ändern?«
»Sie würden den Preis für meine Hilfe weder zahlen können noch wollen.«
»Stellen Sie mich auf die Probe.«
Mit plötzlich erwachendem Interesse musterte er sie unverfroren von Kopf bis Fuß. »Ist das ein Angebot?«
Er hatte sie schockieren wollen, und es war ihm gelungen: Gedemütigt, wurde sie feuerrot. Dennoch wandte sie ihren Blick nicht ab. »Wenn ich ja sage, würden Sie dann Penreith helfen?«
Er sah sie erstaunt an. »Mein Gott, würden Sie wirklich zulassen, daß ich Sie ruiniere, falls es Ihren Plänen zugute käme?«
»Wenn ich sicher wäre, daß es funktioniert, ja«, sagte sie unbekümmert. »Meine Tugend und ein paar Minuten Qual sind nur ein geringer Preis, wenn man es den hungernden Familien und dem möglichen Verlust von Menschenleben gegenüberstellt, sollte die Mine in Penreith explodieren.«
Einen Augenblick schien er sie bitten zu wollen, die Sache näher zu erklären, dann jedoch sagte er nur: »Obwohl es ein interessantes Angebot ist, würde es mich doch wenig reizen, mit einer Frau ins Bett zu gehen, die sich wie Johanna von Orleans auf dem Weg zum Scheiterhaufen benimmt.«
Sie zog die Augenbrauen hoch. »Und ich dachte, Lebemänner haben Spaß daran, Unschuldige zu verführen.«
»Ich persönlich habe Unschuld immer als langweilig empfunden. Bei einer Frau mit Erfahrung bin ich jederzeit bereit.«
Sie ignorierte seine Bemerkung. »Ich sehe ein, daß eine unscheinbare Frau Sie nicht besonders locken kann«, sagte sie nachdenklich. »Aber eine Schönheit kann doch bestimmt etwas gegen Ihre Langeweile tun. Im Dorf gibt es einige entzückende Mädchen. Soll ich mich umhören, ob eine von ihnen bereit ist, ihre Tugend für eine gute Sache zu opfern?«
Mit einem raschen Schritt kam er zu ihr und nahm ihr Gesicht in seine Hände. Sie roch den Brandy in seinem Atem, und seine Hände waren unnatürlich warm, fast schon heiß. Sie zuckte zusammen, zwang sich dann aber, reglos stehenzubleiben, während er ihr Gesicht mit einem Blick studierte, der bis zu den dunkelsten Geheimnissen ihrer Seele vorzudringen schien. Als sie gerade schon dachte, sie könne seine eingehende Musterung nicht mehr ertragen, sagte er langsam: »Sie sind keinesfalls so unscheinbar, wie Sie zu sein vorgeben.«
Dann ließ er die Hände wieder sinken, was Clares Verwirrung jedoch nicht milderte.
Zu ihrer Erleichterung entfernte er sich wieder von ihr, nahm sein Glas und schenkte sich Brandy nach. »Miss Morgan, ich brauche kein Geld. Ich kann jede Frau, die ich haben will, auch ohne Ihre ungeschickte Hilfe bekommen, und ich habe keinerlei Bedürfnis, meinen hart erarbeiteten Ruf zu verderben, indem ich mich für einen guten Zweck einspannen lasse. Würden Sie jetzt endlich freiwillig gehen, oder muß ich Gewalt anwenden?«
Sie war versucht, sich umzudrehen und zu fliehen. Statt dessen sagte sie hartnäckig: »Sie haben Ihren Preis noch nicht genannt. Irgend etwas muß es geben. Sagen Sie es mir, vielleicht kann ich ihn doch zahlen.«
Mit einem Seufzer ließ er sich auf das Sofa fallen und musterte sie aus sicherer Distanz. Clare Morgan war klein und von ziemlich leichtem Körperbau, und dennoch machten Ihre Persönlichkeit und die Kraft, die sie ausstrahlte, es unmöglich, sie zu ignorieren. Eine ernstzunehmende junge Frau. Wahrscheinlich hatte die Aufgabe, sich um ihren weltfremden Vater zu kümmern, ihren Charakter geprägt.
Obwohl niemand sie als schön bezeichnen würde, war sie trotz ihrer angestrengten Mühe, unscheinbar zu wirken, nicht unattraktiv. Ihre schlichte Kleidung betonte ihre gefällige Figur, und ihre straff zurückgekämmten schwarzen Haare ließen ihre intensiv blauen Augen riesengroß erscheinen. Ihre helle Haut besaß die verführerische Glätte von sonnenwarmer Seide – seine Finger kribbelten immer noch von dem Pochen des Blutes, das er eben an ihren Schläfen gespürt hatte.
Nein, keine Schönheit, aber eine Frau, die sich einprägte, und nicht nur wegen ihrer Hartnäckigkeit. Obwohl sie ein verdammtes Ärgernis darstellte, mußte er ihren Mut bewundern. Gott allein wußte, was für Geschichten über ihn im Tal kursierten, aber die Ansässigen betrachteten ihn wahrscheinlich als eine Bedrohung für Körper und Seele. Dennoch war sie hergekommen, vertrat leidenschaftlich ihre Sache und stellte freche Forderungen. Doch leider hatte sie sich den falschen Zeitpunkt ausgesucht, denn sie versuchte, ihn in die Belange eines Ortes und von Menschen hineinzuziehen, die er aufgeben wollte.
Es war eine Schande, daß er nicht schon früher mit dem Brandy angefangen hatte. Dann wäre er vielleicht schon glücklich bewußtlos gewesen, als sein unwillkommener Gast eingetroffen war. Selbst wenn er sie hinauswerfen ließ, würde sie wahrscheinlich noch längst nicht aufgeben. Sie schien ja überzeugt, daß er Penreiths einzige Hoffnung war. Er begann sich zu fragen, was sie von ihm wollen mochte, ertappte sich dabei und unterbrach seinen Gedankengang augenblicklich. Er hatte absolut keine Lust, sich in irgend etwas verwickeln zu lassen. Es war weitaus besser, sein brandy-vernebeltes Hirn anzustrengen und sich etwas auszudenken, das sie endlich von der Hoffnungslosigkeit ihrer Mission überzeugen würde.
Aber was zum Teufel sollte er mit einer Frau machen, die gewillt war, ein schlimmeres Schicksal als den Tod zu erleiden, wenn sie damit ihre Ziele erreichte? Was konnte er verlangen, das so empörend war, daß sie sich schlichtweg weigerte, es nur in Betracht zu ziehen?
Die Antwort, die ihm einfiel, war von wunderbarer Einfachheit. Schier perfekt. Wie ihr Vater würde sie Methodistin sein, Mitglied einer engen Gemeinschaft von bodenständigen, tugendhaften Gläubigen. Ihr Status, ihre gesamte Identität würde davon abhängen, wie ihre Leute sie sahen.
Triumphierend lehnte er sich zurück und kostete die Vorfreude aus, Clare Morgan mit dieser Abfuhr ein für alle Male loszuwerden. »Ich habe meinen Preis, aber Sie werden ihn nicht zahlen wollen.«
Sie sah ihn wachsam an. »Was ist es?«
»Keine Sorge – Ihre so widerwillig dargebotene Tugend ist sicher. Für mich wäre es ermüdend, und Sie hätten wahrscheinlich noch eine gewisse Befriedigung dabei, wenn Sie sich als Märtyrerin meinen krankhaften Lüsten hingeben könnten. Was ich statt dessen will«, er hielt inne und nahm einen großen Schluck Brandy, »ist Ihr guter Ruf.«
Kapitel 2
»Meinen guten Ruf?« fragte Clare verständnislos. »Was in aller Welt meinen Sie damit?«
Der Earl wirkte ausgesprochen selbstzufrieden. »Wenn Sie, sagen wir, drei Monate mit mir zusammenleben, dann würde ich Ihrem Dorf mit allem helfen, was in meiner Macht steht.«
Clare empfand plötzliche Furcht. Eigentlich war sie nur deswegen so forsch aufgetreten, weil sie niemals ernsthaft angenommen hatte, er könnte an ihr interessiert sein. »Trotz der Langeweile, die Sie vermutlich ertragen müßten«, sagte sie bissig, »wollen Sie, daß ich Ihre Geliebte werde?«
»Nur, wenn Sie es freiwillig werden, was wohl nicht geschehen wird, denke ich. Sie wirken auf mich viel zu prüde, als daß Sie sich zugestehen würden, die Sünden des Fleisches zu genießen.« Sein Blick glitt erneut über sie, diesmal jedoch kühl abschätzend. »Wenn Sie allerdings während dieser drei Monate Ihre Meinung ändern würden, dann hätte ich nichts dagegen. Ich hatte noch nie eine tugendhafte, methodistische Lehrerin. Bringt es mich dem Himmel näher, wenn ich mit einer schlafe?«
»Sie sind widerlich!«
»Danke. Ich gebe mir Mühe.« Er nahm einen weiteren Schluck Brandy. »Um auf das Thema zurückzukommen: Obwohl Sie mit mir leben würden, daß es so aussieht, als wären Sie meine Mätresse, müßten Sie nicht wirklich in mein Bett kommen.«
»Und wo liegt der Sinn einer solchen Charade?« fragte sie erleichtert, aber nur noch verwirrter.
»Ich möchte sehen, wie weit Sie gehen, um zu bekommen, was Sie wollen. Wenn Sie auf meinen Vorschlag eingehen, mag Ihr kostbares Dorf davon profitieren, doch Sie selbst werden sich niemals mehr dort blicken lassen können, denn Ihr Ruf wird vernichtet sein. Ist Ihre Sache einen solchen Preis wert? Werden Ihre Nachbarn Ihre Schande akzeptieren, auch wenn sie davon ihren Nutzen haben? Eine interessante Frage, aber wenn ich Sie wäre, würde ich mich nicht so sehr auf deren Barmherzigkeit verlassen.«
Endlich begriff Clare. »Für Sie ist das nur ein bedeutungsloses Spiel, nicht wahr?« sagte sie mit angespannter Stimme.
»Spiele sind niemals bedeutungslos. Natürlich erfordern sie gewisse Regeln. Welche sollen wir bei diesem hier festsetzen?« Er zog die Brauen zusammen. »Mal sehen ... Sie bekommen meine Hilfe als Gegenleistung für Ihre Anwesenheit unter meinem Dach ... und vorgeblich in meinem Bett. Die erfolgreiche Verführung können wir als eine Nebenwette festlegen – ein Bonus, der uns beiden zugute käme. Damit ich eine faire Chance bekomme, Sie zu verführen, sei mir ein Kuß pro Tag gewährt – wann und wo, bleibt mir überlassen. Jede weitere Liebeshandlung, die darüber hinausgeht, setzt gegenseitiges Einvernehmen voraus.
Nach diesem einen Kuß bekämen Sie das Recht, nein zu sagen, und ich darf Sie dann erst wieder am nächsten Tag anrühren. Nach drei Monaten könnten Sie nach Hause gehen, während ich meine Unterstützung so lange weitergewähre, wie sie benötigt wird.« Er runzelte die Stirn. »Eine riskante Sache – wenn ich mich in Ihren Plan hineinziehen lasse, komme ich vielleicht für den Rest meines Lebens nicht mehr von diesem Tal los. Nun, es ist trotzdem nur gerecht, daß auch ich etwas riskiere, da Sie sehr viel verlieren, wenn Sie auf meinen Vorschlag eingehen.«
»Die ganze Idee ist doch absurd!«
Er warf ihr einen unschuldigen Blick zu. »Ganz im Gegenteil. Ich denke, es könnte höchst amüsant werden – es tut mir fast leid, daß Sie ablehnen werden. Aber der Preis ist zu hoch, nicht wahr? Ihre Jungfräulichkeit könnten Sie quasi heimlich opfern, aber der gute Ruf ist ein zerbrechliches, öffentliches Gut, das einem leicht abhanden kommt und dann nie wieder zu erlangen ist.« Er machte eine anmutige Geste, um ihr zu bedeuten, daß sie entlassen war. »Nun, da ich weiß, wo Ihre Bereitwilligkeit zum Martyrium aufhört, bitte ich Sie noch einmal, zu gehen. Ich nehme an, Sie werden mich auch nicht mehr belästigen.«
Er trug die gemeine, selbstzufriedene Miene eines Zigeuner-Pferdehändlers zur Schau, der soeben ein dämpfiges Tier für einen lachhaft überhöhten Preis verkauft hatte. Der Anblick erfüllte Clare plötzlich mit einem heftigen Zorn. Er war so arrogant, so gefühllos, so sicher, daß er sie besiegt hatte ...
Zu wütend, um sich um die Folgen zu kümmern, fauchte sie: »Also gut, Mylord, ich nehme Ihren Vorschlag an. Ihre Hilfe für meinen Ruf!«
Einen Moment lang herrschte verwirrtes Schweigen. Dann setzte er sich kerzengerade auf. »Das glaube ich nicht! Sie würden die Verachtung Ihrer Freunde und Nachbarn auf sich ziehen, vielleicht sogar gezwungen sein, Penreith zu verlassen, ganz sicher aber würden Sie Ihre Stelle als Lehrerin verlieren. Ist das flüchtige Vergnügen, mir einen Dämpfer zu verpassen, es wert, Ihr ganzes Leben zu opfern?«
»Der Grund, warum ich auf Ihren Vorschlag eingehe, ist der, daß meine Freunde Hilfe brauchen, obwohl ich nicht abstreiten will, daß es mir Spaß macht, Ihre Arroganz zu kitzeln«, sagte sie kalt. »Darüber hinaus denke ich, daß Sie sich irren. Ein Ruf, der sich in sechsundzwanzig Jahren aufgebaut hat, mag weniger empfindlich sein, als Sie es glauben. Ich werde meinen Freunden ganz genau sagen, warum ich es tue, und darauf hoffen, daß sie mir vertrauen. Wenn ich unrecht habe und mich dieses Spiel tatsächlich alles kostet, was mir bisher in meinem Leben wichtig war ...«, sie zögerte, dann zuckte sie die Schultern, »... dann soll es so sein.«
Hilflos konterte er: »Was würde Ihr Vater dazu sagen?«
Nun hatte Clare die Oberhand, und das Gefühl war berauschend. »Was er immer gesagt hat. Daß es eine Christenpflicht ist, anderen zu helfen, selbst wenn der Preis dafür hoch ist. Und daß das eigene Verhalten eine Sache zwischen Gott und einem selbst ist.«
»Sie werden es bereuen, wenn Sie das tun«, antwortete er mit Nachdruck.
»Vielleicht, aber wenn ich es nicht tue, werde ich meine Feigheit noch mehr bereuen.« Sie verengte die Augen. »Hat der große Spieler plötzlich Angst bekommen, auf ein Spiel einzugehen, das er selbst vorgeschlagen hat?«
Noch bevor sie den Satz beendet hatte, war er auf den Füßen und stand mit funkelnden Augen ein paar Zentimeter vor ihr. »Also gut, Miss Morgan. Oder nein, ich sollte Sie jetzt Clare nennen, da Sie ja fast meine Geliebte sind. Sie werden bekommen, was Sie haben wollen. Sehen Sie zu, daß Sie den Tag heute dazu verwenden, Ihre Angelegenheiten im Dorf zu regeln. Ich erwarte Sie morgen früh hier.« Er musterte sie noch einmal, diesmal kritisch. »Sie brauchen sich nicht die Mühe zu machen, viel Kleidung mitzubringen. Wir fahren nach London, wo wir Sie angemessen ausstatten werden!«
»London? Sie werden hier gebraucht.« Obwohl es ihr entsetzlich ungehörig vorkam, setzte sie mühsam hinzu: »Nicholas.«
»Keine Angst«, sagte er knapp. »Ich werde meinen Teil der Abmachung erfüllen.«
»Aber wollen Sie denn gar nicht wissen, worum es überhaupt geht?«
»Sie haben morgen Zeit genug, es mir zu erklären.« Er hatte sich wieder gefaßt und machte lässig noch einen Schritt auf sie zu, so daß sie sich fast berührten.
Clares Herzschlag beschleunigte sich. Wollte er sich jetzt schon seinen ersten Kuß holen? Seine Nähe war so überwältigend, daß sie sich kaum noch auf den Zorn, der sie bisher aufrecht gehalten hatte, konzentrieren konnte. »Ich gehe jetzt. Ich habe noch viel zu tun«, sagte sie voller Unbehagen.
»Noch einen Moment.« Ein gefährliches Lächeln erschien auf seinen Lippen. »Wir werden in den nächsten drei Monaten eine Menge voneinander sehen. Sollten wir unsere Bekanntschaft nicht ein wenig vertiefen?«
Er hob die Hände, und sie hätte fast vor Schreck einen Satz gemacht. Er hielt inne und sagte sanft: »Vielleicht kann Ihr Ruf die drei Monate unter meinem Dach überstehen, aber werden Sie selbst in der Lage sein, es zu ertragen?«
Sie fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen und errötete, als sie sah, daß er diese nervöse Bewegung beobachtet hatte. Sie gab sich alle Mühe, zuversichtlich zu klingen, als sie ihre Antwort gab. »Ich kann ertragen, was immer ich ertragen muß.«
»Da bin ich sicher«, stimmte er zu. »Mein Ziel ist es, Ihnen beizubringen, wie man genau das genießt.«
Zu ihrer Überraschung versuchte er nicht, sie zu küssen. Statt dessen hob er seine Hände zu ihrem Kopf und begann, die Nadeln aus ihrem Haar zu ziehen. Sie war sich qualvoll seiner intensiven, verwirrenden Männlichkeit bewußt; seiner geschickten Finger, des Dreiecks gebräunter Haut, das in dem offenen Hemd sichtbar war. Unter dem Brandygeruch nahm sie einen Duft wahr, der sie an Pinienwälder und eine frische Brise vom Meer erinnerte.
Mit hämmerndem Herzen blieb sie reglos stehen, als die dicken Locken plötzlich befreit bis zu ihrer Taille herunterpurzelten. Er nahm eine Handvoll Haar und ließ die Strähnen durch die Finger rinnen. »Ist es noch nie abgeschnitten worden?« Als sie den Kopf schüttelte, murmelte er: »Reizend. Dunkle Schokolade mit einem Hauch Zimt. Ist der Rest von Ihnen auch so, Clare – ordentlich, kontrolliert und spröde, aber voll verborgenem Feuer?«
Das warf sie vollkommen aus der Bahn. »Wir sehen uns morgen, Mylord«, sagte sie hastig.
Als sie versuchte, sich von ihm freizumachen, packte er ihr Handgelenk. Bevor sie in Panik geraten konnte, drückte er ihr die Haarnadeln in die Hand und ließ sie wieder los. »Bis morgen.«
Mit einer Hand in ihrem Rücken führte er sie zur Tür. Bevor er sie öffnete, sah er auf sie hinab und war plötzlich vollkommen ernst. »Wenn Sie sich entschließen, es doch nicht zu machen, dann werde ich Sie dafür bestimmt nicht verachten.«
Konnte er ihre Gedanken lesen, oder besaß er einfach eine gute Menschenkenntnis? Clare öffnete die Tür und schoß aus dem Zimmer. Zum Glück war Williams nicht in der Nähe. Wenn er ihre aufgelöste Frisur und ihre flammendroten Wangen gesehen hätte, würde er sicher denken ...
Ihr stockte der Atem. Wenn sie auf den Vorschlag des Earls einginge, würde sie hier leben und Williams jeden Tag begegnen. Würde er sie wissend ansehen? Oder verächtlich? Würde er ihr glauben, wenn sie es erklärte, oder würde er sie als Lügnerin und Hure verdammen?
Einem Zusammenbruch nahe, stürzte sie durch eine offene Tür in einen kleinen verstaubten Salon. Nachdem sie die Tür zugezogen hatte, sank sie auf einen abgedeckten Stuhl und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Sie kannte Williams praktisch nicht, hatte sich aber dennoch darüber Sorgen gemacht, was er von ihr denken mochte. Dies war ein kurzer, schrecklicher Vorgeschmack auf das gewesen, was sie erleben würde, wenn sie in diese Abmachung wirklich einwilligte. Wieviel schlimmer würde es erst sein, wenn jedermann in Penreith erfuhr, daß sie mit einem berüchtigten Frauenhelden zusammenlebte?
Als sie erkannte, wie teuflisch Nicholas’ Spiel tatsächlich war, flammte ihr Zorn erneut auf. Er hatte genau gewußt, was er von ihr verlangte; ja, er rechnete doch mit ihrer Furcht vor der öffentlichen Verachtung, wollte sie genau damit entmutigen!
Der Gedanke half ihr, die Fassung wiederzuerringen. Während sie sich aufsetzte und ihr Haar feststeckte, machte sie sich voller Ingrimm klar, daß es Wut und ihr Stolz gewesen waren, die sie dazu verleitet hatten, diese absurde Herausforderung anzunehmen, und keine besonders frommen Gefühlsregungen. Aber schließlich war sie auch keine besonders fromme Frau, auch wenn sie sich redlich Mühe gab.
Als ihre äußere Erscheinung wieder präsentabel war, schlüpfte sie aus dem Salon, trat durch die Eingangstür und ging zu den Stallungen, um ihren Wagen zu holen.
Sie konnte ihre Entscheidung immer noch rückgängig machen. Sie würde dem Earl nicht einmal gegenübertreten müssen, um ihre Feigheit einzugestehen. Sie brauchte nur morgen nicht aufzutauchen, und niemand, außer ihr und Nicholas, würde wissen, was sich zugetragen hatte.
Aber wie sie schon vorher gesagt hatte, ging es hier nicht wirklich um sie selbst oder ihren Stolz, auch nicht um den Earl mit seiner sturen Selbstsüchtigkeit. Es ging um Penreith. Diese Tatsache traf sie wie ein Schlag, als sie eine kleine Anhöhe hinauffuhr und das Dorf in Sicht kam. Sie hielt den Wagen an und blickte auf die vertrauten Schieferdächer hinab. Es sah aus, wie hundert andere walisische Dörfer aussahen: Reihen von Steinhäuschen, die sich in das üppige Grün des Tales schmiegten. Und obwohl an Penreith nichts Außergewöhnliches war, so war es doch ihr Zuhause, und sie kannte und liebte jeden einzelnen Stein im Dorf. Die Leute dort waren ihre Leute, mit denen sie ihr ganzes bisheriges Leben verbracht hatte. Mochte es auch einige geben, die weniger liebenswert als die anderen waren – nun, sie gab jedenfalls ihr Bestes!
Der eckige Turm der anglikanischen Kirche überragte die anderen Gebäude, während die bescheidenere Methodistenkapelle zwischen den Häusern verborgen war. Die Mine war kaum zu sehen, denn sie lag etwas tiefer im Tal. Die Grube war mit Abstand der wichtigste Arbeitgeber in diesem Gebiet. Aber sie war auch die größte Bedrohung für die Leute der Gemeinde, ein Risiko, das sich genauso wenig berechnen ließ wie die Sprengstoffe, die dort manchmal eingesetzt wurden.
Diese Wahrheit brachte wieder Klarheit in ihre verwirrten Gedanken. Mochte sie sich heute auch schändlicherweise ihrem Stolz und ihrem Zorn ergeben haben, die Gründe, die sie nach Aberdare geführt hatten, waren nichtsdestoweniger ehrbar. Für das Wohlergehen des Dorfes zu kämpfen, konnte nicht falsch sein; ihre Herausforderung würde eben darin liegen, ihre Seele davor zu bewahren, dem Laster zum Opfer zu fallen.
Das wöchentliche Treffen war ein wesentlicher Bestandteil im Alltag einer Methodistengemeinschaft, und Clares Gruppe hatte an diesem Abend ihr Treffen. Das kam ihr gelegen, denn so konnte sie mit all ihren engsten Freunden zugleich sprechen. Doch als die kleine Gruppe mit einer Hymne begann, zogen sich ihre Eingeweide furchtsam zusammen.
Der Leiter der Gruppe, Owen Morris, sprach ein Gebet. Dann begannen die einzelnen Mitglieder, von den spirituellen Freuden oder Prüfungen zu berichten, die sie in den vergangenen sieben Tagen erfahren hatten. Es war eine ruhige Woche gewesen; nur allzu bald war Clare an der Reihe. Sie stand auf und sah nacheinander jeden aus der Gruppe der fünf Männer und sechs Frauen an.
Die Gruppen konnten als Musterbeispiel einer freudvollen christlichen Gemeinschaft bezeichnet werden. Als Clares Vater gestorben war, hatten die Mitglieder ihr über ihren Kummer hinweggeholfen, so wie sie stets anderen bei ihren Sorgen und Nöten beigestanden hatten. Die Leute, die in diesem Raum versammelt waren, waren für sie praktisch wie eine Familie – die Menschen, auf deren Meinungen sie am meisten Wert legte.
Sie betete im stillen, daß sie sich in ihrem Vertrauen in diese Personen nicht irrte, und begann. »Freunde ..., Brüder und Schwestern ..., ich stehe kurz davor, mich auf ein Unternehmen einzulassen, das hoffentlich ganz Penreith nützen wird. Es ist unorthodox – ja, sogar skandalös –, und viele werden mich dafür verurteilen. Ich hoffe, daß ihr das nicht tun werdet.«
Owens Frau Marged, die Clares engste Freundin war, lächelte ihr aufmunternd zu. »Erzähl es uns. Ich kann mir nicht vorstellen, daß du etwas tun willst, das uns derart mißfällt.«
»Ich hoffe nur, daß du recht hast.« Clare blickte auf ihre fest verschränkten Hände. Ihr Vater war von allen Methodisten in Südwales geliebt worden, und die Zuneigung und die Ehrfurcht, die man ihm entgegengebracht hatte, war inzwischen auf sie übertragen worden. Deswegen besaß sie bei der lokalen Gemeinschaft ein höheres Ansehen, als sie verdiente. Sie hob den Kopf und fuhr fort. »Der Earl of Aberdare ist heimgekehrt. Ich bin heute zu ihm gegangen, um ihn zu bitten, seinen Einfluß geltend zu machen, um unserem Dorf zu helfen.«
Edith Wickes, die niemals mit ihrer Meinung hinterm Berg hielt, sah sie entsetzt an. »Du hast mit diesem Mann gesprochen? Meine Liebe, war denn das klug?«
»Wahrscheinlich nicht.« Clare gab ihnen eine knappe Zusammenfassung der Abmachung, die sie und der Earl getroffen hatten. Wie sie sich gefühlt hatte, wie sich der Earl benommen hatte, erwähnte sie nicht – auch nicht, daß sie sich einmal täglich von dem Earl würde küssen lassen müssen. Am allerwenigsten konnte sie sich dazu durchringen, eine Beschreibung ihrer eigenen unbeherrschten Reaktionen zu geben. Ohne diese Einzelheiten war sie schnell mit ihrem Bericht zu Ende.
Als sie den letzten Satz ausgesprochen hatte, starrten ihre Freunde sie in den unterschiedlichsten Abstufungen von Schock und Sorge an. Edith sprach als erste wieder. »Das kannst du nicht wirklich wollen!« erklärte sie überzeugt. »Es ist ungehörig. Du wärest ruiniert.«
»Vielleicht.« Clare hob flehend die Hände. »Aber ihr alle kennt die Situation in der Grube. Wenn Lord Aberdare in der Lage ist, sie zu verbessern, dann bin ich doch verpflichtet, uns seiner Mitarbeit zu versichern.«
»Nicht zum Preis deines guten Rufes! Ein guter Name ist der größte Schatz einer Frau.«
»Nur im weltlichen Sinn«, erwiderte Clare. »Es ist ein Grundsatz unseres Glaubens, daß jeder Mensch nach seinem eigenen Gewissen handeln soll. Wir dürfen uns nicht dadurch beirren lassen, was die Welt wohl denken mag.«
»Schon«, sagte Marged zweifelnd, »aber bist du denn sicher, daß du dazu berufen bist? Hast du schon gebetet?«
Clare versuchte, ihre ganze Überzeugung in ihre Stimme zu legen. »Ja, ich bin sicher.«
Edith zog die Stirn in Falten. »Und was, wenn Aberdare deinen Ruf ruiniert und dann nicht tut, was er versprochen hat? Du hast nichts als sein Wort, und trotz seines Titels ist der Mann nicht viel mehr als ein Zigeuner, und die lügen.«
»Er sieht die Sache nur als ein Spiel, in dem das Schicksal des Dorfes der Einsatz ist – aber er ist auch ein Mann, der das Spielen sehr ernst nimmt«, sagte Clare. »Ich glaube, daß er auf seine Art ehrenhaft ist.«
Edith schnaubte. »Man kann ihm nicht trauen. Als Junge war er schon wild und ungebärdig, und wir wissen doch alle, was vor vier Jahren geschehen ist.«
Jamie Harkin, der Soldat gewesen war, bis er ein Bein verloren hatte, sagte in seiner bedächtigen, ruhigen Art: »Wir wissen nicht wirklich, was damals geschah. Es kursierten viele Gerüchte, aber es ist niemals wirklich eine Klage gegen ihn erhoben worden. Ich kann mich noch an Nicholas als Junge erinnern, und er war ein anständiger Kerl.« Er schüttelte den Kopf. »Trotzdem gefällt mir der Gedanke nicht, daß Clare in diesem großen Haus wohnen soll. Wir kennen sie zu gut, um zu fürchten, daß sie vom rechten Weg abkommen würde, aber andere werden tratschen und sie verurteilen. Es könnte dich schwer treffen, Mädchen.«
Marged warf ihrem Mann einen Blick zu, der als Hauer in der Grube arbeitete. Er konnte sich glücklich schätzen, Arbeit zu haben, aber sie konnte nie vergessen, wie hart und gefährlich diese war. »Es wäre wunderbar, wenn Clare Lord Aberdare überzeugen könnte, die Arbeitsbedingungen in der Grube zu verbessern.«
»Das ist wahr«, warf Hugh Lloyd, ein junger Mann, der ebenfalls in der Mine beschäftigt war, ein. »Der Besitzer und der Geschäftsführer geben keinen verdammten ...« Er errötete. »’tschuldigung, Schwester. Ich meine nur, die kümmern sich nicht um uns Bergleute. Es ist billiger, uns zu ersetzen, als neue Maschinen zu kaufen.«
»Zu wahr«, sagte Owen düster. »Glaubst du wirklich ganz tief in deinem Herzen, daß du das Richtige tust, Clare? Es ist tapfer von dir, deinen guten Ruf aufs Spiel zu setzen, aber niemand erwartet von einer Frau, etwas zu tun, das sich derart gegen Sitte und Anstand richtet.«
Einmal mehr ließ Clare ihren Blick durch den Raum schweifen und sah jeden nacheinander an. Sie hatte es abgelehnt, Leiter der Gruppe zu werden, und sich niemals gewünscht, predigen zu dürfen, denn sie fand, daß sie diese Ehre nicht verdiente. Doch sie war eine Lehrerin, und sie wußte, wie man die Aufmerksamkeit mehrerer Leute auf sich ziehen konnte. »In den Tagen, als Mitglieder unserer Gesellschaft verfolgt wurden, riskierte mein Vater sein Leben, um das Wort Gottes zu verkünden. Zweimal wäre er fast durch den Mob getötet worden, und er trug die Narben dieser Übergriffe bis zu dem Tag, an dem er starb. Wenn er sein Leben riskiert hat, wie kann ich dann davor zurückschrecken, etwas so Banales aufs Spiel zu setzen wie den weltlichen Ruf?«
Aus den Mienen ihrer Freunde schloß Clare, daß sie zwar von ihren Worten gerührt waren, aber immer noch Zweifel hatten. Doch sie brauchte das Wissen, daß sie von ihnen unterstützt wurde. »Lord Aberdare hat keinen Hehl daraus gemacht, daß sein Angebot keinesfalls aus einer ... einer sittenwidrigen Lust hervorgegangen ist«, sagte sie eindringlich, »sondern daß er mich damit loswerden wollte. Er hat sogar gewettet, wie ich wohl reagieren würde, aber er hat verloren.« Sie schluckte hart und rang sich dann dazu durch, die Wahrheit so zurechtzubiegen, bis sie fast keine mehr war. »Ich vermute, er wird mich zu einer Art Haushälterin oder Schreiberin machen, wenn ich erst einmal in seinem Haus wohne.«
In den besorgten Gesichtern um sie herum zeigte sich endlich Erleichterung. Eine Haushälterin – das war doch harmlos genug. Nur Edith murmelte: »Selbst diese Rolle bewahrt dich nicht davor, daß Seine Lordschaft auf dumme Gedanken kommt. Er heißt ja nicht umsonst Teufelsgraf.«
Clare unterdrückte die leichten Gewissenbisse, daß sie ihren Freunden eine Vermutung eingegeben hatte, die sich wahrscheinlich als ganz und gar falsch erweisen würde. »Warum sollte er bei mir auf dumme Gedanken kommen? Ganz bestimmt hat er genug unmoralische Damen der Gesellschaft zur Auswahl. Und wohl auch«, sie suchte nach dem richtigen Ausdruck, »wie nennt man die noch? Rennpferdchen?«
»Clare!« Edith war entsetzt.
Jamie Harkin gluckste. »Wir wissen alle, daß es solche Frauen gibt. Einige haben sogar zu Gott gefunden und sind gute Methodistinnen geworden. Warum sollen wir um den heißen Brei herumreden?«
Edith warf dem alten Soldaten einen finsteren Blick zu. Sie gerieten öfter aneinander, denn obwohl die Mitglieder durch den Glauben und gegenseitige Zuneigung miteinander verbunden waren, so stammten sie doch aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und waren in weltlichen Dingen nicht immer einer Meinung. »Und was willst du mit der Schule machen, Clare? Du wirst keine Zeit zum Lehren haben. Und selbst wenn – die meisten Leute in Penreith wären ganz sicher entsetzt, daß du ihre Kinder unterrichtest, während du unter solch seltsamen Bedingungen auf Aberdare wohnst.«
»Ich hoffe, daß Marged den regulären Unterricht übernehmen kann.« Clare sah ihre Freundin an. »Würdest du das tun?«
Marged riß die Augen auf. »Meinst du denn, ich könnte das? Außer in der Sonntagsschule habe ich noch nie unterrichtet, und ich habe doch überhaupt keine Ausbildung wie du.«
»Du kannst das schon«, versicherte Clare ihr. »Das Unterrichten ist nicht viel anders als in der Sonntagsschule – lesen, schreiben, buchstabieren, rechnen, ein bißchen Haushalt. Der Hauptunterschied besteht darin, daß weniger in der Bibel gelesen wird und die älteren Schüler schon weiter fortgeschritten sind. Du beziehst natürlich in der Zeit, die du unterrichtest, auch das Lehrergehalt.«
Wie Clare es erwartet hatte, war die Aussicht auf Lohn das Zünglein an der Waage, denn Marged wollte ihren drei Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen und brauchte Geld dazu. »Also gut, Clare. Ich gebe mein Bestes.«
»Wunderbar! Ich habe den Lernstoff skizziert und Bemerkungen dazugeschrieben, was jedes Kind im Augenblick lernt. Wenn du gleich mit mir nach Hause kommst, gebe ich dir alles, was du brauchst.« Nun wandte Clare sich an Edith. »Marged wird die nächsten drei Monate sehr beschäftigt sein. Es ist zwar eine große Last, aber könntest du meine Stunden in der Sonntagsschule übernehmen?«
Die ältere Frau sah sie erst verdutzt, dann erfreut an. »Aber ja, meine Liebe. Wenn es dir hilft.«
Bill Jones, ein anderes Mitglied, meldete sich zu Wort. »Da ich ja in deiner Nähe wohne, werde ich ein Auge auf dein Haus halten.«
Glenda, seine Frau, setzte heftig hinzu: »Und wenn irgend jemand etwas Schlechtes über dich sagt, dann wird er es mit mir zu tun kriegen.«
Clare biß sich gerührt auf die Lippen. »Vielen Dank euch allen. Ich kann mich glücklich schätzen, Freunde wie euch zu haben.«
Und im stillen schwor sie sich, daß sie das Vertrauen dieser Menschen niemals enttäuschen würde.
»Und hier habe ich aufgeschrieben, was die einzelnen Schüler gerade lernen.« Clare gab Marged den letzten von den Zetteln, die sie beschrieben hatte, als sie aus Aberdare zurückgekommen war.
Marged überflog die Blätter, wobei sie gelegentlich eine Frage stellte. Als sie fertig war, legte sie besorgt die Stirn in Falten. »Drei von den Kindern wissen fast soviel wie ich. Es ist ja schließlich auch noch gar nicht so lange her, daß ich in deiner Erwachsenenklasse gesessen habe.«
»Mit den fortgeschrittenen Schülern ist am leichtesten umzugehen. Sie unterrichten sich nicht nur größtenteils selbst, sie helfen auch noch bei den Kleinen. Du wirst das ganz leicht bewältigen«, versicherte Clare ihr. »Und vergiß nicht, wenn du Fragen oder Probleme hast – ich bin nur zwei Meilen entfernt.«
Margeds Lächeln wirkte ein wenig unsicher. »Wie immer hast du alles ganz wunderbar organisiert. Ich habe ein bißchen Angst, aber – o Clare, ich bin so aufgeregt, daß du mir das zutraust! Vor fünf Jahren konnte ich nicht einmal lesen! Wer hätte gedacht, daß ich eines Tages selbst Lehrerin sein würde?«
»Meine größte Sorge ist, daß die Schule mich gar nicht mehr braucht, wenn ich zurückkomme.« Obwohl Clare diese Worte im Spaß gesagt hatte, versetzte ihr der Gedanke daran einen Stich, denn es konnte sich durchaus bewahrheiten. Mit etwas Erfahrung würde aus Marged eine gute Lehrerin werden, die in vieler Hinsicht sogar besser als Clare war, denn obwohl Marged nicht so gebildet war, besaß sie doch viel mehr Geduld.
Nun, da diese Sache besprochen war, lehnte sich Marged in ihrem Stuhl zurück und nippte an dem Tee, den Clare aufgebrüht hatte. »Wie ist er denn so?«
»Wer?« fragte Clare verdutzt.