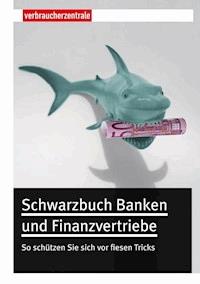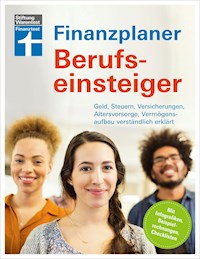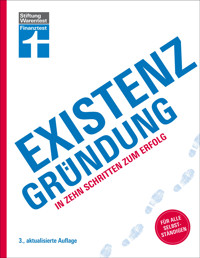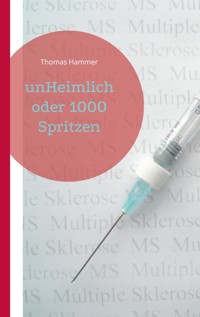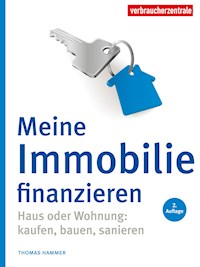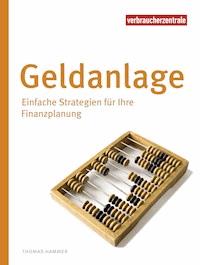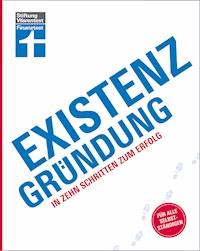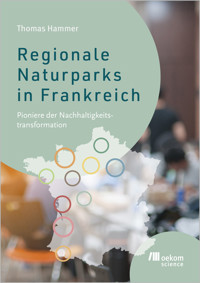
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Regionale Naturparks sind mehr als nur geschützte Landschaften – sie sind Innovationslabore für nachhaltige Entwicklung. In Frankreich haben sie sich von Bewahrern der Natur zu einflussreichen Akteuren des gesellschaftlichen Wandels entwickelt. Diese erste deutschsprachige Monografie erzählt ihre faszinierende Geschichte: von den Anfängen in den 1960er-Jahren bis zu ihrer heutigen Rolle als Treiber der Großen Transformation. Wie gelingt es Naturparks, Biodiversität zu schützen, Kultur und Traditionen zu bewahren und zugleich neue Wege für eine nachhaltige Regionalentwicklung zu eröffnen? Thomas Hammer zeigt anhand spannender Beispiele, welche Strategien erfolgreich waren – und welche Herausforderungen bleiben. Ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für Naturschutz, nachhaltige Entwicklung und die Zukunft des ländlichen Raums interessieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hammer
Regionale Naturparks in Frankreich
Pioniere der Nachhaltigkeitstransformation
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.www.dnb.de abrufbar.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2025 oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Goethestraße 28, 80336 München +49 89 544184 – 200
Layout und Satz: oekom verlag
Korrektur: Maike Specht
Umschlaggestaltung: Laura Denke, oekom verlag
Umschlagabbildung: © Adobe Stock: nutawut; agrus
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 978-3-98726-465-8
DOI: //doi.org/10.14512/9783987264344
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1:
Einleitung
Teil 1:
Entstehung und Werdegang der Regionalen Naturparks (PNR) in Frankreich
Teil 2:
Transformationsbereiche
Teil 3:
Die PNR und die FPNRF als Akteure des Wandels
Verzeichnis der Abkürzungen
Literaturverzeichnis
Vorwort
Damit die Große Transformation Richtung Nachhaltigkeit gelingt, sind alle Akteure aufgerufen, ihr Denken und Handeln mit den langfristigen Zielen nachhaltiger Entwicklung in Übereinstimmung zu bringen. Dabei geht es um nichts Geringeres als darum, überall auf der Erde heutigen und nachfolgenden Generationen eine angemessene Lebensqualität zu ermöglichen, wozu eine intakte Natur unweigerlich eine unabdingbare Voraussetzung ist. Und diese Natur ist zunehmend bedroht oder schon zum Nachteil der Menschen geschädigt und zerstört, was verständlicherweise gerade junge Generationen beängstigt. Sie wachsen in Lebens‑, Konsum‐ und Wirtschaftsweisen hinein, die offensichtlich nicht nachhaltig sind, und gleichzeitig sollen sie zukünftig dafür sorgen, dass neue, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Lebens‑, Konsum‐ und Wirtschaftsweisen entstehen und sich durchsetzen.
In der Transformationsdebatte wird diesbezüglich auf die wichtige Funktion von sogenannten Pionieren des Wandels verwiesen, also auf Akteure, die mit ihrem Handeln vorausgehen, sei es beispielsweise als Individuum, Verein, Verband, Start‐up, Unternehmen, Kulturorganisation, Dienstleistungsbetrieb, Gemeinde, Stadt oder Region. Pioniere des Wandels können unterdessen wohl in allen gesellschaftlichen Bereichen ausgemacht werden, und ihre Bedeutung ist zumindest zweischichtig: Sie können als Vorbild und Inspirationsquelle für vergleichbare Akteure dienen und diese motivieren, selbst aktiv zu werden. Und sie zeigen den Weg, in welche Richtung der Wandel gehen kann.
Als begeisterter Besucher der Naturparks in Frankreich und nach intensiver Auseinandersetzung mit ihren Aufgaben und Tätigkeiten gelangte ich zur Überzeugung, dass diese als Pioniere des Wandels Richtung Nachhaltigkeit gelesen werden sollten. Schon Jahre bevor nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeitstransformationen zu Themen wurden, entwickelten sie in ihren Gebieten entsprechende Vorgehensweisen und förderten entsprechende Prozesse und Maßnahmen. Selbstverständlich kann über das bisher Erreichte gestritten werden. Unabhängig von der Einschätzung ihres Erfolgs gehören die Naturparks aber zu jenen Akteuren, die im ländlichen Raum in Frankreich schon seit Jahrzehnten eine Vorreiterrolle einnehmen, die es zu thematisieren und zu reflektieren gilt. Vorliegendes Buch will zur Schließung dieser Lücke beitragen.
Freiburg im Üechtland im Januar 2025
Thomas Hammer
Kapitel 1Einleitung
Vielfalt der Naturparks und Vielfalt ihrer Herausforderungen
Regionale Naturparks (Parcs naturels régionaux, PNR) – nachfolgend mit PNR abgekürzt – sind in Frankreich national anerkannte Großschutzgebiete. Entsprechend der nationalen Umweltgesetzgebung sind PNR Gebiete mit bedeutendem und zugleich bedrohtem Natur‑, Kultur‐ und Landschaftserbe. PNR haben den offiziellen gesetzlichen Auftrag, in ihrem Gebiet einen Beitrag zur Politik des Natur‐ und Umweltschutzes, der Raumplanung, der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie der öffentlichen Erziehung und Bildung zu leisten. Zu diesem Zweck sollen sie Experimentiergebiete für Innovationen im Dienste nachhaltiger Entwicklung ländlicher Räume sein, insbesondere für Maßnahmen der Gebietskörperschaften.
Ihr Auftrag ist in einer über 15 Jahre gültigen und erneuerbaren, partizipativ erarbeiteten Charta geregelt. Mit der Genehmigung der Charta verpflichten sich die beteiligten Gebietskörperschaften, sich für die Erreichung der in der Charta formulierten Ziele und die Umsetzung diesbezüglicher Maßnahmen einzusetzen sowie die entsprechende Finanzierung sicherzustellen. Von Bedeutung ist, dass zusätzlich zu den beteiligten Gemeinden und ihrer Verbände auch die Departemente und Regionen, in denen die Gemeinden liegen, Mitglied im Zweckverband eines PNR sind und damit zur Trägerschaft eines PNR gehören. Auch verschiedene nationale Behörden tragen die Umsetzung einer Charta mit, da ansonsten das diesbezüglich federführende Ministerium für Ökologie die Anerkennung eines Gebiets als PNR verweigert. PNR sind also national anerkannte Großschutzgebiete, die von allen Behördenebenen Unterstützung genießen.
Seit dem 1. März 1967, dem Datum der Unterzeichnung des ersten Dekrets zur Anerkennung von Gebieten als PNR durch den damaligen Staatspräsidenten Charles de Gaulle, sind 59 PNR gegründet worden (s. Abb. 1). Zusammen bilden diese eine Fläche von 95.000 Quadratkilometern, was mehr als die doppelte Fläche der Schweiz ist. Sie decken über 19 Prozent der nationalen Fläche Frankreichs ab. In den 4.980 beteiligten Gemeinden wohnen 4,5 Millionen Menschen. In Durchschnittswerten ausgedrückt: Ein PNR ist 1.640 Quadratkilometer groß, umfasst 86 Gemeinden und beherbergt 76.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Die Größe variiert aber von unter 500 bis über 3.000 Quadratkilometer Fläche, die Bevölkerung von unter 10.000 bis über 200.000 Einwohner und Einwohnerinnen und die Anzahl Gemeinden pro PNR von drei Gemeinden (PNR Camargue) bis 205 Gemeinden (PNR Ballons des Voges), wobei ziemlich genau ein Drittel aller PNR mehr als 100 Gemeinden umfasst (FPNRF 2023m: 10–11).
Abbildung 1 Die 59 regionalen Naturparks in Frankreich (Quelle: Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, FPNRF)
Die PNR repräsentieren eine Vielfalt der Gebiete von ganz Frankreich mit Ausnahme von Großstädten und von Kernstädten großer Agglomerationen und Metropolen wie Bordeaux, Lyon, Marseille und Paris. Anaïs Carrière unterscheidet drei Typen von PNR: erstens stark urbanisierte PNR mit hoher Bevölkerungsdichte (> 200 Einw. pro km²) und hoher Bodenversiegelungsrate (Artifizialisierung > 8 % der Fläche), zweitens stadtnahe PNR mittlerer Bevölkerungsdichte (50 bis 200 Einw. pro km²) und mittlerer Bodenversiegelungsrate (Artifizialisierung 5–8 % der Fläche) und drittens ländliche PNR mit niedriger Bevölkerungsdichte (< 50 Einw. pro km²) und niedriger Bodenversiegelungsrate (Artifizialisierung < 5 % der Fläche) (Carrière 2022: 38–40).
Zum ersten Typ der stark urbanisierten PNR zählt sie acht PNR, darunter die vier um Paris gelegenen PNR Gâtinais français, Haute Vallée de Chevreuse, Oise – Pays de France und Vexin français wie auch die beiden in der Nähe von Nantes an der Atlantikküste gelegenen PNR Brière und Golf du Morbihan. Zum zweiten Typ meist stadtnaher PNR gehören 21 PNR, darunter jene in den Vogesen (Ballons des Vosges, Vosges du Nord), verschiedene PNR in voralpinen Gebieten wie die PNR Chartreuse, Luberon, Massif des Bauges und Verdon sowie die drei am Ärmelkanal gelegenen PNR Baie de Somme Picardie Maritime, Boucles de la Seine Normande und Caps et Marais d’Opale. Und zum dritten Typ ländlicher PNR mit insgesamt 27 PNR zählt sie PNR in den Voralpen wie den PNR Verdon, drei der vier in der Normandie gelegenen PNR (Marais du Cotentin et du Bessin, Normandie‐Maine, Perche) sowie die meisten in und um das Zentralmassiv gelegenen PNR (u. a. Causses du Quercy, Grands Causses, Haut‐Languedoc, Monts d’Ardèche). Mehr oder weniger große Teile dieser PNR gehören zum »peripheren« ländlichen Raum, der in Frankreich auch als »hyperruraler Raum« (Rieutort 2018) bezeichnet wird und mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert ist als die stark urbanisierten PNR im Einflussbereich großer Kernstädte.
Die PNR stellen keine homogenen Gebiete dar und sind auch innerhalb ihres jeweiligen Gebiets räumlich unterschiedlich stark städtisch oder ländlich geprägt. Es gibt PNR, die von städtischen und periurbanen Gemeinden geprägt sind, solche, die vor allem aus periurbanen Gemeinden oder ländlichen Gemeinden bestehen, und solche, die gleichzeitig periurban und ländlich geprägt sind (FPNRF 2017g). Die Bandbreite von PNR reicht also von PNR, die stark städtisch ausgerichtet und mit den umliegenden Kernstädten von Agglomerationen und Metropolen beispielsweise als Wohngebiete für Arbeitspendler und ‑pendlerinnen oder als Arbeitsorte stark verbunden sind, bis hin zu PNR, die als ländlich‐peripher bezeichnet werden können und Mühe haben, attraktive Arbeitsplätze zu erhalten.
Die FPNRF berechnete den Anteil der städtischen Gemeinden aller Gemeinden in den PNR auf knapp acht Prozent, wobei in den Städten fast 30 Prozent der Bevölkerung aller PNR wohnen (FPNRF 2017g). Ein großer Teil der Gebiete der PNR besteht im Sinne von Monique Poulot, Claire Aragau und Lionel Rougé aus »urbaner Peripherie« und »periurbanen ländlichen Gebieten« (Poulot et al. 2018), die dank der modernen Transport‐ und Kommunikationsmittel ein städtisches Leben im ländlichen Raum ermöglichen, wobei die Vorteile der Städte mit ihren Arbeitsplatz‑, Kultur‐ und Dienstleistungsangeboten mit den Vorteilen des Ländlichen wie naturnaher Freizeitangebote und Leben im Grünen kombiniert werden können.
Die Gebiete der PNR wie auch die verschiedenen Gebiete innerhalb eines PNR unterscheiden sich nach weiteren Kriterien (FPNRF 2017g). Es gibt PNR und Gebiete innerhalb von PNR, die mehr oder weniger von touristischen Aktivitäten, intensiver oder extensiver Land‐ und Forstwirtschaft, Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzverlusten oder der Zunahme von Arbeitsplätzen, Zu‐ oder Abwanderung, Bevölkerungszunahme oder ‑abnahme, Verstädterung und Zersiedelung etc. betroffen sind (Jean & Rieutort dir. 2018). Bezüglich sozioökonomischer Kriterien scheinen die PNR insgesamt etwas besser abzuschneiden als vergleichbare Gebiete ohne PNR, wobei dies nicht zwingend allein mit den Aktivitäten der PNR in Verbindung gebracht werden kann. Die PNR sind attraktive Gebiete für zuziehende Familien, ortsungebundene Betriebe, Ferienhaus‐ und Zweitwohnungsbesitzer und ‑besitzerinnen aus den Kernstädten und weiteren städtischen Gebieten.
Die Attraktivitäten der PNR bringen diesen immer wieder auch Kritik ein: Die PNR würden dank ihrer natürlichen und landschaftlichen Bedingungen und ihrer meist restriktiven Raumentwicklungs‑, Landschafts‐ und Siedlungspolitik immer mehr zu Gebieten für sozioökonomisch besser gestellte Bevölkerungsgruppen, und sie würden indirekt über ihre restriktiven Politiken, beispielsweise in der Raumplanung und Raumentwicklung allgemein, sozioökonomisch schlechter gestellte, insbesondere auch »unerwünschte« Bevölkerungsgruppen ausschließen (Desponds 2007). Diese Kritik ist ernst zu nehmen, befinden sich doch manche PNR wie jene um Paris, aber auch solche an den Küsten, im Zentralmassiv und in den Voralpen im Einflussbereich von Kernstädten mancher Agglomerationen und Metropolen. Die PNR haben gerade die Aufgabe, »grüne Lungen« im zunehmend verstädterten Raum zu bleiben, die Siedlungsentwicklung einzugrenzen und eine strengere Natur‐ und Landschaftsschutzpolitik als die anderen Gebiete um die urbanen Zentren herum zu betreiben, was je nach Bevölkerungsgruppe Vor‐ oder Nachteile mit sich bringen kann.
Werden die PNR also immer mehr zu »Oasen des Glücks«, zu »Inseln hoher Lebensqualität« für sozioökonomisch besser gestellte Bevölkerungsgruppen? Sorgen die rund 40 Fachpersonen, die ein PNR durchschnittlich beschäftigt, mit ihren Tätigkeiten also für den Ausschluss ganzer Gruppen? – Ohne verfügbare diesbezügliche Daten ist nur eine hypothetische Antwort möglich: Es ist gut möglich, dass insbesondere PNR in stark urbanisierten Gebieten indirekt und unbeabsichtigt eine gewisse soziale Segregation fördern und zu attraktiven Wohn‐ und Freizeitgebieten für mobile und sozioökonomisch gut gestellte Bevölkerungsgruppen werden. Aber in PNR, die stark ländlich geprägt sind und hohe Anteile ländlich‐peripherer Gebiete aufweisen, dürften integrative Wirkungen wie der Erhalt und die Förderung von Arbeitsplätzen eher überwiegen, wie im zweiten und dritten Teil dieses Buches erläutert wird.
Im ersten Teil des Buches werden die Entstehungsgeschichte und der Werdegang der PNR nachgezeichnet. Aufgezeigt wird insbesondere, wie sich die PNR über rund sechs Jahrzehnte konzeptionell und inhaltlich bis zum heutigen Selbstverständnis als Akteure, die den lokal‐regionalen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit fördern und beschleunigen wollen, entwickelten. Die Gliederung der Kapitel zum Werdegang der PNR erfolgt nach Jahrzehnten seit Erlass des ersten Dekrets zu den PNR 1967. Diese pragmatische Gliederung nach Jahrzehnten ermöglicht, die vielfältigen Facetten und Herausforderungen, welche die Entwicklung der PNR mitprägten, nachvollziehbar aufzuzeigen und diese vor dem jeweiligen Zeitgeist einzuordnen. Die Gliederung nach Jahrzehnten wurde auch deshalb gewählt, weil die PNR im Hinblick auf ihre runden Geburtstage (seit Erlass des ersten Dekrets zu den PNR) im Rahmen ihres nationalen Verbandes, der FPNRF, oft selbst grundlegende Diskussionen führten, welche das anschließende Jahrzehnt mitprägten.
Der zweite Teil ist sodann den wesentlichen Transformationsbereichen der PNR, die sich im Laufe der Zeit schwerpunktmäßig herausgebildet haben, gewidmet. Mit Bezug zu den Kapiteln im ersten Teil wird aufgezeigt, wie die verschiedenen Transformationsbereiche entstanden sind und wie sie sich bis zur heutigen Ausgestaltung entwickelt haben, was die PNR konkret tun, welches ihre Handlungsspielräume und auch die Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten sind und mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind.
Die Kapitel im abschließenden dritten Teil ordnen sodann die PNR als Akteure des Wandels in die Diskussion um die gesamtgesellschaftliche Transformation Richtung Nachhaltigkeit ein. Zum Abschluss des dritten Teils und als Ausblick wird im letzten Kapitel 19 der Versuch gewagt, mögliche Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der PNR aufzuzeigen.
Vorliegender Text ist das Ergebnis eines gut zweieinhalb Jahre dauernden Projekts von Sommer 2022 bis Januar 2025. Nach einer systematischen Literatur‐ und Dokumentenrecherche anhand von Stichworten in Datenbanken und intensiver Lektüre wurde in einer zweiten Phase zu jedem PNR ein Porträt erstellt mit wesentlichen Angaben zum Gebiet (Lage, Natur, Kultur, Landschaft, sozioökonomische Situation), einer kurzen Entstehungsgeschichte des PNR, zu Herausforderungen aus Perspektive nachhaltiger Entwicklung, Governance‐Aspekten (Organisation, Akteure, Finanzierung), Handlungsachsen, Maßnahmen und speziellen Aktivitäten sowie einer allgemeinen Würdigung der Charta und der Aktivitäten vor dem Hintergrund der Transformationsdebatte. Dazu wurden zu jedem PNR insbesondere die Website, die bestehenden Evaluationen der Chartas, die neueste Zustandsbeschreibung des Gebiets, die aktuelle Charta, allfällig vorhandene Dokumente zum Stand der Überarbeitung der Charta sowie die neuesten Nummern der Magazine oder andersartiger Informationsmedien der PNR gesichtet. Der 59. PNR Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude in der Bretagne, der erst Ende 2024 geschaffen wurde, konnte nicht einbezogen werden. Auch konnten nicht alle Dokumente zu allen PNR beschafft werden, sodass einige Porträts nicht vollständig abgeschlossen werden konnten. Trotzdem entstand von den meisten PNR ein angemessen differenziertes Bild ihrer Herausforderungen, Handlungsachsen, Maßnahmen und Governance.
In einer dritten Phase standen die Konzipierung und inhaltliche Skizzierung des Manuskripts im Vordergrund, wozu die Porträts grob ausgewertet und insbesondere auch die Dokumente des Verbands der PNR, also der FPNRF, miteinbezogen wurden. Eher überraschend zeigte sich in dieser Phase, dass die PNR in Perspektive der Debatte um die Transformation ländlicher Räume Richtung Nachhaltigkeit stärker als Transformationsakteure tätig sind als ursprünglich angenommen. Das weitverbreitete Bild von Naturparks als attraktive Naturgebiete, in denen insbesondere naturnaher, sanfter Tourismus, Regionalprodukte und Umweltbildung gefördert werden, gilt für die meisten PNR schon längere Zeit nicht mehr. Sie sind in verschiedenen für die Zukunftsgestaltung ländlicher Räume wesentlichen Transformationsbereichen aktiv (s. die Kapitel in Teil 2) und können als eigentliche Akteure lokal‐regionaler Transformationen Richtung Nachhaltigkeit gelesen werden (s. dazu die Kapitel in Teil 3).
So ergab sich eine andere Kapitelstruktur und auch eine andere inhaltliche Ausrichtung als ursprünglich angedacht. Dies bringt sowohl Vorteile wie auch Nachteile mit sich. Anstatt die Vielfalt der PNR und ihrer spezifischen Herausforderungen, Aktivitäten und Lösungsansätze anhand konkreter Beispiele aufzuzeigen, werden die diesbezüglichen Gemeinsamkeiten der PNR in den Vordergrund gerückt. Der Fokus liegt auf den allgemeinen Entwicklungen der PNR und der Einordnung dieser, was die Lektüre etwas weniger anschaulich macht als das Aufrollen der Vielfalt der PNR anhand konkreter Beispiele. Die Ausführungen sind theoretischer geworden als ursprünglich geplant. Das Buch richtet sich deshalb insbesondere an Personen, die mit Naturparkarbeit vertraut sind, und an Studierende, Forschende und Fachpersonen, die sich gezielt mit dem »Naturparkmodell« der PNR in Frankreich auseinandersetzen wollen.
Ein Ziel ist es, mit dieser ersten deutschsprachigen Monografie über die PNR in Frankreich eine Übersicht über ihren Werdegang, ihre Aktivitätsfelder, ihre Arbeitsweisen und institutionelle Verankerung zur Verfügung zu stellen und damit deren »unsichtbare Arbeit im Hintergrund« und ihre »Kultur der Diskretion« (Cosson 2022: 190) sichtbar zu machen. Insbesondere sollen ihre doch sehr spezifische Funktionsweise und ihr besonderer Stellenwert im behördlich‐administrativen System Frankreichs, die den wesentlichen Wert der PNR ausmachen, offengelegt werden. Und nicht zuletzt sollen Überlegungen zur ideengeschichtlichen und theoretischen Einordnung des Werdegangs und des Selbstverständnisses der PNR aus Perspektive der Diskussionen über die Zukunft ländlicher Räume und ihre Transformation Richtung Nachhaltigkeit für weitere Diskussionen zur Verfügung gestellt werden.
Als ergänzende und vertiefende Lektüre bietet sich das aktuelle Standardwerk zu den PNR Les parcs naturels régionaux: Des territoires en expériences von Nacima Baron und Romain Lajarge an (Baron & Lajarge 2017). Die Beiträge zum Themenschwerpunkt Les Parcs naturels régionaux: Une expérience d’aménagement durable? in der Revue Pour geben Einblicke in verschiedene Aktivitätsfelder und Erfahrungen der PNR wie auch in Diskussionen zu aktuellen Entwicklungen der PNR (Revue Pour 2022/2: 149–343). Schließlich publiziert die FPNRF manche Studien über verschiedenste Themen zu den PNR. Diese sind über deren Website zugänglich. Hervorgehoben werden hier die Publikation Valeur spécifique de l’action des Parcs naturels régionaux (FPNRF 2017b) und das zweimal jährlich erscheinende Magazin der FPNRF Parcs – Le magazine des Parcs naturels régionaux, die einen guten Einblick in die Vielfalt der Aktivitäten geben und diesbezügliche gute Beispiele thematisieren. Ebenso betreiben die PNR eigene Websites, auf denen sie ihre Dokumente und Informationen zur Verfügung stellen und Einblicke in ihre Tätigkeiten ermöglichen. Zur Einordnung der Diskussion um die PNR in jene um die Zukunft ländlicher Räume in Frankreich bietet der von Yves Jean und Lionel Rieutort koordinierte Sammelband Les espaces ruraux en France (Jean & Rieutort dir. 2018) vertiefende Lektüre. Und schließlich ermöglicht die Publikation Tableau de bord des aires protégées françaises 2021 der UICN France, die PNR ins Schutzgebietssystem Frankreichs einzuordnen (UICN France 2021).
Teil 1Entstehung und Werdegang der Regionalen Naturparks (PNR) in Frankreich
Kapitel 2Die PNR‐Idee entsteht
Vorgeschichte bis zum Erlass des ersten Dekrets zu den PNR 1967
Die Entstehung der Idee der PNR nachzuzeichnen, beinhaltet, sich in die Zeit der 1950er‐ und 1960er‐Jahre hineinzuversetzen und sich dabei den zentralstaatlichen Umgang mit den damaligen Herausforderungen der ländlichen und städtischen Gebiete zu vergegenwärtigen. Damit ist bereits ausgesagt, dass die staatlichen Behörden die wesentlichen Akteure in der Entstehung der PNR‐Idee waren. Diese nahmen die damaligen Geistesströmungen auf, die der Soziologe André Micoud aufgrund seiner hermeneutischen Interpretation von Quellen der damaligen Zeit in Aux origines des parcs naturels français (1930–1960) (Micoud 2007) mit drei Begriffen zusammenfasst: Ruralismus, Naturalismus und Spiritualität. Und diese sind wiederum in einem Kontext entstanden, die eine Vorgeschichte haben. Dazu gehören die traumatischen Erfahrungen der beiden Weltkriege mit den vielfältigen Zerstörungen von Kultur und Natur, die Wirtschaftskrise in den 1930er‐Jahren wie auch die an den Zweiten Weltkrieg anschließende Industrialisierung, Verstädterung, Infrastrukturausrüstung und die umfassende »Modernisierung« von Wirtschaft und Gesellschaft.
Ruralismus, Naturalismus und Spiritualität sind dabei in sich nicht homogene Geistesströmungen, sie überschneiden sich und können nicht scharf voneinander abgegrenzt werden. Aber zusammen haben sie nach André Micoud zu einer »Bewegung« geführt, aus der die Parks Frankreichs – Nationalparks und regionale Naturparks – hervorgegangen sind. Zum Ruralismus gehören beispielsweise Sorgen zum Überleben der Landwirtschaft, des Handwerks und lokaler Kulturen, Vorstellungen zum Erhalt bedrohter ländlicher Lebensweisen, Traditionen, Bräuche und Bauweisen sowie Ideen zum Erhalt des landwirtschaftlichen und handwerklichen Kulturerbes wie auch zur zukunftsgerichteten Gestaltung ländlicher Räume. Ruralismus umfasst vielfältige und durchaus auch konfligierende Sichten zum Erhalt und zur Gestaltung ländlicher Räume.
Wie der Ruralismus ist auch der damalige Naturalismus eine in sich nicht kohärente Geistesströmung mit unterschiedlichen Natur‑, Naturnutzungs‐ und Naturschutzvorstellungen. Dazu gehören Vorstellungen von vom Menschen unberührter Natur und vor dem Menschen zu schützender Natur (»unberührte Natur«, »Wilderness«), Vorstellungen von Natur als vom Menschen geschaffene und für den produzierenden Menschen zu erhaltende Natur (»bäuerliche Natur«) wie auch Vorstellungen von Natur als menschliche Umwelt, als Grünraum zur Erholung des städtischen Menschen, zur Freizeitgestaltung, zur Gesundheitsförderung und zur touristisch‐wirtschaftlichen Nutzung (»Natur als Mitwelt«).
Ruralismus und Naturalismus haben im Sinne von André Micoud eine gemeinsame »ideologische Dimension«, die er – in seinen eigenen Worten »absichtlich etwas provozierend« (Micoud 2007: 3) – als Spiritualität bezeichnet. In seiner Analyse relevanter Texte findet er Aussagen, die mehr auf Verlustängsten, Einstellungen, Grundannahmen und »quasi‐religiösem Respekt« als auf Begründungen beruhen, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Schutz von »wilden Pflanzen und Tieren«, dem »Erhalt der bäuerlichen Natur« und »bäuerlicher Lebensweisen« sowie dem »Zurück zum Wesentlichen«. Die Spiritualität respektive die »ideologische Dimension« von Ruralismus und Naturalismus umfasst insbesondere auch kritische Perspektiven auf die immer mehr Lebensbereiche durchdringende Modernisierung, die jedoch die verschiedenen Gebiete in Frankreich und die sozialen Gruppen in unterschiedlicher Weise betrifft. Die »Moderne« wird im Sinne von André Micoud schon in damaliger Zeit auch als diffuse Gefahr, welche grundlegende kulturelle Werte bedroht, wahrgenommen.
Die Bewältigung der Folgen des Zweiten Weltkriegs ging in den 1950er‐Jahren in zunehmend schnellere Veränderungen der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft und damit auch der städtischen und ländlichen Gebiete, der Natur und der Lebensweisen der Menschen über. Eine beschleunigte Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft setzte ein, die von manchen Akteuren – aber nicht von allen – als Fortschritt und positiv bewertete Modernisierung wahrgenommen wurde. Die »goldenen 30 Jahre«, wie die Zeitspanne bis zur breiten Wahrnehmung von Krisenerscheinungen Mitte der 1970er auch in Frankreich genannt wird, setzten ein. Die Mechanisierung, Motorisierung, Intensivierung und Chemisierung der Landwirtschaft führten zu Produktivitätsschüben, ermöglichten eine verbesserte Versorgung insbesondere der wachsenden städtischen Bevölkerung mit Lebensmitteln und trugen wesentlich zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen in stark von der landwirtschaftlichen Modernisierung betroffenen ländlichen Gebieten bei. Die Modernisierung der landwirtschaftlichen Produktion veränderte großflächig die Feldstrukturen und die bäuerliche Landschaft, insbesondere in den Tiefebenen, Flusstälern und weiträumigen flachen Gebieten. Die Landwirtschaftsbetriebe vergrößerten sich und machten manche Kleinbetriebe und landwirtschaftlich Beschäftigte überflüssig.
Die Industrialisierung der Nahrungsmittelerzeugung und der vormals größtenteils handwerklichen Produktion von Gütern führte zur Ausweitung der Industrieflächen, der Menge und der Vielfalt der produzierten Güter wie auch der Anzahl der Beschäftigten im verarbeitenden Sektor. Einkommen, Kaufkraft und Konsum von Gütern und Dienstleistungen nahmen zu. Parallel dazu weitete sich der Dienstleistungssektor aus und schuf neue Arbeitsplätze, so im Gesundheits‑, Schul‑, Verwaltungs‑, Transport‑, Handels‑, Versicherungs‐ und Bankenwesen.
Insbesondere durch Zuwanderung aus ländlichen Gebieten begannen die Städte bezüglich Bevölkerung und noch stärker bezüglich Fläche durch die regen Bautätigkeiten schnell zu wachsen. Es entstanden auch manch neue Städte. Höhere Schulen, moderne Spitäler und neue gut bezahlte Arbeitsstellen entstanden insbesondere in städtischen Gebieten. Dies führte auch zu Versorgungs‐ und Wohlstandsunterschieden zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Die Infrastrukturausrüstung (Verkehrssysteme, Energieinfrastrukturen), die Motorisierung der Haushalte (Auto, Motorrad) und der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel ermöglichten in kurzer Zeit eine schnelle Ausweitung des Mobilitätsradius.
Innerhalb kurzer Zeit veränderte sich damit das Leben breiter, insbesondere städtischer Bevölkerungsgruppen massiv. Freizeitgestaltung, Naherholung und Mobilität wandelten sich von Luxusgütern zu Grundbedürfnissen. Wochenendausflüge, Ferien am Meer oder in der Natur wurden zur Norm. Der Tourismussektor begann zu boomen. Manche Gebiete an den Küsten und in den Bergen verändern sich rasant aufgrund der touristischen Infrastrukturausrüstung, des Baus von Ferienhäusern und ganzer Feriensiedlungen.
Verstädterungsprozesse setzten verstärkt auch im ländlichen Raum ein. Doch gab es auch viele Gegenden insbesondere in den Hügel‐ und Berggebieten, die von diesen Entwicklungen wenig betroffen waren. Elektrifizierung der Haushalte, private Motorisierung sowie Mechanisierung und Motorisierung der Landwirtschaft begannen sich zwar auch in diesen Gebieten durchzusetzen, doch konnten »abgelegene« oder »periphere« Gebiete mit manchen modernen Errungenschaften schlicht nicht mithalten. Es entstanden nur wenige neue und einkommensstarke Arbeitsplätze; die Infrastrukturausrüstung hinkte hinterher; die Gesundheitsversorgung verbesserte sich weniger schnell als in städtischen Gebieten; die Lohn‑, Kaufkraft‐ und Wohlstandsunterschiede vergrößerten sich. So wanderte ein Großteil der jungen Bevölkerung in städtische Gebiete ab. Trotz nationalen Bevölkerungswachstums setzte in peripheren Gebieten ein Bevölkerungsrückgang ein, was in Frankreich, zugespitzt formuliert, auch als »Entleerung ländlicher Gebiete« oder sogar als »ländliche Desertifikation« bezeichnet wurde.
In diesem Kontext der beginnenden schnellen Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Natur der »goldenen 30 Jahre« entstand das oben erläuterte Denkkonglomerat aus Ruralismus, Naturalismus und Spiritualität. Dieses beinhaltet zumindest implizit grundlegende Kritik an dem alle Lebensbereiche durchdringenden Modernisierungsmodell. Die traditionelle ländlich‐bäuerliche Lebensweise wurde marginalisiert und immer mehr zu einer Randerscheinung. Althergebrachte Lebensweisen, über Jahrhunderte sich nur langsam entwickelnde bäuerliche und handwerkliche Tätigkeiten, dörfliche Bauweisen und landschaftliche Prägungen wurden von manchen als bedroht und ihr Verschwinden als Verlust wahrgenommen. Der französische historische Soziologe Jean‐Pierre Le Goff beschreibt in La fin du village eindrücklich, wie in einem Dorf im heutigen PNR Luberon der gesellschaftliche Wandel vonstattenging und wie dieser empfunden wurde (Le Goff 2012). Nachvollziehbar wird, dass es zwar kein Zurück zu der oft verklärten und idealisierten traditionellen ländlich‐bäuerlichen Lebensweise gibt, dass diese aber schon Elemente enthielt, denen auch in heutiger Zeit noch immer – oder sogar wieder mehr – nachgetrauert wird. Dazu gehören Elemente wie die dörfliche Solidarität, Nachbarschaftshilfe, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, gegenseitiger Tausch, Nutzung und Verarbeitung lokaler natürlicher Ressourcen, lokale Ressourcen‐ und Wirtschaftskreisläufe, lokale Spezialitäten und Bauweisen und vieles mehr, was unterdessen wiederum in den Diskussionen um nachhaltige Entwicklung thematisiert wird. Der große Unterschied zu heute aber ist, dass diese Elemente damals eher aus Not an Alternativen als aus Überzeugung entstanden sind.
Im Sinne von Nacima Baron und Romain Lajarge hat der Ruralismus das französische Naturverständnis, das wesentlich durch die romantische Bewegung in Frankreich beeinflusst wurde, stark mitgeprägt (Baron & Lajarge 2017: 25–26). Die von Kunstschaffenden und Kunstschulen thematisierte und oft idealisierte Natur ist bewohnt, besteht aus naturnahen, vom Menschen mitgeprägten und gestalteten Landschaften (u. a. Jean‐Jacques Rousseau 1712–1778, Théodore Rousseau 1812–1867, Künstlergemeinschaft École de Barbizon 1820er‐ bis 1870er‐Jahre). Ruralismus und Naturalismus gehen ineinander über. Die durch Landbewirtschaftung geschaffene Natur wird als konstitutiver Bestandteil der Natur gesehen. Damit grenzt sich dieses Verständnis etwa vom damals in den USA stark verbreiteten Naturverständnis ab, welches Natur als »vom Menschen unberührte Wildnis« sieht.
Das Verständnis von Natur als vom Menschen unberührte Natur ist im Naturschutzdenken in Frankreich ebenfalls vorhanden, was beispielsweise die bereits ab Ende des 19. Jahrhunderts diskutierten Projekte zur Gründung von Nationalparken in Frankreich belegen (s. dazu Mauz 2002, 2009). Doch haben die Weltkriege, die Wirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit und der im Vergleich zu Deutschland etwas später einsetzende Wirtschaftsaufschwung die Projekte zur Gründung gesetzlich geschützter Nationalparks bis 1960 (gesetzliche Grundlage) respektive bis 1963 (offizielle Anerkennung der beiden ersten Nationalparks) verzögert.
Lokale Naturschutzbestrebungen gehen in Frankreich bis mindestens in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und nehmen gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der Ausweitung landwirtschaftlicher und infrastruktureller Projekte, insbesondere der Eisenbahnprojekte ab Mitte des 19. Jahrhunderts, zu. Bis die vielfältigen, insbesondere lokalen Naturschutz‐ und Umweltbewegungen auf nationaler Ebene breite Resonanz erzeugen konnten, dauerte es aber bis in die 1950er‐Jahre hinein. Ausnahmen bildeten Einzelprojekte wie der Wald von Fontainebleau in der Umgebung von Paris, der auf Initiative von Kunstschaffenden der Künstlergemeinschaft École de Barbizon bereits 1861 unter nationalen Schutz gestellt wurde und damit weltweit als eines der ersten national gesicherten Naturschutzgebiete gilt.
Die Wissenschaft trug ebenso schon in der Entstehungszeit der PNR‐Idee zur Sensibilisierung für Naturschutz‐ und Umweltschutzanliegen bei. Bücher wie jene des französischen Botanikers Roger Jean Heim Destruction et protection de la nature (Heim 1952), der amerikanischen Biologin und Ökologin Rachel Carson Printemps silencieux (Carson 1963), des französischen Biologen und Ornithologen Jean Dorst Avant que la nature meure (Dorst 1965) und des französischen Ornithologen Michel‐Hervé Julien L’homme et la nature (Julien 1965) sind in Frankreich breit rezipiert worden. Naturschutz‐ und Umweltbewegungen sowie Umweltforschung und wissenschaftliche Ökologie haben Wahrnehmung und Denken der Akteure, auch der nationalen Behörden, beeinflusst.
Das Ende der 1950er‐ und die beginnenden 1960er‐Jahre stellten auch den Beginn der großen staatlichen Raumentwicklungsvorhaben dar (Baron & Lajarge 2017: 21 ff.). 1957 entstand ein erster nationaler Raumentwicklungsplan. 1958 startete das nationale Programm zur zivilen Nutzung der Atomkraft und zum Bau von Atomkraftwerken. 1960 richteten verschiedene Ministerien das Interministerielle Komitee für Raumentwicklung ein (CIAT). Im selben Jahr erschien der erste Gesamtplan eines nationalen Autobahnnetzes; Nationalversammlung und Senat verabschiedeten das Gesetz zur Gründung von Nationalparks. 1961 setzte die Politik zur Gründung neuer französischer Städte und zur Entlastung der Metropolen ein. 1962 begannen die Planungen zum Großflughafen Paris‐Charles‐de‐Gaulle. 1963 gründeten verschiedene Ministerien die Interministerielle Delegation für Raumentwicklung und regionale Attraktivität (DATAR). Im selben Jahr wurde die Struktur zur touristischen Entwicklung der Küstengebiete des Languedoc‐Roussillon gegründet. 1964 entstand sodann der erste Plan zur Entwicklung von großen Wintersportorten im Hochgebirge.
Zu den Ende der 1950er‐ und zu Beginn der 1960er‐Jahre einsetzenden nationalen Raumentwicklungspolitiken gehörte auch die 1960 mit dem Erlass des ersten Gesetzes zur Ausrichtung der Landwirtschaft eingeleitete und auf großflächige Modernisierung der landwirtschaftlichen Produktion ausgerichtete Agrarpolitik. Größere staatlich unterstützte Projekte und Programme zur Mechanisierung und Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion wurden möglich, so zur Bewässerung, Trockenlegung feuchter Flächen, Flurbereinigung und Landumlegung.
In wenigen Jahren waren damit große Flächen Frankreichs mit Raumentwicklungsvorhaben abgedeckt. Doch blieben manche ländlichen Gebiete noch »weiße Flecken« auf der nationalen Planungskarte. Zumindest zu Beginn der Blütezeit der großen staatlichen Raumentwicklungspolitiken standen die Anliegen peripherer ländlicher Gebiete und die Naturschutzanliegen zwar nicht im Vordergrund, aber sie waren bereits mitgedacht, was mit dem Nationalparkgesetz 1960 und der Gründung der Interministeriellen Delegation für Raumentwicklung und regionale Attraktivität (DATAR) 1963 zum Ausdruck kam.
Die staatlichen Behörden nahmen in dieser Zeit eine zwiespältige Rolle ein: Sie waren einerseits Treiber von Raumentwicklungspolitiken (Verkehrsplanung, Städteplanung, Tourismusförderung), die in der Umsetzung oft zu lokalen Widerständen führten. Gleichzeitig versuchten sie, die negativen Wirkungen dieser Entwicklungen mit einer ebenfalls in dieser Zeit entstehenden Natur‐ und Umweltschutzpolitik anzugehen. Im Zuge der großen Planungen wurden Natur‐ und Landschaftsschutz wie auch die Entwicklung peripherer ländlicher Gebiete in wenigen Jahren zu neuen staatlichen Politiken.
Nach Baron & Lajarge (2017: 36) können selbst auch die ersten aktenkundigen staatlichen Ideen und Anstrengungen, die schließlich zur Gründung der PNR führten, auf das Jahr 1958 datiert werden. Ihrer Recherche nach wurde 1958 ein erster verwaltungsinterner Bericht zur Gründung sogenannter vorstädtischer Parks (parcs suburbains) verfasst. Diese sollten integriert ländliche und forstliche Planungen sowie den Schutz von bedeutenden Orten ermöglichen. Der Beginn der unmittelbaren PNR‐Vorgeschichte kann entsprechend auf das Jahr 1958 datiert werden.
Die Konkretisierung der PNR‐Idee ist im Kontext dieser Zeit zu sehen, als die staatlichen Behörden die gesamte Fläche mit Planungspolitiken zu überziehen und infrastrukturell und sozioökonomisch zu entwickeln begannen. Dabei spielte die bereits erwähnte, am 14. Februar 1963 gegründete Interministerielle Delegation für Raumentwicklung und regionale Attraktivität (DATAR) eine wesentliche Rolle. Mit ihr entstand jenes behördliche Gefäß, in welchem die PNR‐Idee verwaltungsintern wesentlich reifte. Vertreter verschiedener Behörden, insbesondere aus den Bereichen Landwirtschaft, Raumentwicklung und Umwelt, dachten zu Beginn insbesondere daran, in der Umgebung der Metropolen, stark wachsender Städte und im industriellen Aufschwung befindlicher Gebiete großräumige Grün‐ und Freizeiträume zu schaffen, die für die Städte und deren Bevölkerung als Ausgleichsräume dienen und helfen sollten, Herausforderungen der Urbanisierung zu meistern. Ökologische Aspekte standen verwaltungsintern zumindest anfänglich noch nicht im Vordergrund. Vielmehr wurden die PNR als »natürliche Infrastruktur« besonders für Erholungs‐ und Freizeitnutzungen und Ausgleichsräume für die Städte gesehen.
Die Erhaltung der Natürlichkeit wurde vorerst instrumentell primär als Voraussetzung für Erholungs‐ und Freizeitnutzungen gesehen. Der Begriff »Regionalpark« wurde denn auch offiziell erstmals im Zusammenhang mit dem Begriff »natürliche Infrastruktur« im Zusammenhang mit Ausgleichsräumen für städtische Gebiete verwendet (1963 während einer parlamentarischen Debatte der Nationalversammlung). Doch bis zum Erlass des ersten Dekrets zu den PNR im Jahr 1966 entwickelte sich die Diskussion weiter. Im Grunde wurden vier wesentliche Aspekte vermehrt zusammengedacht und konzeptionell zusammengeführt:
erstens der soeben erwähnte Aspekt der Naherholung und Freizeitgestaltung für die städtische Bevölkerung: In den Augen staatlicher Behörden benötigten die Metropolen Ausgleichs‑, Naherholungs‐ und Freizeiträume für die wachsende städtische Bevölkerung. Agglomerationsnahe Wälder und naturnahe Gebiete sollten dazu erhalten und mit »leichten« Infrastrukturen wie Parkplätzen, Anschlüssen an öffentliche Verkehrsmittel, Wanderwegen, Picknick‐ und Spielplätzen ausgerüstet werden können.
zweitens der weiter oben auch schon erwähnte Aspekt der sozioökonomischen Entwicklung peripherer ländlicher Gebiete: Verantwortungsträger der staatlichen Behörden erkannten im Zuge der Konzipierung der staatlichen Raumentwicklungsinstrumente und der Agrarpolitik schon bald, dass mit den Modernisierungsprogrammen nicht alle ländlichen Gebiete erreicht werden können.
drittens der Aspekt des Natur‐ und Landschaftsschutzes: Weitere Behördenvertreter machten sich dafür stark, naturnahe Gebiete und bäuerliche Landschaften von besonderer Bedeutung (u. a. bezüglich Flora und Fauna, traditioneller Landnutzungsformen, Bauweisen und Siedlungsstrukturen) zu erhalten und diese nicht in die großflächige Agrarmodernisierung, Infrastrukturausrüstung und Siedlungsentwicklung einzubeziehen.
viertens der Aspekt der Suche nach einer zusätzlichen Alternative zu den Nationalparks als Schutzgebieten: Die staatlichen Behörden erkannten im Zuge der Arbeiten zur Gründung von Nationalparks schnell, dass die Nationalparkidee nur in wenigen Gebieten Akzeptanz finden dürfte und es insbesondere in stark landwirtschaftlich geprägten Gebieten ein alternatives und flexibleres Schutzinstrument braucht, wenn die Schutzflächen wesentlich ausgeweitet werden sollten. Dieses alternative Schutzinstrument sollte die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung ab Beginn einer Planung eines Schutzgebiets berücksichtigen und die Schutzauflagen nicht strikt »von oben« verordnen.
Letzter Aspekt, nämlich die Erkenntnisse aus der Diskussion um die Gründung von Nationalparks, hat die PNR‐Idee stark mitgeprägt. Beispielsweise wurde den Behörden autoritäres Verhalten, das bei der Gründung von Nationalparks und Naturreservaten in den ehemaligen Kolonien erlernt worden sei, vorgeworfen, und verschiedene lokale Akteure wehrten sich vehement gegen einen starken Naturschutz im Sinne von strikten Nutzungsverboten (Selmi 2009). Auch aufgrund der Erfahrungen mit der Gründung von Nationalparks entstand bei den beteiligten Behörden die Ansicht, dass es ein weiteres, »leichtes, kostengünstiges und nicht auf Zwang basierendes Instrument« braucht (Baron & Lajarge 2017: 49). In diesem Sinne ist die Entstehung der PNR‐Idee auch ein Ergebnis der Diskussionen um die Nationalparks.
Die inhaltliche Gemengelage der vier Aspekte zusammen führte insbesondere in den Jahren 1963 bis 1966 zur Idee, dass Regionalparks »eine Alternative zu Nationalparks sein sollten, die gleichzeitig Antworten auf die Probleme der Metropolen, der sensiblen Naturräume und der ländlichen Gebiete fernab der urbanen Zentren« geben, die zudem eine neue Form räumlicher Organisation hervorbringen und die insbesondere auch als eine Art »Sauerstoffblasen« (bulles d’oxygène) für städtische Gebiete dienen (Ferreti 2018: 11).
Für die Entstehung des behördlichen Willens, PNR als Raumentwicklungsinstrumente zu ermöglichen, waren verschiedene weitere Impulse von Bedeutung. Als der Landwirtschaftsminister Edgar Pisani 1963 Italien und Deutschland besuchte, ließ er sich in Deutschland vom Vorsitzenden des Vereins Naturschutzparke (VNP), Alfred Toepfer, direkt über die bereits vorhandenen Erfahrungen der Naturparks in Deutschland informieren. Im Juli 1964 führte sodann eine Delegation eine Studienreise in Deutschland, Belgien und den Niederlanden durch (Beaugé 2007). Auch die Delegation kehrte von der Regionalparkidee überzeugt nach Hause zurück. Der Landwirtschaftsminister und das DATAR leiteten danach den Prozess zur konkreten Erarbeitung einer neuen Form von Schutzgebieten ein. Diese sollte weniger einschränkend als jene der Nationalparks sein und in bewohnten ländlichen Gebieten mit bedeutendem Kulturerbe umgesetzt werden können.
So entstand eine Argumentationslinie für die Gründung von Naturparks, in der drei Punkte hervorgehoben wurden (Baron & Lajarge 2017: 53–55): Erstens sollten sich die Regionalparks an den Erfahrungen der Nationalparke in Frankreich orientieren, insbesondere in den Bereichen des Managements natürlicher Gebiete und des Besucherempfangs. Die Regionalparks sollten sich ebenso an den Erfahrungen der in Deutschland geschaffenen Naturparks und insbesondere am Naturschutzpark Lüneburger Heide orientieren. Letzterer umfasste schon damals großflächige Gebiete über verschiedene administrative Einheiten hinweg. Interessant war deshalb insbesondere die Frage, wie die Naturparks in Deutschland institutionell verankert, organisiert und finanziert sind. Drittens sollten Naturparks in Frankreich aufgrund der Erfahrungen in Deutschland unter staatlicher Aufsicht gegründet und verwaltet werden (also nicht privat), und sie sollten die staatlichen Anstrengungen zum Schutz und zum Erhalt der entsprechenden Gebiete wesentlich vorantreiben.
Auf dieser Grundlage wurde im Landwirtschaftsministerium noch 1964 ein Vorprojekt eines Dekrets zur Schaffung von Regionalparks erarbeitet. In diesem Vorprojekt wurden primär institutionelle Fragen und die touristische »Inwertsetzung« thematisiert. Damit übernahm das Ministerium für Landwirtschaft den Lead im Entstehungsprozess. Stärker in den Vordergrund rückte der Aspekt der Regionalentwicklung: Regionalparks sollten insbesondere auch die sozioökonomische Entwicklung in Gebieten, die vom wirtschaftlichen Aufschwung wenig betroffen waren, voranbringen. Die touristische »Inwertsetzung« dieser Gebiete wurde als angemessenes Mittel gesehen, und dafür war der Erhalt der natürlichen Qualität und Attraktivität dieser Gebiete zentral. Ein weiterer Aspekt war von Bedeutung: Die Mechanisierung und Intensivierung der Landwirtschaft war in vollem Gang und wurde staatlich massiv gefördert. Doch war gerade den Akteuren im Landwirtschaftsministerium klar, dass die Landwirtschaft im Hügel‐ und Berggebiet diesbezüglich nicht mithalten kann und diese Gebiete alternative Instrumente sozioökonomischer Entwicklung benötigen.
Die in der Verwaltung geführten Diskussionen um die vielfältigen und teils widersprüchlichen Vorstellungen zu den Zielen von Regionalparks mündeten Ende 1964 in die Schaffung einer Arbeitsgruppe mit Vertretern von zwölf Ministerien, dabei auch die Ministerien Jugend und Sport, Kultur und Bauten (Baron & Lajarge 2017: 62–71). Die Diskussionen innerhalb dieser Arbeitsgruppe führten im Februar 1965 zu einer ersten Umschreibung: Ein Regionalpark soll ein großes ländliches Gebiet sein mit einer Fläche von 50 bis einigen 100 Quadratkilometern, in dem die natürliche Umgebung oder die Flora und Fauna, der Lebensraum, die architektonischen Sehenswürdigkeiten oder auch die Nähe zu großen Agglomerationen für die Erholung, Freizeitgestaltung und Tourismus einen außergewöhnlichen Wert haben. Ebenso wurde eine inhaltliche Ausgestaltung der Regionalparks vorgeschlagen und dabei die Regionalparkidee von den Vorstellungen »Luna Park« und »Nationalpark« abgegrenzt. Anschließend legte die Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge für Regionalparks und weitere Nationalparks und Naturreservate vor.
1965 begann die Interministerielle Delegation DATAR mit der Umsetzung eines ersten experimentellen Regionalparks Saint‐Amand‐Raismes nördlich von Lille (Lanneaux & Chapuis 1993: 520). Im selben Jahr wurde eine weitere Idee mit nunmehr elf anstatt nur sieben Regionalparks, die alle als eine Art Erholungsräume im weiteren Umfeld großer Städte gedacht sind, eingebracht. In den entsprechenden Departements begannen intensive Diskussionen um die Einrichtung von Regionalparks. Beteiligt waren insbesondere Bürgermeister von Gemeinden, Behörden der Departemente, die Interministerielle Delegation DATAR und das Nationale Forstamt (ONF).
Doch lösten diese ersten Diskussionen auf lokaler Ebene häufig mehr Widerstand als Begeisterung aus. Auf lokaler Ebene waren die Überlegungen zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen noch nicht so weit fortgeschritten, wie von den staatlichen Behörden angedacht. Auf lokaler Ebene setzten die Diskussionen nun aber voll ein. Die staatlichen Akteure hielten daran fest, Regionalparks als ein wichtiges Instrument ländlicher Entwicklung und einer das gesamte Staatsgebiet abdeckenden Planungs‐ und Entwicklungspolitik vorzusehen. Entsprechend wurde die Idee der Förderung von Regionalparks 1965 in den fünften nationalen Plan wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung für die Jahre 1966 bis 1970 aufgenommen. Die Regionalparks wurden auch 1965 noch mit Begriffen wie »suburbane und periurbane Grünräume« und »Regionalparks für Freizeit und Erholung« umschrieben. In den offiziellen Texten wurden Natur und Naturschutz weiterhin primär instrumentell im Sinne der Voraussetzung für Freizeitgestaltung und Erholung städtischer Menschen mitgedacht. Auch wenn noch nicht absehbar war, dass sich die Regionalparkidee auf lokaler Ebene durchsetzen kann, hatte sich bei den Fürsprechern der Regionalpark‐Idee eine neue Sicht etabliert: »Parks sind Instrumente, um die Moderne anders zu denken, um in wertvollen, aber empfindlichen Gebieten anders zu handeln, um die neue Natur‐Frage ernst zu nehmen« (Baron & Lajarge 2017: 69).
Das Jahr 1965 stellte ein Schlüsseljahr für die Entstehung der Regionalpark‐Idee dar. Über die verschiedenen Ministerien hinweg entstand ein zukunftsgerichtetes, pragmatisches inhaltliches Konstrukt, das verschiedene Politikbereiche zu einem innerhalb der Verwaltung akzeptablen Konzept verband. Dazu gehörten so unterschiedliche Inhalte wie der Erhalt von Grünräumen und Wäldern, Naturschutz und Schutz des Kulturerbes, die Begrenzung der Ausdehnung der städtischen Siedlungsräume in erhaltenswerte Wälder und naturnahe Gebiete hinein, die Schaffung von Erholungs‑, Ausgleichs‐ und Freizeiträumen für die wachsende Bevölkerung in den Städten, die Ausrüstung von Erholungsgebieten mit »leichten« Infrastrukturen, die Förderung eines naturnahen Tourismus, sozioökonomische Entwicklung peripherer Gebiete sowie die Ermöglichung einer flächendeckenden Raumentwicklung.
Dieses inhaltlich sperrige Konstrukt entstand durch die Zusammenarbeit verschiedener Behörden mit unterschiedlichen Anliegen, die ganz pragmatisch zur Lösung bestehender oder absehbarer Probleme ländlicher und städtischer Räume beitragen wollten. Die verschiedenen Ideen verdichteten sich mit der Zeit zu einem etwas schwammigen Konzept (im Folgenden PNR‐Konzept genannt), welches aber von den verschiedenen staatlichen Akteuren getragen wurde. Ob sich die staatlichen Akteure damals bewusst waren, dass sie gerade ein zukunftsträchtiges, inhaltlich integriertes und flexibles staatliches Förderinstrument erdacht hatten, konnte aufgrund der herangezogenen Texte nicht festgestellt werden.
Für die kritische Reflexion und weitere Ausdifferenzierung des PNR‐Konzepts sowie für den Einbezug weiterer Akteure inklusive der Öffentlichkeit in die Diskussion um die Gründung von Regionalparks ist das von der Interministeriellen Delegation DATAR initiierte Kolloquium in Lurs‐en‐Provence im späteren PNR Luberon in der Haute‐Provence vom 25. September bis 1. Oktober 1966 ein wichtiger Meilenstein (Baron & Lajarge 2017: 73 ff.). Es nahmen über 100 Persönlichkeiten mit unterschiedlichen fachlichen, beruflichen und ideologischen Hintergründen teil, so unter anderem Minister, Behördenvertreter, Politiker, Delegierte von Nichtregierungsorganisationen, Forschende, Zoologen, Ornithologen, Soziologen, Landwirte, Agrarfachleute, Umweltfachleute, Museologen, Städteplaner, Ingenieure, Architekten, Künstler und Journalisten.
Während des einwöchigen Kolloquiums wurden verschiedenste Themen rund um die Situation und die Zukunft der ländlichen Gebiete diskutiert. Insbesondere verdeutlichte sich, dass ein Regionalpark ein flexibles Instrument sein soll, das gleichzeitig den beteiligten Gemeinden, weiteren lokalen Akteuren und den staatlichen Behörden dient, mit welchem je nach lokal‐regionaler Situation die jeweils unterschiedlichen Herausforderungen der jeweiligen Gebiete angegangen und Schwerpunkte gesetzt werden können. Ein Regionalpark soll deutlich anders ausgerichtet sein als ein Nationalpark: »Im Unterschied zum Nationalpark, der ein Heiligtum der Natur sein soll und in dem sich der Mensch so diskret wie möglich verhält, ist der regionale Naturpark für den Menschen und von ihm gemacht« (Beaugé 2007: 9).
Das Medienecho auf das Kolloquium war groß. Heftige Kritik wurde insbesondere von Naturschutzakteuren vorgebracht, die das Fehlen der Forderung nach einem gesetzlich strengen Naturschutz bemängelten und befürchteten, dass in der praktischen Umsetzung Naturschutzanliegen weniger stark als sozioökonomische Anliegen gewichtet werden könnten. Insgesamt war nun die Diskussion um das PNR‐Konzept in einer breiteren Öffentlichkeit, in den Regionen und bei manchen lokalen Akteuren angelangt. Über die verschiedenen Perspektiven der Akteure hinweg zeichnete sich ab, dass die Schaffung von Regionalparks ein breit getragener Ansatz zur Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen in ländlichen Gebieten sein könnte.
Noch im selben Jahr begann ein rund halbjähriger Studien‐ und Ausbildungszyklus (Herbst 1966 bis Frühling 1967), an welchem behördliche oder private Fachpersonen teilnahmen, die mit der Abklärung der Gründung von Regionalparks beauftragt waren und/oder als mögliche erste Direktoren der jeweiligen Parkprojekte infrage kamen. Die 14 Teilnehmenden wurden ins Management von Schutzgebieten eingeführt, und sie besuchten Schutzgebiete in manchen europäischen Ländern und auch in den USA und Japan (Beaugé 2007: 9–10). Baron & Lajarge (2017: 80–82) sehen in diesem halbjährigen Studienzyklus den Beginn einer gelebten »gemeinsamen Kultur« der Regionalparkbewegung, welche den 1971 gegründeten Verband der regionalen Naturparks Frankreichs (FPNRF) bis heute auszeichnet.
Das vom Staatspräsidenten Charles de Gaulle sodann am 1. März 1967 unterzeichnete »Dekret zur Einrichtung von regionalen Naturparks« war entsprechend den vorangegangenen Diskussionen inhaltlich offen formuliert (Kasten 1). Mit der Bezeichnung »regionaler Naturpark« (PNR) war auch geklärt, dass die bis 1967 meist als »Regionalparks« bezeichneten Gebiete in Zukunft »regionale Naturparks« – im Folgenden mit PNR abgekürzt – genannt würden. Als Voraussetzung zur Einrichtung eines PNR wurden die Qualität des natürlichen und kulturellen Erbes, ein besonderes Interesse für die Erholung der Menschen und den Tourismus sowie ein allgemeines Schutz‐ und Gestaltungsanliegen thematisiert (s. Art. 1). Im Dekret wurden insbesondere institutionelle Fragen geregelt: Es wird eine interministerielle Kommission für die PNR gegründet (Art. 2), welche die allgemeinen Grundsätze der Politik in Bezug auf die PNR vorschlägt und diesbezügliche Maßnahmen koordiniert (Art. 3). Die Initiative für die Gründung eines PNR muss in Form eines Antrags von den Gemeinden, den Gemeindeverbänden oder den Departementen ausgehen (Art. 4). Der Präfekt der Region oder die Präfekten der betroffenen Regionen geben sodann der interministeriellen Kommission eine Stellungnahme ab. Diese wiederum unterbreitet der Regierung einen Vorschlag zur Berücksichtigung des Antrags. Bei positivem Regierungsentscheid beauftragt die Kommission den Präfekten oder die Präfektin der Region, mit den lokalen Gebietskörperschaften und den interessierten Gruppierungen eine Charta auszuarbeiten. In der Charta und allfälligen weiteren Dokumenten sind insbesondere die Trägerschaft des Parks, die Zweck‐ und Nutzungsbestimmungen der verschiedenen Flächen des Parks, die angestrebten Maßnahmen und deren Finanzierung zu klären (Art. 5). Die Trägerschaft ist zuständig für die Einrichtung eines operativen Managements, die Überwachung der Umsetzung der Charta und der Erneuerung dieser (Art. 6). Auch wurden im Dekret die allfällige Deklassierung eines PNR (Art. 7) sowie die Verantwortung der beteiligten Ministerien (Art. 8) thematisiert.
Der Präsident der Republik,
»auf Bericht des Premierministers, des Staatsministers für kulturelle Angelegenheiten, des Innenministers, des Ministers für Wirtschaft und Finanzen, des Ministers für Infrastruktur, des Landwirtschaftsministers und des Ministers für Jugend und Sport […],
verordnet:
Artikel 1: Das Gebiet einer oder mehrerer Gemeinden oder eines Teils davon kann als ›regionaler Naturpark‹ eingestuft werden, wenn es aufgrund der Qualität seines natürlichen und kulturellen Erbes von besonderem Interesse für die Erholung, die Ruhe der Menschen und den Tourismus ist und es wichtig ist, dieses zu schützen und zu gestalten. […].
Artikel 2: Beim Premierminister wird unter dem Vorsitz des Delegierten für Raumplanung und regionale Aktion eine interministerielle Kommission für die regionalen Naturparks, die sich aus Vertretern der Minister für kulturelle Angelegenheiten, des Innern, der Wirtschaft und Finanzen, der Infrastrukturen, der Landwirtschaft, von Jugend und Sport, des Tourismus sowie dem Generalkommissar für Planung zusammensetzt, eingerichtet. […].
Artikel 3: Die allgemeinen Grundsätze der Politik in Bezug auf regionale Naturparks werden von der Regierung auf Vorschlag der interministeriellen Kommission festgelegt. Diese verfolgt die Umsetzung dieser Politik und koordiniert die Maßnahmen der verschiedenen Verwaltungseinheiten. […].
Artikel 4: Die Initiative für jeden Antrag auf Einstufung eines Gebietes als regionaler Naturpark liegt bei den Gemeinden, Gemeindeverbänden oder Departementen, die für das jeweilige Gebiet zuständig sind. Auf einen solchen Antrag hin gibt der Präfekt der Region (oder geben die Präfekten der betroffenen Regionen) ihre Stellungnahme der interministeriellen Kommission ab. Die interministerielle Kommission unterbreitet der Regierung sodann unter Berücksichtigung der ihr vorgegebenen Richtlinien einen Vorschlag zur Berücksichtigung des Antrags. Für den Fall, dass die Regierung den Antrag in Betracht zieht, beauftragt die Kommission den Präfekten der Region (oder die Präfekten der Regionen), in Zusammenarbeit mit den lokalen Gebietskörperschaften und den interessierten Gruppierungen eine Charta gemäß Artikel 5 zu erstellen. […]. Die Einstufung als regionaler Naturpark erfolgt sodann per Dekret aufgrund des Berichts der in der Kommission vertretenen Minister.
Artikel 5: Voraussetzung für die Einstufung als regionaler Naturpark ist die Vorlage einer Charta und weiterer Dokumente, die insbesondere Folgendes beinhalten:
Die Gründung einer öffentlich‐rechtlichen oder privaten Körperschaft, die speziell mit der Einrichtung und Verwaltung des Parks beauftragt ist, unter Beteiligung von Vertretern der Parkbewohner, Grundeigentümer und Parknutzer […];
ein Plan des Parks, aus dem die Grenzziehung, die Lage der vorgesehenen Einrichtungen und die Zweck‑/Nutzungsbestimmungen der verschiedenen Zonen hervorgeht;
das Konzept der geplanten Einrichtungen und die Modalitäten ihrer Finanzierung;
die Maßnahmen, die im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften zu ergreifen sind oder die von lokalen Körperschaften, öffentlichen Einrichtungen und Privatpersonen ergriffen werden können;
ein Finanzierungsplan für die Ausrüstungen und die voraussichtlichen Maßnahmen […].
Artikel 6: Nach der Genehmigung übernimmt die Trägerschaft die Realisierung und das Management der ihr obliegenden Einrichtungen, die Betreuung des Parks, die Überwachung der Umsetzung der Charta, und sie macht gegebenenfalls Vorschläge zur Überarbeitung der Charta. Sie ernennt einen Direktor […].
Artikel 7: Die Deklassierung [als regionaler Naturpark] kann in derselben Form wie die Klassierung erfolgen, wenn die Planungen oder die Funktionsweise des Parks nicht mit der Charta übereinstimmen und den allgemeinen Grundsätzen der Politik im Bereich der Naturparks widersprechen. […].
Artikel 8: Der Premierminister, der Staatsminister für kulturelle Angelegenheiten, der Innenminister, der Minister für Wirtschaft und Finanzen, der Minister für Ausrüstung, der Minister für Landwirtschaft, der Minister für Jugend und Sport und der Staatssekretär beim Premierminister, zuständig für die Beziehungen zum Parlament, sind jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich für die Umsetzung des vorliegenden Dekrets […].«
Kasten 1 Dekret vom 1. März 1967 zur Einrichtung von regionalen Naturparks, publiziert im Journal officiel vom 2. März 1967 (Quelle: Revue juridique de l’Environnement 1985/3: 375–376)
Das im Dekret ausformulierte Förderinstrument erlaubte ländlichen Gebieten, von nun an eigene und sektorenübergreifende Zukunftsvorstellungen zu entwickeln und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, die bei erfolgreicher behördlicher Prüfung »von oben« unterstützt werden konnten. Gleichzeitig ermöglichte das Instrument, die staatliche Politik der verschiedenen Ministerien auf kommunaler Ebene einzubringen und damit die Umsetzung der staatlichen Politik auf lokaler Ebene voranzutreiben. Dass der Staatspräsident Charles de Gaulle das Dekret aus eigener Initiative selbst unterzeichnete (und nicht wie üblich der Premierminister Georges Pompidou) und gleich mehrere Ministerien in die Umsetzung eingebunden wurden, unterstreicht die außerordentliche Bedeutung, welche dieser neuen Politik gegenüber dem ländlichen Raum auf höchster staatlicher Ebene beigemessen wurde.
Das Dekret stellte zugleich einen ersten Meilenstein der damals eingeleiteten Dezentralisierungsbestrebungen dar: Die Gemeinden, Gemeindeverbände und Departemente erhielten die Möglichkeit, eigene Visionen lokal‐regionaler Entwicklung zu entwickeln und umzusetzen und dabei von den oberen Behördenebenen unterstützt zu werden.
Die damalige Ausgestaltung des PNR‐Konzeptes ist somit ein Ergebnis rund zehnjähriger Diskussionen innerhalb der nationalen Behörden und dieser mit lokalen Verantwortungsträgern, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Naturschützern und Naturschützerinnen, Kulturschaffenden, Journalisten und Journalistinnen und weiteren Akteuren. Die Beteiligten brachten verschiedenste Interessen und ideologische Positionen ein. Es gelang den nationalen Behörden, die teils konfligierenden Diskussionen zu einem in der nationalen Politik und bei lokalen Akteuren mehrheitsfähigen Konzept und regionalpolitischen Instrument zu integrieren.
Das damalige PNR‐Konzept war ein pragmatisches Produkt des Zusammenführens der damaligen politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskussionen in ein neues, einzigartiges und integriertes Konzept. Die praktische Umsetzbarkeit im politisch‐institutionellen Umfeld wurde stärker gewichtet als die ideologischen Positionen der verschiedenen beteiligten und betroffenen Akteure. Im Konzept sind Elemente der Diskussionen um Dezentralisierung, den »Niedergang« peripherer ländlicher Räume, lokale und regionale Entwicklung, Natur‐ und Landschaftsschutz, Agrarentwicklung, den Erhalt des Kultur‐ und Naturerbes sowie um Erholung und Freizeitgestaltung enthalten.