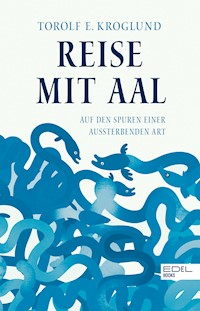
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Aale fasziniert die Menschen seit jeher. Und doch wissen wir immer noch viel zu wenig über diesen schlangenartigen Fisch. Was vielen Menschen gar nicht bewusst ist: Die Aale verschwinden, und zwar so rapide, dass sie schon in wenigen Jahren ausgestorben sein können. So ist der Bestand des europäischen Aals in den letzten zehn Jahren um 90 % zurückgegangen. Der Schriftsteller, Journalist und Sportfischer Torolf Kroglund geht der Frage nach, warum das so ist, und folgt dem Aal dafür durch ganz Europa. Seine Reise beginnt auf der norwegischen Insel Frøya, wo er als Kind Aale fing, und führt ihn danach u. a. nach Deutschland, Spanien, England und die Niederlande. Unterwegs begegnet ihm ein breites Spektrum an Themen rund um die Natur, er erfährt aber auch persönliche Herausforderungen. Beides flicht Kroglund auf faszinierende Weise in seine Erzählung ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Vom Hammarvatnet in die Sargassosee
Die Ballade vom alten Seemann
Die Durif-Methode für den »norwegischen« Aal
Baskischer Glasaal in Olivenöl
Europas »Elfenbeinhandel« mit Aal
Zuchtaal – eine Art Anguilla frankensteini?
Im eigenen Spiegelbild ertrinken
Die letzte Aalgilde?
Aalfestival und Aal in Gelee
»Panta rhei«: Lasst den Fluss leben
Zurück zum Hammarvatnet
Comacchio – Lillesand 30 °C
Quellen und Bücher zum Weiterlesen
Dank
Vom Hammarvatnet in die Sargassosee
Manchmal hatte ich einen Aal am Haken, wenn ich in den Seen Frøyas, der Insel meiner Kindheit in Westnorwegen, Forellen angelte. Ich besaß zwei Ruten, eine Wurfangel, die ich mit Kunstköder, Spinner oder Fliege einsetzte, und eine Rute mit Wurm und Schwimmer. Die Aale bissen immer an der Rute mit dem Wurm, und zwar meist dann, wenn sich bereits die Dunkelheit über Wasser und Land legte. Ich konnte gerade noch erkennen, wie sich ein schwarzes, schweres Etwas in der Tiefe bewegte. Eine große Kraft ging von diesem Etwas aus, wenn ich die Angelschnur einholte. Ich musste dagegen richtig ankämpfen. Und jedes Mal war ich enttäuscht, wenn keine Rekordforelle am Haken hing, sondern ein glitschiges, sich windendes, schlangenartiges Ding, das ich ins Heidekraut warf und mit einer Mischung aus Faszination und Ekel betrachtete. Es erwies sich als fast unmöglich, das Tier vom Haken zu bekommen. Er war so tief im Maul verschwunden, dass ich ihn gar nicht mehr sehen konnte. Auch ließ sich der schleimige Aal kaum festhalten. Es sah aus, als habe er den Wurm samt Haken eingesaugt wie ein Staubsauger. Man hätte wohl die Leine kappen und ihn wieder ins Wasser werfen können, aber ihn mit einem Haken in der Kehle herumschwimmen zu lassen, wäre Tierquälerei gewesen. Die einzige Lösung war, ihn zu töten. Selbst das war nicht so leicht, wie man glauben sollte. Ihn festzuhalten, war nicht das einzige Problem. Auch wenn man auf ihn treten wollte, flutschte er weg wie ein Stück Seife. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir nichts Besseres einfiel, als das Messer hervorzuholen und ihm den Kopf abzuschneiden. Aber nicht einmal danach schien dieses unheimliche, mystische Tier tot zu sein. Der Körper wand sich weiter, und fast sah es so aus, als ob es ihn zurück ins Wasser zöge, um in der Tiefe zu verschwinden und dort weiterzuleben, als sei nichts geschehen. Ohne Kopf. Wuchs der womöglich wieder nach? Auch er schien weiterzuleben, nachdem ich ihn abgetrennt hatte. In der Mitternachtsdunkelheit, allein am undurchsichtigen Wasser, weitab von jeglicher Zivilisation war das alles ziemlich unheimlich.
Ich wusste, dass man Aal durchaus essen kann, und manche aßen ihn tatsächlich. Aber mir kam das ziemlich abwegig vor. Wie konnte man dieses glitschige, unheimliche Wesen, das kaum totzukriegen war, nur auf den Teller bringen? Das überstieg meine Vorstellungskraft, diesen Beifang empfand ich wirklich nicht als Bereicherung.
Ich glaube nicht, dass ich damals schon etwas von der rätselhaften Reise wusste, die dieser Aal hinter sich hatte. Dass mir bewusst war, wie er sich als kleine Larve von der Tiefsee auf den Weg gemacht hatte, um am Ende über Bäche und Stock und Stein als Aal bis hierher in den Hammarvatnet auf Frøya zu gelangen. Oder dass diejenigen Aale, denen ich nicht den Kopf abschnitt, genau das tun würden, wovon ich hier an der Küste immer träumte: hinausziehen in die große weite Welt. Ja, dass mein Aal im Hammarvatnet nicht nur in die weite Welt hinauswollte, sondern sogar bis ganz an ihr Ende, hinunter in die namenlosen Tiefen des sagenumwobensten und geheimnisvollsten aller Gewässer: der Sargassosee.
Früher Morgen mit Kaffee und Zeitung. Ein Artikel in der Lokalzeitung bringt mich dazu, an damals zurückzudenken, an die Aale in den Angelgewässern meiner Kindheit auf Frøya. Fotos zeigen Aale, die von den Turbinen des Wasserkraftwerks am Storelva in Tvedestrand geschreddert wurden. Ein bärtiger Mann hält einen toten Aal in die Kamera, im Hintergrund ist ein ganzer Haufen Fischkadaver zu sehen. Der Mann schaut ziemlich besorgt.
Der besorgt Dreinblickende ist mein Vetter, Frode Kroglund. In dem Artikel spricht er reichlich dramatisch vom »großen Aalmassaker«. Frode ist Biologe (ich selbst habe Literatur studiert). Wir stammen beide aus Trøndelag und haben lange in Sørland gewohnt, Frode in Arendal, ich 40 Kilometer entfernt in Lillesand, also zwei Nordnorweger mit demselben Nachnamen in Südnorwegen …
Das Schlimme an der Sache ist: Der Aal steht in Europa als vom Aussterben bedrohter Fisch auf der Roten Liste; in Norwegen gilt er aber lediglich als gefährdet. Immerhin ist es verboten, ihn zu fischen (das gilt für Berufsfischer wie Freizeitangler). Weltweit versuchen Forscher dahinterzukommen, warum der Aal verschwindet. Hier ist offensichtlich einer der Gründe dafür: Wenn die Aale aus dem großen Einzugsbereich des Storelva hinaus ins Meer wollen, um ihre lange Reise zurück in die Sargassosee anzutreten, treffen sie auf die Turbinen, die sie am Weiterschwimmen hindern und im schlimmsten Fall in Stücke hacken. Gegen Wasserkraftwerke anzukämpfen ist in etwa so schwierig wie Don Quijotes Kampf gegen die Windmühlen. In Norwegen steht an jedem zweiten Fluss eins, und auch die Wasserläufe im restlichen Europa sind voller Turbinen, Wehre und Dämme.
»Diese Aale«, wird Frode im Artikel zitiert, und er spricht aus, was die Bilder bereits ganz unmissverständlich zeigen, »kehren nicht mehr in die Sargassosee zurück.«
Kein einziger Aal in unseren großen und kleinen Seen, in unseren Flüssen und an der Küste paart sich hier. Alle Europäischen und Amerikanischen Aale paaren sich erst in der Sargassosee. Das hat zwar noch nie jemand gesehen, aber die kleinsten Aallarven, die – in relevanten Mengen – gefunden wurden, sind dort gefunden worden. Die Aale, mit denen wir es in den Seen und zwischen den Schären zu tun haben, sind also nur zu Besuch – und sie gehören derselben Art an.
Die Aallarven sehen aus wie durchsichtige kleine Blätter, ganz flach und rund. Sie haben Magensäcke und kleine Augen, kleine Beinchen und kleine, aber furchteinflößende Zähne. Mit dem Golfstrom treiben sie ins südliche Europa, wozu sie mehrere Jahre benötigen. Wenn sie unsere Küsten erreichen, sind sie zwar immer noch klein, doch haben die meisten ihre Form verändert: Sie sind weiterhin durchsichtig, aber der Körper ist jetzt schlanker, aalähnlicher. Aus den Larven sind Glasaale geworden. Man findet sie in besonders großer Zahl an den Küsten und in den Flussmündungen Portugals, Spaniens, Frankreichs und im Süden Englands und Irlands. Glasaale gibt es aber auch im Mittelmeer und selbst hier oben an der norwegischen Küste und in unseren Flüssen. Doch auch wenn sich kleine Glasaale hier in unseren Gewässern tummeln, hat doch kaum einer sie je gesehen. Während sie weiter die Seen und Flüsse hinaufwandern, entwickeln sie Farbpigmente. Dann sehen sie schon halbwegs wie »richtige« Aale aus. Allerdings sind sie immer noch sehr klein, zwischen fünf und zehn Zentimeter, zudem dünn wie ein Stück Draht. In diesem Stadium heißen sie Steigaale.
Die Wanderung aus der Sargassosee hat Jahre gedauert, manche Forscher gehen davon aus, dass es bis zu drei sein können. Aber in den Flüssen und Seen bleiben sie, um erwachsen zu werden, in ihrem Süßwasserlebensraum – sei es das Hammarvatnet, der Håelva, der Vegår, der Vänersee, der Rhein, der Po oder der Nil –, und zwar jahrzehntelang. Sie haben keine ausgebildeten Geschlechtsorgane, in ihrem Leben dreht sich alles nur ums Fressen. Sie bleiben drei bis dreißig Jahre treu an derselben Stelle – manchmal sogar noch viel länger. Der älteste bekannte Süßwasseraal war aus Südschweden. Er hatte ein nachweisliches Alter von mindestens 155 Jahren. Åle – ein Männchen, wie man später herausfand – lebte in einem Brunnen, in dem er im 19. Jahrhundert ausgesetzt worden war, um das Wasser von Algen und Kleintieren freizuhalten. In seinem restlichen Leben hat Åle außer seinem beengten Zuhause nichts von der Welt gesehen, selbst als er ein geschlechtsreifer Blankaal geworden war. Dennoch kannte ihn jeder in Schweden, denn viele kamen ihn besuchen. Es gibt etliche Fernsehaufnahmen, in denen Reporter der schwedischen Naturdokuserie Ut i naturen zu ihm in den Brunnen hinunterkletterten, um mehr über ihn in Erfahrung zu bringen. Heute liegt Åle tiefgefroren in der Gefriertruhe eines schwedischen Aalforschers.
Süßwasseraale werden wegen der Pigmente, die sie im Süßwasser entwickeln, Gelbaale genannt. Diese Farbstoffe sorgen dafür, dass sich der Bauch des Aals goldgelb und der Rücken dunkelbraun färbt. Wenn sich der Aal – auf unerforschte Weise und ohne uns bekanntes Muster – entschließt, ins Salzwasser zurückzukehren, verändert er sich ein weiteres Mal. Sein Maul wird spitzer und seine Augen werden doppelt so groß, seine Haut wird fester. Zudem wechselt seine Farbe: Seine Bauchseite ist nun silbrig und wirkt blank, sein Rücken ist dunkler, fast schwarz. In diesem Stadium heißt er Blank- oder Silberaal.
Zur Familie der Aale oder Anguillidae gehört eine ganze Reihe verschiedener Aalarten, 16 an der Zahl. Die vier wichtigsten sind: der Europäische (Anguilla anguilla) und der Amerikanische Aal (Anguilla rostrata) im Atlantik und der Japanische (Anguilla japonica) und der Tropische Aal (Anguilla australis) in Asien. Der Europäische und der Amerikanische Aal kommen beide aus der Sargassosee. Beide Arten gleichen einander so sehr, dass man sie im Grunde auch als eine einzige auffassen könnte. Unterscheiden kann man sie nur daran, dass der Amerikanische Aal einen Rückenwirbel mehr als der Europäische hat. Möglicherweise hat das damit zu tun, dass er als Aallarve aktiver schwimmt, um die amerikanische Küste zu erreichen, während sich sein europäischer Verwandter eher passiv mit der Strömung treiben lässt. Aber wie so oft beim Aal wissen wir auch hierüber nichts Genaues.
Alle diese Aalarten stehen auf der Roten Liste und sind vom Aussterben bedroht. Am schlimmsten steht es inzwischen um den Europäischen Aal. Es sind sogenannte katadrome Arten, im Gegensatz zu den Lachsen, die anadrom sind. Das bedeutet, dass diese Aalarten in der Tiefsee geboren werden, um dann in Süßwassergewässer zu wandern, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbringen. Es gibt zwar eine Aalart, die man nur im Meer findet und die folglich auch Meeraal heißt, aber trotz aller Ähnlichkeiten gehört der Meeraal nicht zur Familie der Anguillidae, sondern zur Familie der Congridae. Sein wissenschaftlicher Name lautet Conger conger. Er wird sehr groß und teilt seinen Lebensraum mit dem Europäischen Aal, aber nur im Meer.
In den Tropen gibt es einige Muränenarten, die zwar wie Aale aussehen, aber keine sind, sondern eine eigene Familie bilden, die Murenidae. Auch keine richtigen Aale, auch wenn sie so heißen, sind die sogenannten Zitteraale, die in den Flüssen Südamerikas heimisch sind. Sie gehören vielmehr zur Familie der Welsartigen. Es ist tatsächlich so, dass viele Welse wie Aale aussehen. Das gilt auch für die Schleimaale. Diese aalartig anmutenden Fische zählen mit den Neunaugen zu den »Rundmäulern« oder »Kieferlosen«. Die Gemeinsamkeit zwischen den Schleimaalen (im Salzwasser) und den Neunaugen (vor allem in Flüssen) besteht darin, dass sie ihr Maul wie eine Art Saugnapf einsetzen, mit dem sie sich an ihrer Beute oder an einem Aas festsaugen, um dann mit ihrer Raspelzunge – manche Arten auch mit ihren Zähnen – Fleisch herauszulösen. Gemeinsam ist ihnen auch ein Merkmal, das sie sowohl von den Aalen als auch von den Reptilien unterscheidet: Sie haben weder Knochen noch Knorpel. Sie haben nicht einmal einen Magensack. Fridtjof Nansen studierte, bevor er ein berühmter Abenteurer, Polarfahrer und Diplomat wurde, die Biologie des Schleimaals und schrieb seine Dissertation über das Nervensystem dieses Fisches.
Neunaugen und Schleimaale sind in allen unseren Gewässern ziemlich häufig zu finden – ebenso wie der Aal –, auch wenn die meisten von uns nie einen Gedanken an sie verschwendet haben dürften.
Frode hat lange in Arendal gewohnt. Ich bin mit meiner kleinen Familie vor 14 Jahren ganz in die Nähe gezogen. Es ist schon seltsam, dass wir kaum eine halbe Stunde voneinander entfernt leben, aber nie viel Kontakt zueinander gehabt haben. Mein Vater war der einzige Bruder von Frodes Vater, aber beide waren ziemlich verschieden und hatten nicht viel miteinander zu tun. Ich glaube, Frodes Familie ist ab und zu nach Frøya gefahren, und wir haben sie auch in Stjørdal besucht. Frode war so viel älter als ich, dass er da schon von zu Hause ausgezogen war, um zu studieren. Ich war der Jüngste und habe mein Elternhaus als Letzter von uns Geschwistern verlassen.
Als Student lernte ich ein hübsches Mädchen namens Cecilie kennen, das aus dem Süden Norwegens stammte. Ich war schon viel gereist, aber noch nie in Sørland gewesen. Dieser Umstand ließ für mich den Ort, in dem sie aufgewachsen war, in einem ganz besonderen, ja geradezu exotischen Licht erscheinen. Als wir dann gleich im ersten Sommer in das große alte Haus in Sørland zogen, das ihrer Großmutter mütterlicherseits gehört hatte, wurde mir das Exotische zunehmend vertraut. Es war der Rekordsommer 1997. Wir fuhren überall mit dem Fahrrad hin, hinunter ans Meer, wo wir badeten und uns auf den Felsen in die Sonne legten. Am Abend ging es dann zu abgelegenen Kolken in den Flüssen, wo wir uns das Salzwasser abwuschen. Wir waren braungebrannt, unsere Haut sonnenwarm, und wenn ich durch die Sträßchen mit den weißgestrichenen Häusern runter zur Felsenküste fuhr, dachte ich, das könne hier auch die Provence oder Toscana sein. Wir radelten die Feldwege entlang bis tief in die sørländischen Wälder hinein, zu einem Platz, dem Cecilie ihren Spitznamen verdankte: Knibe. Hier saßen wir an einem kleinen Teich, an den sie viele Erinnerungen hatte, an einem Ort, zu dem sie gewandert war, um Blaubeeren zu pflücken oder einfach nur draußen in der Natur zu sein. Ich hatte eine Angelrute mit Schwimmer und Köderwurm dabei. Wir hatten ein paar schöne Forellen gefangen, was ihr imponierte, und als die Dunkelheit sich über die Baumwipfel senkte, saßen wir aneinandergekuschelt und küssten uns. Auf der anderen Seite des Teichs konnten wir in der Dämmerung zwischen den Baumstämmen einen Rehbock erkennen, der von uns noch keine Witterung aufgenommen hatte. Ich weiß noch, wie er ganz unvermittelt und brünstig losröhrte, sodass wir zusammenzuckten. Ein wundersames gemeinsames Erlebnis. Gegen Mitternacht tauchte der Schwimmer an meiner Angel erneut unter Wasser. Und diesmal hatten wir richtig Mühe, das schwere, widerstrebende Etwas am anderen Ende der Schnur heraufzuziehen. Schließlich lag ein großes, glitschiges und schlangenartiges Geschöpf da und wand sich zwischen unseren Füßen. Ein Aal! Cecilie schrie entsetzt auf. Diesmal schaffte ich es allerdings irgendwie, den Haken herauszulösen, während ich mit dem schleimigen, muskulösen Ding kämpfte. Wir entließen das Tier schnell wieder in die unheimlichen Tiefen des Teichs, aus denen es gekommen war.
Was hat es mit dem Aal auf sich, dass er immer entwischt? Diese unfreiwilligen nächtlichen Begegnungen mit Aalen tragen Millionen Jahre nichtmenschlicher Dunkelheit in sich. Aale stehen im Gegensatz zum Licht und zur Wärme, wie sie Wasserkraftwerke erzeugen. Die Naturbeherrschung der Ingenieure und unsere domestizierte, sehr komfortable Lebenswirklichkeit treffen auf die Aale, die sich seit über 50 Millionen Jahren auf dieselbe Art und Weise durchwinden. Der Zeitungsartikel in der Agderposten, in dem Frode zitiert wird, berichtet von einer Kollision zwischen einem natürlichen Urwesen und unserer modernen Gesellschaft.
Es gibt immer noch viele Dinge, die wir nicht wissen über dieses Geschöpf, um das sich in fast allen Kulturen allerlei Mythen ranken. Das Tier, das sich biologisch deutlich von den Reptilien unterscheidet und korrekt als Fisch eingeordnet wird, ist in den Mythen eine Art Mischwesen aus Reptil und Fisch, eine Seeschlange, die zu den Drachen gehört. In der altnordischen Mythologie gibt es die Midgardschlange, die so groß wurde, dass sie nur noch im Meer genug Platz fand. Dort schlang sie sich rund um die gesamte Menschenwelt und biss sich selbst in den Schwanz (nicht unähnlich dem ägyptisch-griechischen Drachen-/Schlangenwesen Ouroboros, das den Kreislauf des Lebens von der Geburt bis zum Tod symbolisiert, indem es sich ebenfalls in den Schwanz beißt). Es heißt, dass die Midgardschlange am Ende der Zeiten aus dem Meer aufsteigen und sich über Felder und Wiesen heranwälzen wird. Odins Sohn Thor, der Donnergott, muss dann gegen sie kämpfen. In der Sage bekommt Thor von ihr eine tödliche Wunde zugefügt und stirbt, woraufhin die Welt untergeht. Mit den Seeschlangen ist also nicht zu spaßen.
Auf der anderen Seite zahlen sich Seeschlangen als Touristenattraktion aus. Die Exemplare, um die es geht, leben seltener im Meer, sondern eher in großen Binnenseen, und zwar überall auf der Welt. Die bekannteste ist Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness. In Norwegen haben wir den Seljordsorm. Was fasziniert uns so an ihnen – selbst heute in unserer aufgeklärten und rationalen Gesellschaft?
Laut einer biologischen Hypothese sollen Schlangen und Aale einen gemeinsamen Ursprung haben, also ist an dem Mythos, wie so häufig, etwas Wahres dran. Als reale Lebewesen gehören sie zu den natürlichen Arten, und gleichzeitig existieren sie in Erzählungen unterschiedlicher Kulturen. Die unübersichtliche Vielfalt der Natur und ihre Rolle in den Sagen und Legenden sind gerade das, was mich an ihnen fasziniert.
Hätten wir doch bloß Lehrer gehabt, die uns von den seltsamen, ja fast unglaublichen Wundern der Natur erzählt hätten!
Bevor ich ein pickliger, eigensinniger Jugendlicher wurde, wollte ich nämlich Biologe werden. Aber die sterbenslangweiligen, theorielastigen und staubtrockenen Naturkundestunden in der Schule raubten mir nach kurzer Zeit den Nerv. Solange ich zurückdenken kann, streifte ich lieber allein in unserem großen Garten oder draußen auf der Kleewiese umher und sammelte zum Beispiel Insekten. Mein Vater war Rektor der Dorfschule und besaß einen Vorrat kleiner durchsichtiger Schachteln, dazu Schaumgummi, das man zuschneiden und hineinlegen konnte, und passende Deckel und dünne Nadeln, um die Insekten aufzuspießen. Rasch hatte ich eine anständige Insektensammlung beisammen. Ich kannte alle Ecken und Winkel des Gartens und hatte viele tolle Verstecke: im Dickicht der verwachsenen Roten und Schwarzen Johannisbeerbüsche, in der verborgenen Hütte unter den Bäumen und oben in den Bäumen, wo mich niemand sehen konnte, aber ich alles im Blick hatte.
Ich träumte oft davon, fliegen zu können. Ich sprang in die Luft und wedelt mit den Armen, lies sie in der Luft kreisen, und wenn ich oben war, konnte ich alles überblicken. Ein prickelndes Gefühl der Freiheit.
Vielleicht interessierte ich mich deshalb für Vögel. Für die, die man essen konnte, aber auch für alle anderen, die ich sah und hörte, zum Beispiel die Brachvögel, Austernfischer, Möwen und Schnepfen. Die majestätischen Seeadler und die Sperber, die im Garten Kleinvögel jagten, begeisterten mich. Greifvögel fand ich insgesamt faszinierend. Ich studierte alle Vögel, die in dem zerlesenen Vogelbestimmungsbuch mit detaillierten Zeichnungen abgebildet waren, und kannte sie alle auswendig. Ich wollte Ornithologe werden. Wenn ich mit Vater zusammen in Trondheim war, gingen wir ins Naturkundemuseum, in dem es viele ausgestopfte Vögel gab. Wir machten einen Sport daraus, dass er die Informationstafeln zuhielt und ich den Namen des Vogels erriet. Vater zeigte sich beeindruckt, und ich war mächtig stolz. Vater erzählte, wie er als Kind einen Verwandten, der im Museum arbeitete, besuchte hatte. Er war im Museum eingeschlafen, und der Verwandte hatte ihn schlafen lassen. Als Vater aufwachte, fand er sich inmitten all der ausgestopften Tiere und Skelette wieder. Eine unheimliche Vorstellung.
Meine Insektensammlung wurde um eine Vogeleisammlung ergänzt. Ich nahm vorsichtig immer nur ein Ei aus den Gelegen, blies es aus, bettete es in einer Holzschachtel auf Watte und beschriftete sie. Alle meine Freunde hatten Eiersammlungen. Aber ich war ein Meisterkletterer; die höchsten Bäume mit den unzugänglichsten Nestern reizten mich am meisten und verursachten das schönste Magenkribbeln – und Baumharz und Kratzer an den Händen. Ich ließ mich auch nicht von den Vogeleltern abschrecken, wenn sie mich im Sturzflug attackierten, um den Nesträuber zu vertreiben.
Der Jagdtrieb als solcher war das eine. Das andere war die Beute, die Eier mit ihren vielen verschiedenen Farben, Mustern und Formen. Kunst der Natur.
Frøya mit seinen verschiedenen Habitaten war so etwas wie ein ornithologisches Mekka, hier lebten sehr viele unterschiedliche Vogelarten auf einem relativ kleinen Gebiet – und wir wohnten praktisch mittendrin in ungezähmter Natur. Ich besaß eine Kreuzotter, die ich selbst gefangen und getötet hatte und die ich in einer der Plastikschalen in Spiritus aufbewahrte. Ich hätte gerne auch einen Aal auf diese Weise konserviert, um ihn zu studieren. Auf meinem Regal über dem Schreibtisch war noch Platz. Aber ich wusste nicht, wie ich ihn hätte nach Hause schaffen und töten sollen. Also begnügte ich mich damit, in die unergründlichen kleinen Augen der Kreuzotter zu starren und an Seeschlangen zu denken. Ihren rätselhaften, geheimnisvollen Blick empfand ich als böse.
An einer Wand in meinem Zimmer hing ein Plakat mit den gängigsten Fischarten. Direkt daneben konnte ich durchs Fenster aufs Meer hinausschauen, das alle diese Tiere beherbergte – und noch viele andere.
Oft träumte ich, dass ich tiefer und tiefer ins Meer hinabsank. An allen Lebewesen vorbei, an den Aalen, den Haien und zum Schluss auch an den Walen. Ich erwachte mit einem Ruck und dem abrupten Gefühl zu fallen – und dem Drang, mich irgendwo festzuhalten.
Es heißt, was der Mensch am meisten fürchte – mehr als den Tod –, sei die Tiefe. Gleichzeitig wollen wir wie die Vögel fliegen können, um uns in die Lüfte zu erheben. So ist es ja auch in den Sagen und Erzählungen verschiedener Religionen: Die Seele als das Göttliche in uns hat eine Verbindung zum Überirdischen, während das Unterirdische, das in der Tiefe lauert, mit dem Bösen, Gefährlichen oder Ekeligen assoziiert wird. Das ist schon ziemlich paradox, wenn man daran denkt, wie viele Menschen in der Erde begraben werden, wenn sie sterben, und dass das meiste, wovon wir uns ernähren, unter der Erdoberfläche oder unter Wasser wächst. Vielleicht liegt es ganz einfach daran, dass wir uns gerne einbilden, wir könnten die Welt erkennen und verstehen, uns aber der eigentliche Sinn des Lebens und unsere Zukunft verborgen bleibt? In der Bibel heißt es: »Aus Erde bist du gekommen, und zu Erde sollst du werden« – kann ja sein, dass wir zu Erde werden, aber entstanden sind wir nicht aus ihr (wir sind keine Pflanzen). Im Grunde, so hat uns Darwin gelehrt, kommen wir aus dem Meer, aus den Tiefen des Meeres.
Mich hat schon immer vor allem das fasziniert, was man auf den ersten und auch den zweiten Blick nicht sofort sieht. Bei den Angelseen meiner Kindheit versuchte ich mir vorzustellen, wie es unter Wasser aussah. Spiegelverkehrte Berge und Täler. Forellen und Aale, die ich nur zu sehen bekam, wenn ich sie, aus ihrem ureigenen Element gerissen, am Haken hatte – ich stellte mir vor, dass sie lebendig in ihrem Lebensraum, wo ich der Fremde war, vielleicht ganz anders aussehen würden.
Die praktischen Kenntnisse im Angeln und Jagen brachte mir unser Nachbar Reidar bei. Keiner aus meiner Familie beherrschte dies oder interessierte sich dafür. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, glaube ich, dass weder meine Eltern noch meine Geschwister jemals viel in der Natur draußen waren, die einen auf Frøya doch überall umgab. Natürlich gingen sie den obligatorischen Wanderweg zur »Trimhütte« hinauf und bei Ebbe hinunter ans Wasser, aber das zählt nicht. Bevor ich mein erstes eigenes Boot mit Außenbordmotor bekam, hatte die Familie ein altes und schönes Færing, ein traditionelles Boot mit zwei Paar Rudern, das mein Vater allerdings kaum nutzte. Höchst selten fuhren wir damit auf den Fjord hinaus, um ein bisschen mit Handleinen zu angeln. Aber alles in allem waren das Ausflüge, auf denen wir »Gäste« der Natur blieben, eher Zuschauer als Beteiligte.
Meine drei Geschwister waren alle in Trondheim geboren und dort aufgewachsen, bis wir nach Frøya zogen. Von dort stammten mein Vater und seine Familie. Ich war der Einzige von uns, der nichts anderes als Frøya kannte. Meine Mutter, eine Engländerin, war meinem Vater nach Norwegen in die Hauptstadt von Trøndelag gefolgt und zog mit ihm und ihren vier Kindern weiter nach Frøya, als mein Vater Rektor an der hiesigen Dorfschule wurde. In den Sommerferien fuhren wir oft zu meinen englischen Großeltern nach Gants Hill, einer Londoner Vorstadt.
Dieser Kontrast zwischen dem winzigen Nest draußen am Meer und der Weltstadt London prägte meine Kindheit. Soll man es Zerrissenheit nennen? Auf der einen Seite war ich voll und ganz in der Natur Frøyas zu Hause, auf der anderen Seite wusste ich sehr gut, dass es eine Welt außerhalb der Insel gab. Ja, dass die Insel am Ende der Welt lag, eine mehr oder weniger exotische Provinz, weit entfernt von den bevölkerten Metropolen, in denen Kunst, Wissenschaft und Literatur mit einer anderen Art Wissen lockten, als es unsere Lehrer vermitteln konnten – oder als wir Schüler aufzunehmen bereit waren.
Seitdem lebe ich jedenfalls in dem Spannungsfeld zwischen Reidars praktischem Wissen über die Natur um uns herum und dem städtischen Bücherwissen meiner Mutter über die große, weite Welt.
Und mein Vater? Ich glaube, ihn reizte es ursprünglich, auf einer Insel zu wohnen, mit einem großen Garten, um Obst und Gemüse anzubauen, frischen Fisch von den örtlichen Fischern kaufen zu können und als Schulmeister eine Autorität im Dorf zu sein. Gleichzeitig denke ich heute – als Erwachsener –, dass er die Schönheit der Natur, die ihn umgab, gar nicht richtig erfasste. Dass er gewissermaßen an der Oberfläche blieb. Dabei war er ein sehr geselliger und umgänglicher Mensch, der gerne Erlebnisse und Anekdoten aus seinem Leben erzählte, von den vielen Reisen rund um die ganze Welt. Zu guter Letzt flüchtete er sich immer weiter in die Oberflächlichkeit, indem er viel mehr arbeitete als nötig – und sich jeden Abend mit einem Gin Tonic oder zwei betäubte. Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden für das, was ich meine, aber diese Gefahr droht vielen von uns. Das Leben lässt sich ja (scheinbar zumindest) an der Oberfläche am leichtesten aushalten, aber ich meine, geistig ermüdet das auf Dauer. Es erfordert Mut und Kraft, in die Tiefe oder die Höhe zu streben und sich komplexen Situationen zu stellen, für die es keine einfachen Lösungen gibt. Das Risiko ist die Ungewissheit. Die Belohnung ist eine Form nichtmateriellen Reichtums. Diesen Reichtum findet man sowohl in der Welt der Natur wie in der Welt der Kultur. Wenn man sich nicht traut, sich all dem Schönen und Bereichernden, das das Leben zu bieten hat, zu öffnen, was ist das Leben dann wert? Die Erkenntnis ist nicht neu, aber manchmal schwer umzusetzen.
Der alte Seefahrer in Samuel Taylor Coleridges Gedicht »Die Ballade vom alten Seemann« fasst das so zusammen: »He prayeth best, who loveth best.« Das Gedicht handelt, grob gesagt, von einem gedankenlosen Matrosen, der einen Albatros tötet, der sich auf einem der Masten niedergelassen hat, und dem Fluch, den seine Missetat für das Schiff nach sich zieht. Der Seemann ist der einzige Überlebende, verurteilt dazu, die Botschaft vom Respekt vor allen Geschöpfen Gottes und der Liebe zu ihnen weiterzugeben – und vor dem alles umfassenden Wunder des Lebens.
Als mein elfjähriger Sohn Leon und ich bei Ebbe die freiliegenden Felsen in Lillesand abgehen und Plastikmüll auflesen und Baumstümpfe aufstöbern, die weit gereist sind, erzähle ich ihm von den Meeresströmungen und der langen Reise, die all das Treibgut hinter sich hat. Vielleicht kommt es von den Küsten Afrikas? Oder aus der Sargassosee? Vielleicht treibt auch das, was wir wegwerfen, mit derselben Strömung zurück in die Sargassosee. Denn es ist ja so, dass es eigentlich keine »sieben Meere« gibt. Die verschiedenen Namen der einzelnen Meere, die wir in der Schule lernen oder die schwarz auf weiß in den Atlanten stehen, sind ja nur ausgedacht und im Grunde irreführend. Es gibt nur ein Meer! Das sage ich ihm und denke bei mir, das ist ja eine fantastische Erkenntnis … Die großen Kontinente sind, wie man auf dem Globus genau sieht, eigentlich nur Inseln im riesigen Weltmeer.
Diese Geschichte ist eine moderne und vielleicht tristere Version der Märchen von Flaschenpostnachrichten in meiner Kindheit. Als Jugendlicher hörte ich The Police und ihren Song »Message in a Bottle«, und ich verstand die Botschaft des Songs. Denn ich war selbst einsam auf der Insel meiner Kindheit. Wie tröstlich war es, dass es viele andere Einsame auf anderen Inseln – sowohl realen wie im übertragenen Sinn – gab, die ihre imaginären Flaschenposten über das unfassbar große, aber allen gemeinsame Meer schickten! Im Songtext heißt es: »…a hundred billion bottles washed upon the shore« – vielleicht ist der Song das Lied unserer Zeit, auch ganz konkret?
Leon und ich kennen viele tolle Plätze in den Schären, zu denen wir gehen, oder Inseln und Holme, zu denen wir mit dem Boot fahren können. Im Herbst übernachten wir dort im Zelt, und wenn unser großes Lagerfeuer erlischt, genießen wir den unendlichen Sternenhimmel. Wir haben Orte, an denen wir tagsüber stundenlang herumlaufen; wir finden Stöcke zum Fechten, Steine mit Fossilien, Krabben und Fische und viele andere Schätze zwischen den Felsen, die die Ebbe freiliegt. Außer in den vier, fünf hektischen Sommerwochen haben wir diese Orte oft für uns ganz allein.
An einem besonders warmen Sommertag wollten wir wieder einmal mit dem Boot hinaus in die Schären fahren. Wir fanden einen kleinen Holm mit einer winzig kleinen Lagune. Das Kielwasser der Boote, mit denen die anderen Leute manchmal herumfahren, kann solche Orte nicht erreichen. Das war genau das Richtige für uns. Ich schaltete den Motor aus und ruderte den Rest. Wir hatten kürzlich im Fernsehen eine Sendung über die Galapagosinseln gesehen, und daher lag es natürlich nahe, dass wir unsere kleine Insel »Galapagos« nannten. Wir badeten, legten uns in die Sonne, und Leon fand alle möglichen Schätze auf dem Grund der Lagune. Unter anderem etwas, das er für einen kleinen Haizahn hielt und das auch wirklich so aussah.
Ich bin später noch oft mit dem Kajak dagewesen. Mit dem Boot war es zu schwierig, weil es nie wieder so windstill war wie damals. Weil direkt dahinter das offene Meer anfängt, ist der Wellengang fast immer zu stark. Also sind wir beide nie wieder zusammen dort gewesen – aber wir erinnern uns daran als einen ganz besonderen Ort.
Leon wünscht sich oft, dass wir auf die richtigen Galapagosinseln fahren. Und ich würde liebend gerne mit ihm dorthin. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass es in dem Dokumentarfilm, den wir uns angeschaut hatten, um die dunklen Schatten ging, die über Darwins einstigem Paradies liegen: Umweltverschmutzung und Tourismus. Leute, die von weither kommen, zum Beispiel von hier, aus Norwegen, mit Flugzeug und Schiff. Weil sie die »richtigen« Galapagosinseln erleben wollen. Aber die mystischen Eilande »versinken« sozusagen, wenn es einfach nur noch Inseln mit Leuten drauf sind, bevölkert nicht nur von Fernreisenden und Neugierigen, sondern auch von Forschern. Die ungezähmte wilde Vielfalt auf den Inseln, die Darwin zu seiner berühmten Evolutionstheorie inspirierte, wird heute genau kontrolliert.
Das erinnert mich ein bisschen an die Rentiere, Bären und Wölfe in den Nationalparks, die allesamt Sender tragen, oder an die Löwen, die von den Wildhütern überwacht werden. Alle Löwen haben Namen, wie Haustiere. Ab und zu denke ich, dass die Forscher Teil des Problems sind.
»Vielleicht ist es doch besser, wenn wir nicht dahin fahren«, sagt Leon.
»Die Menschen sind blöd!«, sagt er, ein bisschen böse, und will nicht mehr darüber nachdenken.
Leon ist elf Jahre alt. Und ich spüre einen Stich tief drin im Herzen, der sich durch den ganzen Körper fortsetzt. Das tut weh.
»Wir haben wenigstens unser eigenes kleines Galapagos und die ganzen anderen Orte«, versuche ich ihn zu trösten. Sind die nicht mindestens genauso naturbelassen? Vielleicht sogar wilder und dazu dünner besiedelt? Insofern exotischer, auf eine paradoxe Weise?
Zusammen mit Leon habe ich mir auch eine schöne und zugleich deprimierende Dokumentation mit dem Titel The smog of the sea (2017) angeschaut. Darin geht es um eine Expedition in einen Teil der Sargassosee, ins sogenannte Bermudadreieck. Der amerikanische Meeresbiologe Markus Erikson teilt der Welt darin mit, dass die riesigen schwimmenden Plastikinseln auf dem Meer ein Medienmärchen seien – die Wirklichkeit, sagt er, sei viel schlimmer. Er nimmt viele bekannte Musiker, Künstler und Surfer mit auf die Reise, um so die maximale öffentliche Aufmerksamkeit für sein Anliegen zu erzielen, was ihm und seinem Team aus Meeresbiologen mit wissenschaftlichen Aufsätzen zu ihren Forschungsergebnissen niemals möglich wäre. Einer der Erzähler ist der Musiker Jack Johnson, der auch die Filmmusik beigesteuert hat. Am Anfang des Films erzählt er von seinem engen Verhältnis zum Meer und wie er als Kind mit seinem Vater an den Strand und ins Watt ging und surfen lernte und wie er das mit seinen Kindern jetzt genauso macht. Das ist also etwas, das wir kennen. Dann sagt er, das Meer sei für ihn immer noch eine Wildnis, die vielleicht letzte große Wildnis. Es sei so groß und endlos, und wir wissen immer noch nicht viel, was das Meer betrifft. Und welches Gewässer ist geheimnisvoller als das Sargassomeer, Ausgangspunkt und Ziel der Aale?
Hierhin fährt also die Expedition und untersucht das Wasser unter der Oberflächenschicht. Sie fördert winzig kleine Plastikstückchen ans Licht. Zu Anfang sehen sie klein und harmlos aus. Die Forscher müssen die Stückchen mit Pinzetten aus den Tangbüscheln pflücken. Nach einigen Wochen auf dem großen und anscheinend unendlichen Blau wird aber deutlich, dass diese kleinen Plastikstückchen wirklich überall sind, wo die Wissenschaftler ihre Netze auswerfen. Als das Schiff aus dem großen Blau wieder nach Hause segelt, sehen wir, dass es Mystic





























