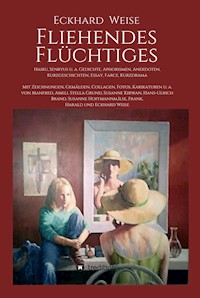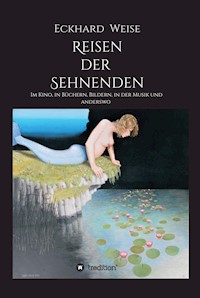
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Roman der Facetten
Das E-Book Reisen der Sehnenden wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Reiselektüre, Reiseroman, Roman der Textsorten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Eckhard Weise
Reisen der Sehnenden.
Im Kino, in Büchern, Bildern, in der Musik und anderswo
© 2020 Eckhard Weise
Lektorat: Susanne Hoffmann, Ramona Lichtblau
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback: 978-3-347-00317-0
Umschlagbild: Manfred Grund: „Heimweh“ (hemlängtan)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Eckhard Weise
Reisen der Sehnenden.
Im Kino, in Büchern, Bildern, in der Musik und anderswo.
Roman der Facetten:
Kurzgeschichten, Erzählungen, Märchen, Novellen, Essays,
Gedichte, Causerien u.a.
Tredition-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I: A long, long way home …
Reisen in der Verdunkelung
Rosebud II
Zwischen Weimar und uns liegt Buchenwald
Preziosen mit Prognosen
Moonlightexpress
Statione Termini
Brescella
Warschau
Anderort
Reisen ins Verlassenwerden und Verlassen. Und ins Vergessen?
Wenn einer eine Reise tut, dann hat er etwas zu erzählen
Wer bin ich?
The long, long way home …
Kapitel II: Grenzfahrt
Die Vögel
Wollust
Liebeskummer
Ideenschmiede
Ahrenshoop im Garten vom Dornenhaus
Dinner for one
Lebenslänglich
Grenzfahrt
Fahrende Gesellen
Wird alles gut? I-IV
Fragen eines lesenden Soldaten
Geschichtsstunde
Der Zahn eines Löwen
Die Anschaffung
Eiliges Senryū
Sehr japanisch
Kapitel III: Verplaudereien
Das barfüßige Lächeln einer Sommernacht
Die Meerjungfrau
Mozalt
„Ich bin eine Dänemarkerin“, sagte die kecke junge attraktive Nadja Tiller zum nicht minder attraktiven Hans-Jörg Felmi im westdeutschen Wiederaufbaufilm „Wir Wunderkinder“.
I. Vedersø, oder sie bekamen die Fähre nicht
II. Hip, Hip, Hurah!
Verbietet Liebe nicht, Liebe zu verbieten?
Johanssens 2. Fall
Kapitel I: A long, long way home …
Reisen in der Verdunkelung
Von Moglis Schmusekurs und Nils Holgerssons Gänseflugbereitschaft eher gelangweilt kämpfe ich doch lieber mit Superman gegen King-Kong zur Errettung der weißen Frau, mit Hemingway gegen Stiere aus Spaß an der Fiesta, mit John Wayne gegen Nashörner, weil die womöglich schneller sind als Geländewagen.
Und weiter: was leg ich mich bloß ins Zeug zusammen mit Kapitän Ahab, Steven Spielberg, der malträtierten Melanie Daniels und ihrem überaus mutigen Freund Mitch Brenner, damit weiße Wale, weiße Haie und in Furien verwandelte Vögel uns nicht länger Gliedmaßen, Augen oder gar das Leben rauben dürfen.
Nein, nein, durchaus nicht von kleinen fröhlich trällernden und zwitschernden Kanarienvögel im goldenen Käfig ist länger die Rede.
Ja, ja, Edgar Allen Poes Vögel sind es, die frau und man zu tautologisieren neigt, schwarze Raben., die hämisch und durchtrieben auf pechschwarzen Starkstromkabeln hocken … ach quatsch: nicht hocken, sondern lauern auf den punktgenauen Moment für die brutalstmögliche Attacke!
Am Ethologen Adolf Remane geschult entdecke ich doch tatsächlich zögerliche Rabinnen darunter. Diplomatinnen vielleicht?
Durchaus? Womöglich schon.
Aber die traurigen Reste des einstigen Matriarchats werden bedrohlich umzingelt von testosterongesteuerten schwarzbefrackten Herren im Reiche der Schatten.
War da nicht noch was?
Ach ja, natürlich! Und nicht zuletzt gilt mein mithelfender emotionaler Einsatz vom gesicherten Sitzplatz aus der Bewahrung einer großen Liebe in Bodegabay, die durch die Eifersucht einer Königin der Nacht, Missis Brenner nämlich, die - gemäß der bekannten Deutung dieser allzu menschlichen Eigenschaft mit Eifer sucht, was Leiden schafft, danach trachtet, die aufkeimende Romanze womöglich im Keime zu ersticken.
Verstand der Meisterregisseur in seinem Horrorszenario vielleicht nicht den Ausbruch des ornithologischen Furors als Metapher für die Boshaftigkeit einer schwachen Witwe, die fürchtete, noch einmal den starken Mann an ihrer Seite zu verlieren?
Und übrigens apropos John Wayne: sich von seinen Schlachten gegen Tier wie Mensch begeistern zu lassen - wie lange in ferner Zukunft eigentlich noch wird man sich dafür schämen müssen? Im Hellen.
Rosebud II
Um Haaresbreite wäre es dem Pressezaren William Randolph Hearst gelungen, einen Jahrhundertfilm und die weitere Karriere eines Jahrhundertregisseurs nachhaltig zu beschädigen.
Wegen der unverblümten Kritik an einer anscheinend unbegrenzten Einflussnahme eines vordemokratischen Zeitungsmagnaten auf die Politik.
Wie wir alle zu wissen glaubten.
Das Leinwanddrama brachte den Meinungskonzern keineswegs ins Schwanken.
Gab es also für Hearsts Hass auf den Grünschnabel von der Ostküste, der die Frauen in Hollywood im Sturm eroberte, einen anderen – tiefergreifenden – Grund?
Das Kunstwerk hatte ein noch in engen Kreisen gehütetes Geheimnis Hearsts in alle Welt hinausposaunt, die romantische Bezeichnung, die der steinreiche uralte Herr seiner jungen nicht sonderlich treuen Geliebten, der Schauspielerin Marion Davis, einst zugehaucht haben muss, nämlich diejenige für ihre Klitoris!
Und die raunte nun sein Abbild, John Foster Kane, als letztes Wort, bevor er stirbt, in der Eröffnungsszene und prangte in schwarzen Lettern und einer stilisierten schwarzen Rosenknospe im Finale verbrennend und orakelhaft bleibend auf einer Studiorequisite, einem Schlitten . . . den sich übrigens „Citizen-Kane“-Verehrer Steven Spielberg später auf einer Auktion ersteigerte - im Glauben, es sei ein Unikat. Na, wenn der gewusst hätte! Aber das ist ja eine andere Geschichte.
(Und eine andere wäre, zwei Fragen nachzugehen, und zwar erstens, wieso sich ein Reporter auf die Suche nach der Bedeutung des Sterbenswortes begibt, wenn es doch niemand gehört haben kann, denn der Multimilliardär verstarb einsam und allein, und zweitens, wie es denn angehen kann, dass dieser Widersinn innerhalb der siebten Kunst einst und womöglich bis heute – fast - niemandem aufgefallen ist.)
Genial, aber viel zu naiv hatte Orson Welles 1941 ein heiliges Gesetz in seinem Land gebrochen: über Geld und – zumindest nicht geschützt genug – über Sex zu reden.
Zwischen Weimar und uns liegt Buchenwald.
Schwerst erkrankt verlangte mir nach einem Buch, das zu lesen ich in Zeiten des Wohlergehens scheute.
Triftige Gründe für die eine wie die andere Gestimmtheit sind mir unerfindlich geblieben.
Im Konzentrationslager Buchenwald, dort, wo es unter zerstörter Humanität allenfalls kleinste Regungen von Mitmenschlichkeit geben konnte, durfte – auf Seiten der Täter ohnehin schwerlich, auf Seiten der Opfer nicht selbstverständlich.
Und doch wird eines Tages ein kleines jüdisches Kind hineingeschmuggelt, um es vor der Vergasung zu bewahren.
Meine Erkrankung hinderte mich daran, mehr als zwei, drei Seiten am Tage zu lesen.
Oder war es doch die Schilderung der Grausamkeiten, die diese Hinderlichkeit verursachte, und nicht die Erkrankung?
Nach einer Woche dieser Art der Lektüre im Trippelschritt ein Wunder.
Mit einer Taschenlampe unterm Bettlaken las ich das Buch – zumeist ungestört von Mitpatienten und Nachtschwestern – zügig bis zum befreienden Ende, für den Leser, mehr aber noch für das Kind und die meisten seiner Retter: der Junge hatte also Auschwitz und zuletzt eben auch Buchenwald überlebt.
Die Ärzte*innen untersuchten mich immer wieder, prüften und verglichen die Befunde.
Sie schüttelten die Köpfe und konnten sich meine überraschende Genesung nicht erklären.
Wie sollten sie denn auch!
Hatte sich mein Leiden durch Nacherleben von und Einfühlung in unermesslich größeres Leid und einer finalen Befreiung davon womöglich wenn nicht auf wundersame, so doch heilvolle aristotelische Weise relativiert?
Preziosen mit Prognosen
Auf einer Insel gibt es das Café „Crêperti Tati“, das offenbar bestbesuchte weit und breit.
Am Eingang prangt ein Schild mit der Aufschrift „Elvis“ - anscheinend passend zu den Rhythmen von drinnen.
Davor parkt ein blau-rot-rostfarbener Cadillac, fahruntüchtig seit langem, soviel ist sicher.
Dieses ins Auge stechende Empfangsensemble wird weitläufig eingekreist von einer Vielzahl an Oldtimern: Volvos, Mercedes, Peugeots, VW, und last but not least steht da doch ein alter Linienbus.
Hatten wir den nicht zuletzt im Kino gesehen, in Hitchcocks Politthriller „Der zerrissene Vorhang“ (Torn curtain), und zwar in der Kulisse einer Fahrt von Leipzig nach Berlin? Unter den Passagieren versuchten ein amerikanischer Physikprofessor und seine Verlobte samt seiner schlau erschlichenen östlichen Geheimformel den Häschern zu entkommen.
Das wohl Einmalige an dieser Installation: die Wagenburg erscheint ausschließlich in Rost bei ansonsten halbwegs erhaltenen Karosserien.
Wo hat man so etwas schon gesehen und gehört?
Der erste Eindruck: Bild und Ton erzeugen verklärte Vergangenheit.
Der zweite Eindruck: Bild und Ton provozieren einen Blick auf Künftiges.
Während der kraftvolle Rock, gespielt und gesungen von dem erst seit einem Jahr von seiner Drogensucht befreiten Neil Young mit „Everybody knows this is nowhere“ bereits eine Zeit jenseits der Gegenwart kreiert, sprechen die glaslosen Scheinwerfer des seltsamen Fuhrparks eine andere Sprache.
Dem nachzutrauern oder sich daran zu erfreuen, das mag jeder so tun, wie er mag.
Moonlightexpress
Jede gute Familie ist bestens geordnet. An kleinen eckigen Tischen steht an jeder Seite ein Stuhl.
Selbst Spiele verlaufen nach Regeln. Das weiß man ja.
Eisenbahnen drehen ihre Runden im Kreis oder in Achten.
In Puppenstuben werden beständig blonde, brünette oder schwarze Haare gekämmt.
Manchmal jedoch ist es Kindern erlaubt, Stühle aneinanderzureihen zu einem Zug, der sich bei Tageshelle langsam in Bewegung setzt – nicht allzu weit, immerhin zu neuen Ideen:
Die Decken fehlen!
Verdeckt wird das Gestühl zum Nachtexpress. Aus dem Kaufmannsladen schnell ein wenig Puffreis und paar Zuckerperlen gegriffen für den Speisewagen, ach – und die verstruwelte Puppe beinahe vergessen, und los geht’s mit Volldampf durch Wälder voller Wölfe und über Gebirge reich an tiefen Schluchten hinauf zum sanft lächelnden Mond, auf dem uns all die den Anreisenden gewogenen Geister, Feen und Trolle uns freudig erwartend entgegeneilen und nun händereichend rufen: „Wo ward ihr denn so lange, ja, wo ward ihr denn bloß?!!“
Und ein aufgeregtes Erzählen will gar nicht enden, einander mit Freudentränen anschauend – wie immer auf gleicher Augenhöhe. Auf Augenhöhe? Wie war das denn nur möglich bei all den vielen Riesen und Zwergen in der Runde?!
Zuletzt singen wir zusammen mit Peterchen und Anneliese unser liebstes Trostlied – begleitet von Herrn Sumsemann auf seiner Geige voller Inbrunst, denn er hatte es heute mit hilfreichen Mächten vermocht, sein sechstes Beinchen zurückzuerobern:
„… verschone uns, Gott, mit Strafen, und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch.“
Und wie sehnsüchtig doch begeben wir uns auf den Heimweg – zu unser geliebten Mutter. Hat sie nicht bereits zum dritten Mal zum Abendbrot gerufen?
Mit Mut und Zuversicht kehren wir zurück in unseren nächsten Lebensabschnitt - in den Vertrauen stärkenden geplanten Alltag.
Statione Termini
Etwas jünger vielleicht als Bruno, der an der Seite seines bislang arbeitslosen Vaters nach dem diesem gestohlen Fahrrad (die Voraussetzung für den Minijob als Plakatkleber) sucht – vergeblich! -, habe ich erstmals erlitten, dass Väter nicht nur streng sein, sondern auch weinen können.
Jahre später noch habe ich wie die Laientheaterenthusiasten und die Müllmänner den beiden bei der Suche helfen wollen …
Endlich in Rom suche ich nach Bruno, meinem gefühlten Alter Ego.
Doch kein Viertel der Stadt zeigt sich mehr so, wie es einmal war, als Bruno sie durchstreife.
Und dennoch entdecke ich ihn endlich an der Statione Termini.
Er winkt mir bedauernd zu mit einer Handbewegung, wie sie als typisch erscheint für Menschen aus Italien, steigt in den Zug und reist hinfort.
In einem kleinen Kino nicht weit vom römischen Hauptbahnhof durchschauert mich ein arabisches Leinwanddrama über ein Mädchen, das davon träumt, ein Fahrrad zu besitzen.
Meine Gewohnheit, mich nur innerhalb der Grenzen Europas zu bewegen, werde ich wohl bald aufgeben müssen.
Brescella
In der italienischen Region Emilia-Romagna hat Jesus Christus zu einem Menschen gesprochen.
Deswegen hat dieser – gelegentlich auf einem Rennrad unterwegs – für seinen geheiligten Herren gekämpft – manchmal sogar mit der Faust.
Und gekämpft hatte der katholische Geistliche einst gegen den Faschismus, gemeinsam mit einem Kommunisten, der später von den Einwohnern Brescellas zum Bürgermeister gewählt wird.
Im Roman und im Kino ist alles möglich. Zumindest Letzteres hat es auch in der Wirklichkeit gegeben.
Neben der Buchreihe hat bzw. haben wohl kaum ein Film (und seine fünfteilige Fortsetzung) das Italien-Bild der 68er-Bewegung mehr geprägt als die immer wieder zu Lachtränen rührenden Darstellungen der Zwistigkeiten zweier Dickschädel, aber auch ihrer Zeichen der Versöhnlichkeit aus alter und neuer Verbundenheit. Inszeniert wurden sie in dem am Po liegenden Dorf Brescella.
Und das ist das Wunderbare für uns Kinoreisende: das Drama über Brunos vergebliche Fahndung nach dem gestohlenen Rad ist auch die hier gedrehte Serie überwiegend außerhalb vom Studio Cinecità entstanden.
Im Unterschied zu Rom jedoch ist in Brescella fast noch alles am alten Ort.
Die Gassen, die Pappelallee vor dem Deich, der Platz in der Dorfmitte.
Und welche Liebhaber*innen dieses einzigartigen Ambientes trotz Strapazierung aller grauen Zellen gar nicht mehr so sicher ist, mit bzw. von wem, was, wann passiert ist, gesagt, geflüstert oder gebrüllt wurde, der oder dem sei ein Besuch des inzwischen zentrumsnah errichteten „Museo di Don Camillo e Beppone“ anempfohlen, das immerhin mit allen sechs Teilen der Kultserie aufwartet.
Wir lauschen indessen unbeirrt dem vertrauten Klang der Glocken, du betrittst andächtig das altehrwürdige Kirchenhaus, den angenehmen Duft des Weyrauchs nimmst du wahr - erstmals natürlich.
Doch dann? Ich traue meinen Ohren nicht.
Spricht da nicht plötzlich aus der Apsis eine sanfte Männerstimme zu dir?
Warschau
Mitten im Krieg war mein Großvater mit meiner kaum 16 Jahre alten Mutter in der Straßenbahn durchs Warschauer Ghetto gefahren, um sie davon zu überzeugen, dass, wenn sie es denn täte, nicht länger an Hitler glauben dürfe.
Und von diesem Tage an glaubt sie tatsächlich ihrem gütigen Vater mehr als der Anführerin des „Bundes deutscher Mädel“ in ihrem Wohnviertel – was gar nicht so wenig Mut erforderte unter den damals herrschenden Verhältnissen.
Dennoch. So oft mir beide von ihrer kurzen Durchfahrt durchs Ghetto erzählten, in der sie eingesperrte jüdische Menschen betrachteten, der Eindruck, den ihr Erschrecken in meiner jugendlichen Vorstellungswelt hinterließ, erwies sich als recht wage, und das Ausmaß des Leides der Gefangenen blieb über viele Jahre allzu abstrakt.
SS-Schergen erstürmen eine Ghettowohnung im 4. oder 5. Stock, in der sie Widerstandskämpfer vermuten.
Sie treffen auf eine gutbürgerliche Familie beim Abendessen. Als der im Rollstuhl sitzende Großvater es wagt, die Soldateska zu fragen, warum man sie beim Essen störe, wirft man ihn in Sekundenschnelle vom Balkon.
Roman Polanski, der als Kind das Ghetto erleiden musste und ihm wie durch ein Wunder entkam, veranschaulichte für mich allein schon mittels dieser einzigen Filmszene das schlimmste Ausmaß solcher Willkürherrschaft. Ich erschauderte an Leib und Seele.
Mein Großvater und meine Mutter – hatten sie denn das Martyrium, das sich hinter dem Bild der zwar gefangenen, aber doch auch geschäftig erscheinenden Kinder, Frauen und Männer, verbarg, zu erahnen oder zu verspüren vermocht?
Um wie viel stolzer bin ich doch seit diesem Kinotag auf meine Mutter und auf meinen Großvater!
Anderort
1
Die Verfolgung von religiösen Menschen durch andersgläubige Menschen reicht weit zurück in der Historie von uns Erdenbürgern und wird leider auch unsere Zukunft prägen – in welchem Maße, darüber entscheidet das veränderbare Größenverhältnis von Humanisten zu Menschenfeinden: erbarmungslose Verfolgung von Schwarzen durch Weiße, Christen, Juden, Sinti, Roma und andere Ethnien und Glaubensrichtungen auf der einen Seite, deren beherzte Rettung auf der anderen Seite.
Die Macht von Verbrechen gegenüber Barmherzigkeit ist, wie wir ja wissen, nicht abhängig von einem womöglich alternativlos waltenden höheren Schicksal sondern vom Gewissen jedes einzelnen von uns.
Ich will eine kleine utopische Geschichte erzählen aus einer Schreckensepoche, als Millionen jüdischer Mitbürger insbesondere von Deutschland aus nach Auschwitz verbracht wurden, um dort vergast zu werden.
Angesiedelt ist sie in einem waldhessischen Bergdorf namens Anderort zwischen Hersfeld und Fulda gelegen und sieben Kilometer südlich von einer anderen waldhessischen Ortschaft namens Rhina.
In der Zeit der Schilderung dieser Geschichte, nämlich vom 7. bis 9. November 1938, lebten in beiden Dörfern jeweils um die 700 Einwohner, wobei die Mehrheit jeweils dem jüdischen Glauben anhing.
Die Geschichte Rhinas ist im Unterschied zu der Anderorts eine Dystopie und sehr real: alle jüdischen Einwohner*innen wurden gefasst, nur die wenigsten überlebten die Todeskammern.
Die Utopie Anderort dagegen besteht, je nachdem, wie wir es sehen wollen, aus faked news oder aus der Schilderung einer möglichen Welt, die anders ist und erst sieben Jahre später an einem realen anderen deutschen Ort geschieht, nämlich im KZ Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar, wo malträtierte gefangene Männer mit einem gelben Stern und andersfarbigen Winkeln am blauweiß gestreiften KZ-Einheitshemd, Juden also, Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen, Homosexuelle, Kriminelle gar der Welt ein wahres Wunder bescherten, nämlich gemeinsam ein kleines jüdisches Kind in ihren Behausungen zu verstecken und somit vor der Reise in den Tod zu bewahren.
Der ostdeutsche Schriftsteller Bruno Apitz hat über das Wunder dieser glaubens- wie anhängerschaftsübergreifenden Mitmenschlichkeit einen ergreifenden Roman geschrieben, „Nackt unter Wölfen“, der verfilmt wurde zunächst in der DDR u. a. mit Armin Müller-Stahl fürs Kino und später nach der Wiedervereinigung noch einmal fürs Fernsehen.
2
Es war gegen Mittag, als Pfarrer Thomas Altrock in Anderort einen Anruf von seinem Amtsbruder Jakob Münster aus Kassel erhielt. Der fragte nur, ob es bei ihnen im Dorfladen heute auch weniger Bananen gegeben habe, und erhielt eine verneinende Antwort. Sie legten rasch wieder auf. Beide Männer verstanden sich als Anhänger der von Dietrich Bonhoeffer gegen die opportunistische Mehrheitskirche der Deutschen Christen begründeten antifaschistischen Bekennenden Kirchengemeinschaft. Genau wie die Amtsbrüder, die aus Fulda und Bebra in Anderort anriefen mit ähnlichen Fragen wie diejenige von Pastor Münster, nämlich ob es nach wie vor nötig sei, mit Gesangsbüchern bzw. einer Vervielfältigungsmaschine auszuhelfen.
Am 7. November 1938 lag Brandgeruch in der nord- und osthessischen Luft.
Was aber genau hatten die Telefonate der geistlichen Herren zu bedeuten?
In einer Art Geheimsprache – denn selbstredend wurde die Telefone von der Gestapo abgehört – hatten sich die Kollegen darüber informiert, dass einerseits Zerstörungen jüdischer Geschäfte, initiiert durch SA-Schlägertrupps, begonnen wurden, diese andererseits aber offenbar ohne nennenswerte Gewaltbereitschaft von Seiten der breiten Bevölkerung blieben.
Und am Abend wusste man mit hinreichender Sicherheit, dass es den Nazis mit dieser Art Generalprobe in den drei genannten hessischen Städten nicht gelungen war, den höllischen Funken auf weitere Gebiete überschlagen zu lassen.
Für Pfarrer Altrock, dem trotz aller Vorahnung die Nachrichten mit großem Schrecken in die Knochen gefahren waren, bedeuteten sie, sofort Alarm zu schlagen in dem Teil der Dorfgemeinschaft, der sich eindeutig dafür entschieden hatte, in unterschiedlichen Formen Widerstand zu leisten gegen die rassistische Diktatur – dort also den Notfall auszurufen so heimlich wie nur irgendwie möglich, aber auch so nachdrücklich.
Thomas Altrock wählte die Nummer der örtlichen Polizei. Neben dem Pastorat und der Feuerwehr gab es nur dort noch ein Telefon im Dorf.
Es meldete sich die Gattin des Wachtmeisters, Frau Lohmann, die er bat, ihre Tochter Paula, seine Konfirmandin, zu ihm zu schicken, um mit ihr noch Einzelheiten der Gestaltung des Ende des Monats stattfindenden Totensonntages vorbereiten zu können.
Kaum fünf Minuten später klingelte es an der Tür des betagten Pastorats. Lisbeth, die Frau des Pfarrers, öffnete, bat Paula herein und im Wohnzimmer Platz zu nehmen und bot ihr eine Tasse mit heißem Kakao an.
Als der Pfarrer den Raum betrat, wusste Paula sofort Bescheid.
Seit vielen Wochen wurde im Konfirmandenunterricht ein Plan erarbeitet, um im Fall der Fälle Leib und Leben der jüdischen Mitbewohner*innen, der liebgewonnenen Nachbar*innen, Freund*innen, Vereins- und teilweise sogar Familienmitglieder zu bewahren.
Über viele Wochen also war ein engmaschiges Netzwerk entstanden, das von evangelischen Kindern und Jugendlichen ausgehend die Hilfsbereitschaft in praktischen Rettungsmaßnahmen durch einen maßgeblichen Teil der Dorfbewohner*innen effektiv zu koordinieren vermochte.
Nach Pfarrer Altrock war die 14-jährige Paula Lohmann sozusagen der zweite Eckstein dieser Bewegung. Sie benachrichtigte in aller Eile aber nicht unbesonnen ihre beteiligungswilligen Mitkonfirmand*innen, die wiederum ausschwärmten, um die verschworenen erwachsenen Vertreter*innen der Dorfgemeinschaft zu kontaktieren, damit ein sogenannter Dorfrat einberufen werden konnte.
In der Zusammensetzung dieses Rates spiegelten sich in etwa die altersmäßigen, sozialen, beruflichen und glaubensmäßigen Verhältnisse von Anderdorf: ein christliches 14-jähriges Mädchen also war vertreten wie eine 93 Jahre alte Baronin, Arbeiter*innen, Bäuerinnen und Bauern, Bürger*innen, ein staatlicher Mandatsträger, nämlich Bürgermeister Niemeyer, selbstverständlich Mitglied der NSDAP … wie sollte es auch anders sein. Und auch meine Wenigkeit, das berichtende Dorfschullehrerlein.
Von besonderer Wichtigkeit in der Runde erwies sich die Beteiligung des kommunistischen Druckermeisters Erwin Grosche, der seit der Machtergreifung der Nazis Anfang 1933 gute vielfältige Erfahrungen sammeln konnte mit der Fälschung von Pässen, in der es nicht allein genügte, das „J“ verschwinden zu lassen.
Zum Vorsitzenden hatte die Versammlung den 85-jährigen dänischen Kapitän Asmus Rasmussen gewählt, der seine Heimat in den frühen 20er Jahren verlassen hatte, um seiner großen Liebe Rosemarie nach Deutschland zu folgen, einer einst hochrangigen Genossin der KPD, die im Zuge des Reichstagsbrandes 1933 verhaftet worden war und seitdem in den Folterkellern der Gestapo als verschollen galt.
Ihr trauernder Ehemann, ein aufrechter Sozialdemokrat, hatte viel lernen können von seiner mutigen Frau, von den Kader- und Konspirationsprinzipien der KPD, insbesondere im Zusammenhang mit Aktionen in rein politischer wie auch militanter Form, die generell so durchgeführt wurden, dass die Aktivisten gemeinsam handelten, naturgemäß, jedoch niemand eine Genossin und/oder einen Genossen persönlich kennen durfte, um im Falle der Gefangennahme niemanden verraten zu können – was bekanntlich nicht, wie erhofft, vor Folter der Nazischergen schützte.
Der alte Käpten eröffnete die Sitzung mit seinem Credo: „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Dann setzte er fort: „Meiner Meinung nach sind unsere Chancen, hier und heute zu gewinnen, sehr gering. Was wir wissen, ist, dass sie heute Vormittag mit der Generalprobe begonnen haben. Was wir nicht wissen, wann die Stunde der großen Erstaufführung folgt. Heute Abend noch? Morgen früh? Aber genau diese Unwissenheit lässt uns für Momente nur - vielleicht - nicht den Mut verlieren, unseren Rettungsplan schnellstmöglich in die Tat umzusetzen, statt wie das Kaninchen vor der Schlange zu erstarren. Aber wir müssen sofort handeln. Es begebe sich bitte jeder an seinen Platz. Gott sei mit uns.“
3
Das von langer Hand vorbereitete Notfallkonzept sah im wesentlichen drei Ebenen der Errettung vor:
- das direkte Verstecken von Menschen hier im Dorf an vielen geheimen Örtlichkeiten insbesondere im Bereich der Bauernhöfe, die zunächst mit Vorräten für zwei bis drei Wochen ausgestattet waren
- das indirekte Verstecken vor allen von Kindern und Jugendlichen in nichtjüdischen Familien. Ihnen wurden nicht nur der Judenstern abgenommen, sie erhielten auch neue Ausweise, soweit das vom Alter her nötig war. Dies war eine sehr kurzfristige Maßnahme, bis geeignete Reisewege gefunden wurden, denn es war selbstverständlich damit zu rechnen, dass kein Einwohnermeldeamt den Blick in seine Karteien verweigern würde.
- die Flucht ins Ausland von möglichst vielen umliegenden Bahnhöfen aus. Die Exilanten waren versorgt worden mit unauffälligem Gepäck, Fahrkarten für Bus, Bahn und Schiff, neuen Papieren und das wichtigste vielleicht – mit Adressen von Gastgebern in Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und Übersee.
Das zivile wie zivilcouragierte Kommando „Schutzengel“ lief weitgehend reibungslos ab, weitaus besser zumindest, als Kapitän Rasmussen zu hoffen gewagt hatte. Besonders erfreut hatte ihn das vorbildliche Engagement von nichtjüdischen und jüdischen Freundeskreisen unter den Jugendlichen. Andererseits tat sich gerade hier eine höchst enttäuschende Neigung zum Verrat der Aktion auf.
Zunächst möchte ich von der gelungenen „Verbringung“ der Tante Mie berichten, der Besitzerin des Dorfladens. Wie konnte wohl der allseits sehr beliebten jüdischen Kauffrau geholfen werden, damit sie nicht an Leib und Seele Schaden nehmen würde, und die Dorfbevölkerung womöglich Hunger erleiden müsste?
Fast um die Uhr herum versorgte sie ihre seit Jahrzehnten gewachsene treue Kundschaft stets mit dem Nötigsten an Lebensmittel vor allem. Wenn etwas fehlte in ihren Regalen, dann notierte sie sich das mit einem dicken Bleistift auf einer Liste. Mit der und einer großen hellbraunen ledernen Einkaufstasche begab sie sich in den einmal pro Woche, nämlich freitags, fahrenden Bus sommers wie winters ins 23 Kilometer entfernte Hersfeld, um die Kundenwünsche zu erfüllen.
So kam es in der schneereichen Adventszeit schon mal vor, dass Tante Mie manchen Freitag Abend nicht nur mit ihrer Einkaufstasche sondern mit weiterem Gepäck überhängt und vollgeschneit vor ihre Ladentür trat und dem einen Mädchen oder anderem Jungen wie die leibhaftige segenbringende Weihnachtsfrau erschienen sein mochte.
Seit vielen Jahren hatte sie es sich zur Angewohnheit gemacht, ihre Kunde*innen allen Alters zur Selbständigkeit zu ermuntern – Kinder und Jugendliche vorzugsweise. Es gab zuletzt kaum Käufer*innen, deren Warenwünsche nicht mit Tante Mies Aufforderung beschieden worden waren: „Nimm selbst!“
Und diese Schrulle erwies sich als besonders nützlich – jetzt, in der Situation, in der Tante Mie versteckt werden musste, und sie wahrhaftig vertreten werden konnte durch Jugendliche vor allem, die die Lücke, die ein so herzensguter Mensch wie Tante Mie hinterließ, zwar nicht zu ersetzen vermochten, die aber voller Selbstvertrauen an ihre Stelle traten und dieser alle Ehre erwiesen.
„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“ Wer weiß denn nicht, dass Goethes Imperativ, sein himmlischer Vorsatz, bis heute beständig angefeindet wurde und weiterhin wird. So auch in unserer kleinen Geschichte über das Ausnahmemusterdorf - gleichwohl mit Ausnahmen von der Regel.
In welchem Spiel gibt es denn nicht einen Schwarzen Peter? In welchen Legenden gibt es nicht einen Verräter Judas Ischariot und/oder einen Verleugner Petrus?
Bevor der Hahn gekräht hatte, zogen sie los mit ihren Rädern, Otto, Aron und Hans-Peter, nach Hersfeld, und zwar mit der festen Absicht, das Fluchtprojekt „Schutzengel“ an die Henker zu verraten, weil sie sich von ein paar Silberlingen hatten verlocken lassen.
Die drei Jungen waren enge Freunde. Aber war denn Aron nicht ein Jude? Sehr wohl – was der Freundschaft indes keinen Abbruch leistete. Was durchaus schwer zu verstehen ist, dass Aron der Freundschaft zu zwei Nichtjuden einen wesentlich höheren Stellenwert einräumte als der Sicherung seines Lebens. Vielleicht, um nicht ewig der Außenseiter zu bleiben?
Aron hatte mit seinen Freunden bis Ostern 1936 das 5. Schuljahr des Hersfelder Gymnasiums für Jungen besucht, das er nun im Zuge der Nürnberger Rassengesetze verlassen musste. Auch aus der Mitgliedschaft im Deutschen Jungvolk der Hitler Jugend, den Pimpfen, war er – selbstredend? - ausgeschlossen.
Es war der Oberscharführer eben dieser Hitlerjugend Kurt Wolf, der seit Monaten seinen Jungstamm zur Wachsamkeit ermahnte in Stadt und Land, wo immer jeder einzelne von ihm auch wohnte, sich umzusehen und umzuhorchen, ob es irgendwelche Versuche der bolschewistischen Juden, dieser schmarotzenden Ratten, wie er sich stets auszudrücken pflegte, sich davonzuschleichen wie die Strauchdiebe, um ihrer gerechten Strafe zu entkommen. Für jede einzelne Aufdeckung solcher heimtückischen Vorhaben würden aufmerksame Detektive in unseren Reihen mit 100 Reichsmark und einer Tapferkeitsmedaille belohnt.
Und die angefeuerten Freunde Otto und Hans-Peter versprachen ihrem guten getreuen Kameraden Aron feierlich, sich im Falle des erwartbaren Erfolgs die Geldbelohnung zu teilen.
Als die Drei Unterhaun erreichten, den südlichen Vorort von Hersfeld, schlugen ihnen ätzende Rauchschwaden entgegen. In der Stadt angekommen trauten sie ihren Sinnen nicht: Flammen loderten aus allen Himmelrichtungen, lautes Gebrüll von teils in Kolonnen marschierenden, teils wild umherlaufenden SA-Leuten, die Fensterscheiben einschlugen und Sprüche wie „Kauft nicht beim Saujuden!“ mit weißer Farbe an Hauswände neben offenbar jüdischen Geschäften schmierten.
Ihre Schule fanden die Jungen geschlossen vor. Der Pausenhof war übersät mit verletzten Menschen in Zivil wie in Uniform – unter ihnen der blutüberströmte Oberscharführer Wolf.
Ihm die Aktion „Schutzengel“ verraten?
Mit Abscheu wandten sie sich von ihm ab.
Sie schämten sich vermutlich in einem ähnlichen Maße dafür, sich in Versuchung geführt haben zu lassen. Otto und Hans-Peter in der Hoffnung, ihr Taschengeld deutlich aufbessern zu können. Und der Aron wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Blutsbrüderschaft oder einfach blinder Gefolgschaft.
4
Wie getretene Hunde kehrten sie in Richtung Anderort zurück, zitternd vor Angst, sie würden zu Hause ein ähnliches Bild der Zerstörung im Kleinen vorfinden wie in der Stadt. Dort angekommen staunten sie nicht schlecht darüber, das ihr Dorf verschont geblieben war.
Hatte es denn selbst einen Schutzengel gehabt?
Sie suchten sofort Ottos und Hans-Peters Konfirmationspfarrer auf, um ihm vom Inferno in Hersfeld zu berichten und ihre schändlichen Gedanken und Begehrlichkeiten tränenreich zu beichten.
Der Seelsorger hielt jedem von den drei Freunden für einen Augenblick die Hand auf den Kopf und sprach: „Im rechten Moment ist aus dir, einem Saulus, ein Paulus geworden. Es sei dir verziehen.“
Dann berichtete er ihnen, dass er bereits gehört hätte, die Nazis wären auch mit ihrem zweiten Versuch, diesmal in einer einzigen Stadt, gescheitert, den Flächenbrand einer reichsweiten Pogromstimmung zu entfachen. „Gott sei‘s geklagt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht.“
Was denn aus der Aktion „Schutzengel“ geworden sei, wollten die Jungen von Herrn Altrock wissen.
Dieser verweigerte ihnen die Antwort auf ihre Frage mit der Begründung, das dürfe er ihnen gar nicht sagen. „Alle aktiv und passiv Beteiligten seien zu strengstem Stillschweigen verpflichtet. Aus Sicherheitsgründen. Ihr seht ja, was ihr beinahe angerichtet hättet. Aber eines kann ich euch sagen. Von einer Konfirmandin, den Namen darf ich euch natürlich nicht nennen, war etwas von eurem gemeinen Vorhaben zu Ohren gekommen, fragt mich nicht wie. Der mögliche Verrat wurde seinerseits zum Glück verraten, und die Alarmsignale standen auf Rot. Gott sei‘s gedankt!
So, Kinners, wir müssen eilen. Wir haben schnellsten eine Lösung für die Sicherheit Arons zu finden.
Ich kann euch nur raten, sofort Kapitän Rasmussen aufzusuchen. Vielleicht vermag er noch Hilfe zu leisten. Lieber heiliger Gott, beschütze uns. Amen!“
5
Tatsächlich wusste der alte Ozeanüberquerer Rat und vermochte noch, wenn auch spät, den für Aron eigentlich längst vorgesehenen Platz im „Seenotrettungsboot“ zuzuweisen. Womöglich durch Gottes Beistand. Denn warum bewegte sich heute am 8. November die Hasswelle von Hersfeld nicht weiter ins umliegende Land bis hinein in die kleinsten Dörfer? Wir wissen es mal wieder nicht.
Zeit war also gewonnen, und die reichsweite Katastrophe wütete erst oder aber dennoch am folgenden Tag, am 9. November, der Reichspogromnacht – oder im Volksmund verharmlosend Reichskristallnacht genannt.
Wir wissen, welche unglaublichen Schrecken und nachfolgende Leiden sie verursachte als unmittelbarer Vorläufer des Holocausts nicht nur aber auch im kleinen Dorf Rhina. Wer kann das Ausmaß dieses Unheils wohl jemals fassen?!