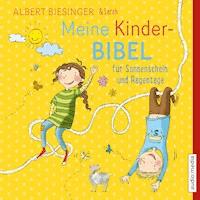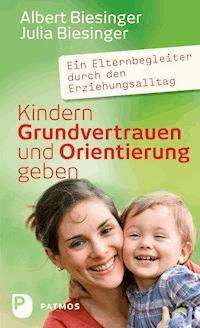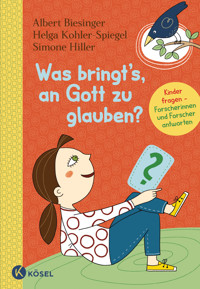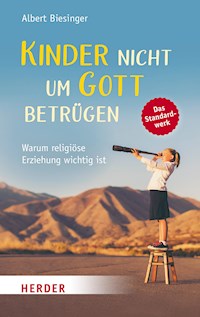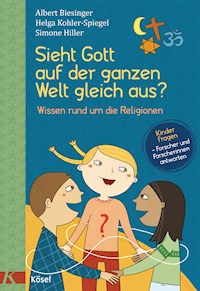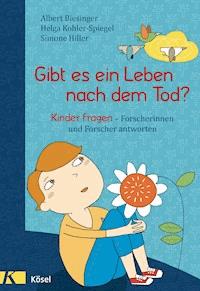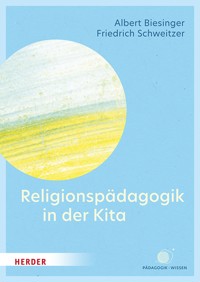
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Alle Kinder stehen in ihrer Entwicklung vor religiösen Orientierungsfragen. In einer multireligiösen und säkularer gewordenen Gesellschaft gilt es umso mehr. Aber wie kann heute religiöse und interreligiöse Begleitung und Erziehung in kirchlichen sowie in kommunalen Einrichtungen verantwortungsvoll gestaltet werden? Die Autoren bieten dazu Grundinformationen und erschließen Schritt für Schritt wichtige Kompetenzbereiche für die religionspädagogische Arbeit mit Kindern. Sie beschreiben Aufgaben und Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte und präsentieren exemplarische Lösungsmöglichkeiten – praxisnah, kompetent und materialreich. Ein Grundlagenwerk für Praxis, Aus- und Fortbildung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Interesse der besseren Lesbarkeit und weil Frauen in frühpädagogischen Berufen prozentual stärker vertreten sind als Männer, wird in diesem Buch meist die weibliche Form verwendet, wenn von pädagogischen Fachkräften die Rede ist. Selbstverständlich sind damit aber immer Leser und Leserinnen bzw. männliche und weibliche Fachkräfte gleichermaßen gemeint.
Überarbeitete Neuausgabe 2024
(3. Gesamtauflage)
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2013
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © Albina Kidinova / 123 RF, Charunee Yodbun – shutterstock
Papierstruktur im Innenteil: © Charunee Yodbun – shutterstock
Satz: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN Print 978-3-451-39770-7
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83216-1
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83237-6
Inhalt
Vorwort
1 Religion in der eigenen Biografie reflektieren
2 Aufgaben in den Orientierungs- und Bildungsplänen
3 Hinweise aus der human- und sozial-wissenschaftlichen Forschung
4 Selbstwerdung und Resilienz
5 Religionspädagogische Orientierung in der Vielfalt gewinnen
6 Wie Christen, Juden und Muslime ihre Religion beschreiben
7 Kindern Erfahrungen mit Religion ermöglichen
8 Konzeption und Leitbild entwickeln im Team
9 Mit Eltern kommunizieren
10 Mit den Erwartungen der Träger umgehen
11 Konfessionslosigkeit und Säkularisierung in der religionspädagogischen Praxis
12 Filme für die religionspädagogische Begleitung
Autor:innenverzeichnis
Vorwort
Erziehungs- und Bildungsaufgaben wahrzunehmen ist nachhaltig, hat höchste Relevanz und Auswirkungen weit in die Zukunft hinein – meistens über die eigene Lebenszeit der Erziehenden hinaus. Kinder in der frühen Phase zu begleiten ist somit eine erfreuliche, aber auch verantwortungsvolle Aufgabe. Kinder sind in diesem Alter neugierig und erschließen sich aktiv ihre Wirklichkeit, sind dabei aber auf eine förderliche Kommunikation in ihrem Umfeld angewiesen.
Pädagogische Fachkräfte sind in der Regel – außerhalb der Familien – die wichtigsten Menschen für die Kinder in dieser Lebensphase. Umso mehr ist es in der Ausbildung, aber auch in der Fort- und Weiterbildung wichtig, die verschiedenen Ebenen professionellen Handelns zu reflektieren. Dazu gehören:
• Die persönliche Motivation für den Beruf der pädagogischen Fachkraft
• Die grundlegenden pädagogischen Kompetenzen in der Kommunikation mit Kindern – aber auch mit deren Eltern und dem Träger der Kita
• Die eigenen religiösen Vorstellungen mit Blick auf religionspädagogische Aufgaben
• Die differenzierten religionspädagogischen Aufgaben mit Blick auf Rituale, religiöse Feste und kindertheologische Gespräche, auf Fragen nach Wahrheit und Wahrheitsansprüchen, vor allem aber auch mit Blick auf die multikulturelle und multireligiöse Zusammensetzung von Kindergruppen in den Einrichtungen im Sinne einer Bereicherung
• Der konstruktive Umgang mit Konflikten und »Störungen«, die in Bildungsprozessen immer auftreten können, und die Bearbeitung von »Störungen« als Chance für Veränderungen und Weiterentwicklung des Kita-Alltags
• Selbstbewusstsein – im Umgang mit sich selbst, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Kindern, mit den Eltern und den Trägern
Dieses Buch ist als Grundlage für die Ausbildung und für die Fortbildung konzipiert, eignet sich aber auch zum individuellen Selbststudium. Religiöse und interreligiöse Bildung bezeichnen dabei keineswegs nur Aufgaben für Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft. Alle Kinder stehen in ihrem Aufwachsen vor religiösen Orientierungsfragen – in einer multireligiösen Gesellschaft mehr denn je. Deshalb wenden wir uns mit diesem Buch an alle Fachkräfte, ganz unabhängig von der Trägerschaft der Einrichtungen.
Wenn wir im Folgenden von Kindertagesstätten oder Kitas sprechen, meinen wir damit sämtliche Formen der frühkindlichen Betreuung und Bildung, also Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten, Kinderhorte etc. Unser Bildungsbegriff umfasst einen lebenslangen Lehr- und Lernprozess, der sich nicht auf Erziehung beschränkt.
Dieses Buch ist bewusst von uns beiden gemeinsam als katholische und evangelische Religionspädagogen erarbeitet worden. Wir gehen seit Jahren davon aus, dass es zu einer engen Zusammenarbeit zwischen katholischer und evangelischer Religionspädagogik kommen muss. Und immer wichtiger wird auch die Zusammenarbeit über das Christentum hinaus, zum Beispiel mit der islamischen Religionspädagogik.
Die einzelnen Kapitel beginnen jeweils mit einer Aufgabe aus der Praxis; Leitfragen helfen bei der Bearbeitung. Darauf folgt ein ausführlicher Hauptteil, in dem sowohl theoretische als auch praktische Grundinformationen dargestellt werden. Am Ende jedes Kapitels gibt es Leitfragen zur vertiefenden Reflexion (»Die eigenen Kompetenzen erproben und einüben«) sowie weiterführende Literaturtipps.
FILMTIPPS
Film und Buch
Dieses Buch macht sich neue mediale Möglichkeiten zunutze – mit der Verbindung zwischen Film und Buch. In der Reihe »kleine menschen – große fragen« stehen aktuell 33 Filmclips zu religionspädagogischen Fragen zur Verfügung, die kostenlos genutzt werden können (www.kleine-menschen-grosse-fragen.de). Im letzten Kapitel dieses Bandes findet sich ein Überblick zu diesen Filmen, die begleitend zur Lektüre oder im Unterricht eingesetzt werden können. Hinweise dazu finden sich am Ende jedes Kapitels.
Dieses Lehr- und Lernbuch baut auf Ergebnissen aus mehreren Untersuchungen auf: der großen Studie »Interkulturelle und interreligiöse Bildung in Kindertagesstätten«, die wir an der Universität Tübingen mit Unterstützung der Stiftung Ravensburger Verlag durchgeführt haben, sowie der wissenschaftlichen Begleitung von Praxisprojekten zur interkulturell-interreligiösen Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder, die von der Stiftung Kinderland (Baden-Württemberg Stiftung) beauftragt wurde. Dazu kommen noch eine aktuelle empirische Untersuchung zur Unterstützung interreligiöser Kompetenz in der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften und nicht zuletzt die wissenschaftliche Begleitung der innovativen Kita Vorwort der Religionen IRENICUS in Pforzheim, der ersten Kita in christlich-jüdisch-muslimisch-jêzîdischer Trägerschaft. Mithilfe dieser Studien besitzt unsere Darstellung eine wissenschaftliche Basis, die es zugleich erlaubt, die für Gegenwart und Zukunft der religionspädagogischen Arbeit zentralen interreligiösen Herausforderungen zu berücksichtigen.
Die genannten Stiftungen haben diese Arbeit in einem langen Zeitraum mit hoher finanzieller und ideeller Unterstützung ermöglicht, wofür wir sehr dankbar sind. Raphael Rauch hatte die redaktionelle Betreuung des ursprünglichen Bandes übernommen. Von seinen journalistischen Fähigkeiten hat die Darstellung sehr profitiert. Hilfreich waren besonders auch die Hinweise zum Manuskript aus der Ausbildungspraxis, die uns Gabriele Beier und Ludger Mehring freundlicherweise zukommen ließen, sowie die eindrucksvollen Arbeiten von Anke Edelbrock. Wir danken Alfred Bodenheimer und Ednan Aslan für die theologischen Beiträge zu Judentum und Islam sowie Bettina Stäb, Georg Hohl und Frank Jansen (verstorben 2022) für ihre Überlegungen der Trägerorganisationen Gemeindetag, BETA und KTK. Für die Zusammenarbeit mit Ralf Gaus, Heike Helmchen-Menke und Andreas Leinhäupl danken wir: Sie bringen didaktische Überlegungen zum multimedialen Filmprojekt kleine-menschen-grosse-fragen in diese überarbeitete und erweiterte Auflage ein.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre, gute Erfahrungen und vor allem auch hilfreiche Unterstützung durch dieses Buch in Ihrer täglichen Kita-Praxis. Und wir sind interessiert an Ihren Rückmeldungen, die Sie uns gerne per E-Mail geben können:
1.
Religion in der eigenen Biografie reflektieren
Die Themen in diesem Kapitel sind
→ Bedeutung von Religion in der eigenen Lebensgeschichte reflektieren
→ Wandel grundlegender religionspädagogischer Fragen
→ Herausforderungen und Chancen durch Multireligiosität
→ Religiöse Bildung ist auch immer interreligiöse Bildung
→ Mit den eigenen biografischen Erfahrungen Kinder religiös begleiten
→ Gemeinsam mit den Kindern nach Antworten auf die »großen Fragen« suchen
Kann ich als pädagogische Fachkraft einen religionspädagogischen Auftrag wahrnehmen?
Die religiöse Begleitung, Erziehung und Bildung von Kindern berührt immer auch die biografischen Voraussetzungen der Erwachsenen. Das gilt nicht nur für die Eltern, sondern auch für die pädagogischen Fachkräfte. Da alle Erwachsenen selbst einmal Kinder waren, begegnen sie sich in den Kindern selber wieder – als das Kind, das sie einmal waren. Sie bringen Erfahrungen mit der eigenen Erziehung mit, und diese Erfahrungen bestimmen sehr häufig auch das spätere pädagogische Handeln, in positiver wie auch in negativer Weise. Denn die Begegnung mit den Kindern kann an gute Erfahrungen anknüpfen, aber auch alte Konflikte aus der eigenen Kindheit wachrufen. Deshalb ist es so wichtig, sich der Bedeutung von Religion und religiöser Erziehung in der eigenen Lebensgeschichte bewusst zu werden. Auf diese Weise werden wir uns unserer Verletzlichkeit bewusst, aber auch unserer besonderen Stärken und Fähigkeiten.
AUFGABE
Schreiben Sie einen Tagebucheintrag, in dem Sie Ihre religiösen Einstellungen und Erfahrungen früher und heute reflektieren. Folgende Fragen können dabei als Anhaltspunkt dienen:
▶ Wie bin ich als Kind selbst mit religiöser Praxis und mit religiösen Bedeutungen in Berührung gekommen?
• Wer war dabei für mich besonders wichtig?
• Welche Gefühle kann ich dazu heute noch wahrnehmen?
• Wie habe ich mir damals Gott und die Welt vorgestellt?
• An welche Zweifel und Ungereimtheiten kann ich mich erinnern?
• Wie hat sich meine Religiosität in der Grundschulphase (weiter-)entwickelt?
• Welche Geschichten aus der Bibel, aus dem Judentum, aus dem Koran und anderen Religionen haben mich beeindruckt?
• Welches sind meine Lieblingsgeschichten geworden?
• Wie hat sich mein Glaube in der Pubertät verändert?
• Welche Rituale (Erstkommunion, Konfirmation, Firmung oder Bar-Mizwa/Bat-Mitzwa, Fasten beim Ramadan etc.) haben mich beeindruckt und sind mir in Erinnerung geblieben? Was waren wichtige Einschnitte und Erfahrungen?
▶ Wie erlebe ich meine Nähe bzw. Distanz zu religiösen Weltdeutungen heute?
▶ Wie sieht meine religiöse/nichtreligiöse Deutung der Welt heute konkret aus?
▶ Was bedeutet es mir, mit Kindern im Kita-Alter über religiöse Themen zu sprechen?
Grundinformationen
Fragen an die eigene Biografie
Es liegt auf der Hand, dass die eigenen Erfahrungen in der Kindheit immer auch das spätere erzieherische Handeln beeinflussen. In der Tätigkeit als pädagogische Fachkraft wiederholen sich oft Situationen, die man selbst in der Kindheit erlebt hat. Im Blick auf religiöse Erziehung ist deshalb die Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen in der Lebensgeschichte besonders wichtig.
Pädagogische Fachkräfte erleben heute in ihren Einrichtungen, dass »Religion« Schritt für Schritt immer mehr zum Thema wird. Dies hängt mit den religiösen und kulturellen Veränderungen unserer Gesellschaft zusammen und kann pädagogische Fachkräfte auch verunsichern. Sie fragen sich dann zum Beispiel: »Inwiefern bin ich aufgrund meiner eigenen Biografie in der Lage, mit religiösen Vorstellungen von Kindern und bisweilen auch denen der Eltern umzugehen?«
Manche pädagogischen Fachkräfte verfügen über keine oder nur wenige Erfahrungen mit Religion, andere wurden religiös sozialisiert und haben bereits in ihrer Familie tiefe Einblicke in eine Religion nehmen können. Mit der neuen Situation in der Kita umzugehen kann jedoch – auf der Basis des eigenen Erfahrungs- und Fragehorizontes – für beide Gruppen eine spannende Herausforderung sein. Damit sich Fachkräfte nämlich selbst als Person in die Bildungsprozesse der Kinder einbringen können, müssen sie die eigene Ausgangslage und die möglicherweise vorhandenen »Störungen« beim Thema Religion analysieren und reflektieren. Die Erfahrungen sollten dabei keinesfalls abgewertet werden. Jeder Mensch bringt seine je eigene Biografie mit – und ebendiese ist zu würdigen. Dass die eigene Biografie nicht zum Hindernis für die anvertrauten Kinder und Eltern wird, gehört zur pädagogischen Professionalität.
Die eigene Biografie für den zu leitenden Bildungsprozess ernst zu nehmen bedeutet immer auch, sich aufgeschlossen zu zeigen und bereit zu sein, sich auf Neues einzulassen.
Früher und heute:zum Wandel religionspädagogischer Problemlagen
In der Forschung standen in den letzten Jahrzehnten vor allem schlechte Erfahrungen mit religiöser Erziehung im Vordergrund. Menschen berichten über die Art und Weise, wie ihnen Gott in der Kindheit nahegebracht worden ist und wie dies ihr Leben eingeengt oder sogar auf Dauer verletzt und verbogen hat. Vor allem die Angst vor einem strafenden Gott, der das Kind – angeblich! – streng überwacht, spielt dabei immer wieder eine Rolle. Offenbar wurde Gott von den Eltern oder auch von anderen Erwachsenen häufig als eine Art Erziehungsgehilfe eingesetzt, der den kindlichen Gehorsam garantieren sollte. Dem Kind wurde gesagt, dass es bei Ungehorsam mit einer Strafe Gottes rechnen müsse, auch wenn zum Beispiel die Eltern gerade nicht sehen, was das Kind tut. Die Folge war dann ein »dämonisches Gottesbild« und die Vorstellung von Gott als einem Wesen, das »alles sieht und alles bestraft«. Aus heutiger Sicht ist hier von einem »religiösen Missbrauch« von Kindern zu sprechen.
Sprichwörtlich geworden ist die von Tilmann Moser beschriebene »Gottesvergiftung«1: Für die Kinder wird bei einer solchen »vergiftenden« Erziehung mit dem Gottesglauben die unerbittliche Forderung verknüpft, immer daran zu denken, wozu dieser Glaube verpflichtet (»Was erwartet Gott von dir?«). Aus dem Glauben wird auf diese Weise eine beständige Selbstüberforderung. Zum Bild des strafenden Gottes tritt dadurch auch der »Leistungsgott«, der dem Kind immer mehr abfordert, als es leisten kann.
ZUSATZ-INFO
»Gottesvergiftung«?
So lautet der Titel eines 1976 veröffentlichten Buches des Psychoanalytikers Tilmann Moser. Darin warnt er vor der krank machenden Seite der christlichen Religiosität und vor erdrückenden Gottesbildern, die zum Beispiel mit Höllenpein verbunden wurden und Versagensängste auslösten. Im Jahr 2003 erschien ein weiteres Buch des Autors– nun mit dem Titel »Von der Gottesvergiftung zu einem erträglichen Gott«2. Wie Matthias Drobinski feststellt, gibt es laut Moser tief in den meisten Menschen »eine selbstverständliche Religiosität, […] die Fähigkeit, sich liebevoll berühren zu lassen – und wenn sie auf ein lebensbejahendes Gottesbild träfe, könne sie viel zu einem gelingenden Leben beitragen. Ob es nun Gott gibt oder nicht«, habe Moser damit nicht belegt, aber immerhin einen Perspektivwechsel vorgenommen: »Glauben ist gesund.«3
Es ist gut, dass heute offen über negative Erfahrungen mit religiöser Erziehung gesprochen wird. Denn nur so kann eine neue Offenheit für eine kindgemäße religiöse Erziehung erreicht werden, die den Menschen in seiner Entwicklung unterstützt und stärkt. Aus christlicher Sicht handelt es sich bei dem Gott, »der alles sieht und alles bestraft«, aber auch bei dem »Leistungsgott«, der das Kind kleinhält, um eine unzulässige Instrumentalisierung der Religion für die Erziehung. Der biblische Gott spielt dabei in aller Regel gerade keine Rolle. Vom gnädigen Gott, der die Menschen liebt, ihnen immer wieder verzeiht und sie annimmt, ist bei einer solchen Erziehung gar nicht die Rede. Auch dass die Bibel betont, dass Gott die Kinder liebt und Jesus sich in ganz spezieller Weise den Kindern zugewandt hat, kommt nicht zur Sprache.
Statt problematischer Gottesbilder wird heutzutage jedoch vermehrt ein anderes Problem wahrgenommen: Junge Menschen nehmen Kirche als langweilig wahr – als Institution, die das Leben der heutigen Menschen nicht versteht. Es findet eine Entfremdung zwischen individuellem Glauben und Kirche statt. Mit der eigenen – eventuell vorhandenen – Gottesbeziehung haben die Erfahrungen mit der Institution Kirche, die für das konkrete Leben der Menschen zum Teil als irrelevant empfunden wird, oftmals nichts zu tun. So lautet häufig der Tenor: »Für einen Glauben an Gott benötige ich keine Kirche, und es ist auch nicht schlimm, wenn ich mit dieser Institution nichts zu tun habe.«
Die Kritik an einer bedrohlichen und einengenden Form der religiösen Erziehung und die zunehmende Entfremdung von der Kirche als Institution haben zum Teil dazu geführt, dass viele Erwachsene unsicher sind und sich bei der religiösen Erziehung stark zurückhalten. Doch diese Haltung ist nicht unproblematisch: Jetzt wachsen Kinder häufig ganz ohne jede religiöse Begleitung auf und erhalten keine entsprechenden Impulse für ihre religiöse Entwicklung. Die Warnung vor einer »Gottesvergiftung« hat an Bedeutung verloren, stattdessen geht es heute um die kritische Auseinandersetzung mit dem »Kaspar-Hauser-Syndrom«. Die Problematik des religiös vereinsamenden und sich selbst überlassenen Kindes rückt ins Zentrum des Interesses. Wie einstmals Kaspar Hauser ohne jeden Kontakt zu anderen Menschen aufwachsen musste, so fühlen sich heute Kinder oft religiös alleingelassen. Für die »großen Fragen«, die unvermeidlich aufbrechen, haben sie keine Gesprächspartner.
ZUSATZ-INFO
Kaspar Hauser
Das war der Name eines Jugendlichen, der im Jahre 1828 wohl als 16-Jähriger in Nürnberg aufgegriffen und 1833 in Ansbach unter offiziell nie geklärten Umständen ermordet wurde. Er berichtete, bei Wasser und Brot ganz allein in einem dunklen Raum gefangen gehalten worden zu sein, was Ludwig Feuerbach bereits 1832 in einer Abhandlung als »Verbrechen am Seelenleben eines Menschen« bezeichnete. In Medizin und Psychologie bezeichnet man als Kaspar-Hauser-Syndrom Verhaltensauffälligkeiten bei Babys und Kindern, die lange Zeit ohne persönlichen Kontakt und ohne Zuwendung aufwuchsen und kaum soziale oder kognitive Anregungen erhielten. Dies führt zu Sprachstörungen, mangelnder körperlicher sowie intellektueller Entwicklung und auch zu Problemen im Sozialverhalten.
Große Kinderfragen
Kinder sind dafür bekannt, dass sie komplexe Fragen stellen, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Dies gilt auch für religiöse Fragen, die zum Beispiel4 lauten können:
• Warum bin ich auf der Welt, wenn ich sowieso mal sterben muss?
• Seit wann gibt es die Erde und wann wird es sie nicht mehr geben?
• Ist es im Himmel schöner als auf der Erde?
• Komme ich von Gott – gehe ich zu Gott?
• Kommt meine Katze in den Himmel?
• Bestraft Gott böse Menschen?
• Warum werden wir krank?
• Wie alt ist Gott?
Chancen für religiöses Wachstum
Trotz der zu kritisierenden und zu vermeidenden Fehlformen der religiösen Erziehung dürfen die positiven Möglichkeiten einer religiösen Begleitung und Erziehung nicht aus dem Blick geraten. Religion ist eine wichtige Dimension des Aufwachsens. Sie eröffnet Kindern Zugänge zu Erfahrungen von Trost, Gewissheit, Geborgenheit, ermöglicht intensive Gemeinschaftserfahrungen und die Erfahrung dessen, was der Begriff Transzendenz meint: das Übersteigen der irdischen, endlichen Erfahrungswelt hin zum göttlichen Grund.
Vielfach wird davon berichtet, dass religiöse Erziehung den Kindern ebenso wie den Erwachsenen neue Chancen für ein religiöses Wachstum eröffnen kann. Bei den Erwachsenen geht es dabei in vielen Fällen um unterbrochene religiöse Lebenslinien. Wenn die Auseinandersetzung mit Glaubensfragen auf die Kindheit beschränkt war und in Vergessenheit geraten ist, können die von Kindern gestellten Fragen und Herausforderungen zu einem Auslöser für ein Wiederaufnehmen der vergessenen Zusammenhänge im eigenen Leben werden. Darin liegt auch für Fachkräfte eine wichtige und bereichernde Chance, sich wieder mit den religiösen Fragen im eigenen Leben auseinanderzusetzen.
Fragen und Zweifel: die eigene Biografie als Hindernis und als besondere Chance
Wie kaum ein anderer Bereich der Erziehung hängt religiöse Erziehung eng mit der eigenen Person zusammen. Kinder haben ein feines Gespür dafür, wann Erwachsene authentisch kommunizieren. Und immer wieder wollen Kinder wissen, ob man denn selber glaubt, was man ihnen erzählt. Viele Erwachsene sagen heute, sie könnten ihre Kinder nicht religiös erziehen, weil sie selbst so viele Fragen und Zweifel haben.
Es ist richtig, dass man Kindern bei der religiösen Erziehung nichts vorspielen soll. Vor allem sollten Erwachsene ehrlich sein. Zugleich ist aber die Vorstellung abzulehnen, dass nur solche Erwachsene religiös erziehen können, die eine Antwort auf alle Fragen der Kinder haben und selbst keinerlei Glaubenszweifel kennen. Denn dann könnte am Ende sicher niemand mehr religiös erziehen – bis auf wenige religiöse Fundamentalisten, die meinen, auf alles eine Antwort zu haben. Zweifeln ist Teil des christlichen Glaubens, was sich auch in vielen biblischen Geschichten (so z.B. Petrus, Thomas, die Jünger während des Sturms auf dem See Gennesaret) zeigt.
Neue kindgemäße Formen der religiösen Erziehung sind darauf ausgerichtet, gemeinsam mit den Kindern nach Antworten zu suchen. Ein Beispiel dafür ist etwa die »Kindertheologie«, die wir hier als Theologie mit Kindern verstehen (siehe Kapitel 7). Bei einer solchen Theologie mit Kindern geht es um ein offenes und immer wieder auch lustiges Gespräch mit Kindern über Fragen des Glaubens. Dabei können die Kinder erfahren, dass es Spaß machen kann und auch soll, selbst nach Antworten auf ganz einfache und doch »große« Fragen zu suchen, wie zum Beispiel: »Warum fällt Gott eigentlich nicht herunter, wenn er im Himmel wohnt?«
Hat die Begleitung der theologischen Fragen von Kindern eine solch offene, intensive, wertschätzende Qualität, dann kann vorausgesetzt werden, dass die pädagogischen Fachkräfte immer sich selbst mit einbringen. Gerade wenn man Wert darauf legt, authentisch zu kommunizieren, dann darf dieses Bestreben im Bereich der religiösen Begleitung nicht ausgeklammert werden. Kinder merken schnell, ob direkt und »von innen heraus« mit ihnen gesprochen wird oder ob sie lediglich Objekte sind.
Für die religiöse Begleitung ist dies insofern eine Herausforderung, als die persönlichen Voraussetzungen gerade auch mit Blick auf die religiöse Identität und das eigene religiöse Selbstverständnis ganz unterschiedlich sein können: Manche Fachkräfte haben Lieblingsgeschichten aus der Bibel und erzählen den Kindern begeistert darüber, anderen wiederum ist die Bibel eher fremd, sie sind religiös distanziert oder konfessionslos. Ähnliches gilt natürlich etwa auch für muslimische Fachkräfte und deren Verhältnis zum Koran.
Grundsätzlich ist in pädagogischen Prozessen die Perspektive des Kindes einzunehmen und von den Kindern her zu denken. Religionspädagogische Begleitung geht sinnvollerweise von der Person und Situation des Kindes aus. Die Frage lautet zunächst also nicht, ob einer Fachkraft religiöse Bildung sinnvoll erscheint, sondern ob religiöse und interreligiöse Fragen für die Kinder und deren Entwicklung relevant sind.
Wenn man – wie die »Kinderstudie«5 des Forschungsprojekts »Interkulturelle und interreligiöse Bildung in Kindertagesstätten« eindrucksvoll nahelegt – die Fragen und kreativen Ideen der Kinder ernst nimmt, können sich Fachkräfte aus dem Themenkomplex Religion jedoch nicht heraushalten, denn keine Stellung zu nehmen ist auch eine Stellungnahme. Und Kinder empfinden dann eine solche Haltung oft als Ablehnung.
Neue Herausforderungen angesichts von Multireligiosität und Konfessionslosigkeit
Die religiöse Situation in Deutschland hat sich stark verändert. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Menschen, die einer nicht-christlichen Religion angehören, auf der anderen Seite nimmt auch die Zahl der Konfessionslosen stark zu. An dieser Stelle soll es zunächst um die neue Multireligiosität gehen, dem Umgang mit konfessionslosen Eltern und Kindern ist ein eigenes Kapitel gewidmet (→ Kapitel 11).
Fachkräfte, die schon viele Jahre berufstätig sind, werden durch die zunehmende Multireligiosität und durch die Herausforderungen des interreligiösen Dialoges in einer bisweilen überraschenden Weise mit ihrer eigenen Religiosität konfrontiert. Kinder stellen heute ganz andere religiöse Fragen als vor einem Jahrzehnt und setzen sich aufgrund der veränderten Lebenswirklichkeit mit anderen religiösen Themen auseinander. Auf dem Nachhauseweg sagte zum Beispiel Mustafa, der Muslim ist, zur katholischen Mirjam: »Der Gott kann doch keinen Sohn haben. Das mit Betlehem ist alles Lüge.« Interreligiöse Gedanken, Dialoge und Konfrontationen sind längst Teil des Kita-Alltags geworden. Auch wer religiöse Weltdeutungen nicht kennenlernen konnte oder sie bewusst ablehnt, sieht sich im Alltag einer Kita mit religiösen und interreligiösen Fragen konfrontiert.
Menschen, die bewusst säkular, also ohne religiöse Rückbindung, leben und dies als ebenso ernst zu nehmende Weltdeutung verstehen wie den religiösen Glauben, sind mit ihrer eigenen Biografie genauso wertzuschätzen. Schließlich kommt ein Mensch, der seine Welt nicht religiös deutet, nicht weniger zu Wahrheitsansprüchen, verlangt deren Würdigung und fordert sie möglicherweise ein. Ebenso, wie derjenige, der einen konkret religiösen Weg beschreitet – ob im Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus oder anderen Religionen –, seine biografischen Erfahrungen nicht verleugnen kann und will.
Die Vielfalt der religiösen und nicht-religiösen Biografien von Fachkräften in Kindertagesstätten kann eine Bereicherung für die Kinder sein. Schließlich kommen die Kinder ebenfalls aus Familien mit vielfältigsten religiösen oder nicht-religiösen Biografien.
Mit den eigenen biografischen Erfahrungen Kinder religiös begleiten
Innerhalb der Religionspädagogik wird kontrovers diskutiert, wie intensiv Fachkräfte ihre eigene biografische Erfahrung in die Begleitung von Kindern einbringen sollen. Es könnte ja auch zu einer »Übermächtigung« kommen – eben nicht zu einer professionellen Unterstützung von Kindern, sondern zu einer Überwältigung. Umgekehrt besteht die Möglichkeit, dass Kinder genau eine solche authentische Fachkraft, deren religiöse Einstellungen sich auch in der Praxis bemerkbar machen, besonders interessant finden. In einer heterogen zusammengesetzten Kindergruppe ist es unerlässlich, sensibel zu agieren, denn die eigenen biografischen Voraussetzungen treffen hier bei den Kindern auf vielfältige Erfahrungen und religiöse Prägungen. Daraus können sich Konflikte ergeben, etwa wenn muslimische Kinder spüren, dass eine christliche Fachkraft den muslimischen Glauben innerlich ablehnt.
Wenn allerdings religiöse Bildung in der Kita – um Konflikte zu vermeiden – vollkommen ausgegrenzt wird und die Kinder mit ihren Fragen keine Unterstützung bekommen, ist dies ebenso defizitär, denn auch so können Kinder eine »Übermächtigung« erfahren. Zwischen diesen beiden Extremen ist ein den Kindern und der eigenen Person angemessener persönlicher Umgang mit Religion, Religiosität und religiöser Begleitung zu suchen.
Auf der Wissensebene kann sich jede Fachkraft im Blick auf Christentum, Judentum und Islam Kompetenzen aneignen, die es ermöglichen, Kinder und ihre Fragen entsprechend zu unterstützen. Die Beschreibungen im 6. Kapitel dieses Buches von Ednan Aslan für den Islam, Alfred Bodenheimer für das Judentum sowie Albert Biesinger und Friedrich Schweitzer für das Christentum bieten dafür eine Grundlage.
Und wenn ich keine Antwort auf die Fragen der Kinder habe …?
Kinder fragen nicht erst, wenn sie dazu aufgefordert werden. Sie sind in ihren religiösen Fantasien, in ihren Interaktionen und Deutungen sehr kreativ und stellen auch ganz überraschende Fragen, die nur schwer zu beantworten sind. Da fällt es manchmal nicht leicht, aus dem Stegreif kompetente Antworten zu geben. »Warum heißt Gott in Berlin Gott, auf der Arabischen Halbinsel Allah und in Thailand Buddha?« wäre eine solche Frage, die – obwohl oder gerade von einem Kind gestellt – ein religionsgeschichtliches und theologisches Kernproblem trifft und nicht einfach schnell in drei Sätzen zu beantworten ist.
Dabei sind die Kontexte zu beachten, in denen die Fragen gestellt werden. Zunächst gibt es Fragen, die Kinder deshalb stellen, weil sie eine Antwort wollen. Andere Fragen formulieren Kinder eher, um in einen Dialog einzusteigen oder um selber Antworten zu suchen und zu finden. Für viele Kinder ist es reizvoll, in der pädagogischen Fachkraft einen Menschen zu haben, mit dem man sich austauschen kann.
Es ist schwierig, auf alle Fragen eine passende Antwort zu finden. Noch schwieriger ist dies bei religiösen Fragen, wo es nicht nur um Faktenwissen, sondern um Glauben geht. Souveräner Umgang bedeutet hier, sich klarzumachen, dass nicht alle Fragen der Kinder beantwortet werden können. Den Kindern sollten keine Antworten gegeben werden, die ihre religiöse Entwicklung und ihre Gottesbilder negativ prägen. Statt unangemessene Antworten zu geben, ist es besser zu sagen: »Darüber muss ich erst mal selber noch nachdenken.« »Können wir darüber morgen noch einmal sprechen?« Besonders zu empfehlen ist die gemeinsame Suche nach Antworten mit dem Kind. Kinder lassen sich in der Regel gerne darauf ein. So gewinnt man Zeit und zugleich fühlt sich das Kind ernst genommen.
Angesichts der Multireligiosität der Lebenswelten heute muss religiöse Bildung auch interreligiöse Bildung einschließen.
KOMPETENZ
Die eigenen Kompetenzen erproben und einüben
Bereiten Sie ein Gespräch mit der Kita-Leitung vor, in dem Sie ausgehend von Ihren religiösen Erfahrungen reflektieren:
• Welche Form der religiösen Begleitung und welche religiösen Erfahrungen möchten Sie den Kindern weitergeben und welche nicht?
• Wo befürchten Sie dabei Probleme?
• Welche Hilfestellungen wünschen Sie sich?
BUCH- & FILMTIPPS
Zum Weiterlesen
Biesinger, A. (172021): Kinder nicht um Gott betrügen. Warum religiöse Erziehung so wichtig ist. Freiburg.
Schweitzer, F. (22019 ): Das Recht des Kindes auf Religion, Neubearbeitung, erw. Neuausgabe. Gütersloh.
Schweitzer, F. & Biesinger, A. (2015): Kulturell und religiös sensibel? Interreligiöse und Interkulturelle Kompetenz in der Ausbildung für den Elementarbereich (Interreligiöse und Interkulturelle Bildung im Kindesalter, 5). Münster.
Möller, R. & Sajak, K.P. (2020): Religionspädagogik für Erzieherinnen. Ein ökumenisches Arbeitsbuch. Stuttgart.
Laufend aktualisierte Informationen bieten die Websites des evangelischen und des katholischen Verbands für Tageseinrichtungen für Kinder sowie der Stiftung Gottesbeziehung gehen Familien:
•www.beta-diakonie.de/
•www.ktk-bundesverband.de/
•www.stigofam.de/
Filmtipps
Auf www.kleine-menschen-grosse-fragen.de bieten sich als passende Videos an:
• Wie privat ist der Glaube?
• Das Recht des Kindes auf Religion
• Religionsfreiheit
1 Moser, T. (1976): Gottesvergiftung. Frankfurt a.M.
2 Moser, T. (2003): Von der Gottesvergiftung zu einem erträglichen Gott. Psychoanalytische Überlegungen zur Religion. Stuttgart.
3 Drobinski, M. (2005): Der Gott in den Köpfen. In: SZ, 14.05.2005.
4 Vgl. Biesinger, A. & Helga Kohler-Spiegel, H. (Hrsg.) (2011): Woher, wohin, was ist der Sinn? Die großen Fragen des Lebens: Kinder fragen – Forscherinnen und Forscher antworten. München. Vgl. Biesinger, A.; Kohler-Spiegel, H. & Hiller, S. (Hrsg.) (2018): Warum haben wir sonntags frei? Wissen rund um religiöse Feste: Kinder fragen – Forscherinnen und Forscher antworten. München; sowie weitere Bände aus dieser Reihe.
5 Edelbrock, A.; Schweitzer, F. & Biesinger, A. (Hrsg.) (2010): Wie viele Götter sind im Himmel? Religiöse Differenzwahrnehmung im Kindesalter. Münster.
2.
Aufgaben in den Orientierungs- und Bildungsplänen
Die Themen in diesem Kapitel sind
→ Der Bildungsbereich Religion in den Orientierungsplänen
→ Länderübergreifende Bestimmungen
→ Die religiöse Dimension in den Bildungsplänen der Länder
→ Übergreifende Aufgaben im religiösen Bereich
→ Leitende Fragen zur Umsetzung des Bildungsbereichs in der Kita-Praxis
Religiöse Bildung und Begleitung für alle Kinder?
Zu den wichtigen bildungspolitischen Entwicklungen der letzten beiden Jahrzehnte gehört die Einführung von Orientierungs- und Bildungsplänen für den Elementarbereich. Darin kommt nicht zuletzt eine Anerkennung der Einrichtungen für Kinder zum Ausdruck, die damit nicht nur als Stätten der Betreuung und Erziehung, sondern weiterreichend auch als Orte der Bildung angesehen werden.
In vielen dieser Orientierungs- und Bildungspläne werden Religion, Religionen und religiöse Begleitung als ein zentraler Bildungsbereich ausgewiesen. Dabei wird den verschiedenen Einrichtungen aber nicht einfach vorgeschrieben, wie sie die entsprechenden Bildungsaufgaben umsetzen sollen, vielmehr wird die Chance eröffnet und bekräftigt, eigene passgenaue Wege zu finden. Insofern ergibt sich aus den Orientierungs- und Bildungsplänen die Herausforderung, sich über die eigenen Ziele und Vorgehensweisen klar zu werden.
Die Bildungs- und Orientierungspläne – zum Teil haben sie in den verschiedenen Bundesländern einen anderen Namen – sind im Gegensatz zu den Bildungsplänen an den Schulen bislang nicht verpflichtend. Bei den Bildungszielen, insbesondere im sensiblen Bereich der religiösen und interreligiösen Bildung, fallen Unterschiede auf, die sachlich kaum zu erklären sind und die deshalb willkürlich erscheinen. So fehlt in manchen Plänen der religiöse Aufgabenbereich ganz. Darin spiegeln sich Auffassungen, die Religion etwa als Privatsache anzusehen oder dass Religion zum Beispiel in kommunalen Einrichtungen keine Rolle spielen dürfe. Dabei wird übersehen, dass auch in kommunalen Einrichtungen Religionsfreiheit gewährleistet sein muss (siehe Seite 26).
Aus pädagogischer Sicht wäre es angemessen, wenn die religiöse Dimension in den Bildungsplänen aller Bundesländer sowie in allen Einrichtungen gleichermaßen berücksichtigt würde. Denn auch die religiöse Dimension gehört unverzichtbar zum Aufwachsen von Kindern. Im Zentrum steht das Kind mit seinen Entwicklungs- und Orientierungsbedürfnissen. Geboten werden dem Kind dann Zugänge zur religiösen Überlieferung – etwa in Form von Geschichten und Liedern, aber auch von Bildern und Symbolen – sowie Zugänge zu Ritualen und anderen religiösen Ausdrucksformen wie Gebeten und Formen des gemeinsamen Feierns. Dazu muss dem Kind eine auch in religiöser Hinsicht anregungsreiche Umwelt zur Verfügung stehen. Kindergärten und Kitas kommt die Aufgabe zu, in ihrer Ausstattung ganz selbstverständlich Zugänge zu Religion ermöglichen. So sollten unter den Kinder- und Bilderbüchern zum Beispiel religiöse Darstellungen vorhanden sein; die Kinder haben dann die Möglichkeit, sich selbst ein Buch nach ihrem aktuellen Interesse auszuwählen und mit der pädagogischen Fachkraft darüber zu sprechen. Im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf sollten feste Zeiten vorhanden sein, zu denen der religiösen Dimension besonders Raum gegeben wird, etwa am Beginn des Kindergartentages oder am Ende der Woche.
Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass die Kinder in den Kindergruppen gewöhnlich nicht nur einer Konfession oder einer Religion angehören. Interreligiöses Lernen gehört zu den Grundaufgaben einer jeden Einrichtung. Und natürlich muss auch die Situation von Kindern, deren Eltern keine religiöse Erziehung wünschen, Berücksichtigung finden.
AUFGABE
Das erste religionspädagogische Ziel in einem der Orientierungs- und Bildungspläne heißt: »Kinder entwickeln Vertrauen in das Leben auf der Basis lebensbejahender religiöser bzw. weltanschaulicher Grundüberzeugungen.« Beschreiben Sie Möglichkeiten, wie dieses Ziel in der Praxis angebahnt und erreicht werden kann.