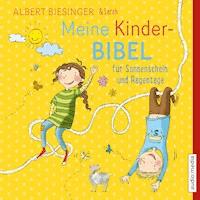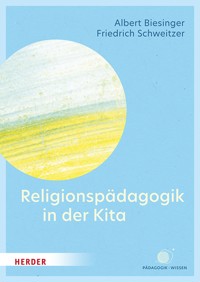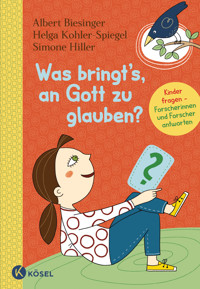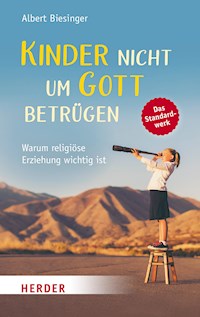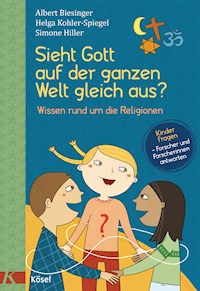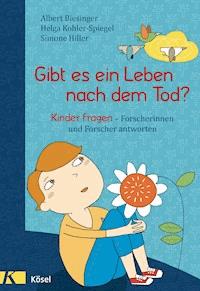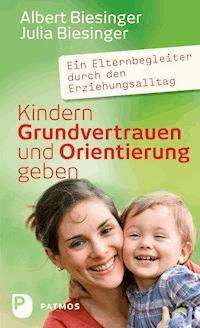
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Was können Eltern ihrem Kind mitgeben, um das Leben zu meistern, in dem früher oder später auch Stress, Leistungsdruck und Ängste auf einen zukommen? Grundlegend ist eine offene, wertschätzende und gesunde Eltern-Kind-Beziehung, aus der das Kind mit innerer Stärke ins Leben hinaustreten kann. Hier erschließen zwei erfahrene Pädagogen psychologisches, pädagogisches und spirituelles Grundwissen. Sie stärken und ermutigen die Eltern in ihrer Rolle als Erzieher mit Blick auf die Kinder und deren Bedürfnisse. Dabei zeigt sich: Es geht nicht um Perfektion, sondern um Liebe, um wechselseitigen Respekt und auch um Spiritualität: Kinder brauchen große Verheißungen und jemanden, der an sie glaubt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Albert Biesinger • Julia Biesinger
Kindern Grundvertrauen und Orientierung geben
Ein Elternbegleiter durch den Erziehungsalltag
Patmos Verlag
Inhalt
Einleitung
Albert Biesinger · Julia Biesinger
1. Mit der Beziehung zu unserem Kind Grundvertrauen schenken
Julia Biesinger
1.1 »Was brauchst du eigentlich?« – Die Bedürfnisse unseres Kindes
1.2 »Hey – du bist mir wichtig!« – Mit der Beziehung zu unserem Kind Grundvertrauen fördern
1.3 »Was meinst du dazu?« – Unser Miteinander positiv gestalten
2. Unser Kind in seinem Grundvertrauen bestärken
Julia Biesinger
2.1 »Ich kann das!« – Wie unser Kind Vertrauen in sich und andere aufbaut
2.2 »Das macht Spaß!« – Wie unser Kind seine Kompetenzen ganzheitlich und selbstbewusst entwickelt und stärkt
2.3 »Ich krieg das hin!« – Wie unser Kind stark und aktiv Probleme meistert
3. Unser Kind motivieren und ihm Zuwendung und Orientierung geben
Julia Biesinger
3.1 »Du stützt mich!« – Kindern Halt und Freiraum im Leben geben
3.2 »Ich stelle die Regeln mit auf!« – Wie Kinder Regeln leichter akzeptieren und dazulernen
4. Unser Denken beeinflusst unsere Sicht der Welt
Julia Biesinger
4.1 »Ich bin ich!« – Die Einzigartigkeit unseres Kindes und wie es sich entwickelt
4.2 »Ich bin neugierig!« – Wie wir lernen
4.3 »Ah – so ist das!« – Wir machen uns ein Bild von der Welt
5. Als Eltern das Grundvertrauen in uns selbst stärken und Orientierung finden
Julia Biesinger
5.1 »Ich bin auch wichtig!« – Was kann ich für mich selbst tun?
5.2 »Zusammen schaffen wir das!« – Eltern und Partnerschaft
6. Weite Horizonte
Albert Biesinger
6.1 Kinder als spirituelle Gabe und Aufgabe
6.2 Kinder spirituell begleiten und ihnen dadurch Grundvertrauen und Orientierung geben
6.3 Kinder brauchen Spiritualität – große Verheißungen und jemanden, der an sie glaubt
6.4 Wie die Gottesbeziehung Kinder stark macht
7. Zusammenfassende Ausblicke
Albert Biesinger · Julia Biesinger
Literatur
Anmerkungen
Über die Autorin und den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Einleitung
Albert Biesinger · Julia Biesinger
Ein Blick, ein Lächeln, ein verschmitztes Grinsen … Kinder sind ein großes Geschenk. Sie bereichern unser Leben. Und sie verändern unser Leben. Ganz entscheidend. Wir lernen durch sie, die Welt mit anderen Augen zu betrachten, und gewinnen einen neuen Blick auf das Leben an sich. Dinge, die uns wirklich wichtig sind, kristallisieren sich heraus. Dinge und Werte, die wir vielleicht auch unserem Kind vermitteln möchten.
Als Eltern machen wir uns viele Gedanken darüber, was wir unserem Kind für sein Leben mitgeben möchten. Vielleicht haben Sie sich dabei schon einmal folgende Fragen gestellt:
Was will ich meinem Kind für sein Leben mitgeben? Was hat mir selbst im Leben weitergeholfen? Was hat mir Kraft gegeben?Was haben mir meine Eltern mitgegeben? Wie haben mich Großeltern, Tanten, Onkel, Freunde und andere Personen positiv beeinflusst?Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Was war für mich hilfreich? Was möchte ich unbedingt vermeiden?Das Leben hält uns viele Möglichkeiten bereit und stellt uns vor Herausforderungen. Natürlich wünschen wir uns als Eltern für unser Kind das Beste, dass es möglichst viele schöne Zeiten erleben und mögliche aufkommende Probleme gut meistern kann. Wir wünschen uns, dass es in seinem Leben glücklich ist.
Doch welche Anforderungen stellt das Leben?Was braucht mein Kind, um in der heutigen Zeit gut durch sein Leben zu kommen?Wie kann ich es stärken und fördern?Und was möchte mein Kind denn?Woher weiß ich, was mein Kind braucht? Wie wird seine Zukunft aussehen?Wir können unserem Kind kein Traumland aufbauen, ihm nicht das Paradies bieten, es nicht vor allen Problemen des Lebens behüten. Wir können auch nicht vorhersehen, wie die Zukunft unseres Kindes aussehen wird, was alles auf unser Kind zukommt und für was es sich entscheiden wird …
Doch wir können unserem Kind als Eltern das Grundvertrauen geben, das es braucht, um sich sicher und geborgen zu fühlen, um selbstbewusst und mit weitem Blick durch das Leben zu gehen, Stärken auszubilden und mit Schwächen umgehen zu können. Grundvertrauen, um Hindernisse zu überwinden, Probleme zu lösen und mit Belastungen zurechtzukommen, und Grundvertrauen, um auch für andere da sein zu können. Grundvertrauen in uns als Eltern, Grundvertrauen in die Welt und vor allem Grundvertrauen in sich selbst. Ein gesundes Grundvertrauen, sich und die Welt realistisch einzuschätzen, seine Möglichkeiten und seine Grenzen zu kennen und zu erkennen, was einem guttut und was nicht.
Wie mache ich das?
Wir sind uns sicher, dass Sie das in vieler Hinsicht schon instinktiv berücksichtigen … Wir möchten Sie auf eine Reise durch die verschiedenen Kapitel dieses Buches einladen, um auf all diese Fragen vertiefend einzugehen:
In Kapitel 1 geben wir Antworten auf die Frage, was unser Kind in seinem Leben braucht und wie wir eine gute und stabile Bindung zu unserem Kind aufbauen und vertiefen können und damit sein Grundvertrauen in sich und die Welt fördern und stärken. Die Verbindung zu Ihrem Kind hat einen entscheidenden Einfluss darauf, solch ein Grundvertrauen ausbilden zu können. Auch durch unsere Art, wie wir mit unserem Kind kommunizieren, nehmen wir darauf Einfluss.
In Kapitel 2 befassen wir uns damit, wie wir unser Kind und sein Grundvertrauen stärken. Dazu schauen wir uns an, wie wir unser Kind ganzheitlich fördern können, wie wir es darin unterstützen können, dass es seine Kompetenzen entfalten kann, und wie wir ihm helfen können zu lernen, auf eine positive Art und Weise mit Problemen umzugehen. Durch den Halt, den Sie Ihrem Kind geben, und dadurch, dass Sie es zu den richtigen Zeitpunkten immer wieder loslassen, geben Sie Ihrem Kind einen Orientierungsrahmen, von dem aus es lernt, selbständig, kompetent und in der Gemeinschaft verwurzelt sein Leben in die Hand zu nehmen. Dies ist im Kern auch so im ersten Paragraphen des achten Buches des Sozialgesetzbuchs verankert: »Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit« (§ 1 SGB VIII, 2007). Wir nehmen unser Kind an die Hand und geben ihm das mit, was wir fühlen, was es im Moment und für später brauchen kann.
Unserem Kind Orientierung zu geben, indem wir ihm Freiraum geben, aber auch notwendige Grenzen setzen, ist der Inhalt des dritten Kapitels. Wir sehen darin auch, welchen Einfluss es hat, wie wir unserem Kind in der Erziehung dabei begegnen. Wir dürfen an der spannenden Zeit teilhaben, zu sehen, wie unser Kind groß wird, wächst und jeden Tag Neues dazulernt. Kinder sind Wesen mit eigenen Bedürfnissen und Grenzen, so wie wir das auch sind. Jeden Tag können wir unserem Kind dabei Orientierung geben, Grundvertrauen vermitteln und es Grundvertrauen spüren lassen.
Das Kapitel 4 durchleuchtet die Hintergründe, warum Grundvertrauen und Orientierung in dieser Welt so wichtig sind, wieso jedes Kind einzigartig ist, wie wir als Mensch lernen und wie die Bilder, die Gedanken, die wir uns über die Welt machen, unser Leben beeinflussen.
Kapitel 5 ist ein Kapitel direkt für Sie, liebe Eltern. Es geht darum, wie Sie das Grundvertrauen in sich selbst stärken können. Denn wenn es Ihnen gut geht, wird sich das auch auf Ihr Kind auswirken.
Im sechsten Kapitel »Weite Horizonte« geht es um konkrete spirituelle Wege für Sie als Eltern. Wie wir unsere Kinder spirituell begleiten können, ihnen damit auch Orientierung und Grundvertrauen geben und sie auf diese Weise für ihr Leben kräftigen können, ist Herausforderung und Chance zugleich. Kindern tun große Verheißungen wie »Ich bin unbedingt geliebt – von meinen Eltern. Ich bin geliebt von Gott« für ihr Leben gut. Wie Sie selbst an Quellen von Zuwendung und an Energien kommen, wird in diesen Überlegungen ebenfalls konkret thematisiert. Alltagstaugliche Rituale lassen dabei oft überraschende Möglichkeiten entstehen.
Wir möchten Sie mit Ihrem Kind auf diesem spannenden Weg seiner Entwicklung begleiten, Ihnen Einblicke in verschiedene Zusammenhänge geben und Sie als Eltern in Ihrer Rolle und Kompetenz als Erzieher ermutigen und stärken. Dazu geben wir Ihnen in unseren »Was-sagt-die-Forschung-zum-Thema?«-Abschnitten (mit dem Doktorhut) bei den einzelnen Themen immer wieder Einblicke in die Erkenntnisse der Forschung.
Und wir wollen Ihnen anhand von psychologischem und spirituellem Grundwissen Handlungsorientierungen geben, wie Sie Voraussetzungen schaffen, damit Ihr Kind kompetent mit den Anforderungen des heutigen Lebens umgehen kann. Denn um unserem Kind Grundvertrauen und Orientierung zu schenken, damit es stark durch das Leben gehen kann, dazu gehört nicht viel: ein offenes Auge, ein offenes Ohr, ein großes Herz, eine Hand, die Sie Ihrem Kind reichen, wenn es sie braucht, und ein Bild davon, was Sie Ihrem Kind vermitteln möchten.
Um Grundvertrauen und Orientierung zu geben, brauchen wir ein offenes Auge, ein offenes Ohr, eine stärkende Hand und ein Bild davon, was wir unserem Kind vermitteln möchten.
Wir möchten Sie in diesem Sinne mit diesem Buch dazu einladen, sich Ihre eigenen Gedanken, Ihr eigenes Bild zu machen und gemeinsam mit Ihrem Kind Ihre eigenen Wege zu gehen.
1. Mit der Beziehung zu unserem Kind Grundvertrauen schenken
Julia Biesinger
Während sich unser Kind entwickelt und sich mit der Welt auseinandersetzt, ist es vor allem in der ersten Zeit seiner Entwicklung auf Menschen angewiesen, die ihm Orientierungen für den Umgang mit sich und dieser Welt geben. Die innige Verbindung zu unserem Kind legt einen wichtigen Grundstein für sein späteres Leben, denn dadurch lernt es Grundvertrauen aufzubauen. Zum einen, das Grundvertrauen in sich selbst – das Selbstvertrauen. Das Vertrauen, dass man sich auf sich selbst, auf seine Person mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten verlassen kann. Zum anderen aber auch, dass man Grundvertrauen in die Welt, in andere Menschen aufbaut. Beides gibt uns Halt und Sicherheit dadurch, dass wir ein tiefes Vertrauen darauf haben und uns darauf einlassen können. Daher sind Sie, liebe Eltern, von ganz besonderer Bedeutung für Ihr Kind, solch ein Grundvertrauen entwickeln zu können, wie Sie in diesem Kapitel sehen werden. Dazu sehen wir uns zunächst an, was unser Kind in seinem Leben braucht.
1.1 »Was brauchst du eigentlich?« – Die Bedürfnisse unseres Kindes
Spontan würden wir Ihnen auf diese Frage antworten: »Liebe – ganz viel Liebe braucht Ihr Kind.« Und im Kern trifft es das auch.
Natürlich ist dabei klar, dass wir als Eltern zunächst einmal die grundlegenden physiologischen Grundbedürfnisse unserer Kinder stillen. Wir geben ihm zu essen und zu trinken, wir achten darauf, dass es genügend Schlaf bekommt. Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass unser Kind in einer geschützten Umgebung aufwächst. Durch Hygiene versuchen wir unser Kind vor Krankheiten zu schützen.
Daneben hat unser Kind aber auch psychologische Grundbedürfnisse. Wie auch wir Erwachsene hat das Kind die Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Zugehörigkeit.1 Was heißt das?
Kompetenz
bedeutet, dass sich unser Kind effektiv mit seiner Umwelt auseinandersetzen will. Das heißt, es will spüren, dass es etwas kann, dass es etwas bewirken kann, dass sein Tun bestimmte Dinge auslöst.
Autonomie
heißt, dass unser Kind sich selbstbestimmt erleben will. Es möchte selbständig, unabhängig von anderen, selbstverantwortlich darüber entscheiden, was es tut.
Es will sozusagen eigenständig Kontrolle über sein Tun haben.
Soziale Zugehörigkeit
bedeutet, dass es sich mit den Personen aus seinem sozialen Umfeld verbunden fühlen will. Es will sich anderen anvertrauen, sich austauschen, Zeit mit ihnen verbringen. Geborgenheit und Sicherheit finden.
Wenn unser Kind noch klein ist, steht vor allem sein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit im Vordergrund. Es sehnt sich nach Liebe, nach Nähe, nach Beachtung. Für Kinder ist es wichtig, dass sie die Nähe ihrer Eltern spüren. Jede Mutter, jeder Vater kennt sicherlich die Situation, dass ein Baby mit Schreien aufhört und sich beruhigen lässt, wenn wir es hochnehmen, es schaukeln und streicheln.
Was sagt die Forschung zum Thema Nähe?
Wie essenziell diese Nähe gerade in der ersten Zeit ist, zeigen Untersuchungen zum kangarooing, der sogenannten Känguru-Methode. Mit dieser Methode wird bei Frühgeborenen gearbeitet, indem das Baby immer wieder für längere Zeit auf den Oberkörper seiner Eltern gelegt wird, sodass ein intensiver Hautkontakt zwischen dem Kind und seiner Mama oder seinem Papa da ist. Mit kangarooing haben die Kinder eine höhere Überlebenschance und können schneller aus dem Krankenhaus entlassen werden. Es unterstützt die Kinder darin, ihre Atmung und ihren Herzschlag zu stabilisieren.2 Die Babies beruhigen sich durch das kangarooing schneller und erfahren weniger Stress. Die Eltern-Kind-Beziehung wird gestärkt, sie trinken mehr Muttermilch und nehmen schneller zu und können ihre Körpertemperatur besser regulieren. Außerdem hat es einen positiven Effekt auf die geistige Entwicklung des Kindes.3
»Bei den Menschen steigt der Oxytocinspiegel [Oxytocin ist ein Botenstoff im menschlichen Körper, der beispielsweise die Stimmung und unser soziales Verhalten beeinflusst. Es wird auch ›Kuschelhormon‹ genannt.] z. B. durch den Hautkontakt von Müttern und ihren neugeborenen Kindern, aber auch durch den engen Partnerkontakt unter Erwachsenen. […] Eltern und Kinder, die in der postpartalen [postpartal bedeutet ›nach der Geburt‹] Phase den Hautkontakt miteinander pflegen, kommunizieren mehr miteinander und sind gelassener und entspannter als solche, die diesen Kontakt nicht haben. Zudem gehen sie feinfühliger miteinander um, und die Kinder können im Alter von einem Jahr besser mit Stresserfahrungen umgehen.« (Kerstin Uvnäs-Moberg)4
An diesen Beispielen erkennt man physiologische und psychologische Auswirkungen der Nähe zwischen Eltern und Kind. Diese Nähe ist nicht nur am Anfang, sondern auch noch später wichtig. Sie hilft, wenn unser Kind traurig oder ängstlich ist. Sie beruhigt unser Kind auch, wenn es mit einem Problem nicht weiterweiß. In allen Fällen wirkt die Nähe beruhigend, wenn sie positiv vom Kind empfunden wird, und ist daher stressreduzierend, wenn das Kind weiß, dass wir ihm beistehen und ihm bei seinen Problemen helfen.
Das Bedürfnis nach Kompetenz und Autonomie wächst mit der Zeit immer mehr an. Es gibt im Laufe seiner Entwicklung immer mehr Bereiche, die unser Kind dann selbständig beherrscht.
Als Eltern ist es unsere Aufgabe, unserem Kind mit unserer Liebe und unserer Lebenserfahrung einen sicheren Rahmen zu schaffen, indem wir unsere Kinder in ihrem Bestreben, Kompetenz zu erwerben und Autonomie zu erlangen, ermutigen, unterstützen und begleiten. Der wichtige Ausgangspunkt hierfür liegt in unserer Beziehung zu unserem Kind.
1.2 »Hey – du bist mir wichtig!« – Mit der Beziehung zu unserem Kind Grundvertrauen fördern
Wenn unser Kind geboren wird, werden wir von einem warmen Glücksgefühl durchzogen. Unser Kind zieht uns in Bann. Wir kümmern uns um unser Kind, achten auf seine Signale. »Ist es müde? Hat es Hunger?« Schnell wird uns bewusst, wie uns unser Elternsein, diese neue Art der Beziehung und Verbundenheit zu unserem Kind, verändert und wie wichtig unser Kind für uns und wir für unser Kind sind. Wir spüren das ganz Besondere in unserer Beziehung zu unserem Kind.1
Diese erste Zeit verläuft besonders intensiv. Wir lernen einander immer besser kennen. Besonders durch den Kontakt in der ersten Zeit entwickelt sich eine enge, intensive emotionale Beziehung zwischen unserem Kind und uns Eltern, die man in der Psychologie Bindung nennt.2
Beziehung aufbauen
Ein wesentlicher Faktor für eine sichere Bindung zwischen Eltern und Kind ist die Feinfühligkeit der Eltern. Damit ist nicht nur die emotionale Komponente gemeint. Dazu gehört auch
ob und wie wir die Signale unseres Kindes wahrnehmen, z. B.:
Wie beobachte ich die Signale, die mein Kind aussendet? – Bin ich aufmerksam?
Achte ich auch auf die körperlichen, nonverbalen Signale, Körperhaltung, Mimik? – Habe ich mein Kind im Blick, wenn es nicht schreit?
wie wir die Signale unseres Kindes interpretieren, z. B.:
Wie deute ich die Signale? – Hat mein Kind Hunger oder ist es müde?
Wie bewerte ich die Signale? – Hat mein Kind starken Hunger oder geht es noch?
wie wir auf die Signale unseres Kindes reagieren, z. B.:
Signalisiere ich meinem Kind, dass ich seine Signale wahrnehme? – Nehme ich z. B. Blickkontakt auf?
Gehe ich angemessen auf seine Bedürfnisse ein? – Wenn das Kind z. B. Angst zeigt, beruhige ich es ausreichend? Fühlt es sich wohl? Wie reagiert mein Kind auf meine Reaktion?
5
Nimmt unser Kind einen Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und dem wahr, wie wir darauf antworten? All dies gibt unserem Kind Rückmeldung darüber, wie zuverlässig wir auf seine Bedürfnisse reagieren. Infolgedessen baut es Vertrauen zu uns auf und fühlt sich sicher.
Bindung ist mehr, als dass wir die Versorgung unserer Kinder gewährleisten und schauen, dass sie ausreichend Nahrung und Schlaf haben. Unsere Kinder brauchen Liebe, Zuneigung und Zuwendung, die sie stärkt und nicht erdrückt.
Kinder entdecken die Welt
Untersuchungen zur Eltern-Kind-Bindung konnten zeigen, dass die Bindung eng mit dem sogenannten Explorationsverhalten der Kinder zusammenhängt, also damit, wie stark Kinder ihre Umwelt aktiv erforschen, sie entdecken und dabei aufgrund der eigenständigen Erfahrungen Schlussfolgerungen ziehen können.6 Weiß ein Kind sich sicher, fängt es an, seine Umgebung genauer unter die Lupe zu nehmen. Als Eltern sind wir auf diese Weise eine sichere Basis,7 von der aus unser Kind die Welt neugierig erkundet. Bei Problemen kann es zu uns kommen. Der »Aktionsradius« der Kinder erweitert sich dabei. D. h. Stück für Stück traut es sich mehr, von seiner Umgebung zu erkunden. Besonders schön anzusehen ist diese Entwicklung, wenn die Kinder beginnen zu robben, wie sie dann immer mehr von ihrer Umgebung »einnehmen« und für sich »erobern«. Jedes Kind entwickelt dabei seinen, oft ganz eigenen Fortbewegungsstil: Die einen ziehen sich mehr mit den Armen vorwärts, die anderen mehr seitwärts, wieder andere bewegen sich durch Drehen oder Rollen fort …
Wichtig ist, dass wir diese Motivation, die in unserem Kind entsteht, unterstützen. Unser Kind ist von Natur aus neugierig und interessiert. Es hat Spaß daran, Dinge zu erkunden. Wir können es dazu anregen, seine Umgebung zu entdecken. Reagiert es auch mal zunächst ängstlich auf Neues, können wir es beruhigen und ihm Sicherheit geben.
Ein Beispiel dazu: Manchmal erschrecken sich Kinder bei neuen Reizen, wenn z. B. beim Spielzeug durch die Bewegung ein bisher nicht gekanntes Geräusch entsteht. Sofort wandert dann der Blick des Kindes zu seinen Eltern: Welche Reaktion kann ich bei ihnen ablesen? Geht davon eine Gefahr aus? Kinder orientieren sich an den Reaktionen ihrer Eltern. Beruhigend wirkt es dann auf die Kinder, wenn sie sehen, dass die Eltern dies ebenfalls wahrgenommen haben, aber entspannt, vielleicht mit einem Lächeln, darauf reagieren. »Alles ist o. k.« Das gibt dem Kind Sicherheit und es ist dazu geneigt, diesem Geräusch nachzugehen und zu untersuchen, was es damit auf sich hat.
Indem wir seine Umgebung kindgerecht gestalten, können wir dafür sorgen, dass es sich voll darauf einlassen kann. Ein Überangebot an Spielzeug oder fortlaufende Darbietung von neuen Reizen überfordert ein Kind. Es muss seine Aufmerksamkeit ständig auf etwas Neues ausrichten und kann sich nicht die Zeit nehmen, sich intensiv mit den bereits vorhandenen Reizen auseinanderzusetzen. Eine vertraute Umgebung und wiederkehrende Abläufe hingegen geben unserem Kind Sicherheit, einen Rahmen, von dem aus es »loslegen« kann und bereit ist, Neues zu entdecken. Beobachten Sie Ihr Kind, ermutigen Sie es, wenn es Ihnen signalisiert, dass es etwas ausprobieren möchte.
Wenn Kinder auf diese Weise ihre Umwelt erkunden, stellen sie mit ihren Sinnen beispielsweise fest, welche Eigenschaften Materialien haben oder welche Folgen ihr Tun hat. »Was passiert, wenn ich den Knopf drücke?« Sie können daraus Gesetzmäßigkeiten ableiten: »Wenn ich einen runden Gegenstand anstupse, dann rollt er.«
Sie testen außerdem aus, welche Fähigkeiten sie selbst haben. Durch das Auseinandersetzen mit den Beschaffenheiten der Welt und ihrer Person erweitern sie die eigene Kompetenz.
Wenn unser Kind also mit seiner Umwelt in Kontakt tritt, so hilft ihm dies, sich ein realistisches Bild von sich selbst und von der Welt zu machen. Ein Bewusstsein für sich und die Welt baut sich auf. Es lernt, wann und wie etwas funktioniert und wann und wie nicht. Auf diese Weise kann es sich zurechtfinden und sich erfolgreich mit ihr auseinandersetzen. Selbstvertrauen baut sich dadurch auf. Unser Kind erlebt sich als kompetent und kann seine Potenziale entfalten.
Was bewirkt eine sichere Bindung?
Wir schenken unserem Kind Aufmerksamkeit und Zuwendung, wir geben ihm dadurch Sicherheit und Orientierung und reduzieren damit aufkommenden »Stress«. Als Eltern geben Sie Ihrem Kind auf diese Weise das Grundvertrauen, das es benötigt, um sich in dieser Welt zurechtfinden zu können. Dieses Grundvertrauen ermöglicht es dem Kind, sich zu öffnen und sich zu entfalten. Es kann sich voll und ganz auf seine Umgebung einlassen und ist nicht ständig mit Unsicherheiten oder Zweifeln beschäftigt. Wir können es auf diese Weise in seiner Kompetenz und Autonomie stärken.
Indem wir unser Kind bedingungslos lieben, bei ihm bleiben, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, geben wir ihm eine Stabilität: Es kann sich anlehnen und Kraft schöpfen.
Gerade wenn Kinder auch mal schwierig sind, ist es wichtig, sie die positive Beziehung zu uns spüren zu lassen und an sie zu glauben. Dies gibt ihnen Halt und hilft ihnen, durch schwierige Situationen zu gehen.
Erziehung ist daher eine Begleitung durch alle Lebenssituationen des Kindes, durch alle glücklichen Momente, aber auch durch Probleme und Krisen hindurch. Diese Erfahrungen nimmt es für sein ganzes Leben mit. Dieses Grundvertrauen wirkt als innewohnende Kraft und als Ort der Geborgenheit.
Verbunden und frei: Indem wir versuchen, eine vertrauensvolle und stabile Beziehung zum Kind aufzubauen, befriedigen wir seine Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung und Wertschätzung und helfen ihm durch diese stabile Basis, sich selbst zu verwirklichen.8 Auch wir spüren, unser Kind gehört zu uns und wir gehören zu unserem Kind. Zwischen uns entsteht ein Band, das uns für immer verbindet.
Dennoch soll es aber nicht unser Kind an uns binden. Vielmehr ermöglicht dieses Band unserem Kind, beschützt und sicher durch die Welt zu gehen. Wir können es zwar nicht vor allen Gefahren schützen, aber diese sichere Bindung ist für unser Kind ein Ausgangspunkt, um die Welt zu entdecken, kennenzulernen und dabei immer mehr selbst einschätzen zu können, welche Fähigkeiten es hat, wie es diese einsetzen kann und welche Gefahren es beachten muss. Auf diese Weise kann es sich in dieser Welt zurechtfinden und selbständig werden. In vielerlei Hinsicht ist eine sichere Bindung die Grundvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung des Kindes.
Was sagt die Forschung zum Thema Bindung?
Die Sicherheit der Bindung zwischen den Eltern und ihren Kindern steht in Zusammenhang mit Merkmalen wie Unabhängigkeit, Selbstwertgefühl oder Schulleistung und ist ein Prädiktor, d. h. eine Vorhersagevariable, für ihre späteren sozialen Beziehungen, z. B. die Beziehung zu Spielgefährten, Gleichaltrigen oder die romantischen Beziehungen im Erwachsenenalter.9
Für die Bindungsentwicklung ist vor allem die Zeitspanne zwischen dem 6. und 24. Lebensmonat und dort besonders zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat relevant.10 Die Bindung zu den Eltern bildet einen wichtigen Ausgangspunkt, von dem aus unser Kind auf gewisse Weise geprägt wird, wie es weitere Erfahrungen tätigt. Gleichzeitig bestimmen die Erfahrungen, die Kinder in dieser frühen Zeit machen, nicht alleinig, wie die Kinder sich weiterentwickeln werden. Natürlich wirken alle Erfahrungen in ihrer Gesamtheit auf die Entwicklung unseres Kindes und so ist natürlich auch die weitere elterliche Fürsorge und Zuwendung für unser Kind von großer Bedeutung.11
Die frühe sichere Bindung zum Kind und das Aufrechterhalten der positiven Beziehung, während es sich entwickelt, wirkt sich positiv auf die Entwicklung und die seelische Gesundheit unseres Kindes aus.12
Die Kommunikation mit unserem Kind spielt dabei eine wichtige Rolle in der Beziehung zu unserem Kind.
1.3 »Was meinst du dazu?« – Unser Miteinander positiv gestalten
Unsere Beziehung zu unserem Kind können wir durch unsere Kommunikation mit ihm stärken. Was bedeutet Kommunikation?
Kommunikation besteht nicht nur in den bloßen Worten oder Sätzen, die wir äußern. Kommunikation ist viel mehr. Kommunikation beinhaltet auch, wie wir uns einander gegenüber verhalten und wie wir etwas sagen. Halten wir Blickkontakt? Sind wir zugewandt? Welchen Gesichtsausdruck haben wir? Wie laut oder bestimmt sagen wir etwas? Oder wie sanft und einfühlend drücken wir uns aus? Sie sehen, es gibt ganz viele Aspekte, wie wir etwas sagen. Schon Nuancen in unserer Stimme oder in unserer Mimik können unserem Gesagten eine neue Bedeutung verleihen.
Unsere aktuelle Stimmung und unser Befinden können sich in unserer Kommunikation ausdrücken, manchmal ohne dass wir es bemerken. Auch unsere Haltung, die wir der anderen Person gegenüber einnehmen, kann sich darin widerspiegeln. Der Satz »Das hast du aber gut hinbekommen!« wirkt anders je nachdem, ob wir ihn wertschätzend und anerkennend aussprechen oder ob wir ihn mit einer Portion Ironie abfällig negativ bewertend aussprechen.
Manchmal sind für die Kommunikation keine Worte oder Äußerungen nötig. Auch wenn unser Kind z. B. vor lauter Freude umherhüpft oder auch wenn es bockig ist, dann kommuniziert es auf diese Weise auch mit uns. Es will sich ausdrücken und in dem Moment ist es seine eigene Art der Kommunikation.
Feinfühligkeit und Weitsichtigkeit in der Kommunikation
Wir haben schon gesehen, Feinfühligkeit spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie gut wir in der Lage sind, unser Kind zu verstehen und angemessen auf seine Bedürfnisse zu reagieren.
Es ist ein intensives Reinhören ins Kind, ein Achtsamsein auf seine körperlichen Signale, auf seine Worte und Gedanken und ein Bemühen, seine Gefühle zu erfragen, zu erspüren. Wir wollen genau wissen: »Was geht in meinem Kind vor?«
Was erleichtert uns so eine Feinfühligkeit? Um feinfühlig wahrnehmen zu können, muss ich selbst frei sein. Ich muss mir Zeit dafür nehmen. Wenn ich gerade im Stress bin, weil ich schnell noch etwas erledigen und gleich wieder weg muss, werde ich mich dieser Wahrnehmung weniger widmen können. Und natürlich muss ich im Kopf frei sein. Wenn mich gerade z. B. persönliche Sorgen quälen oder ich mit wichtigen beruflichen Vorbereitungen beschäftigt bin, kann ich mich nicht so intensiv auf mein Kind einlassen, wie ich das vielleicht gern tun möchte.
Versuchen Sie, sich Zeit für Ihr Kind und für Sie selbst zu nehmen. Ich weiß, in der heutigen »schnelllebigen« Zeit erscheint uns dies oft nicht so einfach, aber Sie können versuchen, Prioritäten zu setzen, denn Zeit hat man nur, wenn man sie sich nimmt … Es tut unserem Kind gut, wenn es weiß, es hat unsere ungeteilte Aufmerksamkeit und wir sind für unser Kind emotional voll verfügbar.
Feinfühlig zu sein bedeutet auch weitsichtig zu sein – dass ich beispielsweise weiß, dass jeder Mensch anders ist und ich nicht unbedingt von meinen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen auf andere Menschen oder von den Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen des einen Kindes auf ein anderes Kind schließen kann. D. h. Feinfühligkeit beinhaltet, dass wir wirklich individuell die Perspektive unseres Kindes übernehmen und dass wir uns bewusst sind, dass unser Kind ein Kind ist und eben noch kein Erwachsener (vgl. Kapitel 4.3).
Wenn wir feinfühlig beobachten, nehmen wir weitsichtig wahr, wie das Verhalten unseres Kindes auch mit der aktuellen Situation oder mit vorhergehenden Erfahrungen zusammenhängt. Ist es quengelig, weil es jetzt auf die Abendstunden zugeht und es einfach müde ist? D. h. wenn ich auf Zusammenhänge achte und sie erkenne und realisiere, ermöglicht mir diese Weitsichtigkeit auch, mit größerer Feinfühligkeit mit meinem Kind umgehen zu können.
Klare Kommunikation und Selbstbild
Wenn unser Kind sich äußert oder wir uns unserem Kind gegenüber äußern, so können wir uns dabei gegenseitig verschiedene Mitteilungen geben. Der Psychologe Friedemann Schulz von Thun hat sich intensiv mit dem Thema Kommunikation beschäftigt und kommt zu dem Schluss, dass eine Äußerung vier verschiedene Aspekte transportieren kann: den Sachinhalt, die Selbstkundgabe, den Beziehungshinweis und den Appell:13
Bei unserem Kind können wir hören, welches Thema es anspricht, d. h. wir erhalten Informationen und Fakten des
Sachinhalts
.
Bei dem Satz »Ich will Essen!« wäre der Sachinhalt beispielsweise, dass unser Kind Nahrung möchte.
Wenn wir uns bei einer Mitteilung besonders auf die Sachinhalte konzentrieren, hören wir mit unserem Sach-Ohr.
Wir können auch heraushören, wie es sich gerade fühlt, was es gerade denkt oder wie es sich selbst sieht. Was gibt es mit dem, was es sagt und wie es kommuniziert, über sich preis? Das ist seine
Selbstkundgabe
.
Bei dem Satz »Ich will Essen!« wäre die Selbstkundgabe beispielsweise »Ich bin hungrig und ungeduldig.«
Wenn wir uns bei einer Mitteilung besonders auf die Selbstkundgabe konzentrieren, hören wir mit unserem Selbstkundgabe-Ohr.
Des Weiteren bekommen wir über die
Beziehungshinweise
mit, wie es uns gegenüber steht, wie es unsere Beziehung wahrnimmt.
Bei dem Satz »Ich will Essen!« wäre der Beziehungshinweis beispielsweise »Du kümmerst dich nicht genug um mich!«
Wenn wir uns bei einer Mitteilung besonders auf die Beziehungshinweise konzentrieren, hören wir mit unserem Beziehungs-Ohr.
Und schließlich können wir wahrnehmen, was unser Kind von uns erwartet, was es will, dass wir tun oder auch fühlen und denken. Dies ist die
Appellseite
einer Äußerung.
Bei dem Satz »Ich will Essen!« wäre der Appell beispielsweise »Gib mir etwas zu essen!«
Wenn wir uns bei einer Mitteilung besonders auf die Appelle konzentrieren, hören wir mit unserem Appell-Ohr.
Je nachdem, was wir uns gegenseitig mitteilen wollen, betonen wir verschiedene Aspekte. Diese Aspekte, die wir direkt oder indirekt in unserer Kommunikation übermitteln, sind uns selbst nicht immer bewusst. Wir haben gleichsam keinen Einfluss darauf, ob unser Gegenüber unsere Äußerung auch so versteht, wie wir sie gemeint haben, ob er versteht, dass wir ihm mit unserer Aussage mehr den Sachinhalt, die Selbstkundgabe, den Beziehungshinweis oder den Appell mitteilen wollten. Er kann seinerseits mehr mit seinem Sachinhalts-Ohr, mit seinem Selbstkundgabe-Ohr, seinem Beziehungs-Ohr oder/und mit seinem Appell-Ohr hören. Auf diesen Ebenen können Missverständnisse entstehen.14 Im Beispiel wäre das, dass unser Kind uns nur mitteilen will, dass es nun Essen braucht, wir aber heraushören, dass wir uns nicht genug kümmern und dadurch auf eine gewisse Weise auf unser Kind reagieren.
Um solche Missverständnisse zu vermeiden, ist es wichtig, dass wir zum einen unserem Kind gut zuhören, was es uns mitteilen will, und dass wir uns zum anderen unserem Kind gegenüber klar und deutlich ausdrücken. Nachfragen können uns dabei helfen.
Achten Sie mal bewusst auf Ihre Kommunikation mit Ihrem Kind. Wie sprechen Sie mit Ihm? Wie gehen Sie mit ihm in Alltagssituationen um, wenn Sie entspannt sind? Wie verändert sich Ihre Kommunikation, wenn es Konflikte zwischen Ihnen gibt? Was denkt Ihr Kind, wenn Sie auf diese Weise mit ihm reden?
Können Sie Ihre eigene Grundhaltung Ihrem Kind gegenüber beschreiben? Denken Sie, dass sich das mit dem deckt, wie Ihr Kind Ihre Haltung ihm gegenüber wahrnimmt?
Wie sieht Ihr eigenes Kommunikationsverhalten aus? Sprechen Sie eher sachlich mit Ihrem Kind und liegt Ihr Augenmerk also auf den anstehenden Themen, die durchzusprechen sind? Fragen Sie nach den Gefühlen und Gedanken Ihres Kindes? Teilen Sie eigene Gefühle und Gedanken mit? Wie sieht Ihre Beziehung zu Ihrem Kind aus? Sprechen Sie oft in Appellen mit Ihrem Kind? Was erwartet Ihr Kind von Ihnen?
Nach Schulz von Thun werden Gefühle hauptsächlich durch die Mitteilungen, die wir auf der Beziehungsebene erhalten, erzeugt.15 Bekommt ein Kind das Gefühl, seine Person an sich wird negativ gesehen, hat das langfristig negative Auswirkungen auf sein Selbstwertgefühl bzw. darauf, wie es sich selbst sieht.16