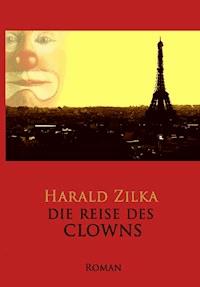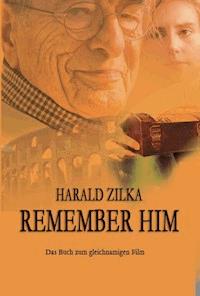
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Der 73jährige Albrecht hat niemanden, der sich an ihn erinnern wird. Seine Erinnerungen trägt er in einer Holzkiste mit sich herum. Eine magische Kiste. Von einem Drama aus dem Leben gerissen, wartet er auf den Tod. Denkt sogar an Selbstmord. Er beginnt, seine Wohnung auszuräumen und mit dem Leben abzuschließen. Als er eines Tages auf dem Friedhof ein fünfzehnjähriges Straßenkind trifft, das alles verloren hat, wird alles anders. Er weiß, dass sein Leben Sinn bekommt, wenn er ihr Leben rettet. Doch sie wehrt sich trotzig dagegen und gerät in einen Polizeieinsatz. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn er weiß - er muss gehen. Wenn es ihm gelingt, ihr Leben in die richtigen Bahnen zu lenken, wird sie sich an ihn erinnern... Der gleichnamige Film über Leben, Sterben und das Weitergeben von Erinnerungen wurde 2012 mit TV-Star Günter Tolar (Made in Austria) verfilmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REMEMBER HIM
von Harald Zilka
Impressum
»Remember Him« basierend auf dem gleichnamigen Film von Harald Zilka mit Günter Tolar in der Hauptrolle.
Lektorat: Victoria Muttenthaler
Fotos: Karin Kirchner
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung.
Copyright: © 2014 Harald Zilka
Covergestaltung & Satz: Sound & Visual Project
published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN 978-3-8442-9870-3
Inhalt
Prolog
Das Kind von der Straße
Der Mann mit dem Trenchcoat
Phasen der Trauer
Der Fünfte im Zimmer
Das dunkle Refugium
Die Dunkelheit
Die Bedeutung der Dinge
Albrecht räumt sein Leben
Die Schatten der Nacht
Wege der Läuterung
Die Kiste der Erinnerung
Albrecht beginnt zu verstehen
Das Mädchen in Schwierigkeiten
Albrecht ist enttäuscht
Apfeltasche und Big Mac
Besuch bei Albrecht
Italienischer Abend
Das letzte Treffen
Ein neuer Anfang
Spuren auf Teneriffa
Der römische Garten
Lisa Maria
Albrecht kehrt zurück
Clara
Der Traum am Meer
Raphaels Tod
Der Herbst des Lebens
Das Erbe
Nach vorne und nie zurückschauen
Die Übergabe der Erinnerung
Epilog
Nachwort zum Buch
Prolog
Sie werden sagen, ein Friedhof ist nicht der richtige Ort, um einem fünfzehnjährigen Mädchen zu begegnen. Wenn man genau darüber nachdenkt, halten sich nicht einmal Erwachsene gerne dort auf, wo aus unbekannten, in Stein geschlagenen Namen lebendige Erinnerungen werden, wenn man die Inschriften den Menschen zuzuordnen weiß. Mancher mag den Gräberreihen und Parkanlagen mit einem gewissen Unbehagen entgegentreten. Andere sagen, Friedhöfe haben etwas Positives, sehr Energetisches, vor dem man keine Angst haben muss. Einige Zeit dachte ich, die Geschichte handelt von Religion oder Spiritualität, aber das tut sie nicht. Spiritualität ist nicht nur auf dem Friedhof zu finden, sondern generell in der Natur. Bei einem solchen Spaziergang im Freien habe ich beschlossen, die Geschichte niederzuschreiben. Viele Monate und Jahre hatte ich mir das immer wieder vorgenommen und es vor mir hergeschoben. Eines Tages fasste ich den Entschluss und begann einfach damit, es niederzuschreiben. Ich machte einen langen Spaziergang auf einem Grashügel über der Stadt und der kühle Wind schlug mir ins Gesicht. Das war der Augenblick, als meine Erinnerungen an Albrecht und die geheimnisvolle Kiste sich in meinem Kopf zusammensetzten wie ein Mosaik. Albrecht, der alte Mann mit dem beigen Trenchcoat war jemand, den Sie nicht einmal bemerkt hätten, wenn sie ihm auf der Straße begegnet wären. Er war groß und trotz seiner hageren Gestalt keiner, der besondere Aufmerksamkeit auf sich zog. Niemand, den man besonders lange im Gedächtnis behielt. Eines von zahllosen Gesichtern, denen man im Laufe eines Tages begegnet, ohne dass diese Begegnungen Spuren hinterlassen. Für gewöhnlich macht man sich nicht die Mühe, Fremde so weit wahrzunehmen, dass man ihre Schicksale hinterfragt. Sie rauschen vorbei, kreuzen unsere Leben und verschwinden, wie die Schatten einer Nacht, wenn die Sonne aufgeht. Sie lösen sich auf, als wären sie nie da gewesen wie Sandburgen am Strand. Man ist ja sowieso das ganze Leben damit beschäftigt, seine eigenen Probleme zu meistern. Natürlich könnte man meinen, diese Geschichte handle von Schicksal, von Vorherbestimmung und von höheren Mächten. Albrecht hatte - wenn er überhaupt je an Höheres geglaubt hat - ein Leben voller Enttäuschungen hinter sich. Besonders in den mittleren Lebensjahren begegnet man Menschen, die ohne Zutun vom Leben geprügelt wurden. Kaum haben sie eine Katastrophe überlebt und sind daran gewachsen, stolpern sie in die nächste Katastrophe. In der Psychologie gibt es sogar einen Ausdruck dafür, das ›self-made-Desaster‹. Es bezeichnet Menschen, die schon zu einem frühen Zeitpunkt, in der Pubertät oder beim Berufseintritt Probleme haben und auch später in negative Bewältigungsmuster fallen. Diese Theorie ist aber schwer umstritten, weil sie in gewisser Weise den Leidenden selbst die Schuld zuschiebt. Manche von den Geplagten schaffen es tatsächlich, ihren Glauben zu wahren oder sogar Gott zu entdecken. Albrecht war keiner von ihnen. Er weigerte sich zu glauben, dass ein Leben voller Prüfungen und Schicksalsschlägen im nächsten Leben belohnt wird. Er verglich den Glauben mit einem Ratenkredit, bei dem man niemals wusste, ob man die Summe ausbezahlt bekommt. »Das ist wie bei einer Versicherung, wo man ein Leben lang einzahlt und im Fall einer Erkrankung die Leistung wegen dieser Vorerkrankung oder jener genetischer Disposition abgelehnt wird!« sagte er oft. Albrecht war aber nicht immer so gewesen. Aufgewachsen am Land, war er sogar katholisch erzogen worden, auch wenn diese Zeit wie ein Nebel am Morgen grau und weit zurücklag. Im Haus seiner Großmutter und auch der Eltern hatte es einen Herrgottswinkel gegeben, eine christliche Zimmerecke in der bäuerlichen Wohnstube. Vielleicht zweifelte Albrecht schon damals daran, denn er wuchs auf in den Wirren des Weltkrieges und verlor zwei Brüder und einen Onkel an der Front. Das Leben hatte ihn gewandelt, seine Einstellung verändert und Albrecht zu einem Pessimisten gemacht, der das Positive im Leben nicht einmal erkennen würde, wenn es ihm auf die Schulter tippt. Einige Zeit suchte er sogar nach dem Glauben, kam aus dem Gestrüpp der negativen Gedanken aber nicht hinaus. Erfahrungen mit dem Tod eines geliebten Menschen hatten damit auch zu tun, aber die hat jeder und muss sie auch bewältigen. Die Psychologie ist voll mit Ratschlägen, wie man seine Trauer verarbeiten kann. Und Albrecht hasste Psychologen noch mehr als er Ärzte hasste. Er gehörte zu den Vertretern seiner Generation, die nie zum Arzt gingen. Ich habe einmal den Fehler gemacht, einem befreundeten Biologen zu erklären, Trauer sei ein Gefühl, das uns von den Primaten unterscheidet. Er hat mich lange angesehen und dann gelacht. Bevor der Abend vorüber war – und es war ein langer, beeindruckender Abend - erfuhr ich von seinen Reisen nach Kenia, wo er die Totenwache der Elefanten beobachtet hatte. Eine Elefantenkuh war nach einem Schlangenbiss zusammengebrochen und die Forscher beobachteten mehrere Tage eine Herde von Tieren, die vor Trauer ganz benommen war. Jeden Abend wanderten die Tiere acht Kilometer weit, um Futter zu finden. Am nächsten Morgen trotteten sie acht Kilometer zurück zu ihrer toten Artgenossin, um Mahnwache zu halten. Ich erfuhr vom Abschiedsschmerz der Paviane und Schimpansen, die ihre toten Kinder herumtrugen, bis sie auf ihren Schultern zu Staub zerfielen. In heißen Gebieten passierte das innerhalb von wenigen Tagen. »Am Anfang dachten wir, die Affen verstehen nicht, dass ihr Kind tot ist! « erzählte mein Freund. »Später entdeckten wir, das dieselbe Affenart, die in kälteren Regionen lebte, sich in viel kürzerer Zeit von ihren Toten verabschieden. Weil das Klima dort es nicht anders zuließ. Die Körper verwesten dort wesentlich langsamer, die Tiere mussten die Toten liegen lassen. Schmerz und Trauer ist etwas, was zum Auftrag der Evolution dazugehört«.
Die Erkenntnis, dass sogar Primaten Tod und Trauer erfuhren und sich Rituale schufen, traf mich hart. Das ist keine gravierende Neuigkeit, von der man nie gehört hat – aber eine, die man lieber zur Seite schiebt. Tiere mit menschlichen Zügen zu sehen, ist unangenehm. Wer geht schon in den Tierpark und baut ein persönliches Verhältnis zu Affen oder Elefanten auf, es sei denn, man blickt zu lange in ihre Augen und damit in das Lebewesen dahinter. Aber wer will das schon? Niemand fährt auf einen Bauernhof und dort einem Schwein einen Namen zu geben, von dem man weiß, dass es zwei Wochen später in Zellophan verpackt im Kühlregal wieder auftauchen könnte. Der Trick der Verdrängung ist, das man nach einer Woche wieder zurückfährt und nur die kurzen, persönlichen Eindrücke mitnimmt. Man grillt ja auch kein Steak, um vorher darüber nachzudenken, wie das Rind in den Gang getrieben wird, wo der Schlachtschussapparat wartet. Man fährt auch nicht nach Italien und erinnert sich dann an die Mafia oder die Arbeitslosigkeit der Jugend, sondern an die warmen Sommerabende mit Lasagne und Chianti, den salzigen Duft im Hafen und den Geruch von Pinien. Die Verdrängung begleitet uns das ganze Leben. Manche Menschen haben den Vorteil, dass sie über ihre Gefühle sprechen können. Sich Anderen zu öffnen, kann Verletzung bringen, aber auch Heilung. Im Tierreich scheint es bei den meisten Arten die gleichen sozialen Verfahren zu geben, die auch bei uns oftmals Linderung bringen. So erfuhr ich an jenem Abend, dass auch Tiere sich im Umgang mit ihren Artgenossen trösten. Bei Schimpansen und Primaten scheint die Trauer damit zu enden, dass die Betroffenen nach der Trauer anderen aus der Gruppe das Fell pflegen und dadurch über den Schmerz hinwegkommen.
Der Kontakt mit dem Lebenden und das Greifen nach sozialen Strukturen scheint das Einzige zu sein, was ein gebrochenes Herz heilen kann. Bei Tieren, die in Gruppen leben, funktionieren also die gleichen Rituale, die Menschen viele Jahrhunderte ebenfalls vollzogen. Besonders in ländlichen Gebieten wurden die Älteren seit jeher im Familienverband gepflegt, bis die Menschheit abbog und alternde Menschen und deren Tod aus der Gesellschaft verbannte. Wer hat schon die Kraft seine Mutter zu pflegen, während man sich gerade mit zwei Jobs über Wasser halten muss, um die Miete zu bezahlen und nebenbei noch den Kindern hinterherhetzt? Outsourcing wurde eingeführt, könnte man sagen und dabei fielen Menschen wie Albrecht durch das soziale System, die noch nicht alt genug waren, um zu sterben, aber auch zu wenig soziale Kontakte hatten, um gepflegt zu werden. Albrecht hatte keine Nachkommen und keine Familie. Er war nicht der Typ, der an lustigen Seniorenabenden oder Schachturnieren teilnahm. Zu groß war die Angst, dass die Menschen in sein Herz sahen und sein Geheimnis entdeckten. Nach seinem größten Verlust war er wie ein Haustier, das seinen Besitzer verliert und daran selbst zu Grunde geht. Ich bin mir sicher, Sie kennen jemanden, der von solchen Begebenheiten berichten kann. Eine der wenigen Erinnerungen, die ich aus meiner eigenen Kindheit habe, ist der Schäferhund meines Großvaters. Als mein Großvater starb, hinterließ er den steinalten Hund, dessen genaues Alter niemand kannte. Das Alter sah man ihm an, denn sein Fell war zottig und die Bewegungen langsam. Anzeichen auf eine Krankheit gab es aber nicht. Wie bei den meisten Hunden war die Nähe zu meinem Großvater das, was ihn am Leben hielt. Keine drei Wochen, nachdem Großvater starb, starb auch der Hund. Er hatte sich kaum mehr bewegt und kein Futter zu sich genommen. Als ich Albrecht, der eine besondere Vorliebe für Hunde hatte, diese Geschichte später erzählte, nickte der nur und sagte:
»Er starb am gebrochenen Herzen«. Die Wahrheit ist, dass ich gar nicht sehr bewandert bin, was man in ein gutes Buch hineinschreibt oder nicht. Die Geschichte von Albrecht ist auf jeden Fall eine, die das Leben geschrieben hat und das sind oft die Härtesten. Albrecht hatte niemanden mehr, der sich an ihn erinnern würde und das war für ihn schlimmer als der Tod. Er hatte sich aufgegeben und trieb mehr dahin, von einem Tag in den anderen, statt zu leben. Eine Abwärtsspirale, die nur dadurch durchbrochen wurde, dass er völlig unverhofft einen Menschen kennenlernte, der viel jünger war und fast ebenso verloren durch das Leben trieb. Eine Begegnung, die beider Leben verändern würde. Und sie begann dort, wo gewöhnlich die Geschichten enden, nämlich am Friedhof in Ober St. Veit, über den Hügeln von Ober St. Veit.
KAPITEL 1
Das Kind von der Straße
Das Mädchen mit den braunen Haaren und dem schmutzigen Overall war keine fünfzehn Jahre alt. Sie hatte mit der Welt gebrochen. Dass sie sich hier am Friedhof herumtrieb, war kein Zufall. Wer keine Angst vor Friedhöfen hat, kann diese Orte der Ruhe und Andacht zum Verweilen und Nachdenken entdecken. Die Bäume und Sträucher der Grabanlagen, die geschmückten Steine sind tatsächlich ein Anstoß zur inneren Einkehr. Der Friedhof lag in dem Wiener Außenbezirk Ober St. Veit. Den gibt es wirklich und er gilt als die älteste Spur menschlichen Lebens, nachdem Zeugnisse einer paläolithischen Siedlung hier gefunden wurden. Heinrich II. verschenkte es an die Bamberger Dombrüder, ehe es 1529 und 1683 von den Türken verwüstet wurde. Im Jahr 1762 verkaufte Kardinal Migazzi die Herrschaft St. Veit an Maria Theresia und diese ließ eine Straßenverbindung nach Schönbrunn anlegen, welche seit 1894 »Hietzinger Hauptstraße« heißt. Über diese oder das Wiental erreicht man die Straßen, in denen Albrecht wohnte und den Friedhof. Hat man das Wien-Tal verlassen und folgt den ansteigenden Gassen zum Roten Berg, ist es nicht mehr weit. Am Rande des Lainzer Tiergartens liegt die Gedenkstätte, wo auch Egon Schiele und Gustav Klimt ihre letzte Ruhe gefunden haben. Hier wurde auch der gleichnamige Hollywood-Film über das Leben von Gustav Klimt gedreht, mit John Malkovich in der Hauptrolle. Der Blick über die Stadt Wien und die ruhige Verkehrslage machten diesen Friedhof ganz sicher zu einem besonders inspirierenden Ort. Das Mädchen suchte auf dem Friedhof aber keine Inspiration. Sie war keiner Sekte oder Jugendbewegung zugehörig, die Gothic-Elemente verehrte und hatte kein starkes Verhältnis zu Gott. Sie hasste Gott mit der gleichen Abscheu, mit der sie sich selbst hasste. Auf dem Friedhof strich sie nur an wärmeren Tagen herum, wenn sie die Schule schwänzte. Die Wiener Einkaufsstraßen oder die Innenstadt waren dafür kein guter Ort, weil Massen von geschäftigen Menschen mit Aktentaschen und Einkaufstaschen wie eine Walze jede Ruhe hinwegfegten. Das Mädchen hatte sich im westlichsten Bezirk von Wien und im Wienerwald herumgetrieben, als sie vor einem Platzregen flüchten musste und sich nach erfolglosen Versuchen in Hausfluren in einer der Grüfte versteckte. Sich in den Kellern und Gängen von bewohnten Häusern herumzutreiben, war mit großem Stress verbunden, weil ständig Hausparteien kamen und gingen und man praktisch jederzeit mit großem Geschrei hinauskomplimentiert werden konnte. Die wenigen Nächte, die sie in bewohnten Häusern verbracht hatte, waren schlaflos gewesen, weil ständig irgendwo eine Tür anschlug oder der Lift sich bewegte. Das Flüstern der alten Kastanienbäume am Friedhof, das in manchen Nächten klang, als würden die Menschen, die hier ruhen, von ihrem Leben erzählen, machte ihr keine Angst. Das Mädchen mochte den Friedhof, weil sie in einer Stimmung war, die diesem Flair sehr nahe kam. Viele Habseligkeiten hatte sie nicht bei sich und ihre Kleidung war nicht so schmutzig, wie man es sich bei Land- oder Stadtstreichern vorstellte. Das lag daran, dass sie nicht auf der Straße lebte, sondern bei der Jugendfürsorge gemeldet war und dort betreut wurde. Die finsteren Zeiten, wo man Kinder in dunklen Heimen mit strengkatholischen Schwestern einsperrte, sind vorbei. Der letzte Versuch, gefährdete Kinder in ein sozialpädagogisches Heimkonzept zu integrieren, war in den 70er Jahren die »Stadt des Kindes«, ebenfalls im Westen von Wien. Damals galt die offene Struktur der Jugendbetreuung mit zahlreichen Sportangeboten als enormer Fortschritt, der sich letztlich aber nicht durchsetze. Die Kinder, die dort aufgewachsen sind, sind heute erwachsen. Albrecht hatte einen Schulfreund gehabt, der als Sport-Betreuer in diesen Einrichtungen arbeitete und später sollte das Mädchen auch große Bedeutung gewinnen. Die Gebäude der Kinderstadt wurden mittlerweile abgerissen und in Wohnungen umgewandelt. Das Schwimmbad, die Bibliothek und die Theaterbühne blieben den neuen Bewohnern erhalten. Der Trend der Jugendwohlfahrt ging danach zu anonymen, betreuten Wohngemeinschaften und flexiblen Versuchen, auch Ausreißern immer wieder habhaft zu werden, um sie zumindest mit Streetworkern zu versorgen. Die Auswirkungen der antiautoritären Erziehung, die sowieso eine junge Generation geschaffen hat, die sich wenig sagen lassen will, hat die Betreuung verändert. So war das Mädchen beim Jugendamt und in einer Wohngemeinschaft gemeldet, in der es Pflichten gab und auch die Schulbildung kontrolliert wurde. Dass sie zeitweise ausriss und für einige Tage verschwand, konnte aber nicht verhindert werden. Der Tag, als das Mädchen auf Albrecht traf, war der erste warme Frühlingstag nach einem bitterkalten, aber schneearmen Winter. Die ersten Strahlen der Sonne tauchten die Bäume und Grabsteine in ein orangefarbenes Licht, wie es nur im Frühling oder im Herbst zu bestaunen ist. Es war das erste Mal im neuen Jahr, dass sie auf den Friedhof kam. Schon am Weg von der U-Bahn durch die Gassen hinauf sah sie, dass die Menschen auf den Straßen die Winterjacken abgelegt hatten und hungrig nach Licht das neue Jahr begrüßten. Das Mädchen war froh, dass die Temperatur sommerlich wurde und sie mehr an der frischen Luft unternehmen konnte. Richtige Schwierigkeiten gab es nur, wenn sie die Schulleistungen nicht erbrachte, aber sie war nicht dumm und schaffte es mit wenig Mühe, die Aufgaben nachzubringen und abzuarbeiten. Größere Probleme hatte sie damit, anderen Menschen zu begegnen. Sie war zu einer Einzelgängerin geworden. Für ihre Jugend war ihr kein dunkler Ort dieser Stadt unbekannt. Sie kannte die Plätze der Drogensüchtigen und die Lokale, in denen die Prostituierten auf ihre Freier warteten. Sie hatte gesehen, wie Drogentote nach einem goldenen Schuss in Särge geladen wurden und sich die Gehirnmasse eines Opfers der Russenmafia in einer Seitengasse der Wiener Innenstadt verteilt hatte. Wie in allen großen Städten auf der Welt gibt es auch in Wien eine Seite, die nicht in den prächtigen Reiseführern angepriesen wird. Aber wie langweilig wäre eine Stadt, die nur mit sich schunkelnden Heurigengästen oder barocken Perücken im Schönbrunner Stil identifiziert werden würde. Schließlich hat auch nicht jeder Australier ein Känguru im Garten. Der Übergang von ihrem einst behüteten Leben und dem Leben auf der Straße ging so fließend, dass sie keinen Unterschied bemerkte. Das Mädchen hatte Bekannte in allen Gruppierungen, obwohl sie sich nirgends dazugehörig fühlte. Später würde sie sagen können, dass es zwei Dinge gab, die ihr Leben gerettet hatten: dass sie keine Drogen konsumierte. Sie wusste, was mit den Menschen passierte, die ihnen verfielen. Und ihr Leben veränderte sich, weil sie Albrecht begegnete.
KAPITEL 2
Der Mann mit dem Trenchcoat
Albrecht bog wie fast jeden Tag vom Hauptweg zu den Ehrengräbern ein, um auf die Hügelspitze des Friedhofs zu gelangen, wo das Grab seiner Familie lag. Er war dreiundsiebzig Jahre alt und sein Gesicht war tief zerfurcht, wie die Rinde eines alten Baumes. Als hätte sich jedes Lebensjahr in sein Gesicht eingegraben. Er hatte einen starken, aufrechten Gang und strahlte etwas aus, das man durchaus als Stärke bezeichnen konnte. Eine abgenutzte, graubraune Lederkappe bedeckte den Kopf und der Knoten seines Schals war nach moderner Art geschlungen. So modern, wie man es bei einem Mann in Albrechts Alter gar nicht erwartet hätte. In seiner rechten Hand hielt er die Plastiktasche fest im Griff, ein billiges Werbegeschenk von einer Ferienmesse. Albrecht hatte einige Zeit lang diese Messen besucht und sich Angebote bei verschiedenen Destinationen angesehen, ohne je den Mut aufzubringen, alleine eine Reise zu buchen. Die einzige Reise, die er seit einiger Zeit wieder auf sich nahm, war ein täglicher Spaziergang zum Friedhof. Er kam inzwischen fast jeden Tag. Das war nicht immer so gewesen. Hinter dem aufrechten Gang und dem kräftigen Blick verbarg sich das Herz eines Menschen, dem im Leben nichts geblieben war. Er hatte viele Rückschläge und Enttäuschungen verkraftet, sogar den Tod seiner großen Liebe überlebt, ohne daran zu wachsen. Die wenigen Freunde, die er hatte, waren gestorben. Einer nach dem anderen. Kontakt mit diesen Menschen hatte er zuletzt wenig gehabt, meistens erfuhr er von ihrem Tod durch Zufall. Und es wurden immer mehr. Sein Leben war wie ein Ausflug auf eine Insel geworden. Nachdem er sich durch das dichte Gestrüpp zum Strand zurückgekämpft hatte, musste er feststellen, dass sein Schiff am Horizont davonsegelte. Der Gedanke, ein Leben gelebt zu haben, das praktisch keine Spuren hinterließ, gab ihm den Rest. In dieser Situation befinden sich viele alte Menschen, nur denkt man nicht oft darüber nach. Nicht allzu viele sind in der glücklichen Lage, das Alter in einem wohlbehüteten Familienverband zu verbringen. Das war eine Sache, die Albrecht stets in südlichen Ländern bewundert hatte. Die Vorstellung, dass mehrere Generationen im Schatten der Olivenbäume ein einfaches Mahl zu sich nehmen, wie Oliven aus Sizilien, Wein aus der Toskana oder Tomaten aus Umbrien, entsprach einem romantischem Ideal. Es entsprach nicht ganz der Wahrheit, sowenig wie das Leben in Venedig mit all den Fluten und feuchten Palazzos romantisch oder das Auskommen der Familien in Italien oder Griechenland leicht zu ertragen ist. Als Tourist bemerkt man das meist gar nicht. Aber natürlich funktionierte in diesen südlichen Ländern ein Generationenvertrag, der in Resteuropa lange nicht mehr galt. Gerade die italienische Kultur, sofern man die unterschiedlichen Regionen überhaupt zu einem Land zusammenfassen kann, hatte die starke Familienzugehörigkeit aus der Not heraus gebildet, zu überleben. Das war in Albrechts Familie nicht anders gewesen, weil er vom Land kam. Wenn man Ende der dreißiger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts geboren war, hatte man durch den Krieg sowieso schon die Hälfte des Lebens verloren und musste froh sein, wenn man den Wahnsinn überlebt hatte. Als die wirklich Besten seiner Jahre hätte Albrecht die Siebziger und Achtziger bezeichnet, allerdings versanken auch diese längst im Schleier der düsteren Erinnerung. Es war erschreckend, wie schnell man so lange leben konnte, dass man Teil der Geschichtsbücher und Ereignisse eines ganzen Jahrhunderts sein konnte. Albrechts Großmutter war in ihrer Kindheit noch nach Wien gefahren, um den Kaiser Franz Josef in seiner Kutsche zuzuwinken. Mit ihm schloss sich der Kreis eines Jahrhunderts. Wenn man auf dem Friedhof spazierte, rückte dieses Gefühl stärker ins Bewusstsein. Die Fotos auf den Gräbern und die eingravierten Namen erzählten vom Leben und Leiden. Der Friedhof, fand Albrecht, war ein Ort, an dem alle Schicksale gleichgemacht wurden. Wie die Flut den Strand glättet und die Sandburgen des letzten Urlaubstages wieder abträgt, spielte es am Ende des Lebens wenig Rolle, was man erduldet und erlebt hatte. Die Leiden und das Lachen des Lebens, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, die lauen Sommerabende wie die knirschend kalten Winternächte - alles wurde ausgelöscht vom Tintenkiller des Lebens. Das gab dem Leben eine andere Bedeutung. Es machte vergänglich, wie ein Umsteigebahnhof, in den man einstieg, ein paar Stationen fuhr und dann wieder ausstieg, ohne sich an Begegnungen zu erinnern. Bei den täglichen Spaziergängen verbrachte Albrecht viel Zeit damit, sich die Namen und die Bilder auf den Grabsteinen anzusehen und darüber nachzudenken, was diese Menschen wohl erlebt hatten. Bei manchen Inschriften, die Details über schweres Leiden oder langer Krankheit offenbarten, war das möglich. Andererseits gefiel Albrecht nicht, einem Menschen auf die letzte Tafel nichts anderes zu schreiben, als die vielleicht schlimmsten Leiden seines Lebens. ›Nach langem Leiden‹ und ›nach langer, schwerer Krankheit‹ verwischten die fröhlichen Momente eines Lebens und zeugten nur mehr von einem Martyrium.
Der Gedanke an den Tod erschreckte Albrecht nicht. In gewisser Weise fühlte er sich bußfertig, ›fertig zum Abholen‹, wie er lakonisch sagen würde. Wenn man darauf wartete, dass es Abend wird und den nächsten Tag erwartete, um es wieder Abend werden zu lassen, ist der Zyklus überschaubar. Dabei war er nicht der Ansicht, dass er viel verpasst hatte oder Dinge erledigen musste. Er wollte keine Tour durch die Sahara machen und niemals den Jakobsweg, den Camino de Santiago bewältigen. Obwohl das nicht geschadet hätte. Menschen, die nicht besonders religiös sind, werden die Vorstellung, tagelang den spanischen Pilgerweg zum Grab des Apostels Jakobus zu wandern sowieso lachhaft finden. Von jenen Menschen, welche die Reise machten, hört man aber auch, dass nicht der Glaube sondern die Zeit mit sich selbst, eigene Gedanken und die Natur die innere Reinigung bewirkten. Wahrscheinlich hätte sich Albrechts Leben also verbessert, wenn er sich den Dämonen seines Lebens gestellt hätte. Der biografische Horizont eines Menschen reicht fünfzehn Jahre zurück in die Vergangenheit und fünfzehn Jahre nach vorne, sagt man. Wer fünfzig ist, teilt eine Menge Generationserfahrung – zum Beispiel Erinnerungen an Filme, Hits und Fernsehserien – sowohl mit den 35-Jährigen als auch mit den 65-Jährigen. Mit noch jüngeren und noch älteren Menschen hat man in dieser Hinsicht nicht mehr viel gemeinsam.
So mag die heutige Generation vielleicht noch Dallas oder Knight Rider auf einer Erinnerungsseite entdeckten, aber kaum Grace Kelly, Audrey Hepburn oder Deborah Kerr kennen. Mit Fünfzig erreichen die meisten im Beruf den Höhepunkt ihrer Laufbahn. Die Jugend ist vorbei, aber noch in Sichtweite und das Ende gleichzeitig schon bedrohlich nahe. Danach kommt es häufiger vor, dass man in einen Raum tritt und der Älteste ist. Zu diesem Zeitpunkt muss man Frieden mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten geschlossen haben, sonst hat man keine Möglichkeit, noch glücklich zu leben. Die Spuren im Sand, sagt man, verwischt das Meer mit jeder Welle der Flut, selbst die Spuren im Schnee schmelzen, wenn das Licht der Sonne stärker wird, als die Winternächte kalt sind. Keine Spuren hinterlassen zu haben, wirft die Frage auf, wofür man gelebt hat. Albrecht, der in seiner Beziehung der Ältere gewesen war, hatte gar nicht damit gerechnet, dass er noch jemanden zu Grabe tragen würde. Er hatte ganz im Geheimen, gehofft, dass er als Erster gehen würde. Das liegt daran, weil er ein empfindsames Gemüt hatte und sich zu schwach sah, als Erster einen derartigen Verlust zu überstehen. Sein Wunsch ging nicht in Erfüllung. Seine Liebe starb völlig unerwartet, völlig bescheuert und viel zu jung. Er dachte immer, dass es nichts Schlimmeres gibt, als einen geliebten Menschen zu verlieren. Es stellte sich heraus, dass es nicht so ist. Viel schlimmer als der Verlust ist das Leben danach.
KAPITEL 3
Phasen der Trauer
Das Leben danach war schmerzhafter als er vermutet hatte. Eine Zeit der Umstellung und des Lernens. Neuorientierung sei wichtig, hatte man ihm angeraten. Der Verlust stieß Albrecht in eine tiefe Betäubung. Die Benommenheit begann morgens, nachdem er geweint hatte, trieb ihn durch den Tag wie ein Blatt im Wind und wurde höchstens von einem erschöpften Schlaf voller wirren, rauschartigen Träumen durchbrochen. Dabei waren Ehen und Beziehungen oft gar kein Honigschlecken, sondern ein emotionales Auf und Ab der Gefühle. Ein Leben lang gab es viele Dinge, die man als störend empfand oder am Partner bekrittelte und jede Menge Probleme, die der romantischen Eintracht im Weg standen. Selbst Albrechts Großeltern hatten, solange er sie kannte, ständig miteinander herumgemeckert. Der Erfolg dieser Generation war wahrscheinlich, dass sie Dinge, die sie nicht hören wollten, einfach nicht hörten und niemals darauf reagierten. Außerdem waren Trennungen aus sozialen Gründen kaum möglich, vor allem für die Frauen. Das hat sich heutzutage geändert, wo selbst die Scheidungen gefeiert werden. Auch das Verhältnis von Jugendlichen und Erziehungsberechtigten hat sich stark verändert. In den USA gab es 2014 den ersten Fall, wo ein minderjähriger Teenager von den Eltern auszog und sie hinterher um Unterhalt verklagt hat. In Amerika ist das gar nicht selten und der Trend zog herüber nach Europa wie eine Kaltluftfront. Inzwischen gab es eine ganze Industrie von Lebensberatern, Psychologen, Anwälten und Jugendbeauftragten, die gut daran verdienten. Die Welt hatte sich einfach geändert, doch für Albrecht war sie gut gewesen, solange sein Leben in der Bahn lief. Er war nun mal kein spontaner Mensch und niemand, der sich freute, wenn die Hausschuhe abends nicht am erwarteten Platz standen. Albrecht war kein besonders spannender Charakter, sondern ein Meer, dessen schönste Seiten man nur ergründen konnte, wenn auf ihm kreuzte, um die stillen Inseln zu erkunden. So war er stets jemand gewesen, der auch Zeit zum Nörgeln fand. Er hatte alle Phasen der Bewältigung durchlebt. Fünf Phasen sind es, sagt man. Der Schock, das Nicht-Wahrhaben-Wollen, die Aggression, die Depression, das Verhandeln mit dem Schicksal und die Akzeptanz. Entdeckt und beschrieben wurden sie von der Psychologin Kübler-Ross und selbst wenn man bereit war, über Psychologen und Psychologie zu schimpfen oder sie abzulehnen, muss man doch zugeben, dass man früher oder später diese Phasen mehrfach erlebt. Früher oder später lernt sie jeder kennen, ob man sich dessen bewusst ist oder auch nicht. Die Phasen sind bei allen Menschen gleich und offensichtlich auch bei manchen Tieren. Wie die Meisten scheiterte Albrecht daran, den Fortschritt seiner Phasen selbst zu bestimmen. Er war noch mitten in einer Depression, vollgepumpt mit Verdrängung und Selbstmitleid, als er sich schon eingestehen wollte, dass er darüber hinweg gekommen war. In dieser Zeit war er niemals auf dem Friedhof und am Grab, denn die Angst vor dem Schmerz war so groß, dass er nicht die Kraft hatte, sich ihr zu stellen. Und er kam gut damit durch, denn viele Leute, die ihn nach seinem Befinden fragten, gab es nicht. Die meisten seiner Freunde waren längst verstorben und es rächte sich auch, dass er von Grund auf kein kommunikativer Mensch war. Teilweise hatte er so wenige soziale Kontakte, dass er selbst deren Tod nur später durch Zufall erfuhr. Er hatte sich zu sehr zurückgezogen. Albrecht war immer schüchtern gewesen und niemand, der leicht neue Kontakte schloss. In seiner Beziehung hatte er jemanden gehabt, der es konnte und ihm diese Aufgabe abnahm. Auch das ist ein Problem: Eine gute Partnerschaft baut darauf auf, dass man sich ergänzt und somit eine funktionierende Gemeinschaft abgibt, was nicht heißt, dass danach der Übriggebliebene die Aufgaben alleine erfüllen kann. Im Gegenteil, meistens verliert man sogar noch ein Stück von sich selbst. Man lernt ein paar Dinge dazu, doch letztlich ist es, als habe man für eine bestimmte Zeit das Vergnügen gehabt, einen fliegenden Teppich aus Tausend und einer Nacht zu benutzen, um hinterher wieder mühsam über Steine und Berge zu klettern. Selbst der Alltag wurde zu einem Kampf ums Überleben. War es gut für Albrechts Beziehung gewesen, dass er nie in Branntweinstuben gesessen hatte oder dem Alkohol zusprach, war es schlecht für die Zeit danach. Er konnte nicht einmal in einem Wirtshaus sitzen und an Kartenrunden teilnehmen, weil er mit diesem Schlag von Menschen, welche dort täglich saßen, nichts anzufangen wusste. Stattdessen war es ihm gelungen, den Friedhof und den Tod aus seinem Leben zu verbannen und sich damit zu arrangieren, dass er selbst ganz gut davongekommen war. Dabei gab es wenige Alternativen, um sein Leben zu füllen. Nach der Zeit, in der er von der Leere berauscht war, dass er kaum den Unterschied zwischen Tag und Nacht feststellen konnte, begann eine Phase der Betäubung. Alles schien sich in Zeitlupe zu bewegen und jede Regung in seinem Gehirn war verzögert. Schließlich hatte er gelernt so zu leben, als wenn der Verlust nie stattgefunden hätte. 2005 hatte man auf der philippinischen Insel Mindanao zwei japanische Soldaten entdeckt, die sechzig Jahre im Dschungel gelebt und das Ende des zweiten Weltkrieges verpasst hatten. Als man sie fand, wussten sie nicht, dass der Krieg vorbei war und befanden sich in Gefechtsposition. So ähnlich fühlte sich auch Albrecht, der auf einer Insel am Leben war, die nichts mit Leben zu tun hatte. Dort saß er, sah die Tage am Kalender und die Jahreszeiten vor dem Fenster vorbeiziehen und wartete auf den Tod.