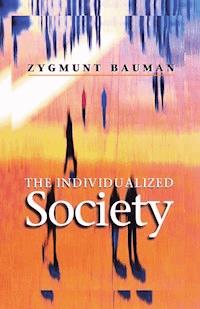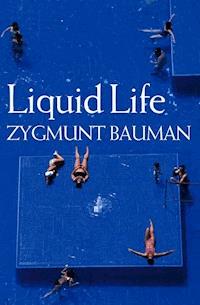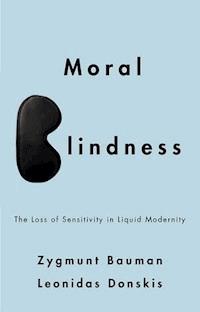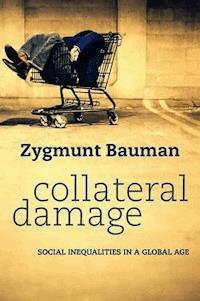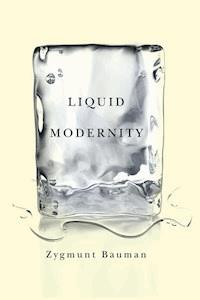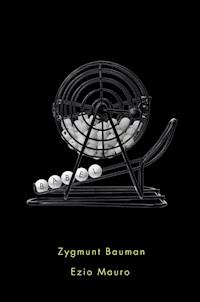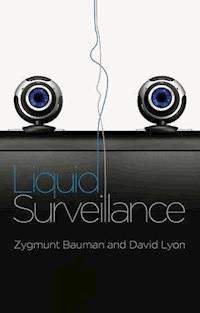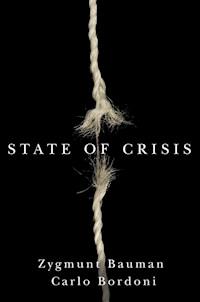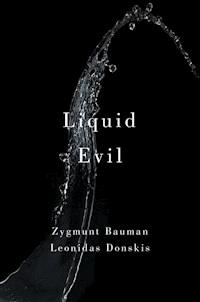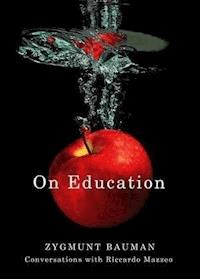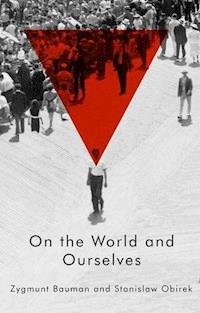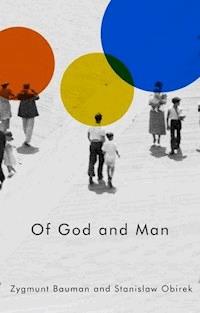15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Jedes einzelne von Baumans Büchern in der letzten Dekade kann als Meisterwerk gelesen werden.«
Ulrich Beck
»Make America great again«, lautet der Leitspruch des amtierenden US-Präsidenten. Nicht »vorwärts« soll es gehen, wie Barack Obama noch im Wahlkampf von 2012 versprochen hatte, sondern zurück zu alter Größe. Die Menschen scheinen die Hoffnung auf ein besseres Leben in der Zukunft aufgegeben zu haben und wenden sich stattdessen einer angeblich guten alten Zeit zu.
In seinem letzten zu Lebzeiten vollendeten Buch untersucht der große Soziologe und Philosoph Zygmunt Bauman die Gründe für diese globale Epidemie der Nostalgie. Gut fünfhundert Jahre nach der Veröffentlichung von Thomas Morus’ Utopia, so seine These, haben die Nationalstaaten die Fähigkeit eingebüßt, ihre Versprechen auf Wohlstand und Sicherheit einzulösen. Wer in einer globalisierten Welt nach Orientierung sucht, der richtet seinen Blick daher nicht länger auf einen als Ideal verklärten Ort – einen topos –, sondern in eine untote Vergangenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
3Zygmunt Bauman
Retrotopia
Aus dem Englischen von Frank Jakubzik
Suhrkamp
7
Für Aleksandra, Kameradin im Leben wie im Denken
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Einführung: Das Zeitalter der Nostalgie
1. Zurück zu Hobbes?
2. Zurück ans Stammesfeuer
3. Zurück zur sozialen Ungleichheit
4. Zurück in den Mutterleib
Epilog: Zur Abwechslung ein Blick nach vorn
Fußnoten
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
9Einführung: Das Zeitalter der Nostalgie
Wie sagte noch Walter Benjamin in seinem Aufsatz »Über den Begriff der Geschichte« (1940), nachdem er in Paul Klees Zeichnung Angelus Novus (1920) den »Engel der Geschichte« entdeckt hatte:
Der Engel der Geschichte […] hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.1
Betrachtet man Klees Zeichnung heute, mehr als ein Dreivierteljahrhundert nach Benjamins unergründlicher und unvergleichlicher Deutung, sieht man den Engel der Geschichte nach wie vor in ungebremstem Flug. Allerdings hat er zur Verblüffung des Betrachters einen U-Turn vollzogen: Nunmehr kehrt er der Vergangenheit den Rücken und blickt entsetzt in Richtung Zukunft. Seine Flügel werden von einem Sturm nach hinten gedrückt, der einem imaginierten, antizipierten und vorauseilend gefürchteten höllischen Morgen entstammt und ihn unaufhaltsam auf das (im Rückblick, nach seinem Verlust und Verfall) paradiesisch erscheinende Gestern zutreibt. Und wieder ist 10der Sturm so stark, dass er die Flügel »nicht mehr schließen« kann.
Vergangenheit und Zukunft haben auf der Zeichnung die Eigenschaften vertauscht, die Klee ihnen, Benjamin zufolge, vor fast hundert Jahren zuschrieb. Heute ist es die Zukunft, auf die man nicht vertrauen kann, da sie vollkommen unbeherrschbar erscheint. Sie wird auf der Sollseite gebucht. Dafür erscheint jetzt die Vergangenheit auf der Habenseite — dank ihres (verdienten oder unverdienten) Rufs, ein Hort der Freiheit gewesen zu sein, auf den sich noch nicht diskreditierte Hoffnungen setzen lassen.
*
Svetlana Boym zufolge, Professorin für Literaturwissenschaft in Harvard, »ist Nostalgie zwar ein Gefühl des Verlusts und der Entwurzelung, zugleich aber auch eine Romanze mit der eigenen Fantasie«.2 Galt sie im 17. Jahrhundert noch als heilbare Krankheit, gegen die beispielsweise Schweizer Ärzte zu Opium, Blutegeln und Reisen in die Berge rieten, »ist aus der vorübergehenden Indisposition im 21. Jahrhundert eine unheilbare Bedingung des modernen Lebens geworden. Das 20. Jahrhundert, das mit futuristischen Utopien begann, endete in Nostalgie.«3 Nach Boyms Diagnose leidet die Gegenwart an einer »globalen Nostalgie-Epidemie, an schmachtendem Verlangen nach Gemeinschaftlichkeit und gemeinsamer Vergangenheit, an der verzweifelten Sehnsucht nach Kontinuität in einer fragmentierten Welt«. Diese epidemische Nostalgie fungiere als »Abwehrmechanismus in Zeiten beschleunig11ter Lebensrhythmen und historischer Umwälzungen«,4 der im Wesentlichen aus »dem Versprechen [besteht], jene ideale Heimat wiederzuerrichten, die im Zentrum vieler heute einflussreicher Ideologien steht und uns dazu verleiten soll, das kritische Denken zugunsten emotionaler Bindungen aufzugeben«. Das Gefährliche daran, so Boym, ist die »Neigung, unsere tatsächliche mit einer idealen Heimat zu verwechseln«.5 Diese Gefahr zeige sich am deutlichsten in der »restaurativen« Spielart der Nostalgie, wie sie uns in »nationalen und nationalistischen Revivals überall auf der Welt« begegnet, »die mit Hilfe des Rückgriffs auf nationale Symbole und Mythen, zuweilen auch indem sie Verschwörungstheorien in Umlauf bringen, eine antimoderne Mythologisierung der Geschichte betreiben«.6
Zu ergänzen wäre, dass die Nostalgie nur ein Mitglied der weitverzweigten Familie affektiver Bindungen an ein »Anderswo« ist. Derartige Gefühlsregungen (und mit ihnen auch die Verlockungen und Fallen, die Boym der »globalen Nostalgie-Epidemie« zurechnet) sind endemische, unverzichtbare Zutaten der Conditio humana seit wenigstens dem — nur schwer genau bestimmbaren — Moment, in dem den Menschen die Optionalität ihres Handelns bewusst geworden ist; genauer gesagt: in dem sie begriffen haben, dass ihre Lebensführung ihrer Entscheidungsfreiheit unterliegt, und dass die hier und jetzt existierende Welt (dank unserer naturgegebenen Vorstellungskraft) immer nur eine von unzähligen möglichen Welten ist — und zwar in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Im Staffellauf der Weltgeschichte hat die »globale Nostalgie-Epidemie« den Stab vom (langsam, aber un12aufhaltsam globalisierten) »Fortschrittsrausch« übernommen.
Das Rennen selbst geht jedoch weiter, ohne Pause. Die Laufrichtung mag sich ändern oder sogar die Rennbahn — anhalten wird es nie. Den ebenso unauslöschlichen wie unersättlichen inneren Imperativ, der uns antreibt und das wahrscheinlich tun wird, bis die Hölle zuzufrieren beginnt, hat Franz Kafka auf eine Formel gebracht:
Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeute. Er wußte nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte: »Wohin reitest du, Herr?« »Ich weiß es nicht«, sagte ich, »nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.« »Du kennst also dein Ziel?« fragte er. »Ja«, antwortete ich, »ich sagte es doch: ›Weg-von-hier‹, das ist mein Ziel.«7
*
Fünfhundert Jahre nachdem Thomas Morus dem jahrtausendealten Menschheitstraum von der Rückkehr ins Paradies beziehungsweise der Errichtung eines Himmels auf Erden den Namen »Utopia« gegeben hat, nähert sich eine Hegel'sche Triade doppelter Negation der Vollendung. Nachdem die seit Morus stets an einen festen topos — einen konkreten Ort, eine Polis oder Stadt, einen souveränen Staat unter einem weisen und wohlwollenden Herrscher — geknüpfte Aussicht auf ein diesseitiges Glück von jedem bestimmbaren topos abgelöst und damit negiert worden ist, damit sie individualisiert, privatisiert und personalisiert (und nach dem Prinzip der »Subsidiarität« auf 13den Einzelnen in seinem Schneckenhaus übertragen) werden konnte, geht sie jetzt durch eine weitere Negation eine Synthese mit dem ein, was sie ihrerseits lange Zeit tapfer, aber erfolglos zu negieren versuchte. Dieser doppelten Negation klassischer, an Morus orientierter Utopien — ihre Zurückweisung, gefolgt von ihrer Wiederbelebung — entspringen die zahlreichen gegenwärtigen »Retrotopien«: Visionen, die sich anders als ihre Vorläufer nicht mehr aus einer noch ausstehenden und deshalb inexistenten Zukunft speisen, sondern aus der verlorenen/geraubten/verwaisten, jedenfalls untoten Vergangenheit:
Oscar Wilde erklärte, sobald wir das Land des Überflusses erreicht hätten, müssten wir unseren Blick auf den Horizont richten und erneut die Segel setzen: »Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien.« Aber der Horizont bleibt leer. Das Land des Überflusses ist in Nebel gehüllt. Just in dem Moment, in dem wir uns der historischen Aufgabe hätten stellen sollen, diese reiche, sichere und gesunde Welt mit Sinn zu erfüllen, beerdigten wir stattdessen die Utopie. Und wir haben keinen neuen Traum, durch den wir sie ersetzen könnten, weil wir uns keine bessere Welt als die vorstellen können, in der wir heute leben. Tatsächlich glauben die meisten Menschen in den reichen Ländern, daß es ihren Kindern schlechter gehen wird als ihnen.
Das konstatiert der Historiker Rutger Bregman in seinem Buch Utopien für Realisten (dessen Untertitel Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen lautet).8
Die Privatisierung beziehungsweise Individualisierung der Idee des »Fortschritts« und des Strebens nach einem besseren Leben wurden von den herrschenden Mächten als Befreiung verkauft und von den meisten ihrer Unter14gebenen als solche begrüßt: die Entlassung aus den strengen Anforderungen der Unterordnung und Disziplinierung — auf Kosten der sozialstaatlichen Absicherung. Für eine große und nach wie vor wachsende Anzahl der »Untertanen« hat sich diese »Befreiung« langsam, aber stetig als überaus zweifelhafter Segen erwiesen, der immer mehr Beimischungen eines Fluchs enthält. An die Stelle der Gängelung durch staatliche Einschränkungen sind die ebenso erniedrigenden, furchteinflößenden und belastenden Risiken getreten, die die von oben dekretierte Eigenverantwortlichkeit unvermeidlich mit sich bringt. Die Furcht vor Ausschluss/Bestrafung, die ihr unmittelbarer Vorgänger, der Konformitätsdruck, erzeugte, wurde von der gleichermaßen quälenden Angst abgelöst, sich als unfähig zu erweisen. Als die alten Ängste in Vergessenheit geraten waren und die neuen an Ausmaß und Intensität gewannen, stellte sich heraus, dass Förderung durch Degradierung, Fortschritt durch Rückschritt abgelöst worden war — zumindest für eine wachsende Zahl hilfloser Opfer der politischen Ränke, die — zumindest aus ihrer eigenen Sicht — zum Scheitern verdammt waren. Daraufhin kam es zu einer Kehrtwende der öffentlichen Meinung und der Mentalität: Statt in eine ungewisse und allzu offensichtlich nicht vertrauenswürdige Zukunft investierte man alle Hoffnungen auf gesellschaftliche Verbesserungen nunmehr in ein halbvergessenes Gestern, an dem man vor allem dessen vermeintliche Stabilität und folglich Vertrauenswürdigkeit schätzenswert fand. Durch diese Kehrtwende wird die Zukunft, vormals natürliches Habitat der Hoffnung und berechtigter Erwartungen, zum Schreckensszenario drohender Alpträume: vom Ver15lust des Arbeitsplatzes und der an ihn geknüpften sozialen Stellung, von der Pfändung des auf Kredit erworbenen Eigenheims mitsamt allen Möbeln und sonstigen Gütern, von der Ohnmacht angesichts des sozialen Abstiegs der eigenen Kinder und des rapide sinkenden Marktwerts der eigenen mühsam erlernten und erweiterten Qualifikationen. Die Straße nach Morgen wird zum düsteren Pfad des Niedergangs und Verfalls. Vielleicht erweist sich da der Weg zurück, ins Gestern, als Möglichkeit, die Trümmer zu vermeiden, die die Zukunft jedes Mal angehäuft hat, sobald sie zur Gegenwart wurde?
Die Folgen dieses Umschwungs werden, wie ich in diesem Buch zu zeigen versuche, auf allen Ebenen des sozialen Zusammenlebens sicht- und spürbar — in der aus ihnen erwachsenden Weltanschauung wie in den Lebensstrategien, die aus ebendieser Weltanschauung entspringen. Daher lässt sich die Diagnose, die der ehemalige Generalsekretär der Nato und des Rates der Europäischen Union Javier Solana im April 2016 in Bezug auf die Folgen der Kehrtwende ins Gestern auf EU-Ebene (dem avantgardistischen Experiment zur supranationalen Erweiterung nationalstaatlicher Integration) stellte, mit geringfügigen Anpassungen auf alle anderen Ebenen übertragen.9 Mögen sich die Begrifflichkeiten auch unterscheiden, die Geschichte ist immer wieder dieselbe.
»Die Europäische Union«, so Solana, »leidet an einem gefährlichen Fall von Nostalgie. Die Sehnsucht nach der ›guten alten Zeit‹ — vor dem vermeintlichen Eingriff der EU in die nationale Souveränität ihrer Mitgliedsländer — führt nicht nur zum Aufstieg nationalistischer Parteien, sondern auch dazu, dass die führenden Politiker ihre Ver16suche fortsetzen, den Problemen von heute mit den Lösungen von gestern beizukommen.« Solana erklärte auch, wie es dazu gekommen ist, und verwies auf die ebenso drastischen wie allgemein bekannten Entwicklungen der letzten Zeit:
Vor der globalen Finanzkrise von 2008 kämpften die wirtschaftsschwachen EU-Staaten mit himmelhoher Arbeitslosigkeit, vor allem unter jungen Menschen, während sich die wirtschaftsstarken Länder gedrängt sahen, »Solidarität zu üben« und den in Finanznot geratenen Mitgliedern der Union aus der Klemme zu helfen. Als die wirtschaftsstarken Staaten die benötigten Mittel bereitstellten, verknüpften sie dies mit Forderungen nach einer Austeritätspolitik, die die wirtschaftliche Erholung in den Empfängerländern behinderte. Viele empörten sich darüber und wiesen der europäischen Integration die Schuld zu.
Solana warnte davor, diese Schuldzuweisung für bare Münze zu nehmen. Das wäre ein fataler Fehler, der uns vom einzig möglichen, gerechten und hoffnungsvollen Weg zur Sanierung der Finanzprobleme abzubringen drohe:
Während die ökonomischen Nöte, unter denen viele Europäer leiden, zweifellos real sind, ist die von den Nationalisten angebotene Diagnose ihrer Ursachen falsch. Den Umgang der EU mit der Krise mag man kritisieren, aber man kann sie nicht für die weltweiten ökonomischen Ungleichgewichte verantwortlich machen, aus denen sich die wirtschaftlichen Konflikte seit 2008 speisen. Diese Ungleichgewichte gehen auf ein weitaus umfassenderes Phänomen zurück: die Globalisierung. Manche benutzen die Enttäuschungen der Globalisierung als Vorwand für die Forderung nach einer Rückkehr zum Protektionismus und in die vermeintlich glückliche Zeit der nationalen Abschottung. Andere wünschen sich sehnsüchtig einen Nationalstaat zurück, der so nie existiert hat, und führen die nationale Souveränität als Argument gegen jede weitere europäische Integration an. Beide Gruppen stellen die Grundlagen des europäischen 17Projekts in Frage. Aber ihre Erinnerung trügt sie, und ihre Sehnsüchte lassen sie in die Irre gehen.
*
Was ich hier »Retrotopia« nenne, geht aus der erwähnten Negation der utopischen Negation hervor und hat mit Thomas Morus' Vermächtnis die Fixiertheit auf die territoriale Souveränität eines topos gemein: auf einen festen Boden, der ein Mindestmaß an Stabilität und infolgedessen Selbstvergewisserung liefern und idealerweise garantieren soll. Allerdings unterscheidet es sich von diesem Vermächtnis darin, dass es die Beiträge/Berichtigungen seines unmittelbaren Vorläufers billigt, absorbiert und übernimmt, und zwar, indem es die Vorstellung einer »endgültigen Vollkommenheit« durch die Annahme der prinzipiellen Nicht-Abschließbarkeit und endemischen Dynamik der von ihm beförderten Ordnung ersetzt, die damit eine unendliche Abfolge weiterer Veränderungen ermöglicht (und wünschenswert erscheinen lässt), die die erstere Vorstellung a priori delegitimiert und ausschließt. Getreu dem utopischen Geist bezieht die Retrotopie ihren Reiz aus der Hoffnung auf eine endgültige Versöhnung von Freiheit und Sicherheit: ein unmögliches Kunststück, das sowohl die Originalversion wie auch deren erste Negation nicht zu versuchen wagten — oder an dem sie scheiterten.
An dieser kurzen Skizze der wichtigsten Umschwünge in der fünfhundertjährigen Historie moderner Utopien seit Morus werde ich mich im Folgenden orientieren, um die zentralen »Zurück zu«-Tendenzen der gegenwärtigen Phase dieser Geschichte zu untersuchen — darunter insbe18sondere die Rehabilitation des tribalen Gemeinschaftsmodells, den Rückgriff auf das Bild einer ursprünglichen/unverdorbenen »nationalen Identität«, deren Schicksal durch nichtkulturelle Faktoren und solche, die Kultur gegenüber immun sind, vorherbestimmt sei, und ganz allgemein die derzeit in den Gesellschaftswissenschaften wie in der öffentlichen Meinung populäre Ansicht, es gebe wesensmäßige, nicht verhandelbare sine qua non-Voraussetzungen »zivilisatorischer Ordnung«.
Selbstverständlich bedeuten diese drei Rückschritte noch keine geradlinige Rückkehr zu einer früher praktizierten Lebensweise — zumal diese, wie Ernest Gellner überzeugend dargelegt hat, ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Vielmehr handelt es sich (mit Jacques Derrida gesprochen) um bewusste Versuche einer Iteration — anstatt einer Reiteration — des Status quo ante, der vor der zweiten Negation (und sei es illusionär) bestand — schließlich wurde das Bild von diesem Status quo ante im Prozess einer selektiven Gedächtnisbildung, die auch selektives Vergessen umfasst, signifikant modifiziert. Auf dieselbe Weise dienen auch genuine oder putative Aspekte der Vergangenheit, die angeblich erprobt sind und nur irrtümlich aufgegeben oder unbedacht dem Verfall überlassen wurden, als Hauptorientierung/Bezugspunkte für die Roadmap nach Retrotopia.
Um den retrotopischen Flirt mit der Vergangenheit im richtigen Licht zu sehen, ist ein weiterer Vorbehalt nötig. Boym zufolge treten Nostalgie-Epidemien »häufig nach Revolutionen auf«. Im Fall der Französischen Revolution von 1789 »brachte nicht nur das Ancien Régime die Revolution hervor, sondern in mancher Hinsicht auch die Re19volution das Ancien Régime, indem sie ihm eine Form, einen Abschluss und eine güldene Aura verlieh«, wie auch die letzten sowjetischen Dekaden seit dem Ende des Kommunismus »einer Mehrheit in Russland bis heute […] als goldenes Zeitalter der Stabilität, Stärke und ›Normalität‹« erscheinen.10 Mit anderen Worten: Wenn wir in nostalgischen Träumen schwelgen, kehren wir in aller Regel nicht »zurück« in die Vergangenheit »als solche« — in jenes »wie es eigentlich gewesen«, das Leopold von Ranke den Historikern als Maßstab ihrer Darstellungen anempfahl (ein Rat, den nicht wenige von ihnen zu befolgen versuchten, obgleich mit geringem Erfolg). E. H. Carr hingegen versichert in seinem einflussreichen Buch Was ist Geschichte?, der Historiker müsse notwendig selektiv vorgehen:
Der Glaube an einen festen Kern historischer Fakten, die objektiv und unabhängig von der Interpretation des Historikers bestehen, ist ein lächerlicher, aber nur schwer zu beseitigender Trugschluß. […] Die Tatsachen sprechen für sich selbst, pflegte man zu sagen. Aber das stimmt natürlich nicht. Die Tatsachen sprechen nur, wenn der Historiker sich an sie wendet: er nämlich entscheidet, welchen Fakten Raum gegeben werden soll und in welcher Abfolge oder in welchem Zusammenhang.11
Carrs Argument richtet sich an seine Kollegen, professionelle Historiker, denen er die ernsthafte Absicht unterstellt, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit aufzuspüren und zu vermitteln. Als die ersten Exemplare seines Buches im Jahr 1961 in die Regale wanderten, war »Erinnerungspolitik« — ein Codename für die Praxis der willkürlichen Auswahl und/oder Unterschlagung von Tatsachen zu (gerade auch: partei-) politischen Zwecken — noch nicht der bekannte Begriff be20ziehungsweise das offene Geheimnis, das sie heute, nicht zuletzt dank George Orwells schauerlicher Darstellung des regelmäßigen »Updatings« historischer Quellen gemäß der neuesten Ausrichtung der Staatspolitik durch ein »Wahrheitsministerium«, ist. Welchen Weg die professionellen Sucher nach historischer Wahrheit auch immer einschlagen, und wie sehr sie auch versuchen, der Wahrheit treu zu bleiben — ihre Feststellungen sind nicht die einzigen Aussagen, die die Öffentlichkeit erreichen. Sie sind nicht einmal unbedingt die hörbarsten oder reichweitenstärksten — während gerade ihre ressourcenreichsten Konkurrenten und deren skrupellose Manager dazu neigen, bei der Unterscheidung zwischen richtigen und falschen Narrationen pragmatische Nützlichkeitserwägungen als oberstes Kriterium über die Wahrheit in der Sache zu stellen.
Manches spricht für die Annahme, dass die Entstehung des Internets das Ende der Wahrheitsministerien bedeutet (gleichwohl aber keineswegs das der »Erinnerungspolitik«; im Zweifel erweitert das World Wide Web deren Möglichkeiten eher noch, indem es ihre Instrumente leichter zugänglich macht denn je und ihre Wirkung potentiell intensiviert — allerdings ohne sie zu verstetigen). Dennoch macht die Abschaffung der Wahrheitsministerien (und des unangefochtenen Monopols der Herrschenden auf die Wahrheit) es den Botschaften der professionellen Sucher und Artikulatoren der »nachweisbaren Wahrheit« keineswegs leichter, ans öffentliche Bewusstsein zu dringen. Ihr Weg ist womöglich noch hindernisreicher, gewundener, gefährlicher und abschüssiger als zuvor.
21*
Nachdem die Kluft zwischen Macht und Politik — zwischen der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und der, sie umzusetzen, die einst gemeinsam beim souveränen Territorialstaat lagen — immer größer wurde, erschien die Idee, das Glück der Menschen durch Entwurf und Aufbau einer besser an ihre Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte angepassten Gesellschaftsordnung zu befördern, zunehmend als nebulös, da man weit und breit keine Instanz ausmachen zu können glaubte, deren Handlungsfähigkeit der Grandiosität und Komplexität der Aufgabe gewachsen sei. Der Wirtschaftswissenschaftler Peter Drucker konstatierte (womöglich inspiriert von Margaret Thatchers berühmter TINA-Maxime: »There is no alternative«) unverblümt, eine Gesellschaft, die die individuelle mit der sozialen Vervollkommnung auf Dauer verknüpfe, sei schlicht nicht denkbar. Von der »Gesellschaftsordnung« sei daher keine »Rettung« zu erwarten.12 Und daraus folgte, wie Ulrich Beck bald danach feststellte, dass es von nun an dem Einzelnen überlassen war, »seine persönlichen« Lösungen für die von der Gesellschaft hervorgebrachten Probleme zu finden oder zu konstruieren — auf der Grundlage seines Verstands und seiner individuellen Ressourcen und Fähigkeiten. Ziel war nun nicht mehr eine Verbesserung der Gesellschaft (die in jeder praktischen Hinsicht ausgeschlossen erschien), sondern die Verbesserung der eigenen Stellung innerhalb dieser wesensmäßig und endgültig unverbesserlichen Gesellschaft. Anstelle gemeinsamer Erträge aus kollektiven Bemühungen um soziale Reformen gab es 22nur noch den individuell angeeigneten Wettbewerbsgewinn.
*
In den folgenden Kapiteln werde ich den Versuch unternehmen, ein vorläufiges Inventar der besonders spektakulären und grundlegenden Umschwünge und Kehrtwenden zu erstellen, die mit dem Aufkommen retrotopischer Regungen und Praktiken einhergehen.
231. Zurück zu Hobbes?
Auf die Idee, dass die Rückkehr zu Hobbes ein Merkmal unserer Zeit ist, muss man kommen, wenn man die zuletzt rasch an Zahl zunehmenden Prognosen betrachtet (von denen manche als Diagnosen daherkommen beziehungsweise sich tarnen), die die Zukunft nach Art von Prophezeiungen aus den neuesten und verbreitetsten Schlagzeilen ableiten. Vom Staat, Hobbes' Leviathan, glaubte man noch vor gar nicht langer Zeit, er erfülle die ihm auferlegte Mission ordnungsgemäß, die dem Menschen angeblich angeborene Grausamkeit zu unterdrücken, damit unser Leben in der Gemeinschaft mit anderen nicht »scheußlich, tierisch und kurz« sei — doch jetzt traut man ihm immer weniger zu, diese Aufgabe zu erledigen oder dazu überhaupt nur in der Lage zu sein. Die endemische menschliche Aggressivität, die immer wieder in Gewalttaten resultiert, scheint alles andere als abgemildert, geschweige denn ausgerottet zu sein; sie erfreut sich bester Gesundheit und ist stets bereit, auf den kleinsten Anlass hin auszubrechen — oder gern auch ohne Anlass.
Der »Zivilisationsprozess«, den der moderne Staat planen, durchführen und überwachen sollte, erscheint zunehmend so, wie ihn Norbert Elias (ob ungewollt oder bewusst) porträtierte: als eine Reform der Sitten — nicht aber der Fähigkeiten, Prädispositionen und Impulse. Akte menschlicher Gewalt wurden durch ihn lediglich aus dem Blickfeld, nicht jedoch aus der menschlichen Natur entfernt. Man hat sie nur an Profis, Berufsgewalttäter sozusa24gen, »outgesourct« beziehungsweise an »niedrige, unreine« Menschen — Sklaven, Knechte oder Dienstpersonal: Sündenböcke, denen man die schändlichen Taten ungezähmter Aggression aufbürdet — »subsidiarisiert«: eine Maßnahme ähnlich der, die man viele Jahrhunderte zuvor in Indien das Kastensystem bewerkstelligen ließ, mit dem die für »unrein«, erniedrigend oder »schmutzig« gehaltenen Arbeiten (Schlachtung, Abfallentsorgung, Beseitigung von Tierkadavern und so weiter) an die »Unberührbaren« delegiert wurden — die sogenannten »Panchama«, Angehörige einer fünften Kaste, die ohne Rückkehrrecht außerhalb (lies: »unterhalb«) des Kastensystems standen, also in einem sozialen Vakuum, ohne Bindung an die Moral/Verhaltensregeln, die innerhalb des eigentlichen Systems (der vier Kasten umfassenden »Varna«, der die Hauptmasse der indischen Gesellschaft zugerechnet wurde) galten und weitgehend eingehalten wurden — genau wie ihre jüngere Reinkarnation, die »Unterklasse«, außerhalb des Klassensystems und damit der Gesellschaft steht. Die zivilisierende Funktion des »Zivilisationsprozesses« bestand darin, Schluss zu machen mit öffentlichen Hinrichtungen, Prangern und Galgen an öffentlichen Plätzen; zugleich aber auch darin, die odiöse Tätigkeit des Zerteilens bluttriefender Tierkadaver aus den Esszimmern in die Küchen zu verlagern, in die sich die Teilnehmer der Mahlzeit nur höchst selten verirrten; und drittens auch darin, die Beherrschung der Natur und die vermeintliche moralische Überlegenheit über Flora und Fauna etwa im jährlichen Ritual der Fuchsjagd zu zelebrieren. Erving Goffman würde dieser Aufzählung »zivilisierender« Tätigkeiten noch die »zivile Unaufmerksamkeit« hinzufü25gen — die Kunst, den Blick abzuwenden, wenn ein Fremder auf dem Gehsteig, im Bus oder im Wartezimmer des Zahnarztes erscheint —, worin sich die Absicht ausdrückt, sich jeder Anteilnahme oder gar Einmischung zu enthalten, um zu verhindern, dass aus der Interaktion einander unbekannter Akteure unangemessene, nicht mehr kontrollierbare Impulse entstehen, die zu einer peinlichen Enthüllung des »Tiers im Menschen« führen, das unter Verschluss gehalten, eingesperrt und der Sicht entzogen werden muss.
Dank dieser und ähnlicher Tricks und Ausflüchte überstand das Hobbes'sche Tier im Menschen die moderne Sittenreform unbeschadet und intakt, in seiner ursprünglichen und potenten, kruden, ungehobelten, flegel- und rüpelhaften Form, die der Zivilisationsprozess zwar zu übertünchen und/oder (wie bei der Verschiebung aggressiven Handelns vom Schlachtfeld ins Fußballstadion) »outzusourcen«, die er aber nicht zu zähmen, geschweige denn auszutreiben vermochte. Das Tier in uns liegt auf der Lauer, bereit, unter der erschreckend dünnen Tünche konventionellen Anstands hervorzubrechen — deren Zweck es lediglich ist, das Unansehnliche zu verbergen, und weniger, das Sinistre und Blutrünstige zu unterdrücken und wegzuschließen.
Timothy Snyder kommt aufgrund seiner Auseinandersetzung mit der grausigen und unheilvollen Erfahrung des Holocaust (und insbesondere mit der Tatsache, dass so viele Menschen am Bösen mitwirkten, während nur sehr wenige ihrem »moralischen Instinkt« folgten und das »Gute im Menschen« dokumentierten) zu folgender Überlegung:
26
Vielleicht stellen wir uns […] vor, inmitten irgendeiner künftigen Katastrophe würden wir auf Seiten der Retter sein. Doch wenn Staaten zerstört, lokale Institutionen korrumpiert und Marktanreize auf Mord ausgerichtet wären, würden sich nur wenige von uns anständig verhalten. Wir haben wenig Grund zu der Annahme, dass wir den Europäern der 1930er und 1940er Jahre moralisch überlegen oder weniger anfällig für Ideologien sind, wie Hitler sie so erfolgreich propagierte und umsetzte.1
Was wir zu unserer eigenen Beruhigung für eine (wenigstens der Absicht, wenn auch nicht der messbaren Wirkung nach) Aufgabe des Social Engineering gehalten haben: die endgültige Ausmerzung und Verbannung des Mr. Hyde aus Dr. Jekylls Innerem, erscheint nun immer mehr wie ein an Dorian Grays stete Verjüngung gemahnendes Unterfangen der plastischen Chirurgie, das dem Schein Vorrang vor dem Sein verschaffen soll. Im wirklichen Leben müssen kosmetische Eingriffe zumeist regelmäßig wiederholt werden, da ihre Wirkung gewöhnlich von kurzer Dauer ist. Allmählich fangen wir an zu begreifen, dass wir uns, anstatt die ultimative und final siegreiche Schlacht zwischen Anstand/Höflichkeit/Distanz und Gewalt zu schlagen, zur Abwehr der letzteren auf eine unendliche Abfolge »proaktiver« Gegenmaßnahmen einzurichten haben. Es hat ganz den Anschein, als wollten wir uns mit einem kontinuierlichen und niemals abzuschließenden Ermüdungskampf zwischen »guter« (gemäß der jeweils gültigen Fassung von »Recht und Ordnung« ausgeübter) und »böser« (deren Untergrabung betreibender) Gewalt zufriedengeben — wobei das »Böse« letzterer nicht zuletzt darin liegt, dass sie die Verfechter der »guten Gewalt« der hinterhältigen Verlockung aussetzt, ihre Strategien und 27Mittel zu übernehmen. Wir werden die Idee einer gewaltfreien Welt wohl unter die schönsten — und, leider, leider zugleich unerreichbarsten — Utopien einordnen müssen.
Wie lässt sich dieser unerwartete (aber darum nicht weniger radikale und folgenreiche) Wandel unseres Verhältnisses zur Gewalt erklären? Der Auslöser könnte die eruptionsartige Zunahme von Bildern der Gewalt sein, die uns die ubiquitären Medien unermüdlich vor Augen führen — getreu der Maxime des Medien-Tycoons William Randolph Hearst, dass »aufmerksamkeitsstarke« Nachrichten »wie Kaffee serviert werden müssen — frisch aufgebrüht und kochend heiß«, auf eine Weise also, die uns buchstäblich zwingt, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Und könnte wiederum dieser Ausbruch außerordentlich greifbarer Gewaltbilder als Folge des Brüchig- und Durchlässigwerdens einst als unüberwindbar gedachter Grenzen erklärt werden — die von den steigenden Wassern der fortlaufenden Globalisierung unterspült werden?
Vielleicht lässt sich dieser Wandel im Denken auch damit erklären, dass die Staaten neuerdings, wenn auch nicht in der Theorie, so doch in der Praxis, ihren einstigen Anspruch auf ein Gewaltmonopol aufgegeben haben. Womöglich ist auch das einst nur sorgfältig ausgesuchten und eindeutig bestimmten Akteuren zuerkannte Recht, die Grenze zwischen legitimer (der Wahrung der Ordnung dienender) und illegitimer (diese Ordnung störender oder untergrabender) Gewalt zu ziehen, auf die unaufhaltsam wachsende Liste »wesensmäßig umstrittener Begriffe« (essentially contested concepts im Sinne Alfred North Whiteheads) gewandert — und gilt nun als etwas, das immer umstritten sein wird. Um nochmal an Timothy Sny28ders Begriffsrahmen anzuknüpfen: Die Staaten der Gegenwart befinden sich irgendwo auf einer Achse zwischen Max Webers Idealtypus des über ein Gewaltmonopol verfügenden Staates und Snyders failed state, dem scheiternden, versagenden oder zerfallenden Staat — beziehungsweise, was in der Praxis auf das Gleiche hinausläuft, einem »staatenlosen Territorium«.
*
Das Recht, die Grenze zwischen legitimer und illegitimer, erlaubter und verbotener, legaler und krimineller, tolerierbarer und intolerierbarer Gewalt zu ziehen (und nötigenfalls neu zu ziehen), ist das, worum es in Machtkämpfen in erster Linie geht. Schließlich besitzt, wer über dieses Recht verfügt, das entscheidende Attribut der Macht (während die Fähigkeit, es für andere bindend auszuüben, ein grundlegendes Merkmal von Herrschaft ist). Etablierung und Ausübung dieses Rechts galten seit Hobbes' Leviathan als Domäne der Politik — als Vorrecht und Aufgabe des Staatsapparats, der den politischen Körper repräsentiert. Diese Auffassung ist in jüngerer Zeit von Max Weber (der den Staat anhand seines Monopols auf die Mittel — und damit naheliegenderweise auch den Gebrauch — von Gewalt definierte) umfassend begründet und emphatisch bekräftigt worden und hat in den Gesellschafts- und Politikwissenschaften nahezu kanonischen Rang angenommen. Obgleich Leo Strauss, als er zu Beginn der flüchtigen Moderne die historistische Sicht auf die Conditio humana diskutierte, hellsichtig mahnte:
29