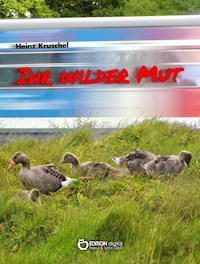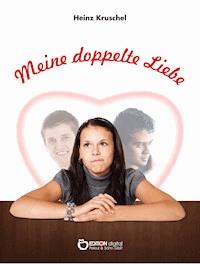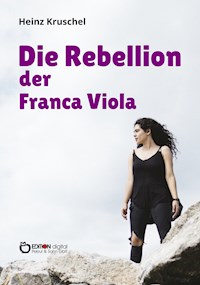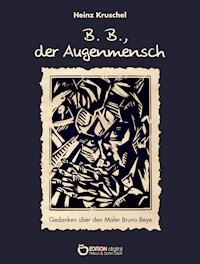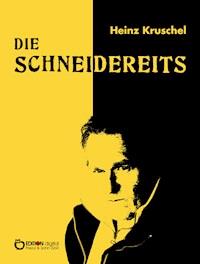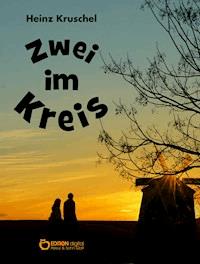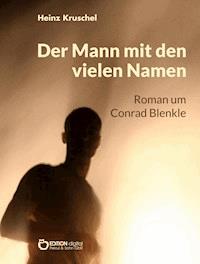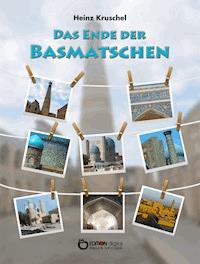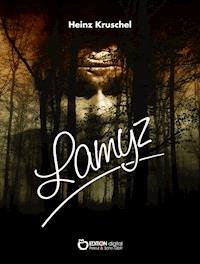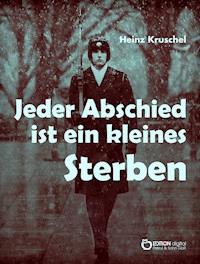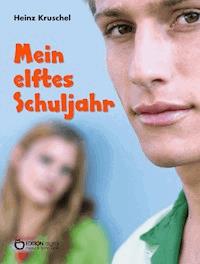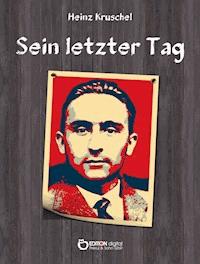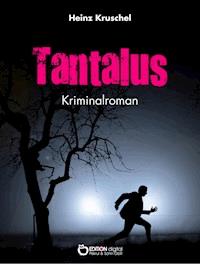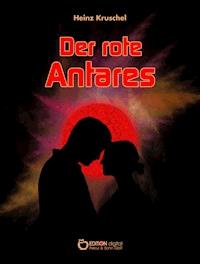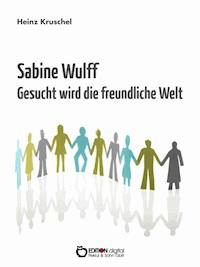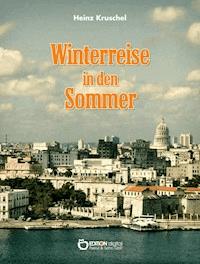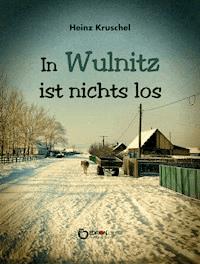7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das ist eine Liebesgeschichte. Sie spielt auf dem Lande. Und sie spielt zu einer Zeit, als es auf dem Lande noch Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften gab, kurz LPG – oder wie der eine oder andere im Osten nach sowjetischen Vorbild auch zu sagen pflegte: Kolchosen … In einer dieser LPG gab es zwei Buchhalterinnen. Deren zweite war die zu Beginn der Handlung gerade mal neunzehnjährige Ille. Also eigentlich heißt sie Ilse. Und so stellt sich die junge blonde Frau selber vor: Ich heiße Ilse Pohlmann und arbeite als zweite Buchhalterin in der Genossenschaft Freier Bauer. Ich sehe nicht schlecht aus, na schön, ich habe ein bisschen dicke Beine, darum trage ich keine Mini-Röcke. Und mein Hals ist etwas kurz geraten, darum liebe ich ausgeschnittene Kleider. In zwei Jahren werde ich einundzwanzig, das betone ich mit einer gewissen Hoffnung, es heißt doch, dass sich der Mensch alle sieben Jahre erneuere, nicht komplett natürlich, aber das Wesen eines Menschen immerhin. Meine Mutter meint zwar, ich solle meine Hoffnungen nicht so hoch schrauben, sonst würde ich eines Tages noch mit siebzig Jahren an eine Runderneuerung glauben. Ich verstehe mich gut mit meiner Mutter, weil ich mit ihr über alles reden kann. Sie ist Milchprüferin, leitet den Dorfklub, und die Bauern sagen: „Se daut dauernd wat!“ Mutter braucht immer Bewegung, und die Leute unseres Dorfes brauchen sie. Vater ist nicht mehr da. Er lebt im Westen, irgendwo, mit einer fremden Frau. Ich denke nicht an ihn, ich war noch so klein, als er davonlief. Das komplette Gegenteil von Davonlaufen ist Hinkommen. Tatsächlich kommt ein junger Mann ins Dorf – und das hat Folgen für Ille. Allerdings ist das anfangs noch nicht absehbar – außer vielleicht im Schreibplan des Autors. Jedenfalls passiert Folgendes: Neulich war ein junger Mann bei uns im Dorf, ein angehender Journalist, der eine Arbeit über die Kooperation schreiben will. Fritz Schönemann, unser Vorsitzender, hatte mal wieder keine Zeit für die Presse und überließ den Mann mir. Ich habe bisher jeden Zeitungsvertreter geschafft, ich kann gut erzählen. Schönemann wollte keinen Ärger mit der Zeitung. Organisiere gefälligst einwandfreie Artikel, verlangte er von mir. So haben manche Liebesgeschichten auf dem Lande angefangen, als es dort noch LPGs gab und LPG-Vorsitzende und Leute, die von der Presse dachten, dass man der schon beibringen könne, wie einwandfreie Artikel auszusehen haben. Da mag der Journalist K. den Schriftsteller K. beraten haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Heinz Kruschel
Rette mich, wer kann
ISBN 978-3-95655-140-6 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1976 im Militärverlag der DDR, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
... Zu zweien nur kann sich das Tier erheben;
Im Singular bleibt es am Boden kleben.
Dem Pihi gleich, gekettet an das Nest
Ist meine Seele, wenn du mich verlässt.
Mascha Kalèko
1. Kapitel
Ich heiße Ilse Pohlmann und arbeite als zweite Buchhalterin in der Genossenschaft Freier Bauer. Ich sehe nicht schlecht aus, na schön, ich habe ein bisschen dicke Beine, darum trage ich keine Mini-Röcke. Und mein Hals ist etwas kurz geraten, darum liebe ich ausgeschnittene Kleider. In zwei Jahren werde ich einundzwanzig, das betone ich mit einer gewissen Hoffnung, es heißt doch, dass sich der Mensch alle sieben Jahre erneuere, nicht komplett natürlich, aber das Wesen eines Menschen immerhin.
Meine Mutter meint zwar, ich solle meine Hoffnungen nicht so hoch schrauben, sonst würde ich eines Tages noch mit siebzig Jahren an eine Runderneuerung glauben.
Ich verstehe mich gut mit meiner Mutter, weil ich mit ihr über alles reden kann. Sie ist Milchprüferin, leitet den Dorfklub, und die Bauern sagen: »Se daut dauernd wat!« Mutter braucht immer Bewegung, und die Leute unseres Dorfes brauchen sie.
Vater ist nicht mehr da. Er lebt im Westen, irgendwo, mit einer fremden Frau. Ich denke nicht an ihn, ich war noch so klein, als er davonlief.
Neulich war ein junger Mann bei uns im Dorf, ein angehender Journalist, der eine Arbeit über die Kooperation schreiben will. Fritz Schönemann, unser Vorsitzender, hatte mal wieder keine Zeit für die Presse und überließ den Mann mir. Ich habe bisher jeden Zeitungsvertreter geschafft, ich kann gut erzählen. Schönemann wollte keinen Ärger mit der Zeitung. Organisiere gefälligst einwandfreie Artikel, verlangte er von mir.
Dieser Praktikant wirkte zuerst ein bisschen affig, Goldrandbrille, Diplomatenkoffer, Kassettenrekorder in schicker Umhängetasche und so, aber er redete nicht geschwollen, fragte nicht etwa, wo denn der Vorsitzende sei, sondern erkundigte sich nach meiner Freizeitgestaltung. So ein Dorf, von der Stadt ein schönes Ende entfernt, gibt es da ein Jugendleben, was macht man nach Feierabend, können Sie mir darüber etwas erzählen?
Heute weiß ich natürlich, dass diese Frage mit seinem Reportageauftrag gar nichts zu tun hatte.
»Kann ich«, sagte ich, »ich lerne Englisch aus Betriebsgründen. Zu uns kommen oft ausländische Delegationen, und die Dolmetscher, die da mitgeschickt werden, verstehen nichts von der Landwirtschaft. Dann lese ich gern, Geschichten über uns, gehe ins Kino, paddle im Sommer mit der Luftmatratze und fahre samstags in die Stadt, um das Theater zu besuchen.«
»Und hem ... mal zum Tanz?«, fragte er.
So geht’s los, dachte ich, sei auf der Hut, der geht ran, das ist eine typische Fangfrage. »Mal«, sagte ich.
»Und ein Freund?«, fragte er und zwinkerte mit den Augen.
Ich holte Luft. »Kollege Praktikant«, sagte ich, »dazu bleibt wenig Zeit. Mal schon, aber nicht so häufig.«
Da stellte er sich erst vor. Er hieß Rolf Blume und stammte aus der Bezirkshauptstadt und studierte in Sachsen. Ein stabiler, kräftiger Bursche. Ob er glaubte, was ich ihm erzählte? Es stimmte nämlich nicht. Ich hatte schon eine Menge Freunde, und zum Tanzen gehe ich sehr gern, aber erst seit zwei Jahren.
Früher mochte ich nicht tanzen gehen. Ich habe eine Tanzstunde besucht, da kann einem das Tanzen vergrault werden, Tatsache. Ich war sechzehn Jahre alt und ging in die zehnte Klasse und hatte immer noch wenig Busen, eigentlich gar keinen, so Größe eins. Darum war ich auf die Mädchen neidisch, die eine schöne Brust hatten oder die sich einen schaumgummigepolsterten BH kaufen konnten. Aber dafür gab meine Mutter kein Geld her. »Ich kenne die Frauen in unserer Familie«, sagte sie, »die Ausgabe können wir sparen.« Sie hatte recht, das zeigt sich heute.
Ich war also mickrig und dünn, und groß bin ich auch nicht, und die Jungen rannten alle zu den »duften Bienen«. So blieb immer der Kleinste für mich übrig, der schrecklich verlegen war, auf meine Füße trat und mich an sich presste, als fürchtete er, von den strengen Blicken des ergrauten Tanzlehrers über Bord gespült zu werden.
Dazu kam noch, dass er ein entsetzliches Haaröl benutzte, um seine widerspenstigen Büschel in eine Frisur zu zwängen. Das Haaröl roch nach Kamille. Ich kann Kamille nicht ausstehen, Kamille war früher fast ein Nahrungsmittel der Familie gewesen, auf alle Fälle das Hauptgetränk. Meine Großmutter hatte sie eingeführt, sie lebt heute noch und ist über neunzig Jahre alt. Dank der Kamille, wie sie immer behauptet.
Kamillentee, Kamillendämpfe, ich glaube, sie hat auch schon Kamillengemüse gemacht, und Großvater ist bestimmt nur deshalb so früh gestorben (er war fünfundachtzig), weil er getrocknete Kamille in der Pfeife rauchen musste.
In der Tanzstunde roch ich ständig Kamille. Und während die großen Paare lässig und gekonnt nach den Melodien dieser altmodischen Tänze Tango und Fox voranschlurften, hoppelten wir ihnen nach, verhedderten uns mit den Füßen, und ich immer mit diesem Kleinen, dem ich auf den nassen, kamillenduftenden Scheitel sehen konnte ..., eine Tortur. Ich bin erst wieder tanzen gegangen, als ich siebzehneinhalb war und Mutter nicht mehr nach einem gepolsterten BH zu fragen brauchte.
Aber konnte ich das alles dem Praktikanten Rolf Blume erzählen? Nein. Ich führte ihn durch die Genossenschaft, in den Kälberaufzuchtstall, in den halb fertigen modernen Vierhunderterkomplex, erklärte ihm die Lage der drei Dörfer, die sich zusammengeschlossen hatten, und deutete die Schwierigkeiten an, die es dabei gegeben hatte. »Ach, es gibt ja noch welche«, sagte ich. Warnen wollte ich den Journalisten-Lehrling, er sollte ja keinen Hurra-Artikel über uns schreiben, damit würde er nur Unheil anrichten. Ich kenne doch die Bauern, und wir haben ja auch schon unsere Erfahrungen mit der Presse gemacht.
Vor zwei Jahren hatte sich der Landwirtschaftsrat beim Kreis das ausgedacht: Ihr schafft das Beispiel, ihr müsst die Durchreißer sein, Genossenschaften schließen sich freiwillig zusammen, die anderen folgen. Aber die Bauern waren noch nicht überzeugt davon, jedenfalls konnte diese Kooperation nicht leben und nicht sterben. Nicht sterben konnte sie, weil der Kreis und der Bezirk sie am Leben hielten und künstlich ernähren ließen. Nicht leben konnten sie, weil die Bauern skeptisch waren. Und was man dieser sogenannten Kooperation alles zutraute! Während der Getreideernte beglückte uns der Landwirtschaftsrat mit einem Großeinsatz der Technik, um das »berühmte Beispiel« zu schaffen. Aus berühmt aber wurde rasch berüchtigt. Damals rasselten zehn Mähdrescher durchs Dorf, die sich von mir nicht aufhalten ließen. Und auch nicht von Fritz Schönemann, der wütend mit der Mütze wedelte und mit seinem Holzbein aufstampfte. Die Brummer fraßen auf dem größten Schlag alles ratzekahl, und da wir einen komplexen Einsatz der Technik gar nicht eingeplant hatten, konnte Schönemann so schnell kein Kaffgebläse auftreiben, und die Spreu musste auf den Acker geschüttet werden. Reporter und Fotografen und Kameramänner wimmelten umher, Großeinsatz in der Kooperation, Sozialismus siegt und so, einen Hubschrauber besorgten sie auch noch wegen einer Luftaufnahme.
Im Rat der Kooperation sagte Schönemann damals: »Ich könnte mich ohrfeigen, wir haben bloß an die Bautätigkeit gedacht und an die Spezialisierung, aber nicht an die Feldwirtschaft. Die Feldwirtschaft, Leute! Die Grundlage aller Dinge auf dem Lande!«
Na, und am nächsten Tag erschien auf der Seite eins der Zeitung ein großes Bilderbuchfoto von dem komplexen Einsatz mit entsprechender Bilderbuch-Unterschrift. Andere Zeitungen druckten nach, wir waren Gesprächsthema.
Und dann regnete es, das Kaff lag auf der abgefressenen Fläche und verdarb, die Bauern rissen bittere Witze, einem Bauern tut das weh, es geht ihm an die Ehre.
Also das erzählte ich diesem Blume. Er schien sofort »Konfliktstoff« und »echte Probleme« zu wittern und fragte, ob die Bauern den Schlag ins Wasser gleich überwunden hätten.
»Wo denken Sie hin? Damals war die Kooperation eine Frühgeburt, wir waren noch nicht so weit. Der Schönemann fand eines Tages einen Zettel im Briefkasten, auf dem stand Kumpanie ist Lumperie, wir machen nicht mehr mit, anonym natürlich, aber das sagten sie auch offen.«
»Zweifler gibt es immer«, meinte Blume.
Eine Ahnung hatte der. »Die Kooperation fiel noch vor der Rübenernte auseinander.«
»Und heute?«
»Sehen Sie sich das doch selber an.«
Er sagte, er werde wiederkommen. Und ob ich so freundlich sein würde, ihm alles und rückhaltlos zu erzählen, er wolle einen schönen Artikel schreiben, vielleicht eine ganze Seite für die Unterhaltungsbeilage.
Auch das noch. Ich sagte: »Aber Sie müssen mit den Bauern selber sprechen, ich bin man bloß die Buchhaltung.« Stach mich der Hafer? Ich sollte doch den Mann fernhalten.
Buchhaltung sei sehr wichtig, meinte er und wollte abschwirren, aber da begann ich zu fragen: »Warum wollen Sie ausgerechnet über uns schreiben? Es gibt doch andere, die besser sind.«
»Eine Belegarbeit, ich mache noch zwei Semester«, erklärte er, »das ist wie ein Testat, in dem es um gute Zensuren geht, und je konfliktreicher ein Artikel ist, desto besser für den Praktikanten.«
So war das also. Mit unseren Konflikten holte sich der Mann seine guten Zensuren; ich beschloss, vorsichtig zu sein, sonst würde der mich festnageln. Der schreibt einen Artikel, in dem er alle möglichen Behauptungen aufstellt, und dann lässt er sich nicht wieder blicken. Das kennen wir.
Und nach einer solchen Veröffentlichung reisen die Instrukteure des Kreises an und legen den Finger auf jedes gedruckte Wort, das kritisch ist.
Das haben wir von euch ja noch gar nicht gewusst, so sieht das also in Wirklichkeit aus, ganz anders als in den Berichten, ihr habt also noch was in der Hinterhand, wir müssen das prüfen, überprüfen, durchprüfen. Und die Durchprüfer würden uns von der Arbeit abhalten. Ilse Pohlmann, denk an deinen Auftrag, du musst dafür sorgen, dass der Mann einwandfreie Artikel schreibt, aber auch nicht zu positiv, denn dann kommen die Instrukteure auch und sagen: Ihr könnt ja noch viel mehr, ihr seid ja ein Musterbeispiel, das müssen wir auf einer Aktivtagung auswerten, Schönemann als Redner Nummer eins. Und dieser Schönemann hat Vertrauen zu dir, Ilse Pohlmann, er überlässt den Pressemann dir allein.
Ein sympathischer Junge übrigens. Ob er ein Mädchen hat? Ganz bestimmt, solche Jungen sind meistens in fester Hand. Denkt man mit neunzehn schon an einen Mann fürs Leben? Quatsch, wir haben Vollmond, da kommen einem die ulkigsten Gedanken.
2. Kapitel
Es war merkwürdig: Dieser Rolf ging mir in den nächsten Tagen nicht aus dem Kopf, ich dachte oft an ihn und wusste nicht, warum ich so oft an ihn dachte.
Ich bin gern mit einem Jungen zusammen, ich bin ja nicht unnormal. Ich flirte und küsse auch gern, aber wenn ich merke, dass sie gleich alles von mir wollen, dass sie immer zudringlicher werden, dann werde ich stur, das nicht. Ich will den Mann lieben, mit dem ich das tue. Und nach Möglichkeit, ja nach Möglichkeit soll das mein Mann sein oder werden können. Ist das altmodisch? Meinetwegen, irgendwo ist jeder Mensch ein bisschen altmodisch.
Ich weiß nicht, wie mein Mann sein soll. In den Illustrierten stehen manchmal Umfragen, und die befragten Mädchen stellen Eigenschaften zu einer Liste zusammen. Eigenschaften, die ihre zukünftigen Männer haben sollten. Ich finde das Unsinn. Es gibt ja keine genormten Männer. Gott sei Dank gibt es sie nicht.
Wenn da so ein Mädchen meint: »Mein Mann soll schlank und sparsam, dunkelhaarig und sportlich, höflich und erfolgreich im Beruf sein, er darf nicht trinken und muss seine Familie lieben, er darf kein passionierter Skatspieler sein, muss die Gleichberechtigung anerkennen und ein bisschen kochen und waschen und bohnern können, kinder- und tierlieb sein und auch fortschrittlich«, dann denke ich mir immer, die Illustrierten veröffentlichen das direkt zur Abschreckung für junge Männer, damit sie nicht zu früh heiraten. Aber das ist ein Irrtum, denn das Schlusswort schreibt meistens ein sehr alter Akademiker mit mehreren Titeln und viel Erfahrung. Der kann sich so gut an seine Jugend erinnern, analysiert die gewünschten Eigenschaften und bringt sie erst einmal in eine richtige Reihenfolge: Zuerst muss der Mann natürlich fortschrittlich sein und dann noch kochen, waschen und das übrige tun können.
Ich spotte über die Mädchen, die von einem Idealmann schwärmen und nur an Äußerlichkeiten denken: Groß muss er sein, und schlank muss er sein, und einen Bart muss er tragen, und weiße Zähne muss er haben. Nein, vielen Dank, ich kenne solche Männer. Am Ostseestrand laufen sie zu Hunderten ’rum, bronzegetönt und glänzend wie geputztes Messing, und sie recken sich und strecken sich und wölben den Brustkorb vor und tragen Kreuzchen um den Hals.
Ich habe mal so einen kennengelernt, er war in solchem Verein, wo sie nichts weiter tun, als die Muskelpartien zu hegen und zu pflegen und die Stellen zu markieren, auf denen noch neue Muskeln antrainiert werden sollen.
Als er mich küsste, merkte ich, dass er gar nicht bei der Sache war, sondern auf seinen linken Oberarm schielte, auf dem er die Muskeln tanzen ließ und ihr Spiel beobachtete. Der war schon idiotisch, ich habe mich mit ihm eingelassen, es war meine Schuld.
Einmal und nie wieder einen Kulturistik-Mann. Die sollen sich an die Dewag vermieten, die könnte sie in die Schaufenster stellen und Freizeit-Anzüge an ihnen ausprobieren.
3. Kapitel
Nach drei Tagen kam Rolf Blume wieder ins Dorf. Hätte ich gewusst, dass er an diesem Tage kommt, ich hätte einen Vorwand gefunden, um zum Kreis zu fahren, zur Bauernbank oder zum Landwirtschaftsrat. Als ich ihn über unseren Hof kommen sah, klopfte mein Herz bis zum Halse. Aber ich gab mich »kühl bis ans Herz hinan«.
Dabei war es warm, erst April, aber unsere dickbäuchigen Häuser schwitzten schon, der Regen fehlte in der Börde.
Ich sprach. Er schrieb. Er schrieb viel, denn ich redete viel. »Sie haben die hohen Mauern, die festen Häuser gesehen, große Bauern lebten früher in unserem Dorfe, Bauern, die sagen konnten: ,Up mienen Hof kann ick ok wat dotpietschen.‘ Sie hatten über dreihundert Morgen Land, hockten im Krug und rissen ihre Witze über die Halbspänner und Hufner oder über die armseligen Kotsassen.« Von solchen Dingen weiß ich zu erzählen, meine Vorfahren sind arme Leute gewesen. Im Bruch steht noch das Schloss, jetzt sind Kindergarten und Schule und Bürgermeisterei darin untergebracht, früher musste mein Urgroßvater dort erscheinen, um die Befehle des Herrn entgegenzunehmen.
»Die Kotzes herrschten in dieser Gegend, wissen Sie«, sagte ich.
Die Tür klappte, ein Bauer kam ins Zimmer, nahm die Mütze ab, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war Hannes Trosch, der Schweinemeister.
»Daher der Ausdruck großkotzig«, sagte Rolf.
Hannes hieb die Faust auf den Tisch. Guten Tag, hieß das. »Genau«, sagte er, »zu Hause habe ich einen Küchenzettel aus dem Jahre sechzehnhundertelf, da heiratete eine Kotze einen Kammerherrn, acht Tage lang, und sie verzehrten: einen polnischen Ochsen, fünf Amtsrinder, vier Bratschweine, zehn Spanferkel, achtundzwanzig Kälber, hundertneun Schöpse ...«
Hannes redet komisch, dachte ich, so geschraubt, es klingt, als knöpfe er die Sätze nach links übereinander.
»Schöpse?«, fragte Rolf. »Was ist das?«
Ich feixte. Ein Journalist, der über Landwirtschaft schreibt und keine Schöpse kennt, gibt’s denn das?
»Schafe natürlich. Und weiter: sechzehn Hirsche, fünfzig Hasen, zwei Schock Gänse, sechsundfünfzig Wildenten, Lerchen, Finken, neun Sorten Fisch, Austern, Konfitüre, bi wat is eben wedder wat gewesen ...«
»Alle Wetter«, sagte Rolf. Fiel ihm nichts Besseres ein?
»Als wir den Hungerturm aufbrachen, nach fünfundvierzig, fanden wir noch Skelette von Bauern, keiner kannte mehr ihre Namen. De Doot makt Wunder.«
Rolf schrieb. Dann fragte er: »Und wie ist das nun mit der Kooperation, heute?«
Hannes Trosch, Wettergesicht und harte Hände, sah ihn an und sagte: »Schon gut, beschetten. Frag den Vorsitzenden. Ich muss gehen.« Er knallte die Tür hinter sich zu.
Ich sagte erklärend: »Der Hannes Trosch ist nicht dafür, wir sind als LPG stark gewesen, verstehen Sie, allein stark, und unsere Partner sind, na ja, das gehört wohl nicht hierher ...«
Wie wirkte das auf Blume? Die Zeitungen sind voll von der Notwendigkeit der Kooperation. Bauern, die dagegen waren, konnte er das verdauen?
Er konnte. Ich sagte: »Früher zogen die Bauern dicke Mauern um ihre Häuser, heute möchten manche dicke Mauern um die Genossenschaft ziehen.« Und ich erzählte ihm, wie sich alles entwickelt hatte. Vor zwei Jahren begann es. Erstens mit dem Wunsch der Leute vom Kreis und vom Bezirk, das große Beispiel zu schaffen. Fritze Schönemann unterstützte das, viele wunderten sich darüber, aber wer ärgerte sich zum Beispiel nicht über das verzettelte Bauen in den drei benachbarten Dörfern? Fritze sagte: Jawoll, ich bin für Kooperation. Das war der zweite Grund. Da waren die Bauern empört. Sollen wir die Schwachen aufpäppeln? hieß es. Je größer der Haufen, desto schlechter wird es, und zuletzt verlieren wir noch unsere Selbstständigkeit; suchen wir uns Partner, die mehr leisten, wir sind keine melkende Kuh. Die vom Kreis wollen nivellieren und uns Krampen in die Ohren beißen. »Wenn Sie alle Argumente aufschreiben wollen, reicht der Platz in der Zeitung nicht aus.«
»Aber es kam zu einem Beschluss?«
»Ja, schon.«
»War der Beschluss einstimmig?«
»Klar, fast einstimmig.«
»Also war nicht nur der Schweinemeister dagegen?«
Heilige Einfalt. Das gibt es doch, oder nicht? Auch die Zweifler sagten ja, als so kluge Bauern wie der Schönemann oder der lange Lüddecke von Adorf zum Beispiel dafür waren. »In Lüttjen-Wasserleben«, sagte ich, »brauchten sie vor zwei Jahren noch zweihundertzwanzigtausend Mark Überbrückungskredit. Da sagte Hannes natürlich: ,Mit denen kooperieren wir nun, Mahlzeit, Leute! Da sind Hopfen und Malz verloren!‘«
»Und was sagten Sie dazu?«
Was sollte ich dazu sagen? Ich hatte gerade die Lehrzeit beendet, saß in meiner Buchhaltung wie zwischen Baum und Borke und musste mit allen Bauern auskommen. Wenn sie in meinem Büro saßen, redeten sie sich alles von der Seele, ich war eine Art Blitzableiter, ein Abladeplatz für die täglichen Sorgen. Und so hörte ich mir auch die Zweifler an und dachte: Was sie sagen, hat auch was für sich, zurzeit läuft unsere Produktion gut, warum sollten wir jetzt ein Risiko eingehen?
Aber ich verstand auch den Schönemann. Und meine Mutter. Die sagte: »Begreif doch, Ille. Da soll der Lüddecke-Hans in seiner LPG einen Schafstall bauen, aber er hat für eine große Zucht wenig geeignetes Land und kaum Tradition. Bei uns aber wurden schon vor fünfzig Jahren Schafe gehalten, und wir haben das Bodebruch. Siehst du das nicht ein?«
Natürlich sah ich ein. Natürlich war ich für die Kooperation. Aber ich sagte das nicht laut. Damals nicht. Für wen war ich eigentlich? Für die Zweifler, für die Bejaher, für die Verneiner? Ich wollte mich nicht von einer Gruppe festlegen lassen. Heute sagte ich zu dem Praktikanten Blume: »Nehmen Sie das Bauen. Wir einen Rinderstall, der Lüddecke einen und in Lüttjen-Wasserleben einen. Ist das nicht Unsinn? Einfacher und rentabler ist es, wenn die Rinder in einer LPG, die Schafe bei uns, die Bullen in Wasserleben gehalten werden ...«
»Klar, das ist einleuchtend für jeden Bauern«, sagte Blume und schrieb.
»Der Lüddecke hatte das alles zu Papier gebracht, ein paar Varianten.«
»Der Nachbarvorsitzende?«
»Ganz recht. Der von Adorf, der mit dem Rechenstift zur Welt gekommen ist.«
»Aber das griff die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen an, nicht wahr?«
Der redet wie gedruckt, dachte ich und sagte: »Das greift sie noch heute an, weil es die Lebensbedingungen verändert, Jugendfreund.«
Er grinste. »Bist du auch in der FDJ?«, fragte er.
Jetzt duzt er mich, und man kann dagegen nichts tun. Abstand, Ille, halte Abstand, sagte ich mir, zuckte mit den Schultern und nickte. Denkt er, wir leben auf dem Mond?
»Dann könnten wir Du zueinander sagen«, meinte er.
»Das machst du ja schon«, sagte ich.
Wir lachten. Dann beugte er sich wieder über seine Kladde. »Also, der Eisberg hieß damals Lüttjen-Wasserleben ...«
»Eisberg? Ach so, ja, und den Eisberg übernahm damals Ete Wengebrand.«
»Den möchte ich kennenlernen. «
»Fahr doch hin, mit dem Wolga nur fünfzehn Minuten.«
»Könntest du nicht mitkommen?«
Bloß nicht, dachte ich und sagte: »Ich erwarte die Vertreter der Landwirtschaftsbank, die werden mich löchern, warum wir dieses Jahr keine Kredite in Anspruch genommen haben.«
Der Hauptbuchhalter blinzelte über seine Brille und meinte: »Fahr doch mit, Ille, ich bin ja hier. Du kennst ja alle. Man muss der Presse die Arbeit erleichtern, wir arbeiten ja alle an einem Strang.«
So fiel mir mein Kollege Vorgesetzter in den Rücken. Ich ging die Treppe hinunter, auf den blauen Wolga zu und nahm wie selbstverständlich neben dem Fahrer Platz. Wenn schon, denn schon.
Der Fahrer schmunzelte.
»Ein blauer Wolga passt zu deinem weißen Kleid«, sagte Blume, »himmelblau und weiß ...«
»Der ist hainblau«, sagte ich. Keine Ahnung, ob es hainblau überhaupt gibt, aber so was imponiert immer, und er nickte auch schon Beifall.
Es roch nach Rauch und Wärme. Die großflächige Börde zeigte ein glattes Gesicht, sauber und duftend und glänzend, und der Wind fächelte sanft über die kleinen Hügel hin. Aus den Senken stieg Dampf auf.
Ein Doppeldecker brummte drüber weg und streute Dünger.
Ete Wengebrand war nicht im Büro. Wir trafen ihn draußen vor einem Schlag Wintergetreide beim Singen, jawohl, der Vorsitzende sang, nicht mal schlecht, sondern laut und kräftig. Er strich sich über die wellige Schmalztolle, als er mich sah; in jungen Jahren wollte Ete mal Operettentenor werden, davon sitzt heute noch was in ihm.
»Der Kollege ist von der Zeitung«, sagte ich zu Ete, »deine Genossenschaft ist ein lohnendes Objekt für ihn.«
»Die Kooperation«, verbesserte mich Blume und begann Ete gleich nach Lüttjen-Wasserleben zu fragen. Eine Sicherheit besaß dieser Junge, nicht viel Ahnung von der Landwirtschaft, aber immer frisch drauflos.
»Der Eisberg ist getaut«, sagte Ete fröhlich, »schaut euch doch um, alles wie geleckt! Und hier, wo wir stehen, war vor zwei Jahren Unkraut, unter dem Unkraut Klee. Und der Klee war als Vermehrungssaatgut aberkannt worden. Damals war mir das Weinen näher als das Singen.«
»Vorbei«, sagte ich. Ich mag nicht, wenn man sich so lange bei der Vergangenheit aufhält und sich vor Stolz auf die Brust schlägt, ach, was sind wir doch gut, dabei fahren wir noch nicht immer in der richtigen Spur.
Ete wandte sich an mich. »Damals sagtet ihr aus Branzleben: Mit denen sollen wir kooperieren? Die sollen wir mit aller Gewalt hochpäppeln? Prost Mahlzeit.«
»Ich habe das nicht gesagt«, verteidigte ich mich.
»Du hast nichts gesagt«, warf Ete ein, »du sagst zu Dingen, die heikel sind, auch heute selten was.«
Rolf Blume lächelte mich an. Das war mir schon aufgefallen: Wenn kritische Worte laut werden, lächelt er. Ich glaube, dann denkt er nur an seine guten Zensuren. Eigentlich hat er einen schönen Mund, nicht schmal wie ein Strich, nicht wulstig, sondern groß und geschwungen.
»Und heute?«, fragte Blume.
»Heute hat die Kooperation über fünftausend Hektar, wir sind sechs Betriebe mit drei unterschiedlichen Eigentumsformen, Genossenschaften, Volksgut, BHG, heute flutscht es, wat hätt de Lüt sick früher rackt und plackt.«
»Keine Probleme mehr?«
Ete lachte laut. »Im Paradies leben wir nicht, Probleme passen sich einem höheren Niveau auch an, aber wir verzetteln uns nicht mehr.«
Als wir zurückfuhren, spendierte Rolf Blume in »Flotts Höhe« eine Selters mit Geschmack. Drohend lag sein rotes Notizbuch auf dem Tisch. »Mich interessiert noch«, sagte er, »warum die Kooperation vor zwei Jahren wieder zusammenbrach?«
»Das ist nicht einfach zu erklären. Vielleicht war’s zu früh, vielleicht misstrauten die Bauern den Theoretikern aus der Stadt, die alles so schön vorrechnen konnten. Und dann dieser komplexe Einsatz, der ganz danebenging. Ich denke mir, die Menschen waren noch nicht reif, und jeder Vorsitzende dachte nur an sein Scherflein, an den Gewinn für seinen Betrieb.«
»Um ein Karat Diamanten zu gewinnen«, sagte Blume, »müssen zweihundertfünfzig Tonnen Gestein bewegt werden. Und von diesem einen Karat ist nur ein Bruchteil für Schmuck zu gebrauchen.«
»Das hast du schön gesagt.«
»Danke. Und wann wurde es nun besser?«
»Zunächst gar nicht. Man half sich mal aus, verpumpte eine Maschine, mehr nicht. Der frisch geschneiderte Anzug Kooperation hing im Schrank, wir latschten in den alten Klamotten.«
»Das hast du nicht schlecht gesagt. Und dann?«
»Voriges Jahr war es, da wurde ein Rübenkomplex geplant und sehr gut vorbereitet. Sozusagen der letzte Versuch. Die Vorsitzenden gaben sich große Mühe, alle zu überzeugen. Denn die Traktoristen sagten zu ihnen: ,Gut, wir tun euch den Gefallen, aber wenn es wieder nicht klappt, dann bleibt uns mit solchen Späßen fern.‘ Es klappte in der Komplexbrigade, der Ete Wengebrand erntete auf seinen Schlägen nicht hundertachtundachtzig Dezitonnen auf dem Hektar, sondern über dreihundert, und nichts blieb in der Erde, das war Spitze im ganzen Bezirk. Und kein Bauer und kein Schulkind buddelte mehr im November mit klammen Händen und unterm Schnee nach Rüben.«
Rolf Blume schrieb wieder. Seine Selters wurde schal. Er sagte: »Für die Leser, weißt du, da muss das noch klarer werden, mit den Vorteilen der Kooperation und so ...«
Ich überlegte und sagte schließlich: »Ein Beispiel. Bei uns steigt durch die Kooperation die Milchproduktion. Und warum? Früher stöhnten und zeterten doch die Bauern über das miese Futter.«
»Wann früher, Ille?«
»Noch vor zwei Jahren, als wir noch nicht komplex ernteten, da wurde das Rübenblatt erst dann geräumt, wenn die Rüben vom Feld waren, also manchmal erst im Dezember. Dann war das Blatt längst schmierig geworden, aber nun haben wir frisches Futter, weil wir Rübe und Blatt sofort ernten, die Kühe geben mehr Milch, auf gutes Futter reagieren sie gern, weiß gekalkte Ställe allein machen’s nämlich noch nicht.«
»Das Beispiel ist prima.«
»Ich weiß noch mehr.«
»Es reicht.« Er klappte sein Notizbuch zu und meinte: »Ich verstehe das nicht. Du redest so positiv von der Kooperation, als müsstest du mich davon überzeugen.«
»Na und?«
»Der Wengebrand meinte, dass du dich mit deiner Meinung immer zurückhältst. Stimmt denn das? Ich kann es nicht recht glauben.«
»Wenn so eine Sache neu anfängt«, sagte ich, »dann hat sie immer zwei Seiten, und es ist noch gar nicht ’raus, welche mehr glänzt.«
»Aber für eine Seite sollte man sich doch entscheiden, auch wenn sie nicht glänzt auf Anhieb, meine ich. Das Glänzen kann sich auch später erst herausstellen.«
»Mit solchen Entscheidungen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, und schnell macht man sich Feinde.«
»Also weder ja noch nein? Weder Fisch noch Fleisch?«
Ich stand auf. Das war zu viel. Was bildet sich der Kerl ein? »Sie werden im Büro schon auf mich warten«, sagte ich. Du bist ja so klug, dachte ich, du kannst dich nicht in meine Lage versetzen. Ja, ich lebe gern auf dem Dorfe, und ich liebe meine Arbeit, aber was wir hier tun, das soll von Dauer sein und nicht ein wildes Experimentieren. Vielleicht muss ich mich mehr mit der Theorie beschäftigen, man sollte wissen, wie das so in andern Ländern langgeht, der Blume weiß das bestimmt. Was soll ich ihm antworten?
Ich muss mit allen Bauern auskommen. Aber dem breite ich doch nicht meine Seele aus wie ein Schaffell unter der Sonne zum Trocknen. Trotzdem gefiel mir dieser Blume, und es gefiel mir auch, dass er mir nicht gleich recht gab. Es gibt solche Jungen, die geben einem Mädchen gleich recht, weil sie meinen, dann schneller zum Ziel zu kommen. Aber Blume? Wollte er überhaupt bei mir zum Ziel kommen? Ille, du verfällst einem Wunschdenken.
Im Wagen sagte er: »Das passt so gar nicht zu dir.«
»Was passt nicht zu mir?«
»Diese vorsichtige Unentschlossenheit eines Bürokraten.«
Ich schwieg beleidigt, ich suchte nach einer Entgegnung, der »Bürokrat« traf mich hart, aber mir fielen nur zahme Argumente ein, wiederholen wollte ich mich nicht, darum hielt ich lieber den Mund. Ausgerechnet ich ein Bürokrat! Man muss taktisch klug handeln, wenn man tagtäglich hier arbeitet und mit unterschiedlichen Meinungen zu tun hat. Blume ist ein Stoffel.
An diesem Tage kam der Praktikant nicht in die Buchhaltung zurück. Hatte er schon genug Material für seinen Artikel? Fritz Schönemann tauchte auch wieder auf, lachend, die Mütze wie immer schief auf dem kantigen Kopf. »Alles überstanden, Ille? Schreibt er einen ungemein guten Artikel?«
»Ich glaube schon.« Dieser Blume, gefiel er mir überhaupt noch? Jetzt, nachdem er mich beleidigt hatte? Ich hatte die Nase gestrichen voll von ihm.