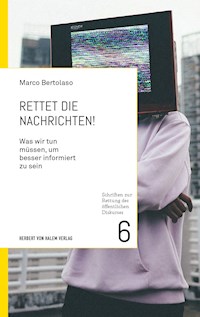
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses
- Sprache: Deutsch
Wir müssen uns dringend um die Nachrichten kümmern. Demokratie, Rechtsstaat und individuelle Freiheiten wird es ohne verlässliche Information nicht mehr geben. Sie vertragen kein "postfaktisches" Verschwimmen von Wahr und Falsch. Der westliche Nachrichtenjournalismus steckt in der Krise, auch wegen eigener Fehler. Wenige Großkonzerne beherrschen die neue digitale Informationslandschaft. Ihre Algorithmen sind an Umsatz und Ertrag ausgerichtet. Sie begünstigen Konflikt und Krawall, nicht Austausch und Achtung. Autoritäre Staaten operieren erfolgreich mit den neuen Kommunikations- und Kontrollmöglichkeiten. Die Corona-Krise hat all dies deutlich ans Licht gebracht und sie hat gezeigt, dass der Nachrichtenjournalismus einen Neuanfang braucht. Redaktionen müssen sich in Frage, aus Fehlern lernen und ihre Arbeit öffentlich zur Diskussion stellen. Gefordert sind aber genauso Politik, Wirtschaft, Verbände und die gesamte Gesellschaft. Wir alle sind in der Verantwortung, wenn wir die Nachrichten retten wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detailliertebibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.ddb.de abrufbar.
Marco Bertolaso
Rettet die Nachrichten!
Was wir tun müssen, um besser informiert zu seinSchriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses, 6Köln: Halem, 2021
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigungund Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durchFotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren)ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziertoder unter Verwendung elektronischer Systeme(inkl. Online-Netzwerken) gespeichert, verarbeitet,vervielfältigt oder verbreitet werden.
http://www.halem-verlag.de
© Copyright Herbert von Halem Verlag 2021
Print:
ISBN 978-3-86962-493-8
E-Book (PDF):
ISBN 978-3-86962-494-5
E-Book (EPUB):
ISBN 978-3-86962-520-1
ISSN 2699-5832
UMSCHLAGGESTALTUNG: Claudia Ott, Düsseldorf
UMSCHLAGFOTO: Joshua Rawson Harris / unsplash
LEKTORAT: Rabea Wolf
SATZ: Herbert von Halem Verlag
DRUCK: docupoint, Magdeburg
Copyright Lexicon © 1992 by The Enschedé Font Foundery.
Lexicon is a Registered Trademark of The Enschedé Font Foundery.
Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses
Marco Bertolaso
Rettet die Nachrichten!
Was wir tun müssen, um besser informiert zu sein
Die Reihe Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses
Warum ist der Lager übergreifende öffentlich-demokratische Diskurs gefährdet, ja geradezu ›kaputt‹? Weshalb ist der öffentliche Wettbewerb auf dem Marktplatz der Ideen ins Stocken geraten? Und welche Rolle spielen dabei Digitalisierung und Algorithmen, aber auch Bildung und Erziehung sowie eskalierende Shitstorms und – auf der Gegenseite – Schweigespiralen bis hin zu Sprech- und Denkverboten?
Die Reihe Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses stellt diese Fragen, denn wir brauchen Beiträge und Theorien des gelingenden oder misslingenden Diskurses, die auch in Form von ›Pro & Contra‹ als konkurrierende Theoriealternativen präsentiert werden können. Zugleich gilt es, an der Kommunikationspraxis zu feilen – und an konkreten empirischen Beispielen zu belegen, dass und weshalb durch gezielte Desinformation ein ›Realitätsvakuum‹ und statt eines zielführenden Diskurses eine von Fake News und Emotionen getragene ›Diskurssimulation‹ entstehen kann. Ferner gilt es, Erklärungen dafür zu finden, warum es heute auch unter Bedingungen von Presse- und Meinungsfreiheit möglich ist, dass täglich regierungsoffiziell desinformiert wird und sich letztlich in der politischen Arena kaum noch ein faktenbasierter und ›rationaler‹ Interessensausgleich herbeiführen lässt. Auf solche Fragen Antworten zu suchen, ist Ziel unserer Buchreihe.
Diese Reihe wird herausgegeben von Stephan Russ-Mohl, emeritierter Professor für Journalistik und Medienmanagement an der Università della Svizzera italiana in Lugano/Schweiz und Gründer des European Journalism Observatory.
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
TEIL EINS:DIE KRISE DER NACHRICHTEN
KAPITEL 1FREIE NACHRICHTEN: EINE HISTORISCHE AUSNAHME
KAPITEL 2MEHR PROBLEME ALS GENUG: NACHRICHTEN UNTER DRUCK
Nicht klar definiert? – Was mit Nachrichten gemeint ist
Nicht mehr geliebt? – Die Sache mit dem Vertrauen
Nicht mehr repräsentativ? – Wenn Menschen sich nicht wiedererkennen
Nicht mehr gebraucht? – Die gefährlichen Umgehungsstrategien
Nicht mehr genutzt? – Netz und soziale Medien als neue Informationsquellen
Nichts mehr wert? – Die (scheinbar) kostenlose Ware Nachricht
EXKURS: DER ALLTAG DER NACHRICHTEN
Eine Redaktion im Lauf der Jahrzehnte
Das alltägliche Ziel: Konstruktion von Wirklichkeit
TEIL ZWEI:REALISTISCHE NACHRICHTEN – NEUSTART FÜR DEN INFORMATIONSJOURNALISMUS
KAPITEL 3WER WIR SEIN WOLLEN – DAS SELBSTVERSTÄNDNIS DER NACHRICHTEN
Verzicht auf die Allwissenheit
Nachrichten und Wahrheit(en)
Abschied von der Objektivität
Probleme der Postobjektivität
Nachrichten und Emotionen
Die große Negativverzerrung
Nachrichten und Macht
KAPITEL 4WAS SICH ÄNDERN MUSS: MEHR NACHRICHTEN WAGEN
Ein neues Verständnis von Aktualität und Relevanz
Ausweitung der Beobachtungszone
Gesellschaftliche Perspektiven
Internationale Sichtweisen
Komplexität und Vertiefung
Das A und O: Die Quellen der Nachrichten
Organisation, Ressourcen und Verbreitung der Nachrichten
TEIL DREI:DIE NACHRICHTEN RETTEN: EINE GEMEINSCHAFTSAUFGABE
KAPITEL 5REALISTISCHE NACHRICHTEN: EINE ZUSAMMENFASSUNG IN ZEHN PUNKTEN
KAPITEL 6WAS DIE GESELLSCHAFT TUN SOLLTE: EINE WUNSCHLISTE MIT ACHT PUNKTEN
SCHLUSSBEMERKUNG UND DANK
LITERATUR UND ANDERE ZITIERTE QUELLEN
EINLEITUNG
Wir müssen uns um die Nachrichten kümmern. Sie, ich, wir alle. Demokratische Verhältnisse, der Rechtsstaat und unsere individuellen Freiheiten, all das ist historisch betrachtet selten, aber auch in unserer heutigen Welt rar und kostbar. All das setzt allgemein zugängliche und verlässliche Informationen voraus. Nur so kann sich jede und jeder eine Meinung bilden. Nur so bleibt eine Öffentlichkeit lebendig, die gemeinsam akzeptierte Tatsachen kennt, eine Öffentlichkeit, die auf dieser Grundlage diskutiert, streitet, entscheidet und Kontrolle ausübt.
Lange war unbestritten, dass den Nachrichten dabei eine zentrale Rolle zukommt. Sie waren Kommunikationsraum und Immunsystem der Demokratie. Ob Zeitungen, Radio, Fernsehen oder Internet – der Informationsjournalismus hat die vergangenen einhundert Jahre geprägt. Jetzt steckt er in der Krise. Gesellschaftliche Fragmentierung, Infragestellung klassischer Medienangebote, die digitale Revolution mit ihren radikal neuen Informationsmöglichkeiten und mit ihren neuen, radikalen Monopolisten, das brutale Ende tradierter Geschäftsmodelle, das sind einige der bekannten Stichworte.
Aus meiner Sicht stehen die Gefahren für den Informationsjournalismus in Wechselwirkung mit einer anderen Krise, mit der Krise der repräsentativen Demokratie. Massenmedien und Parteien verlieren an Kraft, die sozialen Medien und Bewegungen gewinnen an Gewicht. Auch darum geht es in diesem Buch, doch mein Schwerpunkt liegt auf der Absicherung und Weiterentwicklung des Nachrichtenjournalismus. In diesem Berufsfeld bewege ich mich seit drei Jahrzehnten aus Überzeugung und mit Freude. Vor Ihnen liegt daher auch kein kommunikationswissenschaftlicher Text, sondern der eines gesellschaftlich engagierten Nachrichtenredakteurs.
Unser Handwerk muss Regeln nachjustieren. Wir sollten uns von Gewohnheiten und Glaubenssätzen verabschieden, von denen manche auch mir lange heilig waren. Einige Beispiele: Beobachten und kontrollieren wir noch die richtigen Entscheidungsträger, etwa mit journalistischen Hundertschaften rund um den Bundestag, den Schauplatz von teils nur noch vermuteter Macht? Wie lassen sich transnationale, internationale oder gar globale Themen in den überwiegend nationalen Medienlandschaften angemessen darstellen? Viele Menschen erkennen sich und ihre Lebenswelt in den Nachrichten nicht mehr wieder. Wie können Redaktionen darauf reagieren, um Vertrauen zu bewahren oder zurückzugewinnen? Stimmt die nachrichtliche Aktualitätsfixierung eigentlich? Sind unsere Quellen zeitgemäß? Warum klammern wir uns weiter an den mythischen Begriff der Objektivität? Und weshalb behaupten wir immer noch so oft, über ›alles Wichtige‹ zu berichten, als ob dieses Versprechen jemals auch nur für einen Tag einzulösen gewesen wäre?
Hin und wieder übe ich die eine oder andere Form von Kritik und spreche mich für Veränderungen aus. Das richtet sich weder gegen den Nachrichtenjournalismus noch gegen die vielen Kolleginnen und Kollegen, die ihn täglich gestalten und an seiner Weiterentwicklung arbeiten. Die Kritik ist vielmehr ein konstruktiver Teil dieser gemeinsamen Arbeit, an der ich schon lange mitwirken darf. Das ist der Zusammenhang, aus dem einzelne meiner Argumente weder gerückt noch gerissen werden sollten. Die Beobachtungen und Anmerkungen in diesem Buch sind zudem immer die meinen und nicht Standpunkte des Senders, für den ich sehr gerne arbeite.
Mit Betrachtungen über den Journalismus und sein Personal allein ist es nicht getan. Denn bei den Medien wird vieles abgeladen, was in die Zuständigkeit anderer gesellschaftlicher Bereiche gehört. Für wesentliche Defizite der demokratischen Öffentlichkeit sind Politik und Wirtschaft verantwortlich, Verbände, Nichtregierungsorganisationen und andere mehr. Mich besorgt unter anderem das ebenso weitverbreitete wie missbräuchliche Unterlaufen eines funktionierenden Informationsjournalismus durch PR und Marketing.
In der Verantwortung stehen aber letztlich wir alle, die wir Medien nutzen, die wir Bürgerinnen und Bürger sind. Wir alle gehören zur Nachrichtenkultur und entscheiden gemeinsam über die Zukunft der Information. Lassen Sie uns die Nachrichten retten. Es lohnt sich – und es wird uns nur gemeinsam gelingen.
Was erwartet Sie nun? Das Buch ist eine Art Reise durch die Welt der Nachrichten. Im ersten Teil besichtigen wir den freien, westlichen Nachrichtenjournalismus und dann die Probleme, mit denen er von innen und von außen konfrontiert wird. Nach einem Abzweig in den redaktionellen Alltag schauen wir uns im zweiten Teil das Selbstverständnis der Nachrichten und einige handwerkliche Punkte genauer an. Dabei werbe ich für eine Neuorientierung unter dem Sammelbegriff ›Realistische Nachrichten‹. Zum Schluss geht es um den Beitrag von Politik und Gesellschaft für einen demokratie- und gemeinwohlorientierten Informationsjournalismus.
TEIL EINS:DIE KRISE DER NACHRICHTEN
KAPITEL 1FREIE NACHRICHTEN:EINE HISTORISCHE AUSNAHME
Den Anfang macht ein genauerer Blick auf das, für dessen Rettung ich werbe. Ich meine eine Nachrichtenkultur, die den Einzelnen und der Öffentlichkeit den informationellen Rohstoff für demokratische Abwägungen und Entscheidungen verlässlich liefert, die sich den fundamentalen Prinzipien des Grundgesetzes und anderen Normen wie den Menschenrechten verpflichtet fühlt und deren grundsätzlich große Offenheit und Neutralität genau dort ihre wehrhafte Grenze finden, wo diese Werte in Gefahr sind.
Ich meine einen Nachrichtenjournalismus, der seinerseits frei arbeiten kann, in Deutschland zum Beispiel abgesichert durch Artikel fünf des Grundgesetzes und eine funktionierende Justiz. Ich meine Nachrichten, die derart geschützt die Arbeit der demokratischen Institutionen und aller anderen gesellschaftlichen Akteure kontrollieren und kritisieren können. Und ich meine Nachrichten, die sich ihrer Verantwortung zur Herstellung einer demokratischen Öffentlichkeit bewusst sind, die eine funktionierende Fehlerkultur haben und ihre Arbeit ebenso regelmäßig wie transparent überprüfen.
Manche denken, dass eine solche Nachrichtenkultur alltäglich und ungefährdet ist. Wir werden uns das noch genauer ansehen. Historisch betrachtet ist sie jedenfalls die absolute Ausnahme. Frei verfügbare und zuverlässige Information, auf deren Grundlage die Menschen über die Geschicke ihrer Gesellschaft entscheiden können, das war in der Geschichte so wahrscheinlich wie sechs Richtige im Lotto. Meist waren die Nachrichten nämlich Instrument oder Teil der Macht. Wo wüsste man das besser als in Deutschland? Noch vor achtzig Jahren standen die Medien hier unter Kontrolle des Staates. Noch mehr, sie halfen bei der Absicherung einer Diktatur. Durch die Verbreitung von Lügen und Hass wurden Massenmedien zu Massenvernichtungswaffen.
Eine weitere Lehre nicht nur aus der NS-Zeit ist die besondere Rolle der Nachrichten im Journalismus. In einer Diktatur oder in einem autoritären Regime hat es niemand leicht, der von der Meinungsfreiheit Gebrauch machen will. Die Nachrichten aber sind das erste Opfer. So hielten es auch die Nationalsozialisten: Sie unterwanderten und radikalisierten schon 1931 den Reichsverband Deutscher Rundfunkteilnehmer, der sich danach für mehr ›rechte‹ und nationale Inhalte im angeblich links dominierten ›Systemrundfunk‹ stark machte. Eine zentrale Parole lautete »Brecht den roten Rundfunkterror.« In NS-Zeitungen wurde das verbunden mit antisemitischer Hetze, mit Kritik an den Kosten des Rundfunks und Forderungen wie »Fort mit marxistischer Zersetzungspropaganda und verlogenem Literaten-Geseire« (HEIDELBERGER BEOBACHTER 1931).
Bereits 1932 und damit noch deutlich vor der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler sicherten sich die Nationalsozialisten den Einfluss auf die Drahtlose Dienst AG, die erste deutsche Hörfunknachrichtenredaktion. Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels nannte das Radio das »allermodernste und allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument« (GOEBBELS 1933). Sein Mann für den Rundfunk, Hans Fritzsche, sprach später vom »modernsten und schnellsten Nachrichtenmittel« und von einer »Waffe« (FRITZSCHE 1937).
Die Nationalsozialisten verschafften sich auch sonst die Kontrolle über den Informationsjournalismus, sobald sie es konnten. Der Grund ist leicht erklärt und gilt auch für andere Diktaturen: Wenn den Menschen vertrauenswürdige Nachrichten fehlen, wenn sie der Propaganda ausgesetzt sind, wenn sie nicht mehr wissen, was wahr oder falsch ist, dann ist das autoritäre Ziel erreicht. Dann kann der Staat in anderen Bereichen kalkulierte Freiheiten zulassen, etwa ein gewisses Maß an Kunst und Kommentierung erlauben, als Ventil im Inland oder als Feigenblatt für die Welt.
Kaum Note ›gut‹ für die Pressefreiheit
Solche Überlegungen klingen heute für manche wie eine anstrengende und überholte Moralpredigt aus längst vergangenen, dunklen Tagen. Diesen Eindruck gewinne ich seit Jahren im Dialog mit einigen unserer Hörer und Nutzerinnen. Ich sehe das anders. Wir alle sind in unserer Zeit und in unserer Lebenserfahrung befangen. Das schränkt die Vorstellungskraft ein und manchmal auch die Abwehrkraft. Die meisten von uns hatten schon einmal von der ›Spanischen Grippe‹ gehört. Doch mein Gott, das war vor einhundert Jahren. Dann kam Corona und traf viele Gesellschaften einigermaßen unvorbereitet.
Um die Bedrohung freier Nachrichten zu verstehen, muss niemand einhundert Jahre zurückschauen. Es reicht ein offener Blick in die Welt um uns herum. Ein nützlicher Indikator ist der Index, den die Organisation Reporter ohne Grenzen jährlich veröffentlicht. Es ist eine Art TÜV für die Pressefreiheit, der Zensur, Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten und andere einschränkende Faktoren berücksichtigt. Dass es in Nordkorea oder im Iran auch für Medien düster aussieht, darauf kämen wir alle auch ohne diesen Index. Aber wer weiß schon, wie selten freie Nachrichtenkulturen heutzutage generell sind, weit über die üblichen Verdächtigen unter den Staaten hinaus?
Gerade mal für zwölf der 180 bewerteten Länder schätzen die Reporter ohne Grenzen die Lage im Frühjahr 2021 als gut ein (REPORTER OHNE GRENZEN 2021). Ob uns allen klar ist, wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns bewegen? Ob wir es schaffen, aufmerksam und vorsichtig zu bleiben? Garantiert ist das nicht. Denn auch bei der Virengefahr hätten wir nicht nur aus der Geschichte gewarnt sein können. Ärzte in Bergamo sprachen es Ende März 2020 klar aus: »Il coronavirus è l’Ebola dei ricchi«. Corona ist das Ebola der Reichen, so zitiert sie die Nachrichtenagentur ANSA (2020). Andere Teile der Welt haben deutlich mehr Erfahrung mit Pandemien – und mit der Unterdrückung der Medien. Wir wären gut beraten, in beiderlei Hinsicht Anteil am Schicksal der anderen zu nehmen und uns auch bei der Pressefreiheit nicht zu sicher zu fühlen.
Mythos Watergate
In meiner Generation verbindet sich die Idee des Journalismus mit Bildern von Bob Woodward und Carl Bernstein. Viele haben die beiden vor Augen, wie sie aufklärerisch, mutig und stets das Gute im Sinn den Watergate-Skandal aufdecken, wie sie 1974 letztlich US-Präsident Richard Nixon zum Rücktritt zwingen. Ehrlicherweise sind es vielleicht noch mehr die Bilder von Robert Redford und Dustin Hoffman, den Darstellern der Reporter im Klassiker All the President’s Men. Die Verfilmung aus dem Jahr 1976 hat den Beruf des damals noch meist männlichen Journalisten popularisiert und für viele Jahre als Klischee geprägt. Watergate und der Film haben vor bald 50 Jahren auch zu einem Run auf die Ausbildungswege hin zu den Medien beigetragen.
Mit dem Regelfall des Journalismus hat Watergate allerdings wenig zu tun. Über die Jahrhunderte stand in den Medien nicht die Kontrolle der Macht im Vordergrund, sondern die Unterhaltung. Es ging dabei oft um gute Stimmung und politische Ruhe in der Bevölkerung. Die ungebrochene Wucht des Unterhaltungsaspekts können wir an den mit ihm verbundenen Auflagen und Reichweiten in der Medienlandschaft unserer Tage ablesen. Der Hauptjob der Nachrichten, sofern es sie gab, war Information und Desinformation im Interesse der Machthabenden. Das reichte bis zur Mittäterschaft in Diktaturen.
Doch auch jenseits solcher Extreme lebten Informationsmedien meist in einem prekären Geflecht von Abhängigkeiten von und Rücksichtnahmen auf politische, wirtschaftliche und andere Interessen. Stellen wir uns einen Augenblick vor, es gäbe eine Liste mit den Namen aller Frauen und Männer, die jemals in der Geschichte ihr Geld mit der Suche, der Zusammenstellung und Verbreitung von Nachrichten verdient haben. Es wäre eine enorm lange Liste von den Anfängen der professionellen Information bis zu meinen Kolleginnen und Kollegen, die gerade jetzt die DEUTSCHLANDFUNK-Nachrichten verantworten, während Sie diese Zeilen lesen. Die Gesamtübersicht würde deutlich machen, wie sehr ein Journalismus im Sinne von Woodward und Bernstein, im Sinne von Guardian, Tagesschau oder Süddeutscher Zeitung die Ausnahme war.
Die Ausnahme ist, muss man sagen. Denn die Pressefreiheit mag auf dem Papier fast überall garantiert sein, so wie die Welt auch voller Regierungssysteme ist, die sich ›demokratisch‹ nennen. Und doch haben staatlich kontrollierte und weitere, engen Interessen verpflichtete Medien nach wie vor weltweit viel mehr Personal und Ressourcen als die anderen Redaktionen. Als die ›eigentlichen Redaktionen‹, wie ich sie nennen möchte.
Systemstabilisatoren und Systemkritik
Journalistinnen und Reporter, die nach unserem Verständnis nicht frei arbeiten, sehen sich selbst nicht unbedingt als Agitatoren und Propagandistinnen, die den Beruf falsch ausüben. Es wird viele Fälle überzeugter Systemstabilisatoren geben. In manchen Gesellschaften ist das die offizielle Aufgabe des Journalismus. Erklärt und begründet wird dies als patriotische Pflicht, Teil eines revolutionären Weges oder eines ideologischen Konzeptes und fast immer als Dienst am Volk.
Mit dieser Ausrichtung wird das Handwerk heute in Diktaturen unterrichtet, so wie in den 1930er-Jahren schon in Benito Mussolinis Scuola fascista di giornalismo, die Joseph Goebbels zur Gründung der Reichspresseschule inspirierte. Viele in den Medien autoritär regierter Staaten Beschäftigte werden die gewohnten Arbeitsumstände wohl auch einfach für normal halten oder sich den Zwängen beugen.
Weltweit praktizieren in solchen Ländern immer wieder Journalistinnen und Journalisten kleinere Formen des kalkulierten Widerstandes. Andere gehen noch einen Schritt weiter: Sie kämpfen für eine wahrhaftige Berichterstattung. Sie legen sich mit der politischen und wirtschaftlichen Macht, mit dem Militär oder mit mafiösen Strukturen an – und manchmal sogar mit allen diesen Kräften gleichzeitig. Diese Menschen leben gefährlich und können oft nur auf externe Unterstützung von Reporter ohne Grenzen, Amnesty International und andere Organisationen zählen – wenn überhaupt. Wenn unser Beruf Helden kennt, dann sind es diese Frauen und Männer.
Vielfältige Nachrichtenkulturen
Die Nachrichtenkulturen sind vielschichtig wie die politischen Systeme. Die Medienwissenschaft arbeitet mit verschiedenen Modellen, in denen die dem Informationsjournalismus zugeschriebenen Aufgaben variieren – von der Unterstützung der Regierung, etwa in China, bis zur Kontrolle der Macht, so wie wir es im Westen grundsätzlich verstehen. Roger Blum beschreibt dies in seinem Mediensystemvergleich schon im Titel als den Unterschied zwischen den Lautsprechern und den Widersprechern der Herrschenden (BLUM 2014). Blum macht auch einiges an Schattierungen zwischen diesen Polen aus. In Russland oder in der Türkei etwa sieht er »kontrolliert halboffene Systeme« (BLUM 2014: 118ff.).
Man muss aber nicht erst nach China gehen, nach Nordkorea oder in den Irak, um sich in einer spürbar anderen journalistischen Welt wiederzufinden. In Großbritannien erleben wir ein atemberaubendes Nebeneinander: Da ist die BBC, vermutlich der an Tradition und Innovation reichste öffentlich-rechtliche Rundfunksender. Da ist aber auch eine hochgradig polarisierte und konfliktorientierte Presselandschaft, in der die Zeitungen des Unternehmers Rupert Murdoch maßgeblich den Ausgang mehrerer Wahlen in den vergangenen Jahrzehnten entschieden haben – und zwar mal für die Konservativen, mal für Labour. Sie haben auch das Brexit-Referendum mitentschieden. In Frankreich übt die Regierung seit jeher Einfluss auf die elektronischen Medien aus, in die Presse haben sich Industrielle verschiedener Branchen eingekauft.
Italien ist die Heimat von Silvio Berlusconi, dem Meister der Verflechtung wirtschaftlicher, medialer und politischer Interessen. Schon vor ihm teilten sich die großen Parteien die Pfründe beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk RAI, ganz im Sinne der ›Partitocrazia‹. Das gesamte italienische Mediensystem kategorisiert Blum als »freiheitlich-klientelistisch« (BLUM 2014: 164ff.). Er meint damit unter anderem den Vorrang von Gruppeninteressen gegenüber dem Allgemeinen, die große Bedeutung von Netzwerken und Schutzbeziehungen, innerhalb derer auch Journalisten agieren.
Kein Anlass zu westlichem Hochmut
In Deutschland hat es bei Meinungsvielfalt und Wettbewerb zuletzt Einbußen durch Abbau und Zusammenlegung von Redaktionen gegeben. Im Frühjahr 2021 stufte Reporter ohne Grenzen dann auch die Bewertung der Lage der Pressefreiheit in Deutschland von ›gut‹ auf nur noch ›zufriedenstellend‹ zurück und sprach von einem ›Alarmsignal‹. Begründet wurde dies mit den vielen Übergriffen auf Medienvertreter bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen (REPORTER OHNE GRENZEN 2021). Schon 2020 hatte die Organisation in der Nahaufnahme Deutschland beklagt, »Gewalt, verbale Angriffe und Einschüchterungsversuche gegen Journalistinnen und Journalisten bleiben erschreckend häufig.« Weiter hieß es damals:
»Immer wieder gibt es Gesetzesinitiativen, die den Informanten- und Quellenschutz bedrohen. Journalistinnen und Journalisten sollen vermehrt durch Unterlassungserklärungen eingeschüchtert und von Veröffentlichungen abgehalten werden« (REPORTER OHNE GRENZEN 2020).
Auch in Deutschland prägen Unternehmen wie Bertelsmann oder Axel Springer einen wesentlichen Teil des Medienmarkts. Die Geschichte des öffentlich-rechtlichen Teils wiederum ist auch hier nicht frei von Einflussversuchen. Es gibt eine lebendige gesellschaftliche Diskussion darüber, ob die Aufsichtsgremien die gesellschaftlichen Gruppen widerspiegeln oder doch eher den Einfluss politischer Parteien sichern. Das Bundesverfassungsgericht hat 2014 verlangt, die Macht »staatlicher und staatsnaher Mitglieder« in den Gremien müsse stärker begrenzt werden (BVERFG 2014). Den Anstoß zu dem Verfahren hatte die Nichtverlängerung des Vertrages von ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender im Jahr 2009 gegeben.
Festhalten möchte ich, dass auch im Westen in Sachen Pressefreiheit nicht alles gut ist, was woanders schlecht ist. Es gibt keinen Grund, aus der Warte unseres noch einigermaßen intakten medialen Ökosystems hochmütig zu sein. Es gibt aber jeden Grund, unsere freie Nachrichtenkultur zu verteidigen und zu verbessern. Es gibt jeden Anlass, sich gegen die Unterdrückung der Pressefreiheit einzusetzen, genauso wie gegen die Verfolgung von Journalistinnen und Journalisten – wo auch immer dies geschieht.
Digitale Diktaturen
Es wird Zeit, das Internet anzusprechen, sofern man darüber überhaupt noch im Singular sprechen kann. Kieron O’Hara und Wendy Hall von der Universität Southampton jedenfalls beschreiben aus geopolitischer Sicht vier verschiedene Ausprägungen: Da ist das ursprüngliche Internet des Silicon Valley, verbunden mit emanzipatorischen Erwartungen, verknüpft mit Hoffnungen auf freien, vielfältigen Informationsaustausch und Demokratisierung. Daneben gibt es ein bürgerliches, europäisches Modell, in dem Lügen und Hate Speech unterbunden werden sollen, in dem Datenschutz im Zweifel wichtiger ist als Innovation. Nummer drei und vier sind für O’Hara und Hall das an Eigentum und Gewinn ausgerichtete Internetkonzept des US-Establishments sowie Chinas autoritär-paternalistisch genutztes Netz. Dazu tritt aus Sicht der beiden noch »Moscow’s Spoiler Model«, in dem die russische Regierung digitale Kanäle für Desinformation nutzt (O’HARA/HALL 2021). Zu dieser groben Orientierung hinzufügen möchte ich den Hinweis auf das Deep Web, insbesondere auf das Darknet, in dem fernab des allgemeinen Radars so ziemlich alles geschieht.
Hoffnungen wie zu den Anfängen des Internets galten Jahre später auch den aufkommenden sozialen Medien und den Smartphones, den allgegenwärtigen Kommunikationszentralen. Die Proteste und Aufstände des Arabischen Frühlings ab dem Dezember 2010 wurden oft ›Revolutionen 2.0‹ genannt. Doch auch dieser Optimismus ist abgeebbt. Wir haben mittlerweile einen besseren Blick dafür, wie die Nutzung und Kontrolle der sozialen Medien staatlichen Unterdrückungsapparaten in die Hände spielen kann. In einem Artikel für Foreign Affairs aus dem Frühjahr 2020 mit dem Titel The Digital Dictators wird das so zusammengefasst:
»It’s now clear […] that technology does not necessarily favor those seeking to make their voices heard or stand up to repressive regimes. Faced with growing pressure and mounting fear of their own people, authoritarian regimes are evolving. They are embracing technology to refashion authoritarianism for the modern age. Led by China, today’s digital autocracies are using technology – the Internet, social media, AI – to supercharge long-standing authoritarian survival tactics. They are harnessing a new arsenal of digital tools to counteract what has become the most significant threat to the typical authoritarian regime today: the physical, human force of mass antigovernment protests. As a result, digital autocracies have grown far more durable than their pre-tech predecessors and their less technologically savvy peers. In contrast to what technology optimists envisioned at the dawn of the millennium, autocracies are benefiting from the Internet and other new technologies, not falling victim to them« (KENDALL-TAYLOR/FRANTZ/WRIGHT 2020).
Die Hoffnung war groß, dass die Welt durch das Internet zu einem frei und gut informierten globalen Dorf werden könnte. Inzwischen geht die Entwicklung zumindest in Teilen in Richtung eines bewachten und kontrollierten Potemkinschen Dorfs.
Gefahr droht nicht nur vom Staat
Gefahr für die Freiheit der Information droht nicht nur von staatlicher Seite, so verständlich die Sensibilität in dieser Hinsicht als Reflex auf die Diktaturerfahrungen des 20. Jahrhunderts auch ist. Wirtschaftliche Interessen wirken ebenfalls massiv auf die Medien ein. Das ist in der kleinsten Gemeinde so und reicht bis zu den multinationalen Konzernen, die über Grenzen hinweg auf die Information Einfluss nehmen. Die politische Kontrolle dieser Interessen ist durch Deregulierung und Globalisierung noch schwieriger geworden. Die journalistische Kontrolle ist oft sogar unmöglich.
Vor eine neue und gewaltige Herausforderung stellen uns im 21. Jahrhundert die großen Technologiekonzerne, die Machthaber der digitalen Welt. Auch sie sind Profiteure von Deregulierung und Globalisierung. Sie neigen zur Monopolbildung, verfügen über wichtige Daten der meisten von uns und steuern über Algorithmen unser Informationsverhalten. Noch mehr: Die Plattformen der Digitalkonzerne sind die neuen Marktplätze und Fußgängerzonen als Orte der Öffentlichkeit und des Austauschs. Die Konzerne bestimmen dort die Regeln. Sie entscheiden, wer dabei sein darf und wer nicht. Sie bestimmen, was sagbar ist und was nicht.
Überwachungskapitalismus und ›Wild Wild West‹
Bei weitem nicht die einzige Warnung, doch sicher eine der kraftvollsten, kommt von der Harvard-Professorin Shoshana Zuboff. Ihr Buch The Age of Surveillance Capitalism (ZUBOFF 2019) liest sich wie ein Weckruf. Ihre Sorge ist, dass der digitale Kapitalismus die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zum Schaden der Einzelnen und der Demokratie verändern wird, aus reiner Gewinnsucht. Aus Zuboffs Sicht werden die heutigen Menschen von Google und Co. im Überwachungskapitalismus genauso überrollt wie die Ureinwohner Amerikas von den spanischen Eroberern im 16. Jahrhundert (ZUBOFF 2019: 175ff.). Insofern findet sie den Begriff »Digital Natives« »tragisch-ironisch« (NAUGHTON 2019).
Tim Cole bemüht ein anderes Bild aus Amerika: Für ihn ist das WWW derzeit das Wild Wild Web und ähnelt dem Wilden Westen des 19. Jahrhunderts. Damals konnten Räuber und Gesetzlose erst einmal mehr oder weniger ungehindert tun und lassen, was sie wollten. Heute sind es für Cole die digitalen Monopolisten, die von ihrem Recht der Stärkeren Gebrauch machen. Sein Plädoyer lautet, auch im Internet Regeln durchzusetzen, wie seinerzeit im amerikanischen Westen, um insbesondere der Ausbeutung der Daten ein Ende zu setzen (COLE 2018).
Huxley, Orwell, Postman
Es gibt in der Moderne unterschiedliche Sichtweisen auf Freiheitsbedrohungen. Viele wissen das schon aus dem Englisch-Unterricht, zumindest wenn sie Bekanntschaft gemacht haben mit Aldous Huxley und George Orwell. Die beiden haben mit Brave New World (HUXLEY 1932) und 1984 (ORWELL 1949) zwei für das vergangene Jahrhundert prägende Dystopien geschrieben. 1984 ist zu einem Kurzbegriff für den totalitären Staat geworden, der die Menschen mit Zwang und Überwachung kontrolliert, auch in der Kommunikation. Brave New World zeichnet, wieder vereinfacht gesagt, zwar ebenfalls das Bild einer Diktatur, die die Menschen aber eher durch Bedürfnisbefriedigung gefügig hält: Anstatt von Panzern werden Konsum und Drogen eingesetzt.
In einem Brief an George Orwell bestand Aldous Huxley im Oktober 1949 darauf, dass seine Prophezeiung die wahrscheinlichere sei. Die Herrschenden würden eines Tages erkennen, dass sie keine Schlagstöcke oder Gefängnisse mehr brauchten. Vielmehr würden sie Wege finden, den Menschen eine freiwillige Sklaverei angenehm erscheinen zu lassen, schrieb Huxley an Orwell (HUXLEY 1949). Diesen Gedanken hat der US-Medienwissenschaftler Neil Postman in Amusing Ourselves to Death (1985) schon im Vorwort aufgegriffen. Kaum war das ominöse Orwell-Jahr 1984 vorbei, notierte er:
»Orwell warns that we will be overcome by an externally imposed oppression. But in Huxley’s vision, no Big Brother is required to deprive people of their autonomy, maturity and history. As he saw it, people will come to love their oppression, to adore the technologies that undo their capacities to think. What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one. Orwell feared those who would deprive us of information. Huxley feared those who would give us so much that we would be reduced to passivity and egoism. Orwell feared that the truth would be concealed from us. Huxley feared the truth would be drowned in a sea of irrelevance. […] As Huxley remarked in Brave New World Revisited, the civil libertarians and rationalists who are ever on the alert to oppose tyranny ›failed to take into account man’s almost infinite appetite for distractions‹« (POSTMAN 1985).
Postmans Sorge galt der medialen Unterhaltung und dabei insbesondere dem Fernsehen. Einige Jahre später wurde er für unser Thema, die Nachrichten, noch einschlägiger. Postman hielt einen Vortrag, den er sich selbst zitierend Informing Ourselves to Death nannte. Darin warnte er unter anderem davor, die Menschen könnten im Überfluss an Information ertrinken (POSTMAN 1990).
Wandel der Öffentlichkeit
Es gibt an den Massenmedien viel zu kritisieren, genauso wie an der repräsentativen Demokratie und den Volksparteien. Die Ära der einen geht zu Ende, die Zukunft der anderen ist ungewiss. Politische Interessen organisieren sich weniger statisch. Sie finden bewegungsartig zusammen, ob nun bei ›Podemos‹, Emmanuel Macrons ›En Marche!‹ oder ›Fridays for Future‹ (vgl. FRANCESCHINI 2019). Und manchmal versuchen auch Volkstribune das Erbe der Volksparteien anzutreten. Dafür stehen so unterschiedliche Namen wie Matteo Salvini, Donald Trump oder Sebastian Kurz.
Wenige Medien mit großer Reichweite und wenige Parteien mit großer Wählerschaft, das hat eine Zeit lang zusammengepasst. Dieses Zusammenspiel erbrachte Diskussion und Durchsetzung von Entscheidungen, Kommunikation und Kontrolle von Macht. Die Bilanz kann sich zumindest im historischen Vergleich sehen lassen. Eva Menasse würdigte die alte, über Massenmedien hergestellte Öffentlichkeit in einer Art Nachruf:
»Als sie entstand, war sie verdächtig, weil sie einem Niveauverlust Vorschub zu leisten schien. Da hatten wir noch Sorgen, müsste man inzwischen sagen. Denn möglicherweise war diese sogenannte abstrakte, massenmediale Öffentlichkeit das Beste, was in einer zusammenwachsenden Welt zu bekommen war, einen historischen Moment lang, in jenem Wimpernschlag, bevor die Digitalisierung alles durchdrang. Das Beste im Sinne von: größte Verbreitung bei niederschwelligem Zugang. […] Die alte Öffentlichkeit gibt es nicht mehr. Sie wird nicht irgendwann erledigt sein, sie ist es schon. Die Digitalisierung, die wunderbare Effekte auf viele Lebensbereiche hat, hat auf ihrem Urgrund, der menschlichen Kommunikation, eine alles zerstörende Explosion verursacht. Für die ehemalige Öffentlichkeit, die, mit all ihren Fehlern und Schwächen, einmal die informelle Macht der Demokratie war, hat es den Effekt, den es auf die Wirtschaft hätte, wenn jeder sich zu Hause sein eigenes Geld drucken könnte« (MENASSE 2019).
Die neue, digitale Öffentlichkeit ist noch eine große, bunte, interessante und gefährliche Baustelle. Anknüpfend an die zunächst mit dem Internet verbundenen Hoffnungen schrieb Michael Seemann 2017 in seinem Blog ctrl+Verlust:
»Die Demokratisierung der Öffentlichkeit durch das Internet ist und bleibt die radikalste Revolution unserer Zeit. Doch wie bei jeder Revolution ist es naiv zu glauben, dass sie nur positive Effekte kennt. Meinungsfreiheit von einem abstrakten Recht zu einer tatsächlichen Praxis zu machen, war ein enormes Sozialexperiment mit unvorhersehbaren Folgen. Und wir schwenken gerade erst in die Periode ein, in der uns die ersten Untersuchungsergebnisse vor den Latz geknallt werden. Beim Auswerten der Daten dann der Schock: Enzensbergers Medientheorie entpuppte sich mehr als Milton Friedmann, denn Marx. Jedenfalls gleicht die Demokratisierung der Medienöffentlichkeit in ihrer Praxis mehr einer Deregulierung des Wahrheitsmarktes. Die Ergebnisse zeigen im Einzelnen genau dieselben Auswirkungen, die wir von jeder Marktderegulierung kennen: Kostendruck bei den Marktführern, das Auftauchen von neuen Wettbewerbern und schließlich die Ausnutzung von Lücken im System durch ›bad actors‹« (SEEMANN 2017).
Wir wissen (noch) nicht, wie Demokratien mit der digitalen Öffentlichkeit als neuem Betriebssystem funktionieren können. Was wir dagegen wissen ist, dass es ungebrochen viele Bedrohungen gibt für unsere Freiheit und für die der Information. Die freiheitliche Demokratie war nie eine häufige Regierungsform und im 21. Jahrhundert scheint sie weltweit betrachtet auf dem Rückzug. International wie national werden Desinformationsund Propagandakampagnen unternommen.
Wir erleben einen Informationsdschungel, in dem ein Teil der Gesellschaft die Übersicht verloren hat. Der Soziologe Ulrich Beck hat einmal bemerkt, die politische Macht habe, wer über die Zulassung von Themen zur Öffentlichkeit entscheide (BECK 2014). Heute ist die Veröffentlichung an sich kein begrenzender Faktor mehr. Man müsste wohl präzisieren, dass die Macht in den Händen derer liegt, die über die Zulassung zur Aufmerksamkeit entscheiden.
Krise der Nachrichten kommt zur Unzeit
Nach den Jahren der gesellschaftspolitischen Euphorie über die Chancen der Digitalisierung zeigt sich in den 2020er-Jahren vielleicht eine skeptisch-ängstliche Übertreibung in die andere Richtung. Ob das so ist, werden wir eines Tages im Rückblick beurteilen können. Wichtig ist, dass diese Phase des ›Techlashs‹ genutzt wird, damit am Ende weder Huxleys noch Orwells Prophezeiungen wahr werden, damit es nicht zu einer ›Infokalypse‹ kommt. Diesen Begriff hat der Technologieforscher Aviv Ovadya geprägt. Er meint damit, »a catastrophic failure of the marketplace of ideas«, eine Situation, in der entweder niemand mehr irgendetwas glaubt oder in der alle auf Lügen hereinfallen (OVADYA 2018).
Insbesondere im Westen haben wir es noch in der Hand, die neue digitale Phase menschlich und freiheitlich zu gestalten. Anders ausgedrückt: US-Unternehmen wie die fünf aus der GAFAM-Gruppe (Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft) können Gegenstand demokratisch legitimierter Regulierung bis hin zur Zerschlagung werden. Man sollte daher trotz allem froh sein, dass sie nicht aus Peking oder Petersburg gesteuert werden.
Egal wie es mit Big Tech weiter geht, eines ist klar: Die FAZ oder die New York Times werden nicht allein deshalb in die Zukunft kommen, weil sie lange erfolgreich Papier bedruckt haben. Fernsehsender und Radiostationen werden sich nicht auf ihre lineare Ausstrahlung verlassen können, selbst wenn diese schon digitalisiert ist und Streaming genannt wird. Die Informationsanbieter müssen sich das Vertrauen neu verdienen. Die Lorbeeren von früher und der gute Name können dabei etwas helfen, mehr nicht.
In jedem Fall kommt die Krise der Nachrichten zur Unzeit, denn wir brauchen sie heute eigentlich lebendiger, vielfältiger und stärker denn je. Wir brauchen auch in den wichtigen Fragen einen Bestand an gemeinsam geteilter Information, selbst wenn die Bewertung sich deutlich unterscheiden mag. Es besteht kein Grund, unseren westlichen Informationsjournalismus zu idealisieren. Doch mit ihm verhält es sich ähnlich wie mit der Demokratie: Sie wird gerne als die schlechteste Staatsform bezeichnet – mit Ausnahme aller anderen.
Es lohnt also, die Probleme und Schwächen unserer Nachrichten genauer anzuschauen. Das Ziel ist, diesen wichtigen journalistischen Bereich zu stärken. Im Übrigen gilt für die Krise der Nachrichten, was der österreichische Wissenschaftler Gernot Wagner mit Blick auf die Klimakrise gesagt hat: »Für Pessimismus ist es zu spät« (GAULHOFER 2017).
KAPITEL 2MEHR PROBLEME ALS GENUG: NACHRICHTEN UNTER DRUCK
Lange schien die Nachrichtenwelt in Ordnung. So war es zum Beispiel am Donnerstag, dem 8. Januar 1976. Damals versammelte sich in meiner kleinen westdeutschen Heimatstadt am Nachmittag eine Menschenmenge vor einem Schaufenster. Es gehörte zu einer der beiden Lokalzeitungen, die es auch in unserem Ort noch im Plural gab. Als ich endlich durchgekommen war, sah ich den Grund der Aufregung: Die Redaktion hatte eine Eilmeldung ins Fenster gehängt. Zhu Enlai war gestorben, der langjährige Premierminister der Volksrepublik China, Maos Vertrauter und Rivale.
Ein abgerissenes Stück Fernschreibpapier mit Tesafilm in einem Fenster befestigt, so wurden ›Breaking News‹ 1976 verbreitet. Es sollte noch Jahre dauern, bis mit France Info das erste Nachrichtenradio in Europa oder der TV-News-Kanal CNN in den USA auf Sendung gingen. Smartphones, Nachrichten-Apps oder Twitter waren jenseits aller Vorstellungskraft. Dennoch elektrisierte die dürre Meldung aus dem fernen China die Passanten und brachte sie auf dem Bürgersteig unserer Kleinstadt ins Gespräch.
Die meisten würden die Nachricht anderen weitererzählen. Später würden sie im Radio und abends in den Fernsehnachrichten mehr erfahren. Am nächsten Morgen wartete dann die Zeitung mit weiteren Hintergründen auf und vermutlich mit einem Kommentar zum Stand der Dinge in Peking aus weltpolitischer Perspektive. Die Aufgabenverteilung der Informationsmedien war klar und komplementär, die Geschäftsmodelle waren gut abgesichert.
Kaum jemand wäre damals auf die Idee gekommen, die Nachrichtenanbieter grundsätzlich infrage zu stellen. Dabei war die gesellschaftliche Stimmung 1976 in der alten Bundesrepublik angespannter als heute. Der RAF-Terror hielt das Land in Atem. Der Kalte Krieg lastete schwer auf allem und auf allen. Erst nach einem langen und harten Wahlkampf sollte sich Bundeskanzler Helmut Schmidt knapp gegen seinen Herausforderer Helmut Kohl behaupten, der mit der polarisierenden Parole »Freiheit statt Sozialismus« angetreten war. Die gerade eingeführte Gurtpflicht für Autofahrer erregte die Gemüter ähnlich stark wie heute der Begriff ›Impfpflicht‹. Natürlich wurde über den Journalismus gestritten. Öffentlich-rechtliche Sender wurden als ›Rotfunk‹ oder ›Schwarzfunk‹ attackiert, Zeitungen wurden Lagern zugeordnet und entsprechend angegriffen. Doch niemand wäre auf die Idee gekommen, ›Lügenpresse‹ zu rufen.
Diese Zeiten sind erst einmal vorbei. Heute bekomme ich E-Mails wie diese vom 30.8.2020, in der ein Hörer mir mitteilt:
»Ihren Sender wie auch die andere Lügenpresse, ARD, ZDF und andere staatskonforme Medien werde ich nicht mehr konsumieren. Ihr solltet euch [sic!] schämen, aber wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Lügen sie [sic!] weiter so, und im Internet findet man die richtigen Informationen. Wir brauchen euch nicht!!!«
Die Lage des Nachrichtenjournalismus ist schwierig geworden. Lassen Sie uns einen Blick auf einige Aspekte der Krise werfen. Beginnen wir aber mit der Frage, worum es bei den Nachrichten überhaupt geht.
Nicht klar definiert? – Was mit Nachrichten gemeint ist
Die wunderbare Welt der Nachrichten ist reich und vielgestaltig, sie ist bunt und widersprüchlich. Nachrichtenkulturen haben sich über Jahrhunderte entwickelt. Sie unterscheiden sich trotz global wirksamer Trends nach wie vor von Land zu Land erheblich, selbst unter ähnlich verfassten Staaten. Innerhalb der einzelnen Gesellschaften wiederum zeigt sich ebenfalls eine beachtliche Vielfalt im Informationsbereich. Diese Unterschiede machen allgemeine Urteile über ›die Nachrichten‹ fast unmöglich, wie auch die pauschale Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Rolle des Informationsjournalismus. Und dennoch will ich der Frage nicht ausweichen: Was genau meinen wir, wenn wir von ›den Nachrichten‹ sprechen?
Fest steht, dass wir es nicht mit einem geschützten Begriff zu tun haben. Es gibt keine DIN-Norm, niemand hat ein Patent auf die Nachrichten, auf das man sich berufen könnte. Das deutschsprachige Standardwerk von Dietz Schwiesau und Josef Ohler schlägt folgende Definition vor:
»Die Nachricht ist eine direkte, auf das Wesentliche konzentrierte und möglichst objektive Mitteilung über ein neues Ereignis, das für die Öffentlichkeit wichtig und/oder interessant ist« (SCHWIESAU/OHLER 2016: 1).
Dieser sorgsam komponierte Satz verbindet Nachrichtenfaktoren wie Aktualität und Bedeutsamkeit mit dem Hinweis auf die kurze Form und den Anspruch auf Objektivität. Aus der angelsächsischen Welt kann man als Kontrast eine kürzere und entschiedenere Definition dagegenhalten, deren Quelle so unklar ist wie das Zitat bekannt: »News is something which somebody wants suppressed. All the rest is advertising« (QUOTEINVESTI-GATOR 2015). Diese Beschreibung nimmt eine völlig andere Perspektive ein, sie setzt radikal und ausschließlich auf das Moment des Investigativen und Enthüllenden. Die Liste der begrifflichen Annäherungen an die Nachrichten aus Wissenschaft und Praxis ließe sich beliebig verlängern, ohne die eine, abschließende Antwort zu bringen.
Brüder Grimm und Duden
Vielleicht helfen die Wörterbücher weiter. Sie stehen im Ruf, in knapper Form für Klarheit zu sorgen. Der deutschsprachige Nachrichtenjournalismus ist besonders stolz auf die Erwähnung im ehrwürdigen Grimmschen Wörterbuch. Es lässt uns wissen, dass das Wort ›Nachricht‹ erst seit dem 17. Jahrhundert belegt sei und zunächst eine »mittheilung zum darnachrichten« bezeichnet habe. Zweitens sei die Nachricht »überhaupt (die) mittheilung einer begebenheit.«
Die berühmte Definition, eine Nachricht sei dafür da, dass man sich danach richte, ist ambivalent. Denn wenn auch ein Element der Zuverlässigkeit und Orientierung mitschwingt, so scheint es mir doch eher um eine Durchsage von oben zu gehen, also um etwas, nach dem sich die Menschen richten sollen. Nebenbei erwähnt: Selten zitiert und nicht ganz so ruhmbringend für unser journalistisches Metier ist, was die Grimms als dritte Möglichkeit für »die Nachricht« erwähnen, nämlich den »gegensatz zu vorricht: nach der eigentlichen mahlzeit noch angerichtete und aufgetragene speise, der nachtisch« (GRIMM 1854-1961).
Mehr als 150 Jahre nach den Brüdern Grimm listet der Duden heute zwei Bedeutungen für ›Nachricht‹ auf:
»1. Mitteilung, die jemandem in Bezug auf jemanden oder etwas [für ihn persönlich] Wichtiges die Kenntnis des neuesten Sachverhalts vermittelt. 2. Nachrichtensendung« (DUDEN).
Hier wird spürbar, wie fließend der Übergang ist zwischen individueller, zwischenmenschlicher und alltäglicher Kommunikation auf der einen Seite sowie der journalistischen Information auf der anderen. Nachrichten sind nichts, um das herum ein Berufsstand wie die Glasbläser oder eine Wissenschaft wie die Astrophysik einen Zaun errichten könnte. Jede und jeder einzelne wirkt an der Herstellung und Verbreitung von Nachrichten mit, hat eigene Expertise und will mehr oder weniger stark mitreden. Von daher ist der vielbeschworene Effekt der sozialen Medien, uns alle zu potenziellen Nachrichtenanbietern zu machen, gar nicht neu. Eher wird heute ein Grundzug wieder stärker erkennbar, der in der Hegemoniephase der elektronischen Massenmedien vorübergehend in den Hintergrund getreten war.
Noch einmal zurück zum Duden. Die Definition des Begriffs ›Nachricht‹ wird dort durch Beispiele für den Sprachgebrauch veranschaulicht. Sie lassen deutlich werden, dass der Plural ›die Nachrichten‹ im Gegensatz zum Singular ›Nachricht‹ eng mit dem Journalismus verbunden ist. Damit gemeint ist eine Nachrichtensendung oder allgemein die Nachrichtenlage eines Tages, übermittelt durch Medien verschiedener Art. Für diese Unterscheidung spricht auch, dass wir die Bestandteile von Nachrichtensendungen zumeist Meldungen nennen. Kaum jemand würde da von einzelnen Nachrichten sprechen. Man könnte also sagen, der Singular von ›Nachrichten‹ heißt Meldung, so wie eben auch die kürzeste und aktuellste Information Eilmeldung genannt wird und nicht etwa ›Eilnachricht‹.
Im werblichen und dröhnenden Journalismus, aber auch in Angeboten für jüngere Menschen, hat sich im deutschsprachigen Bereich der Begriff ›News‹ breit gemacht. Auch in diesem Fall soll der Anglizismus vermutlich Weltläufigkeit, Professionalität, Modernität und Frische suggerieren. Außerdem ist der Begriff anschlussfähig an die aus dem späten 20. Jahrhundert bei vielen kulturell noch nachwirkende große Zeit der US-Nachrichtenkanäle mit den dramatischen ›Breaking News‹.
Warum es Nachrichten gibt
Nähern wir uns der Frage von einer anderen Seite, werfen wir einen Blick auf die Ursprünge. Der Journalistenberuf ist nach allgemeiner Einschätzung in der Neuzeit entstanden. Für den Historiker Jörg Requate war es erst im 19. Jahrhundert mit dem Aufstieg der Presse so weit (REQUATE 1995). Die Geschichte der Nachrichten und ihrer Übermittlung dagegen ist so alt wie die von uns Menschen, die wir uns immer schon untereinander auf dem Laufenden gehalten haben. Mitchell Stephens hat die erste Auflage seiner History of News daher mit dem Untertitel From drum to satellite versehen (STEPHENS 1988).
Die Nachrichten sind ewige Begleiter der Menschheit und die Gründe dafür liegen auf der Hand. Ganz vorne ist die Neugier als nie zu unterschätzende Grundkonstante. Den größten Teil unserer Informationen bekommen wir im Alltag, von Verwandten, Freunden, Nachbarinnen, Kolleginnen oder Mitschülern. Daran hat sich wenig geändert, auch wenn diese Informationen uns jetzt über soziale Medien, E-Mails oder im Beruf auch via Intranet erreichen und seltener als früher in der Bäckerei oder am Brunnen.
Neben dem Privaten und Nahen war das Wissen um das Geschehen jenseits des engeren Lebensraums schon immer wichtig, oft sogar lebenswichtig. Denken Sie an ein Dorf, irgendwo im Europa des 14. Jahrhunderts. Es war nicht nur dort und damals entscheidend, von sich nähernden feindlichen Truppen rechtzeitig zu erfahren oder vom Ausbruch der Pest, einen Tagesritt entfernt. Diese existenzielle Bedeutung von Nachrichten konnten die meisten in den Industrienationen spätestens nach dem Ende des Kalten Kriegs eine Weile lang vergessen. Die globale Corona-Krise hat uns mit Macht daran erinnert.
Für Informationen, die unser unmittelbares Erleben räumlich und zeitlich überschreiten, für Einordnungen und Erklärungen, die der eigene Wissensstand nicht erlaubt, dafür greifen Menschen seit langem auf professionelle Angebote zurück. Das ist nichts Überraschendes in Gesellschaften, die überall Spezialisierung und Arbeitsteilung entwickelt haben. Heute würde sich niemand in einem Industrieland die Zähne selbst ziehen oder diese Aufgabe dem Friseur anvertrauen, auch wenn das früher sehr üblich war.
In diesem Sinne haben sich auch die Medien als eigener Bereich etabliert – und sie haben sich ausdifferenziert: ›Den Journalismus‹ gibt es schon lange nicht mehr. Von ›dem Journalismus‹ zu sprechen, das ist ähnlich unsinnig und ärgerlich wie die journalistische Unart, über ›die Lage in Afrika‹ oder ›die Stimmung in Lateinamerika‹ zu reden. Auch der Medienbereich kennt Fachgebiete und Spezialistentum, ein wichtiges Beispiel sind die Nachrichten.
Genauso alt: die Falschmeldung
Genauso alt wie die Nachrichten sind ihre oft zum Verwechseln ähnlichen Geschwister: das Gerücht, die Halbwahrheit und die Falschmeldung. Die Gründe für deren Verbreitung lauten oft Unwissenheit oder gezielte Täuschung – und manchmal liegen sie irgendwo dazwischen. Die digitalen Möglichkeiten zwischen ›Cheap Fakes‹ und ›Deep Fakes‹ sind atemberaubend und beängstigend. Und doch sind die zuletzt vielbeachteten Phänomene ›Fake News‹ und ›Framing‹ weder im Kern neu, noch sind es die dahinterliegenden Motive. Es ändern sich die Medien und Techniken, die genutzt werden, nicht Desinformation und Manipulation an sich. So wird es vermutlich bis zum Ende aller Tage bleiben.
Heute sprechen wir beispielsweise über Internetpropaganda aus Russland. Dass die Sorge darüber berechtigt ist, das hat uns unter anderem Nina Jankowicz in How to Lose the Information War deutlich gemacht (JANKOWICZ 2020). Die Petersburger Troll-Fabriken trugen einmal den interessanten Namen ›Agentur für Internetforschung‹. Ein Teil ihres Personals ist inzwischen vom FBI zur Fahndung ausgeschrieben. Auch wenn diese neueste Generation die in Russland traditionelle Propaganda ebenso aktiv wie geschickt betreibt, die Troll-Fabriken müssen sich noch anstrengen, um eine Wirkung zu erzielen wie ein angeblicher römischer Kaisererlass aus dem 4. Jahrhundert.
Gemeint ist die ›Konstantinische Schenkung‹, mit der die Päpste für eine halbe Ewigkeit ihren Anspruch auf weltliche Herrschaft und den Zugang zu umfangreichen Ressourcen begründet haben. Wie wir heute wissen, wurde diese sehr erfolgreiche Falschmeldung um das Jahr 800 erfunden. Von anderer Art, aber ebenfalls mit gewaltiger Wirkung war die Propagandalüge, die man ›Dolchstoßlegende‹ nennt. Die Idee, Deutschland habe den Ersten Weltkrieg ›im Felde unbesiegt‹ nur durch das Handeln feiger Politiker verloren, traf auf offene Ohren und trug zum Niedergang der Weimarer Republik bei.
Immer wieder wurden und werden mit ›Fake News‹ Kriege oder Bürgerkriege angeheizt. Die Lügen hinter dem Völkermord in Ruanda und Maos Kulturrevolution, hinter dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien und der Herrschaft der Roten Khmer in Kambodscha, das sind nur vier furchtbare Beispiele aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Manche dieser Lügen sind schwer aus der Welt zu schaffen, wie eine der übelsten Fälschungen der Geschichte überhaupt: Im Russland des frühen 20. Jahrhunderts wurden, möglicherweise von der zaristischen Geheimpolizei, die sogenannten ›Protokolle der Weisen von Zion‹ erfunden, die bis heute unbelehrbaren Menschen als Beleg für eine angebliche jüdische Weltverschwörung dienen.
Die meisten medial verbreiteten Lügen und Halblügen lösen glücklicherweise keine Kriege aus. Doch der Anteil der Informationen ist groß, die auf einer halben Wahrheit, einer Zuspitzung, auf Spin oder tatsächlich auf einer kompletten Unwahrheit beruhen. Dieses schleichende Gift trägt mit dazu bei, dass das Vertrauen der Menschen in die Nachrichten abnimmt. Es ist eines der Probleme, die der Informationsjournalismus nicht allein lösen kann.
Politische und wirtschaftliche Interessen
Eine mächtige historische Konstante ist der Wunsch, Informationen zu kontrollieren, die Infrastruktur und die Inhalte. Ein wesentliches Motiv war und ist die Absicherung oder Vermehrung politischer Macht. Die Geschichte ist reich an Beispielen. Manchmal geht es zumindest vordergründig um ideologische oder religiöse Fragen. Dann lassen Parteien oder Bewegungen Zensur und Gewalt ausüben, in Theokratien der Vergangenheit und Gegenwart waren und sind es der Papst oder ein Ayatollah. Immer wieder im Mittelpunkt stehen wirtschaftliche Interessen, noch heute. Wer sich anschaut, wem große Medienunternehmen weltweit gehören, der weiß, wovon die Rede ist.
Immer wieder waren militärische Bedürfnisse Katalysatoren technischer Entwicklungen in der Kommunikation, so zum Beispiel bei den Anfängen des Rundfunks nach dem Ersten Weltkrieg. Daneben waren wirtschaftliche Interessen zu allen Zeiten der zweite wichtige Entwicklungstreiber des Nachrichtengeschäfts. Julius Reuter begann 1849 in Aachen mit einem Brieftaubendienst für Börsennachrichten zwischen Deutschland und Brüssel. Damit legte er den Grundstein für eine der wichtigsten Nachrichtenagenturen der heutigen Welt. Auch andere Innovationen im Bereich der Information gehen auf kommerzielle Ziele zurück. Das galt für Infrastruktur und Netzwerke wie die im 19. Jahrhundert revolutionären Unterseekabel, das gilt für Facebook und Co. in unserer Zeit. Die Verbreitung und die Diskussion von Nachrichten waren und sind meist nur ein Kollateralnutzen oder der Punkt, an dem mit Werbung und Datensammlung gewinnbringend angesetzt werden kann.
Die Welt der Spezialnachrichten
Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Nachrichtenangebote und -redaktionen. Zunächst fällt auf, dass es enorm viele Spezialisierungen gibt: Eine wichtige Sonderrolle spielen Nachrichten aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, sowohl in den klassischen Medien im Stil des ARD-Angebots Börse vor acht als auch in Form von Dienstleistungen, die zahlungskräftigen Abonnenten Insiderwissen versprechen. Ebenfalls auf den Wirtschaftsbereich haben sich bestimmte Nachrichtenagenturen als Zulieferer verlegt. Auch der Sportbereich kennt in der deutschsprachigen Welt mit dem Sport-Informations-Dienst eine weitgehend monothematische Nachrichtenagentur. Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk Kultur bieten täglich mehrere Ausgaben von Wissens- bzw. Kulturnachrichten. Viele Medien nehmen eine wichtige Spezialisierung anderer Art vor: Sie konzentrieren sich in der aktuellen Information auf eine Region oder eine Stadt.
Daneben bestehen weitere Formen der gruppenbezogenen Orientierung wie die Kindernachrichten, Nachrichtenangebote in Medien für jüngere Menschen oder auch Informationen in einfacher oder leichter Sprache. In den 1960er-Jahren begannen die ARD-Sender mit Radiosendungen in verschiedenen Sprachen für die – wie man damals noch sagte – Gastarbeiter. Schon lange sind daraus Integrationsangebote geworden, bei denen ein Teil der Informationen weiter auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten ist. Ein Beispiel ist das WDR-Programm Cosmo, dessen italienische Sendung Radio Colonia ich sehr gerne höre.
2017 stellte RADIO BREMEN die Nachrichten in lateinischer Sprache ein. Da sich auch der finnische Rundfunk zwei Jahre später von den Nuntii Latini verabschiedet hat, bleibt ein kleines, aber feines Publikum in seinem Spezialinteresse nun weitgehend unversorgt. Vielleicht entdeckt eine Leserin oder ein Leser dieses Buchs hier eine Marktlücke für sich.
Es gibt über das Genannte hinaus noch eine schier unendliche Vielfalt sektoraler Informationsangebote. Über jeden denkbaren Kanal werden Partikularinteressen angesprochen, von Medien, aber auch von Verbänden, NGOs und kommerziellen Akteuren. Dabei kann es um Golfsport gehen oder um Konsumentenberatung, um Menschenrechtsthemen oder um Brauchtumspflege. Verschiedene Branchen haben eigene Fachzeitungen oder andere für sie wichtige Informationsmedien, denen normale Netzsurfer oder Kioskkunden nie begegnen werden. Die Lebensmittel-Zeitung oder die Nachrichtenfür Außenhandel sind dafür zwei Beispiele von vielen.
Doppelte Facharztausbildung
Bei meinen Überlegungen geht es vor allem um einen enger gefassten Bereich, nämlich die klassischen, überregionalen Nachrichtenredaktionen. Sie legen ihren Schwerpunkt oft auf politische Themen. Haben sie den Anspruch, dabei auch das internationale Geschehen abzubilden, fällt hin und wieder der schöne Begriff der ›Weltnachrichten‹. Betrachtet man die Themenauswahl genauer, so kommen allerdings in den Nachrichten neben der Politik auch so gut wie alle anderen Themengebiete vor: Wirtschaft, Sport, Wissenschaft, Kultur, Weltanschauungen und einiges mehr.
Diese genannten Felder kennen Expertise und Vertiefung in Fachredaktionen. Nachrichtenredaktionen und verwandte Bereiche wie der aktuelle Zeitfunk im Radio müssen hingegen überall hinreichend sattelfest sein. Jedes Thema kann ohne Vorwarnung aktuell werden und muss dann kompetent bearbeitet werden. Die enorme Themenbreite und der hohe Aktualitätsdruck erfordern von Menschen in Nachrichtenredaktionen metaphorisch gesprochen gleich eine doppelte Facharztausbildung: die für journalistische Allgemein- und Notfallmedizin.
Noch eine weitere Besonderheit sei erwähnt. In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich gezeigt, dass die Nachrichtenredaktionen sich schneller und stärker als andere klassische Redaktionen für den digitalen Journalismus geöffnet haben. Der Informationsbereich ist besonders hart umkämpft, ohne Präsenz im Netz und auf den Smartphones ist er nicht mehr vorstellbar. Es kommt hinzu, dass weite Teile der nachrichtlichen Recherche inzwischen im Internet stattfinden.
Nachrichten sind Ansichtssache
Nun ist trotz aller Annäherung noch nicht geklärt, was denn nun das journalistische Produkt genau ist, das wir ›Nachrichten‹ nennen. Die Frage ist auch deshalb kompliziert, weil es recht unterschiedliche Perspektiven gibt. Aus der beruflichen Binnensicht scheint manchen der Fall klar: Nachrichten sind das, was aus der Nachrichtenredaktion kommt. Leser und Zuschauerinnen, Hörerschaft und Nutzergemeinde haben aber wenig Sinn für logische Kurzschlüsse. Sie geben nicht viel auf redaktionelle Organigramme und nicht viel mehr auf kommunikationswissenschaftliche Definitionen.
Nach dreißig Jahren Austausch mit Hörern und Nutzerinnen führt für mich nichts an der Feststellung vorbei: Fast jede und jeder versteht unter Nachrichten etwas anderes. Sie sind, wie man es im Englischen sagen kann, ›many things to many people‹. Viele Menschen halten Interviews, Kommentare, Reportagen und Features für Nachrichten. Auch die im Fernsehen allgegenwärtigen Talkshows gehören für manche dazu. Alle diese Formate und vieles mehr aus der nicht-journalistischen Sphäre können der Anlass sein, wenn Menschen sich über ›die Nachrichten‹ äußern.
Darüber zu klagen, führt nicht weit. Den Menschen vorzuschreiben, wie sie etwas wahrzunehmen haben, ist aussichtslos und anmaßend. Eine Schärfung der Aufmerksamkeit für Sinn und Zweck der journalistischen Nachrichten im engeren Sinne dagegen halte ich für möglich und sinnvoll. Das kann aber nur über geduldige und dialogische Prozesse gelingen, die Interesse wecken und Medienkompetenz fördern.
Infotainment und Soft News
Die Vermischung journalistischer Formen und die Verwirrung in Sachen Nachrichten sind aber nicht nur ein Problem auf der Empfängerseite. Schwer wiegt auch, was sich bei den Absendern getan hat: Zahlreiche Medien tragen zwar die Trennung von Nachricht und Kommentar zumindest in der Theorie wie eine Monstranz vor sich her. Mit der Trennung von Nachricht und Unterhaltung nehmen sie es hingegen nicht (mehr) so ernst. Dieses Infotainment wurde schon Mitte der 1980er-Jahre von Neil Postman und anderen beschrieben und beklagt.
Beweggründe dürften Auflage und Reichweite sein, die wiederum Grundlage sind für wirtschaftlichen Erfolg in Wettbewerbsmärkten. Diese Mechanik ist ein Teil dessen, was James Hamilton in seinem Buch beschreibt, das er All the News That’s Fit to Sell genannt hat (HAMILTON 2006), eine ironische Abwandlung des langjährigen Leitspruchs der New York Times. Auch die Ausprägung eines dualen Rundfunksystems mit teilkommerzieller Orientierung hat in vielen Ländern das Infotainment verstärkt. In Deutschland legen die großen TV





























