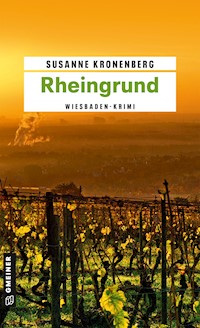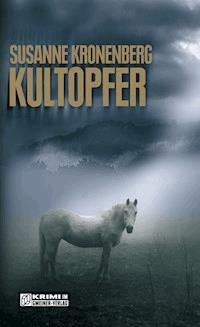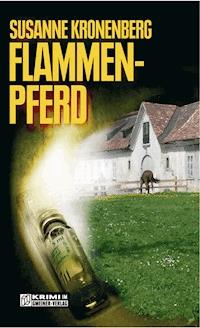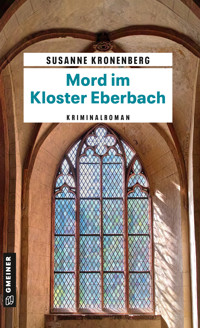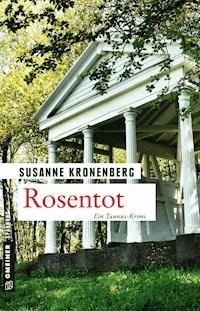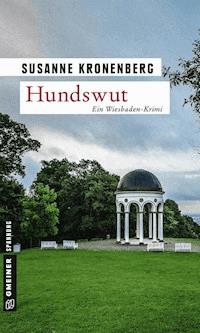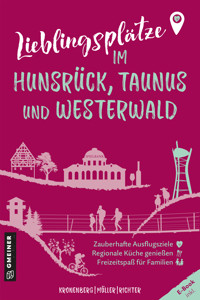Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Biografin Tess Bonifer
- Sprache: Deutsch
Tess Bonifer, Biografin und Historikerin, kommen Zweifel. Verschweigt ihr aktueller Auftraggeber verfängliche Informationen? Der Rheingauer Unternehmer richtet ein Museum für seinen Urgroßvater ein, einst ein bekannter Maler, und Tess soll dessen Biografie schreiben. Kurz zuvor zog sie ins Weinstädtchen Eltville zu ihrem Winzerfreund Jannis, der um die Zukunft seines Weinguts bangt. In einer ehemaligen Mühle bei Schlangenbad kommt Tess der unrühmlichen Vergangenheit des Malers auf die Spur. Und sie erkennt, dass auch im Hier und Jetzt tödliche Gefahren lauern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Kronenberg
Rheingau Vernissage
Kriminalroman
Zum Buch
Kunstverdruss Im Rheingau entsteht ein neues Kunstmuseum. Mit dem »Edwineum« möchte Gerold Busold, ein kunstsinniger Unternehmer, die Werke seines Urgroßvaters ins Licht der Öffentlichkeit rücken. Die schöpferische Inspiration für seine außergewöhnlichen Tierporträts fand Edwin Busold um 1900 in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Der Journalist Rico Biella übernimmt den Auftrag, das Leben und Wirken des vergessenen Künstlers in einer Biografie zu würdigen. Doch bevor seine Arbeit erledigt ist, verreist er überraschend. Gerold bittet daraufhin Tess Bonifer, das Manuskript zu Ende zu führen. Die Historikerin und Biografin, die kurz zuvor ins Weinstädtchen Eltville auf das Weingut ihres Freundes Jannis gezogen ist, nimmt den Auftrag an. Und während sie sich in ihrem neuen Zuhause auf dem Weingut einrichtet, kostet das beklemmende Erbe des vergessenen Künstlers ein Leben.
Susanne Kronenberg lebt und schreibt im Taunus bei Wiesbaden. An ihrer Wahlheimat liebt sie die Nähe zum Rheingau, einem geschichtsträchtigen Landstrich zwischen Rhein und Rebenhängen. In der Weinbauregion von Weltruf führt sie ihre Protagonistin Tess Bonifer durch beschauliche Winzerstädtchen und auf eine unheilvolle Entdeckungsreise. Neben 14 Kriminalromanen veröffentlichte die Autorin Kurzgeschichten für verschiedene Anthologien, eine Reihe von Jugendbüchern sowie Fachbücher und Bücher zu regionalen Themen. Als Dozentin für Kreatives Schreiben gibt sie ihre Freude am Schreiben in Kursen und Workshops weiter. Sie ist Mitglied des »Syndikats« und Mitgründerin der Wiesbadener Autorengruppe »Dostojewskis Erben«.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © buchpetzer / Shutterstock.com
ISBN 978-3-7349-3174-1
Deutsch-Südwestafrika im Jahr 1904
Bleiern verfängt sich die Luft im staubigen Dickicht. Nicht ein Hauch ist zu spüren. Der Schatten des Kameldornbaums erweist sich als noch dürftiger als befürchtet. Edwin lässt sich nicht beirren. Rasch und mit geschultem Auge macht er die beste Position aus und rammt den Sitzstock in den Boden. Breitbeinig nimmt er darauf Platz und schlägt den Skizzenblock auf. Aus Sorge, der Schweiß könne das Papier besudeln, wischt er sich unablässig mit dem Handrücken über die Stirn. Der Sitzstock ist unbequem, was Edwin nicht kümmert. Vor ihm im roten Sand lauert der Mähnenlöwe. Geduldig seziert Edwin das Raubtier mit Blicken, bevor seine geübte Hand den Bleistift führt. Hochkonzentriert skizziert er sein Motiv: den mächtigen, sehnigen Körper vor dem Panorama des endlosen Buschlands. Dabei lässt er die Fliegenschwärme, die brummend die blutigen Flanken umkreisen, ebenso unbeachtet wie die Holzpfosten und Seile, mit denen seine Männer den Kadaver in einer stabilen Position fixiert haben. Wie vor seinem Tod sitzt das Tier auf den Vorderbeinen aufgerichtet da, während sein Hinterleib auf den angewinkelten Hinterläufen ruht. Das mähnenumwobene Haupt erhebt sich stolz über den gewaltigen Vorderpranken. Der Löwe scheint wie zum Sprung bereit. Mit einer Gelassenheit, die ihm unbändige Kraft verleiht, und aufmerksam nach Beute Ausschau haltend: In dieser Haltung wird Edwin den König der Savanne mit präzisen Strichen zum Leben erwecken.
Während er die Linien des Löwenhaupts einfängt, trägt die drückende Luft die Stimmen seiner Männer heran. Mürrisch lungern sie um die Dornenhecke herum, spielen Karten oder erholen sich von der Jagd. Der Vormann lehnt in Sichtweite an einem verdorrten Stamm und döst vor sich hin. Stundenlang sind sie der Fährte der Löwengruppe gefolgt. Stets auf der Hut vor Elefanten und Büffeln, vor Raubtieren und Aufständischen. Am frühen Morgen gelang Edwin der Schuss, der ihm nun erlaubt, seine Beute unmittelbar am Ort des Geschehens auf das Papier zu bannen. Wie jedes seiner tierischen Motive tötete er den Löwen, um ihn anschließend – als wiederbelebtes Geschöpf – in seinem Lebensraum darzustellen. Im Busch zeichnet er mit Bleistift und Kohle und beschränkt sich auf Schwarz, Weiß und Grauschattierungen. Doch er wird jede einzelne Farbe und ihre Nuancen akribisch in Erinnerung behalten. Zurück in Deutschland will er sich mit ganzem Herzen der Malerei widmen, so sein Ansinnen, und den Löwen in seiner Pracht und Farbigkeit malen. Mit seinem sandfarbenen Fell und der wallenden Mähne, deren Kolorierung von Rötlich über Dunkelbraun bis Schwarz changiert. Die Zeichnungen aus Afrika sollen ihm zu Hause als Vorlagen für seine Ölgemälde dienen.
Der Raubtierschädel ist erfasst. Als Nächstes folgen die Augen. Tote Augen, denen er einen intensiven Ausdruck von Willensstärke, Klugheit und Mut verleihen wird. Er legt sein gesamtes künstlerisches Geschick dahinein. Hingebungsvoll arbeitet Edwin an den Pupillen. Hier noch ein Strich, dort ein Punkt. Es ist geschafft.
Als er beglückt innehält und vom Blatt aufschaut, bemerkt er in der Ferne eine Bewegung hinter einer Ansammlung struppig-gelber Grashorste. Zwischen zusammengekniffenen Lidern hält Edwin Ausschau. Fünf Eingeborene nähern sich dem Kameldornbaum. Nein, nicht fünf, korrigiert er den ersten Eindruck. Sie sind zu sechst. Das Kind hat er zunächst übersehen. Seine Stirn reicht kaum über die Grashalme hinaus. Allesamt schemenhafte nackte Gestalten und so durchscheinend mager, dass die Männer selbst im Näherkommen kaum von den Frauen zu unterscheiden sind. Als sie Edwin und seine Leute entdecken, bleiben sie erschrocken stehen. Verängstigt rotten sie sich zusammen. Verharren schweigend, als fehle ihnen die Kraft, sich untereinander zu beraten. Für eine Flucht ist es ohnehin zu spät.
Schließlich wagt das Kind einen Vorstoß. Mit kleinen Schritten trottet es dem Baum entgegen. Es bemerkt den Löwen, zaudert, erkennt dessen Harmlosigkeit und steuert auf Edwin zu, der abwartend auf dem Sitzstock kauert. Mit wilder Entschlossenheit streckt ihm das Kind die spindeldürren Ärmchen entgegen. Es hält einen Gegenstand in den Händen. Ein Spielzeug aus Holz. Eine Löwenfigur mit stämmigen Beinen. Grob geschnitzt, die Mähne angedeutet. Das Maul leicht geöffnet. Zu große Ohren. Die Augen weit aufgerissen.
Edwin steht auf. Er klemmt sich den Block unter den Arm, greift nach der Figur und schiebt sie sich unter die Jacke.
Wie winzige Raubtierzähne piksen ihm die hölzernen Tatzen in die Haut.
1
Eltville im Rheingau
Im Laufschritt durchquerte Tess den Hof und warf einen Blick in Regina Meiburgs Kunstgalerie, hinter deren Fenstern sich zahlreiche Gipsmasken aufreihten. Eine Gemeinschaft blasser Geister. Gespenstische Objekte, obwohl es sich keinesfalls um die Gesichtsabdrücke Verstorbener handelte. Die Künstlerin arbeitete ausschließlich mit äußerst lebendigen Personen, die – nebenbei bemerkt – gutes Geld für diese Kunst zahlten. Bei Tess, deren »vom Leben geprägte Züge« sie reizten, hätte Regina auf Bezahlung verzichtet, doch Tess dachte gar nicht daran. Allein der Gedanke, sich eine dicke Paste auf Wangen, Stirn und Nase schmieren zu lassen, bereitete ihr Abscheu und sorgte für Atemnot.
Im Haus genügten ihr fünf Minuten, um Ricos Wohnungsschlüssel aus dem Küchenschrank zu kramen, die Treppen ins Dachgeschoss hinaufzuhechten und sich dort oben den Schlüssel des SUV zu greifen, der auf dem Schreibtisch gelegen hatte. Seit ihrem letzten Besuch in der Wohnung war dort einiges geschehen. Karl und Regina hatten aufgeräumt. Das schimmlige Obst war aus der Küche verschwunden, das gebrauchte Geschirr gespült. Die Arbeitsplatte zeigte sich blitzblank gewienert.
Mit dem Autoschlüssel kehrte sie in den Hof zurück und lief zum hinteren Parkplatz. Mit leisem Klacken sprangen die Türschlösser auf. Wachsam schaute sie sich um. Karl könnte sie jetzt am wenigsten gebrauchen. Der Blick in den Kofferraum offenbarte nichts von Belang. Sie öffnete die Tür hinter dem Beifahrersitz. Dort lag etwas im Fußbereich. Ein matt glänzendes schwarzes Gewebe, das sich kaum von der dunklen Bodenmatte abhob. Gespannt bückte sie sich und zog eine Jacke hervor. Ricos Lederblouson, von dem er sich selbst an sommerlichen Tagen nicht trennen mochte.
Wer ließ sein Lieblingsstück zu Hause, wenn er auf Reisen ging?
Auf der Knopfleiste des hauchzarten Materials saßen markante Messingknöpfe mit eingeprägten Löwenköpfen. Ein Knopf fehlte und hatte ein Loch im Leder hinterlassen. In der Jackentasche steckte ein Umschlag, der ein gerahmtes Foto enthielt. Sie erkannte den darauf abgebildeten Mann.
Ein Portemonnaie lag hinter dem Sitz auf dem Boden. Darin befanden sich neben Führerschein und Personalausweis mehrere Bankkarten, die Gesundheitskarte und Bargeld. Alles, was für eine Reise nach Namibia nötig wäre. Wie hätte Rico ohne Papiere ins Ausland aufbrechen können?
Bald darauf würde sie gleich zwei Männer verdächtigen, den Journalisten getötet zu haben.
Dabei war noch nicht einmal seine Leiche aufgetaucht.
2
Fünf Tage zuvor
Ich habe die Liebe meines Lebens getötet.
Entmutigt stierte Tess auf die hingekrakelten Wörter. Mit einem Ratschen riss sie das Blatt vom Block, schleuderte den zerknüllten Fetzen auf die Holzdielen und kickte ihn mit dem Fuß zu einem Haufen aus weiteren Papierbällchen. Es war zum Verzweifeln! Zuversichtlich hatte sie den Vormittag damit begonnen, sich schreibend der eigenen Vergangenheit anzunähern, und scheiterte am ersten Satz. Kein vernünftiges Wort brachte sie aufs Papier, obwohl ihr etliche Leute durchaus schriftstellerisches Talent attestierten. Anscheinend konnte sich diese Begabung nur entfalten, wenn es um die Schicksale fremder Menschen ging. Schreiben in eigener Sache: Genauso gut hätte sie sich in der Kelterei zu schaffen machen können. Dem einen war sie ebenso wenig gewachsen wie dem anderen.
Das Klingeln des Telefons rettete sie aus der kläglichen Selbstanalyse. Nach einigem Suchen stöberte sie den Apparat unter einem Zeitschriftenberg auf.
»Frau Bonifer?«, fragte eine unbekannte Männerstimme. »Spreche ich mit Tess Bonifer, der Biografin?«
»Das bin ich. Und Sie sind?«
»Mein Name ist Gerold Busold. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie am Sonntag störe.«
»Worum geht es?«, fragte Tess, die für jede Ablenkung dankbar war.
»Könnten Sie sich vorstellen, sehr kurzfristig einen Auftrag zu übernehmen?«
»Wenn Sie mir sagen, worum es sich handelt?«
Hastig entschuldigte er sich für seinen Übereifer. »Es geht um die Lebensgeschichte eines Künstlers, meines Urgroßvaters. Er war Maler. Könnten wir uns heute Mittag sehen? Dann erkläre ich Ihnen die Details.«
Ein Kunstmaler? Das gefiel ihr. Außerdem böte eine neue Schreibarbeit die willkommene Gelegenheit, sich den eigenen Erinnerungen zu entziehen. »Einverstanden, aber bitte verstehen Sie das nicht als Zusage.«
»Ich danke Ihnen. Die Adresse schicke ich Ihnen aufs Handy.«
Gleich darauf trafen die Daten ein. Eine Straße in Johannisberg, einem Ortsteil des Städtchens Geisenheim, das ebenso für seine hervorragenden Weine bekannt war wie für die Hochschule, die sich der Lehre über den Weinbau verschrieben hatte. Wie das Winzerstädtchen Eltville, in dem Tess neuerdings wohnte, lag auch Johannisberg im Rheingau. Für den Fußweg zum Bahnhof, die Zugfahrt und eine kurze Bustour bis zu ihrem Ziel müsste sie mit einer Dreiviertelstunde rechnen. Oder sie bat Jannis um den Wagen und wäre in 20 Minuten vor Ort. Obwohl sie sich vorgenommen hatte, seine Hilfsbereitschaft nicht auszunutzen, kam es häufig vor, dass sie ihn nach einem Gefallen fragte. Jannis hatte kein Problem damit, im Gegenteil. Er liebte es, ihr helfen zu können.
Nach einer Internetrecherche, um nicht unvorbereitet auf den potenziellen Klienten zu treffen, nahm sie ihre Jacke und verließ die Wohnung. So kalt und regenreich, wie sich der Mai verabschiedet hatte, war der Juni gestartet. Ihr Zuhause lag im Erdgeschoss eines dreigeschossigen, massiv gemauerten Kastens, der über anderthalb Jahrhunderte Dynastien von Winzergroßfamilien beherbergt hatte. Tess genügten zwei Zimmer. Eins zum Wohnen und Schreiben, das andere zum Schlafen sowie daran angeschlossen, was ihr wichtig war, ein Bad: ihr eigenes und nur für sie. Die geräumige Küche teilte sie sich mit Jannis, der ihr bester Freund und Vermieter zugleich war. Er hatte das Weingut inklusive des Wohnhauses und aller weiteren Gebäude gepachtet. Seine privaten Zimmer lagen auf der mittleren Etage.
Auf dem Weg nach draußen wandte sie sich kurz entschlossen um und stieg die Treppen hinauf. Vielleicht hatte sie Glück und traf Rico in seiner Wohnung im Dachgeschoss an. Vor zwei Wochen hatte er sie um Hilfe gebeten. Ob sie ihn mit Literatur versorgen könne, hatte er gefragt. Er müsse sich über die Kolonialgeschichte Namibias schlaumachen. Rico arbeitete als investigativer Journalist und war damit ziemlich erfolgreich. Sogar Chiffre Seven, ein bekanntes politisches Enthüllungsmagazin, druckte seine Reportagen.
»Ein Segen, dass ich mit einer Historikerin befreundet bin«, hatte er ihr geschmeichelt und beschwingt drei umfangreiche, von ihr im Antiquariat teuer erworbene Schinken über die deutsche Kolonialzeit nach oben getragen. Seitdem hatte sie ihn kaum zu sehen bekommen. Sie befürchtete, dass er zu jenen Freunden gehören könnte, die geliehene Bücher klammheimlich ihrem Besitz einverleibten, sofern sich der Ausleihende nicht gelegentlich in Erinnerung brachte. Nun kam sie allerdings vergebens. In der Wohnung rührte sich nichts auf ihr Klingeln und Klopfen. Sie würde es später erneut versuchen, beschloss sie, als sie das Haus verließ.
Der Innenhof war menschenleer. Vielleicht hielt Jannis sich in der Vinothek auf – voller Stolz auf den eleganten Laden und Verkostungsraum, den er im Frühjahr eröffnet und zuvor über den Winter mit gehörigen Kosten und großem handwerklichem Geschick eingerichtet hatte. Auf dem Weg dorthin legte Tess einen Abstecher in ihr Tattoostudio ein, das sie in einer ehemaligen Werkstatt betreiben durfte, um einen letzten Blick auf einen Entwurf zu werfen.
Das Schreiben bot ihr ein gewisses Einkommen, das sie vor allem dem Erfolg ihres Debüts verdankte. Dennoch reichte diese Arbeit, obwohl Tess bescheiden lebte, nicht für ihr Auskommen. Zusätzliches Geld verdiente sie mit dem Tätowieren. Das Stechen hatte sie als Jugendliche gelernt und die Freude daran beibehalten. Jannis wäre nicht Jannis gewesen, hätte er ihr auf dem Weingut ein eigenes Studio verwehrt. Dennoch schien er im Stillen zu befürchten, seine konservative Kundschaft könnte sich an den schrägen Typen stören, die bei Tess ein und aus gingen. An einem Mann wie Harry Eberling zum Beispiel. Dieser Hüne von Mensch bevorzugte selbst an kühlen Tagen Shorts und Muskelshirt, um möglichst wenig von seiner opulenten Körperkunst zu verdecken. Auf seiner Haut liebte Harry alles Getier, das bunt war und fliegen oder flattern konnte. Sein neustes Projekt war ein Schmetterling. Harry setzte großes Vertrauen in Tess’ Kunstfertigkeit und erwartete ihren Vorschlag. Sie betrachtete ihre Zeichnung prüfend. Der farbenfrohe Falter würde ihm gefallen, hoffte Tess, und sandte den Entwurf per Mail ab.
Danach steuerte sie die Vinothek an. Hinter dem Tresen war Jannis damit beschäftigt, eine Reihe von Weinkartons für die Auslieferung vorzubereiten. Die ruhigen Stunden am Sonntag nutzte er gern für solche Arbeiten. Er schaute auf, als Tess die Tür öffnete. Schillernde Rot- und Blautöne überzogen seine geschwollene rechte Wange. Die Haut über der Augenbraue war aufgeschürft, die Oberlippe dick.
»Du lieber Himmel«, entfuhr es ihr. »Lass mich fragen: Wie sieht dein Gegner aus?«
»Geprügelt habe ich mich nicht«, knurrte er.
»Dir ist klar, dass ich genau weiß, was eine Schlägerei anrichten kann.«
»Sicher, deine bewegten Jugendjahre. In meinem Fall irrst du dich.« Ihm gelang ein flapsiges Grinsen, was Tess angesichts seiner lädierten Oberlippe allein vom Hinsehen wehtat.
»Du humpelst, auch das noch«, bemerkte sie, als er hinkend hinter dem Tresen hervorkam. »Raus mit der Sprache: Mit wem hast du dich angelegt?«
»Mit der Treppe zum Weinkeller, ich bin gestolpert.« Vorsichtig betupfte er sein Gesicht. »Ein vergessener Eimer auf der Stufe. Ich war beladen wie ein Packesel. Hat mir einfach die Füße weggehauen.«
»Ach du Schreck! Wann ist das passiert?«
»Gestern kurz vor der Mittagszeit.«
»Warum hast du mich nicht gerufen? Ich hätte dich in die Notaufnahme gefahren.« Den Samstagvormittag hatte sie im Tattoostudio verbracht und an Harrys Schmetterling gefeilt. Der Eingang zum Weinkeller lag dem Studio gegenüber. Wenn sie ein neues Motiv entwarf, war sie vollkommen auf ihre Arbeit fokussiert und bekam nichts von ihrer Umwelt mit.
»Halb so wild«, murmelte er. Es hatte geklungen wie »alt und mild«. Von Milde und Altersweisheit war Jannis jedoch himmelweit entfernt.
»Was ist mit einem Arzt? Soll ich dich hinbringen?«
»Nicht nötig. Unkraut vergeht nicht. Kannst du mir mit dem Versand helfen und die Etiketten aufkleben?«, bat er deutlich verständlicher.
Jannis zeigte auf einen Stapel mit Adressaufklebern, der auf dem Tresen bereitlag. Während sie ihm zur Hand ging, stellte sie fest, dass eine größere Sendung für Oestrich-Winkel vorgesehen war.
»Ich fahre nachher nach Johannisberg. Die Anschrift liegt auf der Strecke.«
»Das trifft sich gut! Dann könntest du doch bitte die Auslieferung übernehmen. Meinen Anblick möchte ich der Kundschaft ersparen. Ich rufe kurz an und frage, ob es passt.«
Sein Lächeln fiel asymmetrisch aus, als er zum Telefon griff. Der Kunde stimmte der frühzeitigen Lieferung erfreut zu. Tess half Jannis, die entsprechenden Kartons auf einen Handkarren zu laden.
»Musst du wegen deiner Arbeit los?«, fragte er.
»Ja, kann sein, dass ich einen Schreibauftrag annehme. Sagt dir der Name Gerold Busold etwas?«
Behutsam platzierte Jannis die letzte Kiste auf der Ladefläche. »Sprichst du von dem Unternehmer Busold?«
»Ja, er ist Geschäftsführer eines Baustoffgroßhandels.«
Jannis nickte. »Ein renommiertes Familienunternehmen. Ich kenne den Mann persönlich. Gerold Busold kauft gelegentlich bei mir ein. Er wohnt in einer restaurierten Mühle bei Schlangenbad.«
Der kleine Ort mit großer Geschichte als Kurstadt lag zehn Kilometer vom Rhein entfernt im Taunus. Tess hatte ihn unlängst bei einem Spaziergang erkundet und vergebens darauf gehofft, auf eine Schlange zu stoßen. Das Städtchen verdankte seinen Namen der Äskulapnatter, einer ungiftigen Art, die in der Region heimisch war.
»Warum bestellt er dich nach Johannisberg?«, wunderte sich Jannis.
»Vielleicht befindet sich dort seine Firma?«
»Soweit ich weiß, hat das Unternehmen seinen Sitz in Wiesbaden. Busold wird seine Gründe haben. Nimm den Roten, er ist aufgeladen.«
Jannis reichte ihr einen Autoschlüssel. Er wusste, sie fuhr lieber mit dem wendigen Elektroauto als mit dem sperrigen Transporter.
Zielstrebig zog der Winzer mit dem Handkarren los. Tess begleitete ihn zu den Stellplätzen hinter der Scheune, die den hofeigenen Fahrzeugen vorbehalten waren. Der Kundenparkplatz lag vorn an der Straße. Der Parkplatz hinten war knapp bemessen. Es erforderte geschicktes Rangieren, um neben dem Elektroauto und Lieferwagen auch den Kombi des Verpächters und einen ausladenden SUV unterzubringen.
»Na, so was!«, rief Tess verwundert. »Die Monsterkarrre steht hier, obwohl Rico nicht zu Hause ist.« Nichts läge dem Journalisten ferner als der Gedanke, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.
Jannis bremste den Handwagen ab, um auf sie zu warten. »Was willst du von Rico?«
»Meine Bücher zurückholen, aber das eilt nicht. Lass uns die Kisten einladen.« Sie bückte sich nach einem Weinkarton.
»Vielleicht hat Karl eine Idee, wo sein Neffe abgeblieben ist. Schau mal, da drüben ist er.«
»Wer sonst könnte es wissen, wenn nicht er?«
Seit Karl Keuke das Weingut an Jannis verpachtet hatte, bewohnte er das Altenteilerhaus im Garten. Der Winzermeister im Ruhestand hatte die Augen und Ohren überall. Kompromisslos warf Karl strenge Blicke auf das Geschehen in seiner früheren Wirkungsstätte. Dabei sparte er weder mit Kritik noch mit Verbesserungsvorschlägen und packte an, wo er es für nötig hielt, ohne sich mit Jannis abzusprechen oder gar um Erlaubnis zu fragen. Tess war es ein Rätsel, woher Jannis die engelsgleiche Geduld nahm, mit der er Karls permanenten Einmischungen begegnete.
Auch an diesem Sonntagvormittag ging Karl, ausgestattet mit Besen, Kehrschaufel und Schubkarre, seiner Lieblingsbeschäftigung nach und »machte sich nützlich«, wie er behauptete. Die Neugier würde ihn umgehend hertreiben. Und siehe da – soeben hatten sie den letzten Weinkarton verstaut, als Karl beim Stellplatz angelangt war.
»Ach du grüne Neune!«, rief Karl erschrocken. »Jannis, was ist dir zugestoßen?«
Jannis winkte ab. »Ausgerutscht auf dem Abgang zum Keller. Kein Beinbruch!«
Karl beruhigte die Erklärung nicht. Aufgeregt wetterte er: »Wie lange rede ich schon davon? Die Treppe gehört neu gemacht. Die Stufen sind ausgetreten, aber dich kümmert ja nicht, was ich sage.«
Dem Vorwurf folgte eine Tirade von Tipps, wie die Treppe zu sanieren wäre. Warum genoss er seinen Ruhestand nicht mit Spaziergängen am Rheinufer oder im Rosengarten wie andere Rheingauer Rentner, fragte sich Tess.
Um den Ausführungen ein Ende zu setzen, erkundigte sie sich nach Rico und ergänzte: »Mit dem Auto ist dein Neffe offensichtlich nicht unterwegs.«
»Rico hat sich gestern Abend ein Taxi genommen. Ich hätte ihn zum Flughafen gebracht, aber er wollte mir keine Umstände machen.«
»Flughafen? Wohin wollte er denn?«
»Namibia«, lautete Karls knappe Antwort. Bestimmt war er enttäuscht, weil Rico ihn nicht um Hilfe gebeten hatte, vermutete Tess. Karl liebte es, seinen Neffen väterlich zu umsorgen.
»Schon wieder?«, staunte sie. »Rico war doch erst kürzlich für eine Reportage in Windhoek.« Sie erinnerte sich an seinen begeisterten Bericht über Land und Leute.
»Beneidenswert, so eine Fernreise auf Spesen«, bemerkte Jannis, während er sich über die ramponierte Mundpartie strich. »Afrika würde mich ebenfalls reizen. Mal was anderes als immer nur Griechenland.«
»Zumal du dort für den Familienclan schuftest, anstatt dich zu erholen.«
Der Satz war ihr herausgerutscht, eine unnötige Bemerkung, die sie umgehend bereute. Die griechische Verwandtschaft war sein wunder Punkt. Es war nicht fair, ihn deswegen aufzuziehen. Während sie für zehn lange Jahre von der Bildfläche verschwunden gewesen war, hatte Jannis eine entfernte Cousine geheiratet, mit ihr eine Tochter bekommen und war später von der Frau, die mit dem Kind nach Griechenland zurückkehrte, brutal abserviert worden. Tess tat es in der Seele weh, wie er sich von seiner Ex-Frau und deren Sippe ausbeuten ließ, um nicht den Kontakt zu seinem Kind zu verlieren. Eine unüberschaubare Schar von Angehörigen lauerte darauf, ihn im Heimaturlaub für Hilfsdienste aller Art einzuspannen.
Bevor Jannis etwas erwidern konnte, widersprach Karl aufgebracht: »Von wegen Spesen! Rico reist auf eigene Kosten. Obwohl er selbst gar nichts für den ganzen Schlamassel kann. Er wurde aufs Übelste reingelegt.«
»Wie und von wem?«, fragte Tess gespannt.
»Ist kompliziert.« Karl zuckte mit den Achseln.
Es würde sie nicht wundern, wenn Rico mit seinen investigativen Reportagen in ein Wespennest gestochen hätte. Sie erinnerte sich an eine kuriose Szene, als sich der Journalist vor zwei Herren im Anzug und einer Dame im Businesskostüm in ihr Tattoostudio geflüchtet hatte. Mit einem Sprung war er unter eine Ablage gehechtet. Tess hatte sich gerade über Harry gebeugt, um ihm einen hauchzarten Kolibri zwischen die übrige Vogelwelt zu tätowieren, als Ricos Verfolger ins Studio einfielen und den bunten muskulösen Oberkörper entgeistert zur Kenntnis nahmen. Als die Luft rein gewesen war, Rico hervorgekrochen kam und etwas von vertrackten Enthüllungen in Sachen Kryptowährung erzählte, wäre Harry vor Lachen beinahe von der Liege gerutscht. Tess bemühte sich, ernst zu bleiben, weil Rico sorgenvoll seinen Bürstenschnitt betastete und tief errötete, als sie ihm hinter Harrys Rücken mit dem Daumen signalisierte, dass mit seiner Frisur alles in Ordnung war. Dass Ricos volles Haar einem Toupet zu verdanken war, wusste sie, seit sie ihm einen kleinen Totenkopf in den Nacken gestochen hatte. Es war ihm äußerst peinlich gewesen. Sie hatte ihm versprochen, kein Wort darüber zu verlieren.
»Ist er auf der Flucht?«, fragte sie freiheraus.
»Unsinn, er will in Namibia eine Unterstellung ausräumen«, sagte Karl nebulös.
Bevor sie nachfragen konnte, meldete sich Jannis zu Wort. »Sorry, Tess, wenn du noch zu meinem Kunden willst, solltest du losfahren.«
Mit einem Gruß verabschiedete sie sich von den Männern und stieg in den Wagen.
3
Kaum war sie im Weingut eingezogen, hatte Rico ihr Avancen gemacht – wie sich ihre Mutter ausgedrückt hätte. Es war kein Wunder, dass Tess sich geschmeichelt gefühlt und den smarten Journalisten bestaunt hatte wie ein Alien. Für ein Jahrzehnt hatte sie nur Frauen zu sehen bekommen, abgesehen von den wenigen Männern, die dem Personal des Wachdienstes und Justizvollzugs angehörten. Und Jannis natürlich, der gute Jannis, ihr einziger privater Kontakt in die Freiheit. Er hatte ihr die Treue gehalten und ihr eine Zuflucht geboten, als sie nach der Entlassung nicht gewusst hatte, wohin mit sich. Über Ricos Annäherungsversuche war er kommentarlos hinweggegangen.
Sie schätzte Ricos Eloquenz, seinen spitzzüngigen Humor, seine Cleverness. Zudem sah er passabel aus. Die markante Hakennase verlieh seinem Gesicht eine gewisse Kühnheit, die von der bleistiftminendicken Narbe, die sich von der linken Schläfe bis zur Augenbraue zog, unterstrichen wurde und die Rico je nach Laune mal als Folge eines Messerangriffs, mal als Konsequenz eines Fahrradunfalls im Wispertal erklärte. Tess war sich alsbald auch seiner Schwächen bewusst geworden. Rico verfügte über eine unterschwellige Skrupellosigkeit und Gerissenheit, die für seinen Beruf nützlich sein mochten, jedoch keine gute Basis für eine Partnerschaft boten. Tess war entschlossen, sich nicht ein zweites Mal auf eine desaströse Liebe einzulassen. Ihren Rückzug hatte Rico ohne Aufheben akzeptiert. Womöglich war es ihm sowieso eher um eine Story über die entlassene Kriminelle, die ein neues Leben in der Idylle eines Weinguts begann, gegangen als um eine ehrliche Beziehung. Geblieben waren eine unverbindliche Kumpelhaftigkeit und gelegentliche unterhaltsame Plaudereien bei Whisky und Wein auf seinem Balkon. Jannis fühlte Tess sich weitaus tiefer verbunden als Rico. Ihr Jugendfreund war und blieb ihr Fels in der Brandung.
Dass Rico eine Reise nach Namibia geplant hatte, hatte er ihr gegenüber nicht erwähnt. Bei ihrer letzten Begegnung, die einige Tage zurücklag, war er sehr in Eile gewesen, erinnerte sie sich, während sie den Wagen entlang des Rheinufers in Richtung Westen steuerte. Gemächlich rollte sie hinter einem Lastwagen her – dankbar für das gemütliche Tempo. Immer wieder aufs Neue war sie hingerissen vom Ausblick auf den gewaltigen Strom. Auf Höhe der Mariannenaue verengte sich das Flussbett, um sich nach der Insel wieder auszudehnen. Schaute sie nach rechts, konnte sie im wellenartigen Grün der Rebflächen vereinzelt liegende Weingüter ausmachen, nicht selten nach den Vorbildern uriger kleiner Burgen oder romantischer Palais errichtet. In Oestrich-Winkel hielt sie an, um ihre Fracht abzuliefern, und setzte die Fahrt nach wenigen Minuten fort.
Einige Kilometer später, nachdem sie die Uferstraße verlassen und Jannis’ Roten bergauf in die Winzerlandschaft hineingelenkt hatte, schob sich unübersehbar die anmutige Silhouette von Schloss Johannisberg in ihr Blickfeld. Abrupt drosselte Tess die Geschwindigkeit. An einem der ersten Tage in Freiheit hatte Jannis sie auf die Aussichtsterrasse des Schlosses geführt. Beim Ausblick auf das Rheintal, das sich unter ihr ausgebreitet hatte – der Strom und die aus dieser Perspektive spielzeuggroßen Ortschaften zu seinen Ufern –, waren ihr die Tränen in die Augen gestiegen. Beschämt war sie beiseitegetreten, um Jannis nichts merken zu lassen. Andere Frauen hatte die Haft hart werden lassen. Sie hingegen war fürchterlich sentimental geworden, wie sie es selbst ausdrückte. Tess habe endlich Zugang zu ihrem Gefühlsleben gefunden, hatte die Einschätzung der Anstaltspsychologin gelautet.
Ein stürmisches Hupen riss sie zurück ins Hier und Jetzt. Der Fahrer hinter ihr hatte die Geduld verloren und rauschte, nicht ohne seinem Ärger mit einem eindeutigen Handzeichen Luft zu machen, mit einem knappen Schlenker an ihrem Wagen vorbei. Auch Tess drückte auf das Gaspedal. Die Straße zog sich durch das Örtchen Grund und schlängelte sich zum Städtchen Johannisberg hinauf. Anders als Tess erwartet hatte, schickte ihr Navi sie auch durch dieses Weinbaudorf hindurch. Sie folgte den Anweisungen mit leisem Zweifel, wie weit man einem Navigationssystem überhaupt trauen durfte. Es war nur eines von vielen neuartigen Hilfsmitteln, von denen sie sich verunsichern ließ. Die Fahrt durch Schlossheide wurde von Richtungsschildern mit der Aufschrift »Edwineum« begleitet. Schon vorher waren Tess mehrere Wegweiser dieser Art aufgefallen. Während sie sich noch fragte, was darunter zu verstehen sein mochte, hatte sie das Ziel erreicht.
Sie parkte den Roten am Straßenrand und stieg aus. Der Bungalow war umgeben von einem weitläufigen Grundstück, auf dem eine Schar von Männern und Frauen in grünen Overalls Gartenarbeit nachging. Gewalzte erdige Flächen ließen ahnen, wo einmal Rasen wachsen sollte. In den kargen Beeten verloren sich die zarten Setzlinge. Junge Büsche suchten Halt in dem kahlen Boden. Der ausladende Flachbau erinnerte Tess an den Bonner Kanzlerbungalow aus den 1960er-Jahren, über den sie kürzlich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen hatte. Dessen Außenwände verdienten diese Bezeichnung kaum, setzten sie sich doch überwiegend aus Glasflächen zusammen. Weit über die gläserne Außenhaut hinaus schob sich sein auskragendes Flachdach.
»Edwineum« lautete der Schriftzug, der sich in haushohen Buchstaben über eine Fensterfront vor Tess erstreckte. Am Gartentor gab eine Tafel Auskunft über das Anwesen. Die Ausstellungsräume des sanierten Bungalows, entnahm Tess dem Text, würden der Öffentlichkeit demnächst die Werke des Tiermalers Edwin Busold präsentieren. Die Bauherren und Eigentümer, das Ehepaar Jana und Gerold Busold, sowie die Edwin-Busold-Stiftung widmeten sich der Aufgabe, dem Künstler mit diesem Museum die gebotene Aufmerksamkeit zu verschaffen. Weiterer Sinn und Zweck der Stiftung bestanden darin, ausgesuchte künstlerische Talente aus Namibia zu fördern.
Namibia – zum zweiten Mal heute, wunderte sich Tess, die bis zum Morgen noch nie von einem Maler namens Edwin Busold gehört hatte. Die Eröffnung des Museums stand kurz bevor. Ein Plakat verkündete, dass die Vernissage am kommenden Samstagabend stattfinden würde.
Die Haustür sprang auf, und ein Mann schritt ihr entgegen. In den 50ern, mit kräftigem, dennoch nicht dicklichem Körperbau.
Freundlich streckte er ihr die Hand entgegen. »Frau Bonifer, treten Sie ein. Ich bin Gerold Busold. Willkommen in diesem Tempel der Kunst. Bald wird alles fertig sein.«
Mit großspurigen Gesten winkte er sie zum Eingang hinüber. Während er ihr den Vortritt ließ, fragte sie sich, warum dieser gewiefte Geschäftsmann ausgerechnet eine so unbedeutende Biografin wie sie ausgewählt haben mochte. Mit selbstgefälliger Miene geleitete er sie durch das lichtdurchflutete Gebäude. Die sand- und ockerfarbenen Oberflächen der Innenwände schimmerten im Sonnenschein. Halbhohe Wände in denselben warmen Erdtönen teilten die Räume in Nischen auf.
»Wir haben uns für die herrlichen Farben des namibischen Buschlands entschieden«, tat Gerold Busold mit schwärmerischer Begeisterung kund. »Die traumhafte Stimmung der Savanne! Wunderbar eingefangen, nicht wahr? Vor allem an so hellen Tagen wie heute. Das perfekte Ambiente für die Werke meines Urgroßvaters. Edwin Busold malte die wilden Tiere der Savanne.«
Aufmerksam schaute Tess in die Runde. Ein Großteil der Wandflächen war frei. »Sie stecken sicher mitten in den Vorbereitungen zur Eröffnung.«
»Zurzeit sind wir dabei, die Exponate aufzuhängen«, verkündete er enthusiastisch. »Der Lohn für die anstrengenden Vorarbeiten. Das Museum ist ein Herzensprojekt für mich und meine Frau.«
In einem Nebenraum waren zwei Handwerker damit beschäftigt, eine Reihe von Wandleuchten zu installieren. Sonst war niemand zu sehen. »Ist Ihre Frau nicht hier?«
»Jana wird bald zurück sein. Sie holt weitere Ausstellungsstücke aus unserem Haus.«
Tess musste an die Bemerkung von Jannis denken. »Wie ich hörte, wohnen Sie in einer ehemaligen Mühle. Das klingt romantisch.«
»Ich nenne das Haus ein Groschengrab«, bekannte er mit einem zerknirschten Lächeln, das ihn sympathisch erscheinen ließ. »An allen Ecken und Enden gibt es etwas zu reparieren. Aber Jana und die Kinder lieben den alten Kasten. Und auch mir liegt die Mühle am Herzen.«
»Haben Sie das Anwesen gekauft?«
»Oh nein, die Mühle befindet sich seit gut 100 Jahren im Familienbesitz. Wussten Sie, dass es an den Bächen rund um Schlangenbad einst Dutzende von Mühlen gegeben hat? Unser Anwesen hatte Edwin ursprünglich erworben, um dort die Sonntage zu verbringen. Wie viele andere Mühlen war sie stillgelegt worden. Ihr drohte der Verfall.«
»Soweit ich weiß, hat Edwin Busold das Unternehmen, das Sie heute leiten, einst gegründet.«
Gerold neigte den Kopf. »Mein Urgroßvater war ein versierter und fleißiger Geschäftsmann. Über Jahrzehnte hatte er alle Hände voll mit dem Betrieb zu tun. Erst als sein Sohn Edmund in die Leitung eingestiegen war, konnte Edwin sich endlich ganz der Kunst hingeben. Er siedelte dauerhaft in die Mühle um.«
»Dort hat er sich ein Atelier eingerichtet«, vermutete sie.
Gerold strahlte sie an. »Die Mühle war sein Refugium und dessen Herzstück ein Turm. Mit einem sonnigen Atelier hoch unter dem Dach.«
»Ich würde mich gern ein wenig umschauen.«
»Nur zu! Die ersten Gemälde sind bereits an Ort und Stelle.«
Neugierig spähte Tess in eine Nische, die mit Exponaten bestückt war. Auf einer Seite versammelten sich die gerahmten Abbildungen einer Giraffe, eines Büffels und einer Antilope neben weiteren Stellvertretern der afrikanischen Tierwelt. Ihnen gegenüber hing – als uneingeschränkter Alleinherrscher des Ensembles – das großformatige Gemälde eines Mähnenlöwen.
»Unser wertvollstes Stück«, erklärte Gerold mit einem liebevollen Blick auf das Motiv. »Ich konnte es kaum erwarten, ihn in diesem Licht zu sehen.«
Wie die übrigen Tiere, die sich in der Nische präsentierten, war auch der Löwe alles andere als naturalistisch dargestellt, geschweige denn das Ergebnis einer ausgefeilten Maltechnik. Und trotzdem – oder gerade deswegen – zog die Raubkatze den Betrachter in ihren Bann. Fasziniert trat Tess näher heran.
»Was sagen Sie zu dem Prachtkerl?«
Auf seine Frage fiel ihr keine spontane Antwort ein. Sprachlos bestaunte sie das Wesen, das der Künstler in groben Zügen auf die Leinwand gebracht hatte. Als hätte ein Kind den Pinsel geführt, umrandeten kräftige schwarze Linien seine einzelnen Körperpartien, deren Flächen von gelben, roten und braunen Farbnuancen ausgefüllt wurden. Die schlichte, geradezu einfältige Darstellung eines Tieres – und dennoch erfüllt von Schönheit und Lebendigkeit. In seinen eigenartigen Augen schienen sich Mut und Weisheit gleichermaßen zu spiegeln. Sogar eine Spur Demut ließ sich herauslesen.
»Dieser Ausdruck der Augen«, sagte sie und suchte nach den passenden Worten. »Sein Blick erscheint mir wie der eines abgeklärten Menschen, der alles gesehen hat. Beeindruckend. Ich muss zugeben, ich kannte den Maler gar nicht.«
»Viele Leute haben noch nie von Edwin gehört. Das werden wir mit dem Edwineum endlich ändern«, antwortete Gerold zuversichtlich. »In den 1920er- und 1930er-Jahren waren seine Bilder durchaus populär.«
Sie löste sich von dem Löwen und wandte sich um. »Aus welchem Grund gerieten die Gemälde in Vergessenheit?«